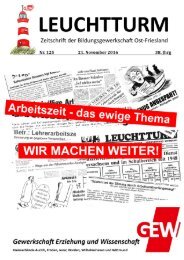LEUCHTTURM121
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft<br />
Kreisverbände Aurich, Emden, Jever, Norden, Wilhelmshaven und Wittmund<br />
LEUCHTTURM<br />
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft in Ost-Friesland<br />
Nr. 121<br />
20. Februar 2015<br />
37. Jhrg.<br />
Arbeitskreis Ostfriesische Hochschultage in Zusammenarbeit mit<br />
Ostfriesische Hochschultage 2015<br />
Schule in der Welt - Welt in der Schule<br />
Inhaltliche Gestaltung: Bielefeld School of Education<br />
am 12. und 13. März 2015 im Europahaus in Aurich<br />
Donnerstag, 12. März 19.30 Uhr<br />
Öffentliche Veranstaltung<br />
mit Prof. Eiko Jürgens (Universität Bielefeld) und Laura Pooth (Stellvertretende Landesvorsitzende<br />
der GEW)<br />
Freitag, 13. März 2015<br />
8.30 Uhr Einführungsvorträge<br />
Prof Dr. Eiko Jürgens:<br />
Prof. Oliver Böhm-Kasper:<br />
Brennpunkte und Perspektiven des Umgangs mit Heterogenität<br />
Multiprofessionelle Kooperation in der Schule<br />
9.30 – 13.15 Uhr Workshops<br />
Präventive Sprachförderung+++ SchülerInnen zwischen den Welten Schule und Familie+++ Differenzierung<br />
im naturwissenschaftlichen Unterricht+++Akrobatische Weltreise als Klassengestaltung+++<br />
Das Oberstufen-Kolleg Bielefeld+++ Menschenrechtsbildung+++ Inklusion im Mathematikunterricht+++<br />
Weltbilder im sozialwissenschaftlichen Unterricht+++ Tanz in der Schule+++ Diagnose<br />
und Förderung im Deutschunterricht+++ Migration als Unterrichtsthema+++ Resilienz: Was Kinder<br />
stärkt+++ Fotosynthese-Workshop<br />
Anmeldung bis zum 28.02.2015 siehe auch S. 15 bis 17
LEUCHTTURM<br />
2<br />
Käpt’n Blaubär und die Sprachförderung<br />
ein technisch innovativer Sketsch<br />
Heinrich<br />
Herlyn<br />
Käpt’n Blaubär und die drei<br />
Bärchen treten auf.<br />
Blaubär: Hab ich euch schon<br />
erzählt, dass ich ein<br />
Jobangebot aus Bayern<br />
bekommen habe.<br />
Enkel 1: Aus Bayern? Du<br />
schwindelst doch wieder,<br />
Opa!<br />
Blaubär: Ich gebe zu, es klingt<br />
unglaublich, aber es ist<br />
genauso wahr, wie ich<br />
Blaubär heiße.<br />
Enkel 2: Opa, verstehen die dich<br />
denn mit deinem norddeutschen<br />
Akzent in Bayern?<br />
Blaubär: Norddeutscher Akzent,<br />
was soll das denn heißen?<br />
Wir Norddeutschen sind<br />
bekanntermaßen die einzigen<br />
Deutschen, die glasklares<br />
Hochdeutsch sprechen.<br />
Und genau deswegen wollen<br />
die Bazies mich dort<br />
unten haben.<br />
Enkel 3: Du meinst wohl eher<br />
dort oben.<br />
Blaubär: Na, meinetwegen auch<br />
dort oben.<br />
Enkel 1: Wirst du denn nicht<br />
das Meer vermissen?<br />
Blaubär: Ganz bestimmt! Und<br />
vor allem werde ich euch<br />
vermissen, ihr kleinen Rakker.<br />
Aber ich weiß ja, bei<br />
Hein Blöd seid ihr in den<br />
besten Händen und bereits<br />
in einem Jahr bin ich doch<br />
wieder da.<br />
Enkel 2: In einem Jahr erst?<br />
Blaubär: Nun habt euch man<br />
nicht so. Hein Blöd kann<br />
auch ganz schöne Geschichten<br />
erzählen und bei<br />
YouTube gibt es tolle Videos<br />
von mir.<br />
Enkel 3: Aber das ist doch nicht<br />
dasselbe, Opa.<br />
Blaubär: Nun macht mir doch<br />
die Sache nicht so schwer,<br />
Kinners. Mich reizt einfach<br />
die Aufgabe.<br />
Enkel 1: Was sollst du eigentlich<br />
in Bayern machen. Opi?<br />
Blaubär: Ich werde der bundesweit<br />
erste Landesbeauftragte<br />
für Sprachmotivation von<br />
Migranten.<br />
alle: Hä??????<br />
Blaubär: Ja bekommt ihr denn<br />
wieder rein gar nichts mit?<br />
Habt ihr noch nichts von<br />
der Idee gehört, dass die<br />
CSU die Migranten in<br />
Deutschland motivieren<br />
möchte, zu Hause Deutsch<br />
Redaktion Leuchtturm Redaktionsschluss: 15.02.2015<br />
KV Wittmund www.GEW-wittmund.de<br />
Ronald Wilts Lüdstede 3 26487 Neuschoo Tel. 04975 - 366 Ronald.Wilts@t-online.de<br />
Jürgen Kramm Wangeroogestr. 8 26409 Wittmund Tel. 04462 - 6102 Juergen.Kramm.WTM@t-online.de<br />
KV Jever www.GEWweserems.de/kv-fg/jever/jevindex.htm<br />
Heiner Wegener Kniphauser Weg 7 26441 Jever Tel. 04461 - 73133 heinerwegener@t-online.de<br />
Klaus Blume-Wenten Javenloch 5 26434 Wangerland Tel. 04464 - 8150 k.blume-wenten@t-online.de<br />
KV Aurich www.aurich.GEWweseremsde<br />
Ralf Dittmer Brunnenstr. 6 28203 Bremen Tel./Fax 0421 - 79469878 radidodo@t-online.de<br />
Franz Kampers Hinter Eschen 16F 26607 Aurich Tel. 04941 - 6988012 fkampers@ewetel.net<br />
KV Norden<br />
Herbert Czekir Reithammer Weg 29 26529 Osteel Tel. 04934 - 6766 herbert.czekir@ewetel.net<br />
Anette Hillen Im Dullert 3026524 Hage Tel. 04931 - 7 4474 anette-hillen@web.de<br />
KV Emden www.GEW-emd.de<br />
Dr. Josef Kaufhold Herm.-Hesse-Str. 4 26721 Emden Tel. 04921 - 45266 JosefKaufhold@web.de<br />
Hans-Gerd de Beer Graf-Edzard-Str. 20 26721 Emden Tel. 04921 - 29778 hans-gerd-de-beer@t-online.de<br />
KV Wilhelmshaven<br />
Friedrich Fischer Fedderwarder Str. 124 26388 Wilhelmshaven Tel.04421-502119 magfish@gmx.de<br />
Wolfgang Niemann-Fuhlbohm Güstrower Str. 3c 26388 Wilhelmshaven Tel.04421-87117 wolfgang.nif@gmx.de<br />
Impressum: GEW-LEUCHTTURM Nr. 121 / 37. Jahrgang vom 20.02.2015<br />
LehrerInnenzeitung für die Kreisverbände Aurich, Emden, Jever, Norden, Wilhelmshaven, Wittmund<br />
Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im DGB/Kreisverband Wittmund<br />
verantwortl.: Ronald Wilts (1. Vors.), Lüdstede 3, 26487 Neuschoo, 04975/366<br />
Internet: www.gewweserems.de - dort auch Informationen aus den Kreisverbänden<br />
Druck: www.janssendruck.de, Finkenburgstr. 47, 26409 Wittmund
3 LEUCHTTURM<br />
zu sprechen.<br />
Enkel 2: Echt? Und wie wollen<br />
die das machen?<br />
Blaubär: Die nicht, sondern ich.<br />
Ich bin es, der die<br />
entscheidende Idee gehabt<br />
hat.<br />
Enkel 3: Wie immer, Opa.<br />
Blaubär: Ihr braucht gar nicht<br />
zu spotten. Meine Idee ist<br />
wirklich genial. Und - ihr<br />
werdet es mal wieder nicht<br />
glauben - sie ist voll auf der<br />
technischen Höhe der Zeit.<br />
Enkel 1: Da sind wir aber<br />
gespannt.<br />
Blaubär: Tja, ihr denkt wohl<br />
immer noch, ich sei ein<br />
Internet- und Computer-<br />
Muffel. Dieses Mal irrt ihr<br />
euch aber gewaltig. Ich habe<br />
nämlich, ohne dass ihr<br />
davon etwas wusstet, einen<br />
Computer-Kurs für Senioren<br />
belegt. Und nun bin ich<br />
voll auf dem Laufenden. Ich<br />
besitze jetzt sogar ein<br />
Schmart-Fon!<br />
alle: Ein Smart-Phone?<br />
Blaubär: Tja, da staunt ihr, was?<br />
Enkel 2: Du bist echt cool, Opa!<br />
Blaubär: Und wenn ihr erst mal<br />
meinen Vorschlag gehört<br />
habt, dann werden ihr<br />
kleinen Nerds merken, dass<br />
ich sogar mega-cool bin.<br />
Enkel 3: Nun erzähl’s uns endlich,<br />
Opa. Du machst es ja<br />
noch spannender als sonst.<br />
Blaubär: Also, die geniale Idee<br />
von mir besteht darin, dass<br />
wir jeden Migrantenhaushalt<br />
mit kostenlosen Tabletten<br />
ausstatten werden.<br />
Enkel 1: Tabletten?<br />
Blaubär: Äh, wie heißen die<br />
Dinger gleichen noch mal?<br />
Enkel 2: Meinst du vielleicht<br />
Tablets?<br />
Blaubär: Genau! Diese kleinen<br />
Computer ohne Tastatur<br />
meine ich, die schon jedes<br />
Baby bedienen kann.<br />
Enkel 3: Und was soll das<br />
bringen, Opa?<br />
Blaubär: Diese Dinger haben<br />
doch so einen Webkamm.<br />
Enkel 2: Du meinst Webcam,<br />
Opa, so eine kleine Kamera.<br />
Blaubär: Richtig, diese kleinen<br />
Kameras meine ich. Und ich<br />
habe in meinem Kurs<br />
gelernt, dass man damit<br />
durch das Internetz alles<br />
sehen kann, was so bei dem<br />
Juser passiert, der dieses<br />
Tablett – oder wie das Ding<br />
heißt – benutzt.<br />
Enkel 2: Und warum sprechen<br />
die Migranten, wenn sie so<br />
ein Tablet haben, mehr<br />
Deutsch zu Hause?<br />
Blaubär: Ganz einfach: Weil sie<br />
diesen kleinen Computer<br />
nur behalten dürfen, wenn<br />
sie auch mindestens drei<br />
Stunden Deutsch am Tag<br />
gesprochen haben.<br />
Enkel 3: Und das willst du<br />
wahrscheinlich über die<br />
Webcam kontrollieren?<br />
Blaubär: Ihr seid gar nicht so<br />
schwer von kapee, wie ich<br />
manchmal denke. Immer<br />
wenn die ins Internetz<br />
gehen, wird von unserer<br />
Behörde die Webcam aktiviert<br />
und ein Beamter im<br />
Kultusministerium kann<br />
kontrollieren, ob die auch<br />
wirklich genug Deutsch<br />
sprechen.<br />
Enkel 1: Aber Opa, das ist ja<br />
schlimmer als alles, was die<br />
Amerikaner und die NSA<br />
bisher an Internet-Spionage<br />
gemacht haben.<br />
Blaubär: I wo! Das ist doch<br />
keine Spionage, hier geht es<br />
schließlich nicht um Staatsgeheimnisse,<br />
sondern nur<br />
um private Sachen.<br />
Hein Blöd: Käpt’n, da ist schon<br />
wieder ein Brief. Der ist von<br />
einem Andreas Bescheuert<br />
oder so ähnlich. Aber dieses<br />
Mal ist ein goldener Löwe<br />
drauf und nicht so ein<br />
weißes Pferd.<br />
Blaubär: Aha, das wird meine<br />
Einstellungsurkunde sein.<br />
Lies vor, Hein!<br />
Hein: Sehr geehrter Herr<br />
Blaubär! Ich muss Ihnen die<br />
Mitteilung machen, dass ich<br />
als Generalsekretär der CSU<br />
nach der üblen Medien-<br />
Kampagne anlässlich meiner<br />
Vorschläge zur besseren<br />
Integration von Migranten<br />
zurückgetreten bin. Leider<br />
ist der bayrische Ministerpräsident<br />
auch von dem<br />
Vorschlag abgerückt, das<br />
Amt eines Landesbeauftragten<br />
für Sprachmotivation<br />
von Migranten einzurichten.<br />
Erfreulicherweise bin<br />
ich aber in der Lage, Ihnen<br />
einen Alternativvorschlag<br />
zu unterbreiten: Ich plane<br />
den Vorsitz der Initiative<br />
OBEGIDA zu übernehmen.<br />
OBEGIDA bedeutet,<br />
„Ostfriesische und bayrische<br />
Europäer gegen die Islamisierung<br />
des Abendlandes“.<br />
Ich würde sie gerne als<br />
meinen Co-Vorsitzenden<br />
nominieren. Wir Bayern<br />
und Ostfriesen sollten in<br />
Zukunft nicht nur den<br />
Windstrom miteinander teilen,<br />
sondern wir sollten<br />
auch gemeinsam den Untergang<br />
des Abendlandes verhindern.<br />
Hochachtungsvoll, Ihr<br />
Andreas Scheuer.<br />
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft<br />
Kreisverband Aurich<br />
Mitgliederversammlung<br />
aurich.gewweserems.de<br />
Mi., 22. April 2015, ab 18.30 Uhr<br />
im Seminarhotel der KVHS Aurich<br />
mail:gew.aurich@ewetel.net
LEUCHTTURM<br />
4<br />
Hartwig Poyda Aurich, 4.1.2015<br />
Berliner Ring 4<br />
26603 Aurich<br />
An das<br />
Niedersächsische Kultusministerium<br />
Postfach 161<br />
30001 Hannover<br />
nachrichtlich auch an:<br />
die Niedersächsische Landesschulbehörde<br />
die GEW<br />
den VDS<br />
den Landeselternrat<br />
Betr.: Überlegungen zu „Regionalstellen für schulische Inklusion“<br />
Sehr geehrte Damen und<br />
Herren,<br />
in den neuen schulgesetzlichen<br />
Überlegungen werden Regionalstellen<br />
für schulische Inklusion<br />
(Reschi) beschrieben. Diese sollen<br />
zukünftig Aufgaben übernehmen,<br />
die bisher in der Regel<br />
von den Förderschulen übernommen<br />
wurden, die ihre<br />
Aufgabe als Förderzentrum ernst<br />
genommen haben.<br />
Wir haben uns in Aurich und<br />
Ihlow intensiv und immer<br />
kooperativ seit vielen Jahren um<br />
die Entwicklung schulischer<br />
Integration / Inklusion bemüht:<br />
– Integrationsklassen seit 1988<br />
in Grund- und Gesamtschulen<br />
– Seit 10 Jahren flächendeckende<br />
sonderpädagogische<br />
Grundversorgung in den 16<br />
Grundschulen unserer Region<br />
– Seit Jahren Wahlmöglichkeit<br />
der Eltern im Übergang von<br />
der GS zur SEK-I zwischen<br />
allgemeiner Schule und Förderschule<br />
(inzwischen besuchen<br />
150 Schüler/innen mit<br />
festgestelltem sonderpädagogischen<br />
Unterstützungsbedarf<br />
allgemeine SEK-I-Schulen,<br />
130 Schüler/innen besuchen<br />
die SEK-I der Förderschule<br />
Lernen).<br />
– Seit 6 Jahren MESEO<br />
(mobiler Dienst ES) zur<br />
Unterstützung der 16 Grundschulen<br />
Als Schulleiter habe ich mich<br />
in der Doppelbelastung „Förderschule<br />
Lernen entwickeln (und<br />
gleichzeitig abwickeln)“ und<br />
„inklusive Strukturen entwi-<br />
ckeln“ des öfteren „zerrissen“<br />
gefühlt. Deshalb vorweg meine<br />
Überzeugung:<br />
Die beabsichtigte Trennung von<br />
Förderschule und einer Unterstützungsinstitution<br />
für schulische Inklusion<br />
ist richtig!<br />
Ich habe aber trotzdem einige<br />
Bedenken und Anmerkungen<br />
bezüglich der zukünftigen Organisationsstruktur<br />
der Reschi:<br />
Die Organisationsstruktur<br />
muss sich aus den Aufgaben<br />
ergeben, die notwendig sind zur<br />
Unterstützung von Schüler/<br />
innen und Lehrer/innen in<br />
inklusiven Schulen, deren Schulleitungen,<br />
den Eltern, den<br />
Schulträgern, Trägern der Jugendhilfe<br />
und anderen.<br />
Was erscheint mir bisher<br />
notwendig, sinnvoll, hilfreich<br />
gewesen zu sein, um in unserer<br />
Region eine Inklusionsquote<br />
von inzwischen über 50% zu<br />
erreichen?<br />
Wir arbeiten kooperativ in<br />
einer überschaubaren Region, in<br />
der sich sehr viele Akteure<br />
(Schüler/innen, Eltern, Lehrkräfte,<br />
Schulleitungen, Mitarbeiter/innen<br />
des Schulträgers, des<br />
Jugendamtes und anderer Jugendhilfeträger)<br />
persönlich kennen.<br />
Ich arbeite intensiv vor allem<br />
mit den Schulleitungen der<br />
Grundschulen, jetzt auch zunehmend<br />
mit denen der SEK-I-<br />
Schulen zusammen, d.h. wir<br />
treffen uns regelmäßig zu<br />
Dienstbesprechungen und erörtern<br />
umfangreich Probleme und<br />
Möglichkeiten inklusiver Beschulung.<br />
Gemeinsam besprechen wir,<br />
wie viele FöS-Lehrer-Stunden an<br />
den einzelnen Schulen rechnerisch<br />
vorzuhalten wären, welche<br />
personellen Ressourcen zur<br />
Verfügung stehen (leider noch<br />
nie 100%), welche FöS-Lehrkräfte<br />
zur Verfügung stehen und wie<br />
diese verteilt werden sollen.<br />
Um den unterschiedlichen<br />
Unterstützungsbedarfen der<br />
Schüler/innen gerecht werden zu<br />
können, arbeite ich mit den<br />
Schulleitungen der Förderschulen<br />
GE und KME zusammen, da<br />
diese sich an der Versorgung der<br />
inklusiven Schulen mit ihren<br />
spezifischen Qualifikationen beteiligen<br />
müssen.<br />
Seit Beginn integrativer/<br />
inklusiver Beschulung haben wir<br />
die Lehrerfortbildung als ganz<br />
wesentliche Aufgabe verstanden.<br />
In regelmäßigen Dienstbesprechungen<br />
mit unseren Förderschullehrkräften<br />
und an jährlichen<br />
Fortbildungstagen (inzwischen<br />
differenziert nach sonderpädagogische<br />
Grundversorgung,<br />
Inklusion in SEK-I, MESEO in<br />
Grundschule und ES-Förderung<br />
in der SEK-I), an denen wir<br />
Lehrkräfte der allgemeinen<br />
Schulen beteiligen, stellen wir<br />
den qualifizierenden Austausch<br />
unter den Kolleg/innen sicher<br />
und sorgen für ein Mindestmaß<br />
abgesprochener und vergleichbarer<br />
Standards in den Schulen.<br />
Viele aktuelle Fragen oder<br />
Problemstellungen werden zeitnah<br />
und kollegial telefonisch<br />
oder in persönlichen Gesprächen<br />
erörtert. Zudem werde ich zu<br />
Dienstbesprechungen oder schulinternen<br />
Fortbildungen zum<br />
Thema „Gemeinsamer Unter-
5 LEUCHTTURM<br />
richt“ in die mit uns kooperierenden<br />
Schulen eingeladen.<br />
Die Mitarbeit in der regionalen<br />
Lehrerfortbildung (RPZ<br />
Aurich) trägt dazu bei, den<br />
Austausch zwischen den ostfriesischen<br />
Regionen (und darüber<br />
hinaus) zu ermöglichen.<br />
Unsere Förderschule / unser<br />
Förderzentrum ist bisher der<br />
Ort, an dem Lehr- und<br />
Lernmittel, Testverfahren und<br />
anderes diagnostisches Material,<br />
sonderpädagogische Fachliteratur<br />
etc. vorgehalten wird. Dieses<br />
wird auch von den Kolleg/innen<br />
in den inklusiven Schulen<br />
intensiv genutzt. Unsere Förderschule<br />
/ unser Förderzentrum ist<br />
auch Ort des Gedankenaustausches<br />
und der Konzeptentwicklung.<br />
Hier wird sonderpädagogische<br />
Expertise bewahrt und<br />
weiterentwickelt.<br />
Bei Auflösung der Förderschule<br />
mit dem Schwerpunkt<br />
Lernen muss ein entsprechender<br />
Ort in den Regionen vorgehalten<br />
werden.<br />
In den beiden Auricher IGSn<br />
ist inzwischen jeweils eine<br />
spezielle Fachgruppe Inklusion<br />
gebildet worden. Das ist gut, da<br />
der Bereich „Gemeinsamer Unterricht“<br />
dadurch in den IGSn<br />
deutlich mehr in den Fokus<br />
gerückt ist. Noch wird die Arbeit<br />
der Fachgruppen partiell durch<br />
die Förderschule / das Förderzentrum<br />
unterstützt, deutlich<br />
wird aber schon, dass hier<br />
zunehmend selbstständige Arbeitsorganisationen<br />
entstehen.<br />
Notwendig erscheint mir, dass<br />
diese Fachgruppen anderen<br />
Fachgruppen gleichgestellt werden<br />
(Leitung mit Funktionsstelle!).<br />
Deutlich notwendiger erscheint<br />
mir noch auf lange Sicht<br />
eine Unterstützung der Kolleg/<br />
innen „von außen“ in den vielen<br />
Schulen zu sein, in denen nur<br />
wenige Schüler/innen mit sonderpädagogischem<br />
Unterstützungsbedarf<br />
beschult werden.<br />
Dieses gilt insbesondere für die<br />
Grundschulen, da die Sonderpädagogen<br />
dort „allein“ tätig<br />
sind. Sie benötigen aber den<br />
kollegialen fachlichen Austausch<br />
und immer mal wieder auch<br />
meine beratende „Rückendekkung“<br />
(z.B. beim Bemühen<br />
zieldifferenten Unterricht bei<br />
einzelnen Grundschulkolleg/innen<br />
einzufordern, bei übermäßigem<br />
Einsatz für Vertretungsunterricht,<br />
bei Fragen zu Aufsichten,<br />
Zeugnisformulierungen<br />
etc.). Diese Beratung muss auch<br />
zukünftig möglich sein ohne als<br />
schulbehördliche Weisung zu<br />
erscheinen.<br />
Auch weil wir in Ostfriesland<br />
keine öffentliche Förderschule<br />
mit dem Schwerpunkt ES<br />
vorhalten, stellt die inklusive<br />
Beschulung der Schüler/innen<br />
mit Verhaltensschwierigkeiten<br />
eine große Herausforderung dar<br />
und überfordert nicht selten die<br />
betroffenen Schüler/innen<br />
selbst, ihre Mitschüler/innen<br />
und leider viel zu oft auch ihre<br />
Lehrkräfte.<br />
Die Unterstützung der Schüler/innen<br />
und Lehrer/innen im<br />
Förderbereich ES nimmt für<br />
mich inzwischen ganz viel Zeit<br />
in Anspruch. Ich muss diese Zeit<br />
investieren (und tue das gerne),<br />
da die Zustimmung in den<br />
Schulen zu inklusiven Strukturen<br />
gerade durch die erheblichen<br />
Probleme mit den verhaltensschwierigen<br />
Schüler/innen in<br />
Frage gestellt wird.<br />
Die Leitung unseres MESEO-<br />
Teams wird erheblich erleichtert<br />
– durch meine Kenntnis und<br />
vorhandenen Kontakte zu<br />
vielen mit Problemen beladenen<br />
Familien unserer Region.<br />
– durch genaue Kenntnis von<br />
außerschulischen Unterstützungsmöglichkeiten<br />
in unserer<br />
Region für die betroffenen<br />
Schüler/innen und ihre Familien.<br />
– durch persönliche Absprachen<br />
und Kooperationen mit den<br />
Akteuren in der für unsere<br />
Region zuständigen Regionalstelle<br />
des Jugendamtes.<br />
– durch relativ genaue Kenntnis<br />
der Förder- und Erziehungskonzepte<br />
in den allgemeinen<br />
Schulen.<br />
– durch vorangegangene Kontakte<br />
zu vielen Lehrkräften in<br />
den allgemeinen Schulen.<br />
Als äußerst sinnvoll hat sich in<br />
den vergangenen Jahren erwiesen,<br />
dass grundsätzlich alle<br />
Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen<br />
Unterstützungsbedarfs<br />
über unser Förderzentrum<br />
„gesteuert“ werden:<br />
– Häufiger habe ich mit den<br />
Grundschulleitungen die<br />
Sinnhaftigkeit von Meldungen<br />
besprechen können und<br />
dadurch einige Verfahren<br />
vermieden.<br />
– Meldungen, die vermutlich<br />
die Unterstützungsbereiche<br />
GE, KME, Hö, Se betreffen,<br />
werden an die entsprechenden<br />
Förderschulen weitergeleitet.<br />
Die Kenntnis über die<br />
Feststellungsverfahren in allen<br />
Bereichen für Kinder aus<br />
unserer Region und die<br />
Kenntnis aller Schüler/innen<br />
mit sonderpädagogischem<br />
Unterstützungsbedarf in den<br />
Schulen der Region erleichtert<br />
nicht nur die Ressourcenverteilung<br />
erheblich, sondern<br />
auch die Beratung.<br />
Leider hat sich auch in<br />
unserer Region trotz insgesamt<br />
rückläufiger Schülerzahlen die<br />
Anzahl der Feststellungsverfahren<br />
von durchschnittlich 90 auf<br />
jetzt 120 erhöht (die viele Jahre<br />
bei uns praktizierte zieldifferente<br />
Beschulung mit schriftlicher<br />
Zustimmung der Eltern ohne<br />
formales Feststellungsverfahren<br />
ist nicht mehr möglich, Doppelbegutachtung<br />
durch zusätzliche<br />
Verfahren im Übergang Kl. 4 –<br />
Kl. 5, Doppelzählung bei der<br />
Klassenbildung, „Rucksack-Stunden“).<br />
Die Zuständigkeit für das<br />
Feststellungsverfahren zukünftig<br />
den Reschi zu übertragen<br />
erscheint mir absolut sinnvoll,<br />
wenn auch die damit notwendigen<br />
Beratungsaufgaben „auf<br />
Augenhöhe“ übernommen werden.<br />
Zu lesen ist, dass 47+x Reschi<br />
in Niedersachsen eingerichtet<br />
werden sollen, angegliedert an<br />
die Landesschulbehörde, personell<br />
ausgestattet mit Leitung,<br />
stellv. Leitung und ½ Verwaltungskraft.<br />
Meine oben beschriebene
LEUCHTTURM<br />
persönliche Erfahrung zeigt, dass<br />
das bei den zu erledigenden<br />
Aufgaben nicht ausreichen wird.<br />
Dabei ist nicht die Anzahl der<br />
Reschi entscheidend, sondern<br />
die personelle Ausstattung und<br />
regionale Arbeitsstruktur. Diese<br />
ist an die Größe der Region<br />
anzupassen.<br />
Ganz wesentlich für die<br />
Weiterentwicklung inklusiver<br />
Strukturen und breiter Zustimmung<br />
dafür erscheint mir, dass es<br />
gelingt ein möglichst hohes Maß<br />
an Kooperation und daraus<br />
resultierendem gegenseitigem<br />
Vertrauen herzustellen. Dieses<br />
entwickelt sich besser in einer<br />
überschaubaren Region. Diese<br />
muss sicherlich kleiner sein als<br />
die meisten Landkreise in<br />
Niedersachsen.<br />
Wenn es pro Landkreis nur<br />
ein Reschi geben soll, so muss<br />
dieses personell so ausgestattet<br />
sein, dass kleinere regionale<br />
Einheiten gebildet werden können.<br />
Kleinere untergeordnete Einheiten,<br />
die räumlich von den<br />
Außenstellen der Landesschulbehörde<br />
getrennt sind, hätten<br />
zudem den großen Vorteil nicht<br />
als „Aufsichtsbehörde“ zu erscheinen,<br />
sondern wirklich als<br />
kollegiale Unterstützungs- und<br />
Beratungsinstitution.<br />
Abschließend noch vier<br />
grundsätzliche<br />
Bemerkungen:<br />
Ziel unserer gemeinsamen<br />
Bemühungen muss es sein, den<br />
gemeinsamen, aber differenzierenden<br />
Unterricht zunehmend<br />
so zu verbessern, dass immer<br />
mehr Schüler/innen auch mit<br />
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfen<br />
in allen Schulen<br />
„ihren Platz“ finden. Das wird<br />
noch einige Zeit dauern und<br />
zusätzliche Ressourcen erfordern.<br />
„Schnellschüsse“ ohne<br />
hinreichende positive Unterstützung<br />
in den Kollegien, ohne<br />
nachhaltige ausreichende sonderpädagogische<br />
Unterstützung<br />
der betroffenen Schüler/innen<br />
können zu „Rohrkrepierern“<br />
werden und bereits erreichte,<br />
deutlich sichtbare Erfolge zunichte<br />
machen.<br />
– In unserer Region werden<br />
bereits 120 Schüler/innen mit<br />
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf<br />
in den beiden<br />
IGSn beschult, keine am<br />
Gymnasium (immerhin das<br />
größte in Niedersachsen). Das<br />
überfordert (zumal bei Auflösung<br />
der Förderschule Lernen,<br />
in der z. Zt. insgesamt noch<br />
150 Schüler/innen (Kl. 3 bis<br />
10) beschult werden) die<br />
IGSn.<br />
– In Ostfriesland gibt es keine<br />
öffentliche Förderschule mit<br />
dem Schwerpunkt ES.<br />
37 Schüler/innen mit diesem<br />
6<br />
Unterstützungsbedarf besuchen<br />
z. Zt. Die Förderschule Lernen<br />
in Aurich. Ich bin überzeugt<br />
davon (unsere Grundschulleiterkonferenz<br />
auch), dass unser<br />
MESEO-Team gute Arbeit leistet<br />
und etliche betroffene Schüler/<br />
innen und deren Lehrkräfte in<br />
den Grundschulen hinreichend<br />
unterstützen kann. Die Ausweitung<br />
der mobilen Unterstützung<br />
in die SEK-I streben wir intensiv<br />
an.<br />
Ich bin allerdings auch fest<br />
davon überzeugt, dass einige<br />
Schüler/innen mit erheblichem<br />
Unterstützungsbedarf im Bereich<br />
ES zumindest temporär eine<br />
ihrem speziellen Bedarf angemessene<br />
Lernumgebung (ich<br />
benutze dafür gerne den leider<br />
inzwischen verpönten Begriff<br />
"Schonraum") benötigen.<br />
Es kann nicht sein, dass vor<br />
allem in den niedersächsischen<br />
Zentren öffentliche Förderschulen<br />
mit dem Schwerpunkt ES<br />
weiter vorgehalten werden, während<br />
in den „Randregionen“<br />
betroffene Schüler/innen, ihre<br />
Mitschüler/innen und Lehrkräfte<br />
überfordert werden.<br />
– Wir erleben zunehmend<br />
Kinder mit erheblichen<br />
Sprachauffälligkeiten. Diesen<br />
werden wir im Rahmen der<br />
sonderpädagogischen Grundversorgung<br />
nicht immer hinreichend<br />
gerecht. Da im<br />
Landkreis Aurich keine spezielle<br />
schulische Sprachfördereinrichtung<br />
vorgehalten wird,<br />
wir auch diesen Bereich<br />
weiterhin inklusiv „bearbeiten“<br />
möchten, hat unser<br />
Schulträger vor einem Jahr<br />
beim Kultusministerium die<br />
Genehmigung eines mobilen<br />
Dienstes im Bereich Sprache<br />
beantragt. Leider warten wir<br />
bisher auf eine positive<br />
Antwort, während in anderen<br />
Regionen die weniger inklusive<br />
Sprachheilklasse beibehalten<br />
werden soll.<br />
– Unsere Erfahrungen in Aurich<br />
/ Ihlow zeigen, dass<br />
deutlich zunehmend mehr<br />
Eltern für ihre Kinder mit<br />
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf<br />
die allgemeine<br />
Schule anwählen, weil sie<br />
erfahren, dass dort „förderlich“<br />
gearbeitet wird. Das ist<br />
gut. Einigen Kindern werden<br />
wir aber in der inklusiven<br />
Schule unter den gegebenen<br />
Bedingungen noch nicht gerecht,<br />
sie empfinden sich dort<br />
als „Versager“, als „Außenseiter“<br />
und entwickeln ein<br />
unangemessenes Arbeits- und<br />
Sozialverhalten. Vereinzelt<br />
sind betroffene Schüler/innen<br />
von der inklusiven Schule in<br />
die Förderschule Lernen gewechselt<br />
und haben dort „neu<br />
starten“ und sich gut entwickeln<br />
können. Zumindest<br />
noch für einige Zeit wünsche<br />
ich mir für Eltern mit<br />
Kindern auch im Unterstützungsbereich<br />
Lernen die<br />
Möglichkeit eine entsprechende<br />
Förderschule anzuwählen.<br />
Auf der Straße, in der Kneipe<br />
und in den Schulen habe ich in<br />
den vielen Jahren unserer<br />
Bemühungen um die Entwicklung<br />
schulischer Inklusion sehr<br />
viel Zustimmung erlebt. Erst<br />
jetzt höre ich überall den Satz:<br />
„Inklusion überfordert, das ist<br />
der falsche Weg!“ Das bereitet<br />
mir Sorge.<br />
Mit freundlichem Gruß<br />
Hartwig Poyda
7 LEUCHTTURM<br />
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen<br />
Verband Sonderpädagogik Landesverband Niedersachsen e.V<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft * Landesverband Niedersachsen Berliner Allee 16 * 30175 Hannover * Tel. 0511/33804-0 * Fax 0511/33804-46<br />
* e-mail: eMail@GEW-Nds.de * Internet: www.GEW-Nds.de<br />
Hannover, 29. Januar 2015<br />
Gemeinsame Erklärung der<br />
und des zur Weiterentwicklung<br />
der inklusiven Schule<br />
1. GEW und vds sind sich einig,<br />
dass der Prozess der Einführung<br />
der schulischen Inklusion weiter<br />
geführt werden soll. Dazu sind<br />
Änderungen im Schulgesetz<br />
ebenso wie neue untergesetzliche<br />
Regelungen unabdingbar.<br />
2. GEW und vds sind sich einig,<br />
dass die Bedingungen in den<br />
Schulen und insbesondere die<br />
Steuerung der Inklusion bisher<br />
unzureichend sind und gegenüber<br />
den bisher vorgelegten<br />
Konzepten verbessert werden<br />
müssen.<br />
3. GEW und vds sehen in dem<br />
vorliegenden Gesetzentwurf einen<br />
richtigen Schritt zu einer<br />
Ausweitung der inklusiven Schule<br />
in Niedersachen.<br />
4. GEW und vds treten dafür<br />
ein, dass die sonderpädagogische<br />
Unterstützung in den Förderschwerpunk-ten<br />
Lernen und<br />
Sprache verstärkt und ausgeweitet<br />
in den allgemeinen Schulen<br />
stattfinden kann bzw. perspektivisch<br />
ausschließlich dort stattfindet.<br />
Das Auslaufen der Förderschule<br />
Lernen in der Sekundarstufe I ist<br />
aus ganz pragmatischen Gründen<br />
notwendig, weil die Anwahl<br />
der Förderschule Lernen ab<br />
Jahrgang 5 massiv zurück geht<br />
und die Schülerzahlen insbesondere<br />
in den Gegenden dramatisch<br />
sinken, in denen die<br />
Regionalen Integrationskonzepte<br />
schon über eine längere Zeit<br />
erfolgreich umgesetzt worden<br />
sind.<br />
5. GEW und vds erwarten, dass<br />
die Landesregierung aus den<br />
Stellungnahmen zu den geplanten<br />
untergesetzlichen Regelungen<br />
zur Steuerung der Inklusion<br />
die Schlussfolgerung zieht, dass -<br />
unabhängig von der in der<br />
Gesetzesnovelle vorgesehenen<br />
rechtlichen Trennung der Förderzentren<br />
von Förderschulen -<br />
ein grundsätzlicher und dringender<br />
Beratungsbedarf bezüglich<br />
der formalen und inhaltlichen<br />
Ausgestaltung der regionalen<br />
Steuerung für die Umsetzung<br />
der inklusiven Schule<br />
besteht. Die festgelegten Zielvorstellungen<br />
für die sogen.<br />
Regionalstellen für schulische<br />
Inklusion sind aus Sicht von<br />
GEW und vds zu eng als<br />
verwaltungsmäßige Konstrukte<br />
einer neuen Schulaufsichtsebene<br />
vorgesehen, die den unbedingt<br />
erforderlichen Rahmen für die<br />
kollegiale Vernetzung und Abstimmung<br />
nicht gewährleisten.<br />
6. GEW und vds erwarten, dass<br />
sie in eine ergebnisoffene<br />
Debatte zur Neukonzipierung<br />
der sogen. Regionalstellen für<br />
schulische Inklusion sowie zur<br />
Ausgestaltung der verschiedenen<br />
untergesetzlichen Regelungen<br />
einbezogen werden.<br />
7. GEW und vds gehen davon<br />
aus, dass eine Übergangsregelung<br />
zum 01.08.2015 die<br />
bisherige erfolgreiche Arbeit der<br />
Förderzentren als Steuerungsmodell<br />
der sonderpädagogischen<br />
Unterstützung in den allgemeinen<br />
Schulen als Ausgangsbasis<br />
festlegt und diese weiter zu<br />
führen sind, bis eine vollständige<br />
Neuregelung eingeführt werden<br />
kann. Diese Übergangsregelung<br />
sollte auf ein Jahr befristet<br />
sein und würde für die<br />
Ausarbeitung und Beratung der<br />
vielfältigen untergesetzlichen<br />
Regelungen die nötige Zeit<br />
verschaffen.<br />
8. GEW und vds begrüßen in<br />
diesem Zusammenhang das<br />
Verfahren zur Einführung der<br />
Schulgesetznovelle. Es wird<br />
nicht auf dem kurzen Weg über<br />
die Fraktionen eingeführt, sondern<br />
von der Landesregierung.<br />
Dies wurde von der Regierung<br />
ausdrücklich mit der Absicht<br />
begründet, Hinweise aus dem<br />
Anhörungsverfahren aufzunehmen.<br />
Es ist ein Zeichen<br />
politischer Stärke, diese Absicht<br />
jetzt auch umzusetzen.
LEUCHTTURM<br />
Wer sind die Anhänger von Pegida?<br />
Hasso<br />
Rosenthal<br />
Was treibt Menschen um,<br />
sich unter dem Banner<br />
eines Aufrufs der „Europäischen<br />
Patrioten gegen eine Islamisierung<br />
des Abendlandes“ (Pegida)<br />
zu versammeln? Da stimmt<br />
schon die Begrifflichkeit nicht:<br />
Ein Patriot will ein Vaterlandsfreund<br />
sein. Dem Mutter- oder<br />
Vaterland steht unser Grundgesetz<br />
vor, das einen sozialen<br />
Rechtsstaat beschreibt. Also auch<br />
die Integration von Ausgestoßenen.<br />
Das Wort Patriot kommt<br />
aus dem Griechischen, es gibt es<br />
auch im Lateinischen<br />
(patriota=der Landmann) und<br />
im Französischen (Mitbürger).<br />
Jedenfalls ist der Ursprung des<br />
Begriffs das Griechische „patriotes“,<br />
damit benennen die<br />
Athener den Landsmann und<br />
Mitbürger. Er soll vor Ort<br />
geboren sein. Socrates begann<br />
seine Rede mit der Wendung<br />
„Bürger von Athen“, um<br />
wortreich zu verkünden, dass er<br />
nichts weiß. Seit dem 17.<br />
Jahrhundert verwendet man den<br />
Begriff mit „heimisch“ oder<br />
„vaterländisch“ als Bedeutungskern.<br />
Die Aufrufe der Pegida-<br />
Bewegung verstehen sich als<br />
Trendsetter des Rechtspopulismus,<br />
der in Europa wie in den<br />
Niederlanden, der Schweiz,<br />
Dänemark Großbritannien oder<br />
Italien um sich greift.<br />
Getragen werden die Verlautbarungen<br />
dieser antiparlamentarischen<br />
Sekte durch eine<br />
Sehnsucht nach Werten wie<br />
Sicherheit, Disziplin und Leistungswillen,<br />
als gäbe es sie in<br />
den erfolgreichsten OECD-<br />
Staaten nicht.<br />
Gewachsen aus dem künstlich<br />
erzeugten Gefühl der Selbstgerechtigkeit<br />
lässt man sich von<br />
unbegründeten Überfremdungsängsten<br />
beherrschen. Leitstern<br />
ist die Angst vor den wirklich<br />
unscheinbaren Spuren eines<br />
gedachten „Fremden“, das man<br />
nicht versteht und auch nicht<br />
verstehen will. Die dort mitmarschieren,<br />
leben das Gefühl<br />
sozialer Bedeutungslosigkeit aus,<br />
wollen sich abgrenzen von<br />
denen, die sie nicht kennen.<br />
Bezeichnenderweise ist „Pegida“<br />
dort am stärksten, wo die<br />
wenigsten Einwanderer leben.<br />
Doch selbst sind sie nicht<br />
bereit, sich in ihrer Region, bei<br />
Verbänden, Parteien oder Gewerkschaften<br />
in die Pflicht<br />
nehmen zu lassen. Stattdessen<br />
reihen sie sich ein in die Masse<br />
derer, die durch das Tal der<br />
Ahnungslosen schreiten und<br />
gebrauchen Parolen wie „Wir<br />
sind das Volk“, die ihre<br />
Entfremdung vom Denken eines<br />
politisch liberalen, parlamentarischen<br />
Rechtsstaat deutlich werden<br />
lässt.<br />
Heinz Bude, Macrosoziologe<br />
der Universität Kassel nennt sie<br />
„extreme Mitte“, die durch<br />
Einflüsterer aus Internet-Netzwerken<br />
in eine „Panik des<br />
Mittelstandes“ rutschen, genährt<br />
von Ängsten, die mit der<br />
Wirklichkeit nichts zu tun<br />
haben. Entstanden ist in diesen<br />
Kreisen eine Stimmungslage, die<br />
das Gemeinsame verleugnet und<br />
denen, die sich unter Mühsal<br />
und Entbehrung wirklich leiden,<br />
die helfende Hand verweigert.<br />
Natürlich gibt es eine Gegenbewegung,<br />
die ihre Kritik an den<br />
Panikmachern in die Öffentlichkeit<br />
trägt. Sie demonstrieren<br />
beharrlich und in großer Zahl<br />
auch in Dresden. Doch es bedarf<br />
weiter der argumentativen Auseinandersetzung..<br />
Jeder Mitbürger (Patriot) lebt<br />
in einem sozialen Rechtsstaat,<br />
dessen Prinzipien Ausgleich,<br />
Hilfe für Mitleidende, Rechtssicherheit,<br />
Gerechtigkeit, Solidarität<br />
und Einfühlungsvermögen<br />
8<br />
anzustreben sind und nicht<br />
Ausgrenzung und das Schüren<br />
irrationaler Ängste gegen „die<br />
Anderen“. Einer, der Mutteroder<br />
Vaterlandsliebe in den<br />
Vordergrund stellt, verwendet<br />
den Begriff „Liebe“, der Träger<br />
des Wortes „Nächstenliebe“ ist.<br />
Wir verdanken unsere Schrift<br />
den Sumerern, die Mathematik<br />
den Indern und Arabern, den<br />
Kaffee den Türken, den Tee den<br />
Chinesen, mit der Völkerwanderung<br />
kam der Pflug mit den<br />
Mongolen aus Asien. Wer vor<br />
einer Überfremdung warnt,<br />
vergisst, dass gerade Deutschland<br />
in der Mitte Europas seinen<br />
wirtschaftlichen Welterfolg der<br />
Toleranz und der Bereitschaft,<br />
von anderen zu lernen, verdankt.<br />
Dumpfe Ausländerfeindlichkeit,<br />
Ausgrenzung und Intoleranz<br />
sind immer der Garant<br />
für einen wirtschaftlichen und<br />
menschlichen Niedergang. Ihr<br />
Fluch sind Unfreiheit, politische<br />
Intoleranz, Dogmatismus und<br />
Fundamentalismus.<br />
Wer vom Abendland spricht,<br />
darf vom Morgenland nicht<br />
schweigen. Ambrose Bierce<br />
schrieb zum Unterschied vor<br />
100 Jahren, dass das Abendland<br />
jener Teil der Welt sei, der<br />
westlich des Morgenlandes liegt.<br />
Größtenteils bewohnt von Christen,<br />
einem mächtigen „Stamm<br />
der Hypokriten“, deren wichtigstes<br />
Gewerbe Mord und Betrug<br />
sind, von ihnen gern „Krieg“<br />
und „Handel“ genannt. Dass<br />
seien auch die wichtigsten<br />
Gewerbe des Morgenlandes. Der<br />
Begriff Abendland wird seit dem<br />
16. Jahrhundert gebraucht. Und<br />
sei aus der Sicht der Europäer<br />
mit ihrer seinerzeit arg eingeschränkten<br />
Weltsicht „die westliche<br />
Hälfte Europas“.<br />
Konsequenz aus all dem kann<br />
nur sein, dass in den Schulen<br />
Aufklärung forciert wird. „Pegida“<br />
ebenso wie „Salafisten“ sind<br />
Symbole der Gegenaufklärung.<br />
Die GEW muss sich dagegen<br />
eindeutig positionieren.<br />
Holthusen, 13. Januar 2015
9 LEUCHTTURM<br />
Für eine solidarische und gerechte Gesellschaft<br />
Gemeinsam gegen Ausgrenzung, Rassismus und Rechtspopulismus<br />
27. Januar 2015<br />
Der DGB und seine Gewerkschaften<br />
sind aufgrund der Pegida-<br />
Demonstrationen in Dresden und<br />
anderen Städten und dem wachsenden<br />
Rechtspopulismus besorgt.<br />
Der Terroranschlag in Paris darf<br />
nicht als Vorwand genommen<br />
werden, um noch mehr Rassismus,<br />
Antisemitismus und Islamophobie<br />
innerhalb der deutschen Gesellschaft<br />
zu schüren.<br />
Die WortführerInnen von Pegida<br />
beklagen die Opfer des Terrors<br />
durch den sogenannten Islamischen<br />
Staat (IS). Doch anstatt sich mit den<br />
Flüchtlingen zu solidarisieren, die<br />
Opfer des IS-Terrors geworden sind,<br />
rufen sie jeden Montag zu<br />
Demonstrationen auf, die genau<br />
diese Flüchtlinge diskreditieren.<br />
Diese Demonstrationen sind<br />
gefährlich, weil sie den Boden für<br />
rassistische Übergriffe bereiten und<br />
die Bevölkerung spalten. Unter dem<br />
Deckmantel des Protestes gegen eine<br />
angebliche Islamisierung, wird gegen<br />
Flüchtlinge im Allgemeinen<br />
und Menschen islamischen Glaubens<br />
im Besonderen gehetzt.<br />
Den OrganisatorInnen von Pegida<br />
geht es allein um Populismus.<br />
Es werden Ängste um die soziale<br />
Sicherheit, um Arbeitslosigkeit und<br />
um ein gesellschaftliches Miteinander<br />
benutzt, um Rassismus und<br />
Fremdenfeindlichkeit zu schüren.<br />
Gleichzeitig wähnen sich Neonazis<br />
durch diese „Bewegung“ bundesweit<br />
im Aufwind. Es gibt einen rasanten<br />
Anstieg von Gewalttaten und<br />
Anschlägen. Die Nachahmer von<br />
Pegida entpuppen sich dabei nicht<br />
selten als Initiativen von Neonazis<br />
und Rechtsradikalen.<br />
Als Gewerkschafterinnen und<br />
Gewerkschafter ist uns die Unterstützung<br />
der bundesweiten Proteste<br />
gegen Pegida und ihrer Ableger ein<br />
wichtiges Anliegen. Solidarität ist<br />
die Grundlage unserer gewerkschaftlichen<br />
Arbeit. Nationalität, Herkunft,<br />
Religion oder Geschlecht<br />
waren nie und werden auch<br />
zukünftig kein Grund sein, uns in<br />
unseren Grundfesten spalten zu<br />
lassen.<br />
Unsere Solidarität gilt allen<br />
Menschen, die aufgrund von Krieg,<br />
Terror, Verfolgung oder Armut ihre<br />
Heimat verlassen mussten und als<br />
Flüchtlinge und Asylsuchende in<br />
unser Land kommen. Sie gilt auch<br />
denjenigen Migrantinnen und<br />
Migranten, die seit Jahren mit ihrer<br />
Arbeit zu Wachstum, Wohlstand<br />
und Vielfalt in Deutschland<br />
beitragen.<br />
„Die Gewerkschaftsbewegung in<br />
Deutschland ist ihrer Tradition und<br />
Geschichte verpflichtet: Demokratie<br />
und Freiheit, Gleichheit und<br />
Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz<br />
leiten seit jeher unser<br />
Handeln.“ (DGB-Grundsatzprogramm)<br />
Die rassistischen Proteste und die<br />
Vorurteile gegenüber Flüchtlingen<br />
und MigrantInnen nähren sich<br />
auch aus Abstiegsängsten vieler<br />
Menschen. Durch zahlreiche Lügen<br />
über eine angeblich ansteigende<br />
Kriminalitätsrate oder der Verrohung<br />
der Gesellschaft, versuchen die<br />
InitiatorInnen die Ängste in der<br />
Bevölkerung weiter zu schüren. Als<br />
Gewerkschaften wollen wir über die<br />
wirklichen Fakten aufklären.<br />
Pegida, AfD & Co versuchen,<br />
verfehlte Wohnungspolitik, Sozialund<br />
Bildungsabbau, die Rente mit<br />
67 sowie die Absenkung des<br />
Rentenniveaus und anderes für ihre<br />
Propaganda auszunutzen. Aber<br />
nicht MigrantInnen und Flüchtlinge<br />
sind schuld am Arbeitsplatzabbau,<br />
am fehlenden sozialen Wohnungsbau,<br />
Hartz IV, Privatisierungen<br />
und einer unsozialen Politik.<br />
Nicht MigrantInnen und Flüchtlinge<br />
verweigern vernünftige Arbeitsbedingungen<br />
und einen Tarifvertrag.<br />
Nicht sie sind es, die für eine<br />
ausufernde Befristungspraxis in den<br />
Betrieben verantwortlich sind.<br />
Wir fordernvon den Parteien sich<br />
für eine soziale und gerechte Politik<br />
einzusetzen, die den Menschen -<br />
egal welcher Herkunft und Religion<br />
- wieder in den Mittelpunkt des<br />
politischen Handels setzt.<br />
Wir rufen dazu auf, die Probleme<br />
dort anzugehen, wo sie verursacht<br />
werden.<br />
Wir streiten für eine solidarische<br />
Gesellschaft, in der Einkommen<br />
und Vermögen gerecht verteilt sind.<br />
Wir rufen dazu auf, gemeinsam<br />
mit uns in und außerhalb der<br />
Betriebe und Dienststellen aktiv zu<br />
werden für soziale Verbesserungen,<br />
für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen.<br />
Und wir rufen dazu auf, sich<br />
überall an den Protesten gegen<br />
Pegida, AfD & Co zu beteiligen. In<br />
den anstehenden Tarifrunden, wie<br />
zum Beispiel der Metallindustrie,<br />
dem Sozial- und Erziehungsdienst,<br />
der Beschäftigten des öffentlichen<br />
Dienstes der Länder, der Post, aber<br />
auch bei anderen betrieblichen<br />
Protesten werden sich KollegInnen<br />
mit und ohne deutschen Pass<br />
gemeinsam für höhere Löhne und<br />
bessere Arbeitsbedingungen einsetzen.<br />
Gemeinsam sind wir auch aktiv<br />
für ausreichende Sozialleistungen,<br />
eine auskömmliche Rente und die<br />
Rekommunalisierung öffentlicher<br />
Dienstleistungen. In Verbindung<br />
mit der Aufklärung über die<br />
falschen Argumente von Pegida &<br />
Co. ist dies das beste Mittel im<br />
Kampf gegen Neonazis und<br />
Rassisten.<br />
„Die Gewerkschaften treten allen<br />
Erscheinungsformen von Extremismus,<br />
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit<br />
– auch in den eigenen<br />
Reihen – entgegen. Wir werben für<br />
Offenheit gegenüber Fremden und<br />
Zugewanderten und unterstreichen<br />
unsere Verpflichtung, uns in den<br />
Betrieben und Verwaltungen für<br />
Toleranz einzusetzen.“ (DGB-<br />
Grundsatzprogramm)<br />
Für eine solidarische und<br />
gerechte Gesellschaft – Gemeinsam<br />
gegen Ausgrenzung, Rassismus und<br />
Rechtspopulismus!<br />
Wir werben außerdem für die<br />
Unterstützung des Internetaufrufes<br />
„1 Mio. Unterschriften gegen<br />
Pegida“.<br />
https://www.change.org/p/1-mio-unterschriften-gegen-pegida-nopegida?after_sign_exp=member_sponsored_donation<br />
Erklärung der DGB Region Oldenburg-Ostfriesland
LEUCHTTURM<br />
10<br />
Auszüge aus der Rede von Dorothee Jürgensen zum<br />
Neujahrsempfang des DGB Kreisverbandes Aurich<br />
(Dorothee J. ist die DGB–Regionsgeschäftsführerin in Oldenburg-Ostfriesland)<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
Demokratie braucht soziale<br />
Gerechtigkeit, dafür stehen<br />
wir Gewerkschaften ein. Die<br />
Realität sieht aber etwas anders<br />
aus. Noch immer sind die<br />
sozialen Risiken auf dem<br />
Arbeitsmarkt groß. Trotz hohem<br />
Beschäftigungsniveau nimmt die<br />
Arbeitszufriedenheit ab und die<br />
sozialen Unterschiede werden<br />
größer. Der Niedriglohnsektor<br />
wächst und die berufliche<br />
Aufstiegsmobilität ist relativ<br />
gering – trotz des steigenden<br />
Fachkräftebedarfs.<br />
Leistungsfähige Sozialsysteme<br />
sind erforderlich, die den<br />
sozialstaatlichen Auftrag ernst<br />
nehmen. Arbeitsmarktpolitik<br />
darf sich nicht auf rein<br />
betriebswirtschaftliche Ziele reduzieren,<br />
sondern muss über<br />
individuelle Hilfen hinaus einen<br />
wirksamen Beitrag zur Steigerung<br />
der gesamtwirtschaftlichen<br />
Wohlfahrt leisten. ... ...<br />
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften<br />
fordern seit<br />
langem eine Neuordnung auf<br />
dem Arbeitsmarkt, um diese<br />
Schieflage zu beheben. Wir<br />
haben den Parteien vor der<br />
Bundestagswahl 2013 frühzeitig<br />
Vorschläge für einen Politikwechsel<br />
hin zu einer sozial<br />
gerechten Politik gemacht. Viele<br />
davon sind im Wahlkampf von<br />
den Parteien aufgegriffen worden<br />
und einiges wurde dann auch im<br />
Koalitionsvertrag festgehalten,<br />
wie z.B. die Einführung eines<br />
bundesweit flächendeckenden gesetzlichen<br />
Mindestlohns, Werkverträge<br />
stärker zu überwachen<br />
und die Bedingungen für<br />
Leiharbeit zu verbessern.<br />
Andere wichtige Dinge wie<br />
die Überführung der Minijobs,<br />
also der geringfügigen<br />
Beschäftigung<br />
in sozialversicherungspflichtige<br />
Arbeit, sowie<br />
die Beendigung<br />
der sachgrundlosen<br />
Befristung von<br />
Arbeitsverhältnissen<br />
werden in der<br />
Koalitionsvereinbarung<br />
leider nur<br />
vage angerissen. ...<br />
...<br />
Ein wichtiger<br />
Schritt ist endlich<br />
geschafft! Auch<br />
Deutschland gehört<br />
jetzt endlich<br />
… zur Mehrheit<br />
der europäischen<br />
Länder, in denen<br />
ein allgemeiner gesetzlicher<br />
Mindestlohn<br />
gilt. Alle<br />
Beschäftigten in<br />
Deutschland sollen<br />
mindestens 8,50<br />
Euro brutto pro Stunde verdienen.<br />
Das gilt auch, wenn die<br />
Beschäftigten oder ihre Unternehmen<br />
aus dem Ausland<br />
kommen: Jede Arbeitnehmerin<br />
und jeder Arbeitnehmer in<br />
Deutschland hat grundsätzlich<br />
Anspruch auf den Mindestlohn<br />
– mit einigen Übergangsfristen.<br />
Jede Arbeitnehmerin und<br />
jeder Arbeitnehmer ??? - Leider<br />
NEIN!<br />
Ärgerlich sind die Ausnahmen,<br />
betroffen sind z.B.:<br />
· Zeitungszustellerinnen und<br />
Zeitungszusteller – ...<br />
· ... . Anders als bei unseren<br />
europäischen Nachbarn, wo<br />
prozentuale Abstufungen für<br />
einen Jugendmindestlohn gelten,<br />
sind Minderjährige in<br />
Deutschland komplett ausgenommen.<br />
· Für Auszubildende oder<br />
Pflichtpraktikanten im Rahmen<br />
einer Ausbildung oder<br />
eines Studiums gilt der<br />
Mindestlohn nicht.<br />
· Langzeitarbeitslose, die seit<br />
über einem Jahr erwerbslos<br />
gemeldet sind, haben erst<br />
sechs Monate nach Wiederaufnahme<br />
einer Tätigkeit das<br />
Recht auf einen Mindestlohn.<br />
Die Ausnahmen müssen<br />
beseitigt werden, denn Würde –<br />
und ein existenzsicherndes Arbeitsverhältnis<br />
gehört für uns<br />
dazu – kennt keine Ausnahme!<br />
Trotzdem ist die Einführung<br />
des gesetzlichen Mindestlohns<br />
ein Fortschritt. Er bildet endlich<br />
eine unterste Haltelinie und<br />
kann damit zumindest die<br />
extremsten Niedriglöhne verhindern.<br />
Es kommt nun darauf an,<br />
dass das Gesetz umzusetzen und<br />
mit Leben zu füllen! Daran<br />
müssen wir Politik jetzt messen<br />
und dafür müssen wir uns jetzt<br />
einsetzen. Die Gewerkschaften<br />
werden darauf achten, dass der
11 LEUCHTTURM<br />
Mindestlohn ... nicht unterlaufen<br />
wird. ...<br />
... Denn jetzt heißt es: Dran<br />
bleiben!<br />
Der Mindestlohn muss wirksam<br />
umgesetzt und effektiv<br />
kontrolliert werden, damit alle,<br />
denen er zusteht, ihn auch<br />
tatsächlich erhalten. ... Keine<br />
Ausnahmen beim Mindestlohn<br />
mehr! ...<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
bleiben wir dran an einer<br />
neuen – gerechten Ordnung am<br />
Arbeitsmarkt!<br />
Lasst uns dran bleiben beim<br />
Kampf gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse!<br />
Lasst uns<br />
weiter für mehr Mitbestimmung<br />
und für die Stärkung der<br />
Tarifautonomie kämpfen! Lasst<br />
uns die Zukunft der Arbeit<br />
gestalten!<br />
„Die Zukunft der Arbeit<br />
gestalten wir“,<br />
so lautet auch das diesjährige<br />
Motto zum 1. Mai! Ich finde ein<br />
gutes Motto!<br />
Raus aus dem Abwehrkampf hin<br />
zur Gestaltung!:<br />
- Humanisierung der Arbeit (...<br />
...)!<br />
· Ausbau des Kündigungsschutzes!<br />
· eine Reform des Befristungsrechtes,<br />
die Kettenbefristungen<br />
ausschließt und die<br />
unbefristete Beschäftigung<br />
zum Regelfall macht!<br />
· sozialen und arbeitsrechtlichen<br />
Schutz für Minijob-<br />
Beschäftigte. ...!<br />
· die betriebliche und Unternehmensmitbestimmung<br />
ausbauen!<br />
· das Rentenniveau auf höherem<br />
Niveau stabilisieren!<br />
Unsere Gesellschaft braucht<br />
Solidarität!<br />
Ein Ausstieg aus dem Euro ist<br />
so ohne weiteres rechtlich gar<br />
nicht möglich, noch wird dieser<br />
Ausstieg von relevanten politischen<br />
Kräften in Griechenland<br />
angestrebt. Dennoch zettelten<br />
deutsche Politiker und Medien<br />
eine Phantomdebatte an. Der<br />
Grund: Eine linke Partei könnte<br />
in Griechenland möglicherweise<br />
die anstehenden Wahlen gewinnen<br />
und über harte Sparauflagen<br />
neu verhandeln wollen. Das<br />
passt Merkel und Schäuble gar<br />
nicht. Sie hätten lieber eine<br />
Athener Regierung, die brav die<br />
Politik des sozialen Kahlschlags<br />
weiter treibt.<br />
Die Griechen sind mündige<br />
BürgerInnen Europas und brauchen<br />
keine Bevormundung<br />
durch Merkel und Co! In<br />
Griechenland gibt es zu Recht<br />
Unmut über die bisherige<br />
Krisenpolitik. Die Sparpolitik<br />
hat zu einem massiven Anstieg<br />
der Armut geführt. Die Zahl der<br />
Obdachlosen steigt. Straßenkriminalität<br />
nimmt zu. Das<br />
Gesundheitssystem ist der Kürzungspolitik<br />
zum Opfer gefallen.<br />
Drei Millionen Menschen<br />
haben laut Zeitungsberichten<br />
keinen Zugang mehr zur<br />
Gesundheitsversorgung.<br />
Merkel und Schäuble spielen<br />
mit dem Feuer. Denn allein die<br />
Debatte um Staatspleiten führt<br />
zu neuer Unsicherheit - eine<br />
Einladung an Hedgefonds und<br />
andere Spekulanten, Wettgeschäfte<br />
auf die Pleite von Euro-<br />
Ländern abzuschließen.<br />
Wir brauchen einen Kurswechsel<br />
bei der EU-Anti-Krisen-<br />
Strategie. Die bisherige Politik<br />
der Troika aus Europäischer<br />
Zentralbank (EZB), EU-Kommission<br />
und Internationalem<br />
Währungsfonds ist nicht nur in<br />
Griechenland gescheitert. Sie hat<br />
in allen Krisenländern (und<br />
nicht nur hier) zu einem Angriff<br />
auf Tarifautonomie, Gewerkschaften<br />
und auf die Löhne<br />
geführt: In Griechenland wurden<br />
Branchentarifverträge weitgehend<br />
durch Haustarifverträge<br />
verdrängt. In Portugal galt 2009<br />
noch für 1,9 Millionen Beschäftigte<br />
ein Flächentarifvertrag,<br />
2012 nur noch für 300.000. In<br />
Spanien verloren seit 2008 fast<br />
7,5 Millionen Beschäftigte den<br />
Schutz durch einen Flächentarifvertrag.<br />
Das Ergebnis dieser<br />
Politik: Die Reallöhne sind seit<br />
2010 massiv gesunken – in<br />
Portugal und Spanien um rund<br />
sieben, in Griechenland sogar<br />
um fast 23 Prozent. Entsprechend<br />
haben diese „Reformen“<br />
auch zu einem Einbruch der<br />
Binnennachfrage, zu massiver<br />
Rezession und Arbeitslosigkeit<br />
geführt.<br />
Und liebe Kolleginnen und<br />
Kollegen, diese wird auch auf die<br />
ArbeitnehmerInnen hier bei uns<br />
über kurz oder lang Auswirkung<br />
haben – das wisst ihr alle!<br />
Angesichts dieser Dramatik ist<br />
eine Debatte über eine andere<br />
Krisentherapie überfällig. Egal<br />
wer in Athen die Wahlen für<br />
sich gewinnt. Eine Kurskorrektur<br />
der EU und Deutschlands<br />
gegenüber Griechenland wäre<br />
kein Zeichen der Schwäche,<br />
sondern ein Zeichen der<br />
ökonomischen Vernunft.<br />
Unsere Solidarität gilt allen<br />
Menschen, die aufgrund von<br />
Krieg, Terror, Verfolgung oder<br />
Armut ihre Heimat verlassen<br />
mussten und als Flüchtlinge und<br />
Asylsuchende in unser Land<br />
kommen. Sie gilt auch denjenigen<br />
Migrantinnen und Migranten,<br />
die seit Jahren mit ihrer<br />
Arbeit zu Wachstum, Wohlstand<br />
und Vielfalt in Deutschland<br />
beitragen. Denn die schockierenden<br />
Bilder aus Frankreich lassen<br />
euch bestimmt genauso wenig<br />
los, wie mich!<br />
In Paris haben Fanatiker 17<br />
Menschen ermordet. Diese Morde<br />
wenden sich gegen unsere<br />
Gesellschaft, gegen Demokratie<br />
und Toleranz. Dieser Terror will<br />
gezielt unsere Meinungs- und<br />
Pressefreiheit angreifen! Dies<br />
dürfen wir nicht zulassen!<br />
Wir dürfen jetzt aber auch<br />
nicht zulassen, dass diese zu<br />
verachtenden Taten dazu führen,<br />
dass rechten Demagogen wie der<br />
Front National oder - wie hier in<br />
Deutschland - Pegida, AfD und<br />
NPD weiterer Vorschub geeistet<br />
wird. Auch durch Ausgrenzung,<br />
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus<br />
ist unsere Gesellschaft –<br />
unsere Demokratie bedroht.<br />
Lasst uns gemeinsam einstehen<br />
… für eine weltoffene,<br />
solidarische und gerechte Gesellschaft<br />
– Gemeinsam gegen Ausgrenzung,<br />
Rassismus, Antisemitismus<br />
und Rechtspopulismus. Gebt dem<br />
Hass keine Chance!
LEUCHTTURM<br />
12<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen!<br />
Die rassistischen Proteste und<br />
die Vorurteile gegenüber Flüchtlingen<br />
und MigrantInnen nähren<br />
sich auch aus Abstiegsängsten<br />
vieler Menschen. Die<br />
Ängste werden durch zahlreiche<br />
Lügen über ansteigende Kriminalität<br />
usw. geschürt. Als<br />
Gewerkschaften wollen wir über<br />
die wirklichen Fakten aufklären.<br />
Pegida, AfD & Co versuchen,<br />
verfehlte Wohnungspolitik, Sozial-<br />
und Bildungsabbau, die<br />
Rente mit 67 und anderes für<br />
ihre Propaganda auszunutzen.<br />
Aber nicht MigrantInnen und<br />
Flüchtlinge sind schuld an<br />
Arbeitsplatzabbau, fehlendem<br />
sozialem Wohnungsbau, Hartz<br />
IV, Privatisierungen und einer<br />
unsozialen Politik. Nicht MigrantInnen<br />
und Flüchtlinge<br />
verweigern zum Beispiel vernünftige<br />
Arbeitsbedingungen<br />
und einen Tarifvertrag. Nicht sie<br />
sind es, die für eine ausufernde<br />
Befristungspraxis in den Betrieben<br />
verantwortlich sind.<br />
„Wenn Teile der Politik und<br />
der Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände<br />
dem Sozialstaat,<br />
Arbeitnehmerrechten und dem<br />
Flächentarifvertrag grundsätzlich<br />
den Kampf ansagen, ist es eine<br />
prinzipielle und aktuelle Aufgabe<br />
der Gewerkschaften, gegen<br />
eine Systemwende nach rechts,<br />
gegen den Marsch in einen<br />
ungezügelten Kapitalismus, Widerstand<br />
zu leisten.“ (DGB-<br />
Grundsatzprogramm)<br />
Wir rufen dazu auf, die<br />
Probleme dort anzugehen, wo<br />
sie verursacht werden. Wir<br />
streiten für eine solidarische<br />
Gesellschaft, in der Einkommen,<br />
Vermögen und Lebenschancen<br />
gerecht verteilt sind. Wir rufen<br />
dazu auf, gemeinsam mit uns in<br />
und außerhalb der Betriebe und<br />
Dienststellen aktiv zu werden für<br />
soziale Verbesserungen, für bessere<br />
Lebens- und Arbeitsbedingungen.<br />
In den anstehenden Tarifrunden,<br />
wie zum Beispiel der<br />
Metallindustrie, dem Sozialund<br />
Erziehungsdienst, der Beschäftigten<br />
des öffentlichen<br />
Dienstes der Länder, der Post,<br />
aber auch bei anderen betrieblichen<br />
Protesten werden sich<br />
KollegInnen mit und ohne<br />
deutschen Pass gemeinsam für<br />
höhere Löhne und bessere<br />
Arbeitsbedingungen einsetzen.<br />
Gemeinsam sind wir aktiv für<br />
ausreichende Sozialleistungen,<br />
eine auskömmliche Rente und<br />
die Rekommunalisierung öffentlicher<br />
Dienstleistungen. In Verbindung<br />
mit der Aufklärung<br />
über die falschen Argumente<br />
von Pegida und Co. ist dies das<br />
beste Mittel im Kampf gegen<br />
Nazis und Rassisten.<br />
„Denn Demokratie und Freiheit,<br />
Gleichheit und Gerechtigkeit,<br />
Solidarität und Toleranz<br />
leiten seit jeher unser Handeln.“<br />
Es gibt viel zu tun und ich<br />
wünsche uns allen für die<br />
bevorstehenden Aufgaben und<br />
stattfindenden Tarifverhandlungen<br />
Ausdauer und Kraft und<br />
immer ein gutes Gelingen!<br />
Personalräteschulung der GEW<br />
Kreisverbände Aurich und Norden 2014<br />
Annette und<br />
Anette<br />
Zur „Herbstschulung“ der<br />
GEW Personalräte trafen sich<br />
die KollegInnen Anfang Dezember<br />
im Seminarhotel in Aurich.<br />
Die Schulung war wieder gut<br />
besucht. Enno Emken und Ralf<br />
Dittmer (Mitglieder der GEW-<br />
Fraktion im SBPR) waren in<br />
diesem Jahr unsere Referenten.<br />
GEW KV Aurich Vorankündigung:<br />
Personalräte- und<br />
Vertrauensleute-<br />
Konferenz<br />
am 10. März 2013, ab 10 Uhr<br />
im Seminarhotel der KVHS Aurich<br />
Sonja Heinemann, (Suchtberaterin<br />
für Beschäftigte im<br />
Schuldienst, regionale Suchtberaterin<br />
für die Landkreise<br />
Aurich, Leer, Emden, Wittmund),<br />
stellte am Vormittag die<br />
Dienstvereinbarung für den<br />
Umgang mit Suchtproblemen<br />
von Landesbediensteten im<br />
niedersächsischen Schuldienst<br />
und an Studienseminaren (DV<br />
Sucht) vor:<br />
Seit dem 11.12.2013 gibt es<br />
landesweit eine einheitliche<br />
„DV-Sucht“, die in Schulen<br />
und Seminaren gilt. Die<br />
Dezernentinnen und Dezernenten<br />
müssen jährlich auf diese DV<br />
hinweisen. Ein Fürsorgegespräch<br />
und/oder ein Klärungsgespräch<br />
sollten dem<br />
dann folgenden Stufenplangespräch<br />
vorausgegangen sein.<br />
Eine Beratung der oder des<br />
Vorgesetzten durch den/die<br />
Suchtberater/in sollte vor diesen<br />
Gesprächen erfolgen.<br />
Über insgesamt 5 Stufenplangespräche<br />
mit jeweils einem<br />
Rückmeldegespräch zieht<br />
sich der Ablauf hin, wobei die<br />
Personalvertretung der jeweiligen<br />
Ebene immer beteiligt ist.<br />
Auch das neue Altersteilzeitmodell<br />
war Thema der<br />
Schulung. Zum 1.8.2015 tritt<br />
dies neue Modell in Kraft, es ist<br />
etwas flexibler als das Modell<br />
von 2012, die Modalitäten<br />
liegen aber weiterhin bei 60%<br />
Arbeit – 70% Gehalt und 80%<br />
Anrechnung auf die Versorgung.<br />
Neu ist, dass eine altersabhängige<br />
Teilzeitbeschäftigung nicht<br />
erst mit 60. sondern bereits ab<br />
dem 55. Lebensjahr beantragt<br />
werden kann.<br />
Die Themen: Gesundheit,
13 LEUCHTTURM<br />
Beschäftigungsverbot von<br />
Schwangeren, Impfschutz vor<br />
und während der Schwangerschaft,<br />
Arbeitsbelastungen und<br />
Arbeitsentlastungen, das Zeiterfassungsprojekt,<br />
die Aktion<br />
,Beschwerdewelle der Grundschulen’,<br />
Dienstaltersstufen in<br />
Niedersachsen, Ganztagsschule<br />
und Fragen aus dem Schulalltag<br />
(Abordnungen, Dienstvereinbarungen,<br />
Schulfahrten, Inklusion<br />
…) füllten die Personalräteschulung,<br />
so dass alle PR-VertreterInnen<br />
mit vielen neuen Infos nach<br />
Hause fahren konnten.<br />
Wir bedanken uns nochmals<br />
auf diesem Wege bei Enno und<br />
Ralf für die angenehme Führung<br />
durch die Personalräteschulung<br />
2014. Im Rahmen der Personalräteschulung haben die Beauftragten für Suchtfragen und –prävention über<br />
die „Dienstvereinbarung Sucht“ und die damit zusammenhängenden sensiblen Fragen referiert.<br />
Personalräteschulung im KV Wittmund<br />
Wie in jedem Jahr führte der<br />
Kreisverband Wittmund<br />
der GEW wieder eine ganztägige<br />
Personalräteschulung für die<br />
Schulpersonalvertretungen an<br />
den Schulen im Landkreiss<br />
Wittmund durch. Die inhaltliche<br />
Vorbereitung und die<br />
Leitung der Schulungen lag wie<br />
üblich bei den Mitgliedern der<br />
GEW-Fraktion im SBPR. In<br />
diesem Jahr konnten wir wieder<br />
unseren Kollegen Enno Emken<br />
aus Esens als Referenten<br />
begrüßen.<br />
Eine angenehme Tagungsatmosphäre<br />
bot wieder das Hotel<br />
„Residenz“ in Wittmund.<br />
Themen der Schulung in diesem<br />
Jahr waren u.a.:<br />
· Änderungen rechtlicher Vorgaben<br />
· Arbeits- und Gesundheitsschutz<br />
· Arbeitsbelastungen und -<br />
entlastungen<br />
· Ganztag<br />
· Probleme aus dem Schulalltag<br />
Die Teilnehmer bekamen<br />
darüber hinaus einen umfänglichen<br />
Tagungsreader ausgehändigt,<br />
der von der GEW-Fraktion<br />
des SBPR erarbeitet und in<br />
Druck gegeben wurde.<br />
Enno Emken
LEUCHTTURM<br />
14<br />
THEMA: Altersteilzeit<br />
Antragfrist zum 1.8.2015 bis zum 31.3.2015 verlängert<br />
Altersteilzeit für Lehrkräfte ab 55 und im Blockmodell<br />
Der Niedersächsische Landtag<br />
hat am 15.12.2014 den von<br />
SPD und Grünen eingebrachten<br />
„Entwurf eines Gesetzes zur<br />
Altersteilzeit der Beamtinnen<br />
und Beamten an öffentlichen<br />
Schulen“ (Drucksache 17/1983)<br />
und die damit verbunden<br />
Änderung der Arbeitszeitverordnung<br />
für Lehrkräfte beschlossen.<br />
Das Gesetz tritt zum 2.2.2015 in<br />
Kraft und bringt entscheidende<br />
Verbesserungen für beamtete<br />
Lehrkräfte.<br />
In der Anhörung zum Entwurf<br />
vor dem Innenausschuss des<br />
Landtages wurde deutlich, dass<br />
alle an Lösungen und Verbesserungen<br />
interessierten Gewerkschaften<br />
und Verbände sich<br />
positiv zum Entwurf äußerten.<br />
Neben der GEW und dem DGB<br />
war dies auch der Beamtenbund.<br />
Dass der Philologenverband<br />
seine Zustimmung nur verklausuliert<br />
signalisierte, war noch zu<br />
erwarten gewesen. Die Ablehnung<br />
der Berufsschullehrerverbände<br />
und des VBE erstaunte<br />
hingegen nicht nur die Abgeordneten!<br />
Altersteilzeit für<br />
Beamtinnen und Beamte<br />
im Blockmodell ermöglicht<br />
Die Altersteilzeitregelungen werden<br />
ab 1.8.2015 so verbessert,<br />
dass Altersteilzeit (ATZ) bereits<br />
ab dem 55. Lebensjahr in<br />
Anspruch genommen werden<br />
kann. Auch wird wieder die<br />
Möglichkeit eröffnet, die Altersteilzeit<br />
im sog. Blockmodell zu<br />
beantragen. Damit eine durchgängige<br />
Beschäftigung im Umfang<br />
von 60 % der Arbeitszeit<br />
gegeben ist, wird Altersteilzeit<br />
im Blockmodell nur für eine<br />
Laufzeit von 5, 10, 15 oder 20<br />
Schulhalbjahren bewilligt werden.<br />
Nachfolgend die wichtigsten<br />
Eckpunkte:<br />
• Altersteilzeit kann Lehrkräften<br />
im Beamtenverhältnis<br />
bereits ab Vollendung des 55.<br />
Lebensjahres bewilligt werden.<br />
• ATZ wird bei Lehrkräften<br />
jeweils zum 1.<br />
Februar und zum 1.<br />
August bewilligt.<br />
• ATZ muss sich bis<br />
zum Beginn des Ruhestandes<br />
erstrecken, so dass<br />
ein Altersurlaub nach §<br />
64 Abs. 1 Nr. 2 NBG im<br />
Anschluss an die ATZ nicht<br />
in Betracht kommt.<br />
• Ein Ausgleich des Arbeitszeitkontos<br />
ist nur in der Arbeits-,<br />
nicht aber in der Freistellungsphase<br />
möglich.<br />
• Im Rahmen der ATZ ist nur<br />
eine Reduzierung der Arbeitszeit<br />
auf 60 % der in den drei<br />
Jahren zuvor durchschnittlich<br />
geleisteten Arbeitszeit möglich,<br />
aber: wenn die zuletzt<br />
festgesetzte Unterrichtsstundenzahl<br />
vor Beginn der ATZ<br />
geringer ist als die durchschnittliche<br />
Unterrichtsstundenzahl<br />
gilt diese – geringere<br />
– Unterrichtsstundenzahl für<br />
die Berechnung der Arbeitszeit<br />
in der ATZ<br />
• Ab dem 1. August 2015 wird<br />
die ATZ mit einer gleichmäßigen<br />
Arbeitszeit von 60 v. H.<br />
der maßgeblichen Arbeitszeit<br />
bewilligt.<br />
• Auf Antrag kann ATZ<br />
weiterhin in Form einer<br />
„ungleichen Verteilung der<br />
Arbeitszeit“ bewilligt werden.<br />
Die ATZ gliedert sich in zwei<br />
gleich lange Abschnitte. In<br />
dem ersten Abschnitt beträgt<br />
die Arbeitszeit 80 %, im<br />
zweiten Abschnitt 40 % der<br />
für die ATZ maßgeblichen<br />
Arbeitszeit. Auf Antrag kann<br />
sich die ATZ auch in drei<br />
Abschnitte gliedern. Dann<br />
beträgt die Arbeitszeit im<br />
ersten Abschnitt 80 %, im<br />
zweiten 60% und im dritten<br />
40 %. Der zweite Abschnitt<br />
darf längstens drei Schulhalbjahre<br />
dauern, der erste und der<br />
dritte Abschnitt müssen gleich<br />
lang sein.<br />
• Auf Antrag kann ATZ auch<br />
im Blockmodell bewilligt<br />
werden. Die ATZ im Blockmodell<br />
gliedert sich in zwei<br />
Abschnitte: Arbeitsphase 60<br />
% (mit 100 % Dienstleistung)<br />
und die Freistellungsphase (0<br />
% Dienstleistung) mit 40 %<br />
der Gesamtlaufzeit. Die Gesamtlaufzeit<br />
sieht einen Zeitraum<br />
von 5, 10, 15 oder 20<br />
Schulhalbjahren vor.<br />
• Während der ATZ erhalten<br />
Lehrkräfte keine Altersermäßigung.<br />
• Einen Rechtsanspruch auf<br />
ATZ gibt es nicht. ATZ kann<br />
nicht bewilligt werden, wenn<br />
dringende dienstliche Belange<br />
entgegenstehen.<br />
• Neben der anteiligen Besoldung<br />
wird ein nicht ruhegehaltsfähiger<br />
Altersteilzeitzuschlag<br />
gezahlt, so dass 70 %<br />
der zuvor erhaltenen Nettobesoldung<br />
gezahlt werden.<br />
• Die Zeiten der ATZ sind zu<br />
80 % ruhegehaltsfähig.<br />
Wer Altersteilzeit im Blockmodell<br />
für sich erwägt, sollte sich so<br />
früh wie möglich informieren.<br />
Die GEW berät<br />
iwww.gew-nds.de/thema
15 LEUCHTTURM<br />
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft<br />
Arbeitskreis Ostfriesische Hochschultage in Zusammenarbeit mit<br />
Ostfriesische Hochschultage 2015<br />
Sachdienliches<br />
Schule in der Welt - Welt in der Schule<br />
Inhaltliche Gestaltung: Bielefeld School of Education<br />
am 12. und 13. März 2015 im Europahaus in Aurich<br />
Der Veranstaltungsbesuch ist für GEW-<br />
Mitglieder kostenlos. Nichtmitglieder bezahlen<br />
15 Euro, die vom Fortbildungsbudget der<br />
Schulen getragen werden können. In diesem<br />
Kostenbeitrag ist eine Stärkung mit Kaffee / Tee<br />
und Brötchen enthalten.<br />
Veranstaltungsort ist das Europahaus,<br />
Von-Iheringstraße 33 in Aurich.<br />
Parkplätze gibt es neben der<br />
ehemaligen „Kaufhalle“, die Einfahrt<br />
ist gegenüber dem Zugang am<br />
Breiten Weg.<br />
„Die Ostfriesischen Hochschultage 2015 stehen<br />
unter dem Motto „Welt in der Schule – Schule<br />
in der Welt“. Schule muss mehr denn je<br />
vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen<br />
Rechnung tragen. Diese spiegeln sich wider in<br />
Schlagwörtern wie Inklusion, Schulentwicklung,<br />
Teamarbeit oder Ganztag. Gleichzeitig hat eine<br />
sich im permanenten Wandel befindliche Welt<br />
erheblichen Einfluss auf die Gestaltung von Schule<br />
und Unterricht, beispielsweise durch veränderte<br />
Lebenswelten oder durch die Heterogenität der<br />
Lernenden.“<br />
Renate Schüssler, Bielefeld School of Education<br />
Leitung der Veranstaltung: Jürgen Richter<br />
Vorbereitung durch den Arbeitskreis Ostfriesische<br />
Hochschultage:<br />
Günter Beyer, Ahmed Chaker, Dieter Fröhlich,<br />
Gudrun Jakobs, Franziska Petzold, Jürgen Richter,<br />
Hasso Rosenthal, Hans-Peter Schröder, Detlef<br />
Spindler, Gudrun Stüber, Ubbo Voss, Alexander<br />
Wiebel, Ronald Wilts.<br />
Anmeldung bitte bis Samstag, den 28.2.2015<br />
per Email:<br />
per Post:<br />
Hickel@ostfriesischelandschaft.de<br />
Ostfriesische Landschaft RPZ<br />
z.H. Herrn Hickel<br />
Georgswall 1-3, 26603 Aurich<br />
Name:<br />
Adresse:<br />
Email:<br />
Gewünschte Workshops: A___ und B___<br />
Donnerstag, 12. März, 19.30 – 22.00 h<br />
Eröffnungsveranstaltung<br />
Stefan Störmer<br />
(Vorsitzender der GEW Weser-Ems)<br />
Prof. Dr. Eiko Jürgens<br />
Ungleichheit in der Schule: Brennpunkte und Perspektiven<br />
des Umgangs mit Heterogenität<br />
Laura Pooth<br />
(Stv. Landesvorsitzende der GEW )<br />
Vorfahrt für Bildung<br />
Musikbeiträge der „Teacher´s“
LEUCHTTURM<br />
16<br />
Programm am Freitag, 13. März 2015<br />
8.30 – 9.15 Uhr Parallele Einführungsvorträge<br />
1 ) Prof. Dr. Eiko Jürgens:<br />
Ungleichheit in der Schule: Brennpunkte und Perspektiven des Umgangs mit Heterogenität (Stufen<br />
übergreifend)<br />
Gesellschaftspolitisch und bildungsethisch macht der Heterogenitätsbegriff Karriere als Idee vom Chancenreichtum, der in »der«<br />
Vielfalt verborgen liegt und auf fruchtbare Nutzung hofft. Doch Heterogenität ist ein vieldeutiger, komplexer und zugleich<br />
überladener Begriff ohne klare Konturen. Kann er für die Schule überhaupt praxistauglich gemacht werden?<br />
Moderation: Klaus-Dieter Zoschke<br />
2 ) Prof. Dr. Oliver Böhm-Kasper<br />
Multiprofessionelle Kooperation in der Schule vor dem Hintergrund von Ganztag, Schulentwicklung, Inklusion<br />
(Stufen übergreifend)<br />
Das wissenschaftliche und praktische Interesse am Aufbau und der Förderung multiprofessioneller Kooperation ist in den letzten<br />
Jahren stark angestiegenDie aktuelle erziehungswissenschaftliche Forschung weist in diesem Zusammenhang auf Chancen aber auch<br />
auf Probleme der multiprofessionellen Kooperation in Schulen hin. Beide Aspekte werden im Vortrag thematisiert und die<br />
Gelingensbedingungen multiprofessioneller Kooperation herausgearbeitet.<br />
Moderation: Klaus Kluth<br />
Workshops am Freitag, 13. März 2015<br />
Zeitblock A: 9.30 bis 11.00 Uhr<br />
A1 Birte Letmathe-Henkel:<br />
Präventive Sprachförderung mit Gesellschaftsspielen in der Grundschule<br />
Im Workshop wird am Beispiel von ausgesuchten Gesellschaftsspielen die Möglichkeit der präventiven Sprachförderung im inklusiven<br />
Grundschulunterricht betrachtet. Lassen Sie sich anregen, Gesellschaftsspiele als motivierende Fördermaterialien in Ihre Praxis zu<br />
integrieren und nehmen Sie konkrete Umsetzungsideen, die in einem Handout dokumentiert sind, mit.<br />
Moderation: Gerda Mülder<br />
A2 Theo Stiller<br />
SchülerInnen zwischen den Welten Schule und Familie (Grundschule)<br />
In diesem Workshop können Sie Kindern aus dritten Grundschulklassen zuhören, wie sie sich über die Zusammenarbeit zwischen ihren<br />
Eltern und ihren Lehrkräften unterhalten. Damit haben Sie die Möglichkeit für einen Perspektivenwechsel. Dabei werden Sie auch die<br />
generationale Perspektive verändern. Was sehen wir von dem, was die Kinder sehen?<br />
Dem folgt ein gemeinsames Gespräch über kindliche Perspektiven und Schlussfolgerungen für uns Erwachsene. Eventuell bilden wir<br />
abschließend kleinere Gesprächskreise zu einzelnen Themen. Ergebnisse sammeln wir an den Pinnwänden.<br />
Moderation: Detlef Spindler<br />
A3 Dr. Claas Wegner<br />
Differenzierung mal anders: welche Möglichkeiten gibt es, begabte SchülerInnen im naturwissenschaftlichen<br />
Unterricht zu fördern? (Sek I, II)<br />
Im Workshop werden in Simulationen Konfliktfelder zwischen begabten SchülerInnen, deren Eltern und ihren Lehrkräften diskutiert<br />
und es wird versucht Lösungen zu finden. Die verschiedenen Chancen und Möglichkeiten der Förderprinzipien werden ebenfalls<br />
präsentiert und gegeneinander abgegrenzt.<br />
Moderation: Peter Hürter<br />
A4 Dr. Andrea Menze-Sonneck:<br />
Eine akrobatische Weltreise als Klassengestaltung erarbeiten (Grundschule, Sek I)<br />
Im Workshop wird am Beispiel einer akrobatischen Weltreise aufgezeigt, wie eine solche Klassenaufführung im koedukativen<br />
Sportunterricht erarbeitet werden kann. Der Schwerpunkt der Reflexion liegt hierbei auf der Frage, wie eine geschlechtergerechte<br />
Umsetzung des Vorhabens gelingen kann.<br />
Moderation: Tom Bohmfalk<br />
A5 Dr. Gabriele Klewin & Dr. Michaele Gewecke<br />
Das Oberstufen-Kolleg Bielefeld: Einblicke in die Lernkultur einer Versuchsschule (Stufen übergreifendI)<br />
Das Oberstufen-Kolleg legt schon seit längerem einen Schwerpunkt auf den produktiven Umgang mit Heterogenität. Im Workshop wird<br />
auf drei ausgewählte Unterrichtsangebote eingegangen: Brückenkurse in der Eingangsphase der Sekundarstufe II, Profile in der<br />
Qualifikationsphase und die Projektarbeit zum Ende eines Schulhalbjahres.<br />
Moderation: Günter Beyer
17 LEUCHTTURM<br />
A6 Dr. Renate Schüssler:<br />
(K)ein Thema? Menschenrechte in der Schule (Stufen übergreifend)<br />
Menschenrechte haben Schule Relevanz, als Unterrichtsthema oder Grundlage für einen fairen Umgang miteinander. Im Workshop<br />
haben Sie die Möglichkeit, sich das Thema Menschenrechte und Menschenrechtsbildung mittels praktischer Übungen zu erschließen und<br />
diese hinsichtlich ihres Potentials für die Schule kritisch zu reflektieren.<br />
Moderation: Karin Gerz<br />
Zeitblock B: 11.45 – 13.15 Uhr<br />
B1 Prof. Dr. Andrea Peter-Koop:<br />
Eine Welt der Zahl für alle: Inklusion im Mathematikunterricht der Grundschule<br />
Ziel des Workshops ist es exemplarisch zu zeigen, wie Mathematikunterricht in inklusiven Settings gestaltet werden kann, damit<br />
individuelle Lernprozesse gefördert und angemessen unterstützt werden.<br />
Moderation: Gabi Kleen<br />
B2 Volker Schwier & Christoph Bulmahn<br />
Lebenswelten, Weltbilder: SchülerInnenvorstellungen im sozialwissenschaftlichen Unterricht<br />
(Stufen übergreifend)<br />
Um einzelne Weltbilder für den Unterricht fruchtbar zu machen, müssen sie aufgedeckt und als veränderbar erkannt werden. In dem<br />
Workshop sollen Möglichkeiten zur Erhebung gesellschaftsbezogener Lernvoraussetzungen beispielhaft vorgestellt und von den<br />
Teilnehmenden nutzbringend ausgewertet werden.<br />
Moderation: Alexander Wiebel<br />
B3 Saskia Schicht:<br />
„Jeder ist ein Tänzer!“ – Tanz in der Schule (Stufen übergreifend)<br />
Der Workshop spürt der Frage nach, welche Formen von Tanz in der Schule stattfinden können. In praktischen Übungen und<br />
theoretischen Zugängen können Sie sich mit den Prinzipien des Tanzes vertraut machen und gemeinsam überlegen, welche Möglichkeiten<br />
es für Tanz in Ihrer Schule gibt – auf einer Bühne und ganz ohne Aufführung. Bringen Sie bitte für diesen Workshop warme Socken mit.<br />
Tanz-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.<br />
Moderation: Gudrun Stüber<br />
B4 Anke Schöning, Katharina Herbst & Kevin Loock:<br />
Diagnose und Förderung im Deutschunterricht (Sek I, II)<br />
In diesem Workshop wird das Konzept ReLv (Rechtschreiben erforschen, Lesen verstehen) und dessen Einsatz in der Sekundarstufe I des<br />
Bielefelder Max-Planck-Gymnasiums vorgestellt und diskutiert. Anhand von Praxisübungen können Sie grundlegende Strategien des<br />
Konzepts kennen lernen und diese im Hinblick auf ihre Implementierung im Unterricht sowie ihre Nachhaltigkeit reflektieren.<br />
Moderation: Petra Schweitzer<br />
B5 Susanne Hanhart:<br />
Mit Vielfalt umgehen lernen: Migration als Unterrichtsthema (Grundschule, Förderschule)<br />
In diesem Workshop wird das Interkulturelle Lernen in der Grundschule und damit das Lernen an und über Kultur kritisch in den Blick<br />
genommen. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir darüber, welche Möglichkeiten das Unterrichtsthema Migration bietet, um einseitige<br />
kulturelle Zuschreibungen aufzulösen und ein besseres Verständnis über gesellschaftliche Pluralität zu vermitteln.<br />
Moderation: Dr. Birgitta Kasper-Heuermann<br />
B6 Dr. Birgit Holler-Nowitzki<br />
Resilienz: Was Kinder stärkt (Elementar, Grundschule, Sek I, Förderschule)<br />
Im Workshop wird die Bedeutung resilienter Schutzfaktoren, insbesondere sozial-emotionaler Kompetenzen wie Kontaktfähigkeit,<br />
Selbstbehauptung, Stressregulierung und Explorationsfreude bei der Bewältigung belastender Lebensumstände herausgearbeitet und eine<br />
an den Stärken und Ressourcen der Kinder orientierte Förderperspektive vorgestellt und ansatzweise erprobt.<br />
Moderation: Dieter Fröhlich<br />
B7 Dr. Claas Wegner & Mario Schmiedebach<br />
Fotosynthese-Workshop: Auf den Spuren der Energie des Lebens – The Engine of Life (Sek I, II)<br />
Der im Rahmen des Projekts “Biologie-hautnah? der Biologiedidaktik an der Universität Bielefeld entwickelte Schülerworkshop<br />
ermöglicht SchülerInnen die problemzentrierte und praxisorientierte Auseinandersetzung mit dem Themengebiet der Fotosynthese.<br />
Neben der Vorstellung des Projekts und seiner Evaluationsergebnisse werden im Workshop ausgewählte Experimente präsentiert und<br />
erläutert.<br />
Moderation: Johannes Ackermann
LEUCHTTURM<br />
18<br />
URL: http://bildungsklick.de/a/92979/voraussetzung-fuer-inklusive-paedagogik-verzicht-auf-ziffernnoten/Artikel<br />
Voraussetzung für inklusive Pädagogik:<br />
Verzicht auf Ziffernnoten<br />
Der hessische Schulversuch „Begabungsgerechte Schule“<br />
Brigitte<br />
Schumann<br />
Zur Person<br />
Dr. Brigitte<br />
Schumann war<br />
16 Jahre Lehrerin<br />
an einem<br />
Gymnasium,<br />
zehn Jahre Bildungspolitikerin<br />
und Mitglied<br />
des Landtags<br />
von NRW.<br />
Der Titel ihrer<br />
Dissertation<br />
lautete: „Ich<br />
schäme mich ja<br />
so!“ - Die Sonderschule<br />
für<br />
Lernbehinderte<br />
als „Schonraumfalle“<br />
(Bad<br />
Heilbrunn<br />
2007). Derzeit<br />
ist Brigitte<br />
Schumann als<br />
Bildungsjournalistin<br />
tätig.<br />
Zur Veröffentlichung<br />
freigegeben<br />
-<br />
bildungsklick.de<br />
15.01.2015<br />
Im Rahmen des hessischen<br />
Schulversuchs „Begabungsgerechte<br />
Schule“ (2009-2013) sind<br />
an vier Grundschulen inklusionsorientierte<br />
Entwicklungsprozesse<br />
von einer internen<br />
wissenschaftlichen Begleitung<br />
und einer externen Evaluation<br />
unterstützt, beobachtet, dokumentiert<br />
und ausgewertet worden.<br />
Aus den vorliegenden<br />
Berichten lassen sich relevante<br />
Hinweise für die inklusive<br />
Schul- und Unterrichtsentwicklung<br />
entnehmen. Dabei kommt<br />
insbesondere der Leistungsbewertung<br />
eine zentrale Bedeutung<br />
zu.<br />
Zu den Besonderheiten<br />
des Schulversuchs<br />
Eigentliche Auslöser für die<br />
politische Initiative zu dem<br />
Schulversuch durch den Landkreis<br />
Offenbach als Schulträger<br />
waren der marode bauliche<br />
Zustand einer Schule für<br />
Lernhilfe und die Notwendigkeit,<br />
das Gebäude aufzugeben<br />
und die Schule auslaufen zu<br />
lassen. Konzeptionell orientiert<br />
sich der Schulversuch jedoch an<br />
dem Leitbild der Inklusion und<br />
den Anforderungen der UN-<br />
Behindertenrechtskonvention<br />
(UN-BRK).<br />
Der Schulversuch hebt sich<br />
deutlich von der derzeit vorherrschenden<br />
bildungspolitischen<br />
Praxis ab, Inklusion auf eine<br />
schulorganisatorische Aufgabe<br />
zu reduzieren und in das<br />
unhinterfragte selektive Schulsystem<br />
zu implementieren. Mit<br />
dem Verzicht auf die herkömmliche<br />
formale Feststellung eines<br />
sonderpädagogischen Förderbedarfs<br />
im Förderschwerpunkt<br />
Lernen, einhergehend mit einer<br />
Grundausstattung der Schulen<br />
mit Sonderpädagogen und Sozialpädagogen,<br />
und dem Verzicht<br />
auf traditionelle Ziffernnoten<br />
und Klassenwiederholungen<br />
sind Alternativen in der Organisation<br />
der sonderpädagogischen<br />
Förderung und in der Leistungsbewertung<br />
angewendet und<br />
erprobt worden. Diese sind in<br />
dem systemischen Verständnis<br />
von Inklusion auf der Basis von<br />
Diskriminierungsfreiheit und<br />
Chancengleichheit begründet.<br />
Die im Sommer 2014 vorgelegten<br />
wissenschaftlichen Berichte<br />
sind im Internet<br />
(Evaluation des Schulversuchs<br />
und Bericht über die wesentlichen<br />
Ergebnisse der wissenschaftlichen<br />
Begleitung) zugänglich.<br />
Inklusion - mehr als eine<br />
schulorganisatorische<br />
Maßnahme<br />
Dieses Postulat hebt der<br />
Bericht der wissenschaftlichen<br />
Begleitung zur „Beratung und<br />
Unterstützung der beteiligten<br />
Lehrkräfte sowie Dokumentation<br />
der Lern-und Leistungsfortschritte<br />
der Schülerinnen und<br />
Schüler“ unter der Leitung von<br />
Prof. Kornmann nachdrücklich<br />
hervor. Demnach sind schulorganisatorische<br />
Maßnahmen und<br />
administrative Regelungen zur<br />
Nicht-Aussonderung von Kindern<br />
zwar wichtige formale<br />
Kriterien, die als Voraussetzung<br />
für Inklusion erfüllt sein<br />
müssen. Damit jedoch gewährleistet<br />
ist, dass alle Kinder des<br />
Einzugsbereichs einer Schule<br />
sich achten, einander helfen,<br />
Lernfreude entwickeln, sich in<br />
„lernergiebiger Weise“ betätigen,<br />
„entwicklungsförderliche Erfahrungen“<br />
machen, „selbst bei<br />
unterschiedlichen Voraussetzungen<br />
tragfähige Zugänge zu den<br />
gemeinsamen Lerninhalten“ erhalten,<br />
ihr individuelles Potential<br />
ausschöpfen und sich als<br />
„individuell geschätztes, wichtiges<br />
Mitglied der Lerngemeinschaft“<br />
erleben, muss die<br />
pädagogische Arbeit eine inklusive<br />
Qualität entwickeln.<br />
Anhand von Einzelfallstudien<br />
zeigt der Bericht, dass bei<br />
Kindern, die sich trotz schwerwiegender<br />
Lernprobleme und<br />
Verhaltensauffälligkeiten „erwartungswidrig“<br />
positiv entwickelten,<br />
die verantwortlichen Lehrkräfte<br />
„keinerlei Zweifel daran<br />
aufkommen ließen, dass diese<br />
Kinder in dieser Schule und in<br />
dieser Klasse an dem richtigen<br />
Platz seien, auch wenn sie<br />
zeitweise die üblichen Regeln<br />
nicht einhalten mussten oder<br />
außerhalb des Unterrichts betreut<br />
wurden. Zielsetzung dieser<br />
besonderen Maßnahmen war es<br />
stets, ihnen einen sicheren Platz<br />
in der Lerngemeinschaft einzuräumen“.<br />
Insgesamt belegt der Bericht<br />
auf der Basis dokumentierter<br />
erfolgreicher Entwicklungsverläufe<br />
und der in Unterrichtsbeobachtungen<br />
gesammelten positiven<br />
Beispiele „inklusiv wirkender<br />
Aktivitäten zur Gestaltung<br />
des Schullebens und des<br />
Unterrichts im Schulversuch“,<br />
dass inklusive pädagogische<br />
Arbeit an die Entwicklung und<br />
Pflege einer Lern- und Leistungskultur<br />
gebunden ist, „die<br />
von Hilfsbereitschaft, Toleranz<br />
und gegenseitiger Wertschätzung<br />
getragen ist und die den immer<br />
wieder aufkommenden Tenden-
19 LEUCHTTURM<br />
zen von Konkurrenzorientierung<br />
beim schulischen Lernen<br />
Einhalt gebietet“.<br />
Verzicht auf Ziffernoten –<br />
eine unabdingbare<br />
Voraussetzung für den<br />
Erfolg inklusiven<br />
Unterrichts<br />
„Entscheidend für die glaubwürdige<br />
und erfolgreiche praktische<br />
Umsetzung einer solchen<br />
inklusiven Kultur ist der<br />
bewusste Verzicht auf Ziffernnoten.“<br />
Diese Kernthese stand im<br />
Zentrum der im Schulversuch<br />
erprobten Unterrichtsentwicklung.<br />
Die wissenschaftliche Begleitung<br />
konnte davon ausgehen,<br />
dass unabhängig von der<br />
Inklusionsdebatte seit langem<br />
gesicherte erziehungswissenschaftliche<br />
Erkenntnisse darüber<br />
vorliegen, dass Ziffernnoten<br />
keine präzisen Aussagen über<br />
den Leistungsstand machen,<br />
zudem intransparent bezüglich<br />
der Qualität des Unterrichts, der<br />
Leistungsanforderungen und -<br />
erwartungen sind und keinesfalls<br />
das Kriterium der Objektivität<br />
erfüllen. Dagegen sind ihre<br />
zahlreichen negativen Effekte<br />
wie konkurrenzorientiertes Wettbewerbsverhalten,<br />
Leistungsdruck,<br />
angepasstes Fehlervermeidungsverhalten,<br />
Entmutigung,<br />
Beschämung, Diskriminierung,<br />
Schulangst und Schulabsentismus<br />
bei Schülerinnen und<br />
Schülern nachgewiesen. In heterogenitätsbewussten,<br />
inklusiven<br />
Lernprozessen wäre es erst recht<br />
pädagogisch widersinnig, die<br />
Leistungen der unterschiedlichen<br />
Kinder im gemeinsamen<br />
Lernen miteinander zu vergleichen<br />
und in eine Rangfolge zu<br />
bringen.<br />
Vor diesem Hintergrund<br />
verfolgte die wissenschaftliche<br />
Begleitung im Schulversuch das<br />
Ziel, die Lehrkräfte vertraut zu<br />
machen mit alternativen Formen<br />
der Dokumentation von Lern-,<br />
Arbeits-, Sozialverhalten und<br />
schulischen Leistungen. Über<br />
eigene praktische Erfahrungen<br />
und pädagogische Reflexion<br />
sollten die Lehrkräfte außerdem<br />
befähigt werden, auch gegenüber<br />
Eltern argumentativ den Verzicht<br />
auf Noten zu begründen.<br />
Ein gezieltes Fortbildungsprogramm<br />
unterstützte diese Lernprozesse.<br />
In Lehrerteams wurden als<br />
Alterative zu den Ziffernnoten<br />
an allen beteiligten Grundschulen<br />
in den vier Jahrgängen für<br />
Deutsch und Mathematik - auch<br />
unter Anleitung - Kompetenzraster<br />
entwickelt. Sie wurden so<br />
angelegt, dass sie die Ergebnisse<br />
erfolgreicher Lerntätigkeiten zu<br />
bestimmten Zeitpunkten abbilden.<br />
Dafür wurden in Ich-Form<br />
positiv formulierte Aussagen zu<br />
curricularen Kompetenzen, „die<br />
ein Kind entweder bereits<br />
erworben hat oder die es noch in<br />
seinen späteren Lernprozessen<br />
erwerben sollte“, formuliert. Die<br />
Lehrkräfte notierten dazu ihre<br />
Einschätzungen und Anmerkungen.<br />
In Ergänzung zu den<br />
Kompetenzrastern wurde zur<br />
Dokumentation und Reflexion<br />
von Lernprozessen und Arbeitsergebnissen<br />
auch die Arbeit mit<br />
Portefolios im Unterricht eingesetzt.<br />
Die Auswahl dieser<br />
Instrumente entsprach der Intention,<br />
in der Auseinandersetzung<br />
mit der Beurteilung des erreichten<br />
Lernstands das Kind als<br />
Subjekt seines Lernens ernst zu<br />
nehmen, es an der Einschätzung<br />
seiner Kompetenzen zu beteiligen<br />
und Lernende und Lehrende<br />
zu Kooperationspartnern zu<br />
machen.<br />
Die im Schulversuch angeregte<br />
und gemeinsam entwickelte<br />
didaktische Konzeption stand in<br />
einem engen, sinngebenden<br />
Zusammenhang mit der neuen<br />
Form der Leistungsbewertung.<br />
Sie ging von den Vorteilen<br />
eigenaktiven Lernens in kooperativen<br />
und offenen Lernformen<br />
aus und berücksichtigte Lehrwerke,<br />
die für differenzierende und<br />
individualisierende Unterrichtsarbeit<br />
besonders geeignet sind.<br />
Auch dazu gab es unterstützende<br />
Anleitung und Fortbildung Bei<br />
Kindern mit auffälligen Problemen<br />
beim Erwerb schriftsprachlicher<br />
und mathematischer Kompetenzen<br />
wurden informelle<br />
förderdiagnostische Tests eingesetzt,<br />
um Erkenntnisse für die<br />
Förderplanung zu gewinnen.<br />
Dabei wurde bewusst auf das<br />
mehrstufige, testdiagnostisch gestützte<br />
Trainingsprogramm „Response<br />
to Intervention“ (RTI)<br />
zur Identifizierung und Förderung<br />
von Kindern mit Leistungsschwächen<br />
verzichtet, das<br />
in dem Rügener Inklusionsmodell<br />
(RIM) angewendet wird.<br />
Aus Sicht der wissenschaftlichen<br />
Begleitung verhält es sich<br />
ambivalent zu dem Gedanken<br />
der Inklusion.<br />
Effekte des gemeinsamen<br />
Lernens auf<br />
Schülerleistung und<br />
soziale Integration<br />
Der Bericht der internen<br />
Begleitforschung<br />
stellt<br />
heraus, dass<br />
mit den Impulsen<br />
der<br />
neuen Lernund<br />
Leistungskultur<br />
Kinder<br />
im unteren<br />
Leistungsbereich<br />
deutliche<br />
Lernerfolge erzielen<br />
konnten. Ihr Urteil wird<br />
gestützt durch Befunde der<br />
externen Evaluation unter der<br />
Leitung von Prof. Katzenbach.<br />
Für die Untersuchung der<br />
Leistungsentwicklung wurde<br />
eine Kontrollgruppe aus dem<br />
Einschulungsjahrgang vor Beginn<br />
des Schulversuchs gebildet.<br />
Untersucht und verglichen wurden<br />
die Lernbereiche Mathematik,<br />
Schreiben und Lesen. Zu den<br />
Schulleistungen von Schülerinnen<br />
und Schüler mit ungünstigen<br />
Lernvoraussetzungen stellt<br />
der externe Evaluationsbericht<br />
fest, dass am Ende des<br />
vierjährigen Schulversuchs „keine<br />
statistisch signifikanten Differenzen<br />
des Jahrgangs 2009<br />
gegenüber dem Kontrolljahrgang<br />
trotz einer deutlich<br />
schlechteren Ausgangslage“ zu<br />
Dr. Brigitte<br />
Schumann<br />
ifenici@aol.com
LEUCHTTURM<br />
finden sind. „Offensichtlich<br />
gelingt es den Schulen in hohem<br />
Maße, unterschiedliche Lernausganglagen<br />
zum Schuleintritt<br />
auszugleichen.“<br />
Über die allgemeine Leistungsentwicklung<br />
lautet das<br />
Urteil: „Resümierend kann festgehalten<br />
werden, dass sich der<br />
Befund vieler Begleitforschungen<br />
auch hier bestätigt: Weder<br />
finden wir nennenswerte Leistungseinbußen<br />
noch spektakuläre<br />
Leistungszuwächse.“<br />
Auch bezogen auf die soziale<br />
Integration der Schülerinnen<br />
und Schüler mit Leistungsschwächen<br />
sind zwischen den Jahrgängen<br />
des Schulversuchs und den<br />
Kontrolljahrgängen laut Bericht<br />
keine auffälligen Unterschiede<br />
zu verzeichnen. Der Evaluationsbericht<br />
verweist jedoch auf<br />
sehr unterschiedliche Ergebnisse<br />
nach Schulen und innerhalb der<br />
Schulen des Schulversuchs und<br />
interpretiert dies als Hinweis,<br />
dass die Lehrkräfte noch<br />
unterschiedlich erfolgreich sind<br />
bei der Erfüllung der Aufgabe,<br />
die soziale Integration aller<br />
Schülerinnen und Schüler in<br />
ihren Lerngruppen zu gewährleisten.<br />
Dabei deutet sich der<br />
empirisch allerdings schwach<br />
gesicherte Befund an, dass in<br />
Lerngruppen mit einer höheren<br />
durchschnittlichen Schulleistung<br />
der Zusammenhang zwischen<br />
Schulleistung und Beliebtheit<br />
der Schüler tendenziell dichter<br />
ist.<br />
Die Akzeptanz der<br />
„notenfreien“<br />
Grundschule bei Lehrern<br />
und Eltern im<br />
Schulversuch<br />
Schon vor Schulversuchsbeginn<br />
war ein ausgeprägtes<br />
Problembewusstsein bezüglich<br />
der Sinnhaftigkeit von Ziffernnoten<br />
bei den meisten Grundschullehrkräften<br />
vorhanden. Die<br />
Arbeit mit den selbst entwickelten<br />
Kompetenzrastern wurde als<br />
sehr positiv und bereichernd<br />
empfunden. Es wurde erkannt,<br />
dass damit nicht nur die<br />
erreichte Schülerleistung präziser<br />
erfasst und bewertet werden<br />
kann, sondern zugleich diagnostische<br />
und unterrichtspraktische<br />
Zwecke erfüllt werden, weil über<br />
den erreichten Leistungsstand<br />
hinaus auch Aussagen über noch<br />
zu entwickelnde Kompetenzen<br />
gemacht werden.<br />
40 Prozent der Eltern<br />
verhielten sich hingegen skeptisch<br />
bis ablehnend zu der<br />
Umstellung. Die .negative Einschätzung<br />
war in der Regel<br />
verbunden mit den antizipierten<br />
Übergängen zu den weiterführenden<br />
Schulen. Insbesondere<br />
bestand Besorgnis, dass das<br />
Gymnasium die Schülerinnen<br />
und Schüler aus dem Schulversuch<br />
ablehnen könnte. Weiterhin<br />
wurde vermutet, dass die<br />
Kinder beim Schulwechsel<br />
Schwierigkeiten haben könnten,<br />
weil ihnen die „richtige“<br />
Leistungsorientierung fehle. Es<br />
wurden Zweifel geäußert, ob mit<br />
der Unterrichtskonzeption des<br />
Schulversuchs die Kinder den<br />
Anforderungen der aufnehmenden<br />
Schulen gerecht werden<br />
könnten. Dass in der Abschlussbefragung<br />
nur 62 Prozent<br />
der resümierenden Frage zustimmten,<br />
ob in Zukunft an<br />
allen Grundschulen so gearbeitet<br />
werden solle wie im Schulversuch,<br />
steht in einem hochsignifikanten<br />
Zusammenhang mit der<br />
Ablehnung der neuen Arbeitsweise<br />
und Leistungsbewertung.<br />
Fazit<br />
Die Übergangsproblematik<br />
greift tief in die Inklusionsentwicklung<br />
der Grundschulen ein.<br />
Sie entsteht aus der strukturellen<br />
Besonderheit des deutschen<br />
Schulsystems mit seiner im<br />
internationalen Vergleich frühen<br />
Selektion und kann deshalb<br />
nicht allein mit pädagogischen<br />
Mitteln gelöst werden. Der<br />
Schulversuch identifiziert - „eingelagert<br />
in die Struktur des<br />
deutschen Schulsystems“ - die<br />
Selektion als zentrale Barriere<br />
für inklusive Pädagogik.<br />
Der Schulversuch bestätigt<br />
den für die Entwicklung einer<br />
inklusiven Pädagogik unabding-<br />
20<br />
baren Verzicht auf vergleichende<br />
Ziffernnoten und die pädagogische<br />
Brauchbarkeit von Kompetenzrastern,<br />
die auf einem<br />
heterogenitätsbewussten didaktischen<br />
Unterrichtskonzept mit<br />
Individualisierung und Differenzierung<br />
aufsetzen. Die Schulen<br />
im Schulversuch werden ausdrücklich<br />
darin ermutigt, die<br />
„entwickelten Verfahren selbstbewusst<br />
zu vertreten und diese<br />
primär aus ihrem eigenen<br />
pädagogischen Auftrag heraus zu<br />
begründen, statt sich den von<br />
außen gesetzten Verwertungsansprüchen<br />
zu unterwerfen“.<br />
Die oftmals behaupteten<br />
Leistungseinbußen im gemeinsamen<br />
Lernen werden auch in<br />
diesem Schulversuch eindeutig<br />
empirisch widerlegt, stattdessen<br />
machen Schülerinnen und Schüler<br />
mit äußerst ungünstigen<br />
Lernvoraussetzungen nachweislich<br />
große Lern- und Entwicklungsfortschritte.<br />
Inklusive Pädagogik hat die<br />
anspruchsvolle Aufgabe, eine<br />
hohe Leistungserwartung an alle<br />
Schülerinnen und Schüler zu<br />
stellen und gleichzeitig die<br />
Wertschätzung auch der leistungsschwächeren<br />
Schülerinnen<br />
und Schüler aufrechtzuerhalten.<br />
Der Schulversuch verweist auf<br />
die Notwendigkeit, unterstützende<br />
und beratende Prozessbegleitung<br />
bereitzustellen und für die<br />
Etablierung und Kooperation<br />
von multiprofessionellem Personal<br />
an den Schulen zu sorgen,<br />
um inklusive Qualität in den<br />
Schulen zu entwickeln und zu<br />
verankern, Inklusive Pädagogik<br />
setzt die Entwicklung inklusiver<br />
Haltungen und Einstellungen<br />
bei den Lehrenden voraus.<br />
Damit ist aus Sicht des<br />
Schulversuchs die besondere<br />
Herausforderung für deutsche<br />
Lehrkräfte beschrieben. Schließlich<br />
haben sie ihre eigene<br />
Schulzeit in einem selektiven<br />
Schulsystem verbracht und dort<br />
auch erfolgreich absolviert. Dieser<br />
Ausgangslage muss in der<br />
Fort- und Ausbildung von<br />
Lehrkräften bewusst Rechnung<br />
getragen werden.
21 LEUCHTTURM<br />
Aus der OZ Emden Ausgabe Emden Seite 17 © 2013 ZGO Zeitungsgruppe Ostfriesland GmbH<br />
Schulen richten sich auf Flüchtlinge ein<br />
GORDON PÄSCHEL<br />
Bildung Grundschule Grüner Weg<br />
möchte als erste Emder Einrichtung<br />
Sprachlernklassen anbieten<br />
Der Spezialunterricht ist für<br />
Kinder gedacht, die bislang<br />
keine Deutschkenntnisse haben.<br />
Die Grünen-Fraktion im Rat<br />
fordert, dass diesen der Zugang<br />
zur Bildung erleichtert wird.<br />
Emden - Je mehr Familien<br />
aus Krisen- und Kriegsgebieten<br />
nach Emden flüchten, desto<br />
mehr müssen sich auch die<br />
Schulen vor Ort auf neue<br />
Herausforderungen einstellen.<br />
Denn mit der Zahl der<br />
Flüchtlinge wächst auch die Zahl<br />
der Schüler, die kein Wort<br />
Deutsch sprechen und dennoch<br />
am normalen Unterricht teilnehmen.<br />
Kein leichtes Unterfangen<br />
– sowohl für die Kinder als auch<br />
die Bildungseinrichtungen. Aus<br />
diesem Grund hat das Kultusministerium<br />
in Hannover in dieser<br />
Woche angekündigt, die Zahl<br />
sogenannter Sprachlernklassen<br />
landesweit schon zum nächsten<br />
Schulhalbjahr verdoppeln zu<br />
wollen – von derzeit 120 auf<br />
dann rund 240.<br />
Den Anfang in Emden hat die<br />
Grundschule Grüner Weg noch<br />
vor dieser Mitteilung gemacht.<br />
Als erste Emder Schule stellte sie<br />
zu Beginn des Jahres bei der<br />
Landesschulbehörde den Antrag,<br />
Sprachlernklassen einrichten zu<br />
können. Das dazugehörige Konzept<br />
erläutert Dr. Josef Kaufhold,<br />
Rektor der Grundschule im<br />
Stadtteil Barenburg. Ziel sei,<br />
Kinder, die bislang kein Deutsch<br />
sprechen und verstehen, ein Jahr<br />
lang intensiv auf den normalen<br />
Unterricht vorzubereiten. Dafür<br />
sollen sie mehr als die Hälfte<br />
ihrer Schulstunden in den<br />
Sprachlernklassen verbringen.<br />
Randfächer wie Sport, Kunst<br />
oder Nachmittagsangebote würden<br />
dann in den normalen<br />
Klassen mitgemacht. Dadurch<br />
hofft Kaufhold die Integration<br />
rascher voranzubringen.<br />
In der Grundschule Grüner<br />
Weg verfügen der Rektor und<br />
seine Kollegen bereits über<br />
einen reichen Wissensschatz im<br />
Umgang mit Migrationskindern.<br />
Schon seit den 80er Jahren gibt<br />
es dort das Unterrichtsangebot<br />
Deutsch als Zweitsprache. „Das<br />
geht zurück auf die Boat People<br />
aus Vietnam“, sagt Kaufhold und<br />
meint eine Flüchtlingswelle vor<br />
gut 30 Jahren, bei der viele<br />
Menschen per Schiff aus dem<br />
asiatischen Land flohen und<br />
unter anderem nach Ostfriesland<br />
kamen. In der Schule hätten sie<br />
sich auch deswegen früh auf<br />
Kinder eingestellt, die dem<br />
normalen Unterricht kaum folgen<br />
können, so Kaufhold. Die<br />
Zahl derer, die schon jetzt<br />
Unterstützung<br />
wegen ihrer<br />
mangelnden<br />
Deutschkenntnisse<br />
benötigt,<br />
beziffert Kaufhold<br />
mit<br />
„mehr als<br />
150“.<br />
Waren es in<br />
der Vergangenheit<br />
vor allem<br />
viele vietnamesische<br />
Jungen<br />
und Mädchen,<br />
denen der Zugang<br />
zur Bildung<br />
ermöglicht<br />
werden sollte, sind es an der<br />
Grundschule Grüner Weg aktuell<br />
eher Kinder aus osteuropäischen<br />
Staaten. Sie machen das Gros der<br />
28 Schülerinnen und Schüler<br />
aus, die so gut wie gar kein<br />
Deutsch beherrschen und für die<br />
die Sprachlernklassen eingerichtet<br />
werden sollen. Gerade zwei<br />
kommen aus Kriegsgebieten in<br />
Syrien. Die Auswirkungen der<br />
Flüchtlingsströme sind für Josef<br />
Kaufhold und seine Kollegen<br />
noch nicht akut. Aber, so der<br />
Rektor, der Ende nächster Woche<br />
in den Ruhestand geht: „Wir<br />
sind darauf vorbereitet.“<br />
Die Ratsfraktion von Bündnis<br />
90/Die Grünen drängt darauf,<br />
dass sich möglichst auch alle<br />
anderen Bildungseinrichtungen<br />
in Emden auf diese neuen<br />
Anforderungen einstellen. Ihr<br />
Vorsitzender Bernd Renken sagt:<br />
„Wir erwarten, dass sich etwas<br />
bewegt.“ Mit dem Vorstoß des<br />
Kultusministeriums sollte „jetzt<br />
die Chance genutzt“ werden,<br />
weitere Sprachlernklassen einzurichten,<br />
appelliert er an die<br />
Emder Schulleiter.<br />
Grundschule Grüner Weg auf<br />
Flüchtlingskinder eingestellt<br />
Als erste Emder Schule hat die<br />
Schulleitung (im Bild Rektor Dr.<br />
Josef Kaufhold) der Grundschule<br />
Grüner Weg jetzt den Antrag auf<br />
Einrichtung von Sprachlernklassen<br />
gestellt.<br />
Bild: Päschel
LEUCHTTURM<br />
Jahresmitgliederversammlung des KV<br />
Wilhelmshaven<br />
Wolfgang<br />
Niemann-<br />
Fuhlbohm<br />
Blick in die Versammlung<br />
Die<br />
Jahresmitgliederversammlung<br />
der Gewerkschaft<br />
Erziehung und Wissenschaft,<br />
Kreisverband Wilhelmshaven,<br />
kritisierte am 10. Dezember<br />
in der „Ruscherei“ den<br />
Umgang der SPD-geführten<br />
Landesregierung mit ihren Lehrerinnen<br />
und Lehrern scharf.<br />
Die Streichung der Altersermäßigung<br />
für alle und die<br />
Stundenerhöhung für Gymnasiallehrkräfte<br />
habe man ausgerechnet<br />
der SPD nicht zugetraut und<br />
mache fassungslos, so die<br />
Versammlung. Man werde sich<br />
dagegen wehren. „Das Maß ist<br />
voll! Die Arbeitszeit stößt in<br />
allen Schulformen an die<br />
Grenzen der Belastbarkeit!“,<br />
führte Laura Pooth, stellvertretende<br />
Landesvorsitzende der<br />
GEW, aus. Die Finanzierung der<br />
Bildungspolitik auf dem Rücken<br />
der Bediensteten sei ein Unding;<br />
die ständig wachsenden Belastungen<br />
im Schulalltag seien<br />
nicht länger hinnehmbar. Die<br />
GEW werde ihre Forderungen<br />
mit wissenschaftlich begleiteten<br />
und repräsentativen Arbeitszeitstudien<br />
an niedersächsischen<br />
Schulen untermauern; auch<br />
Wilhelmshavener Schulen wer-<br />
den sich daran beteiligen.<br />
Laura stellte in ihrem Referat<br />
die Tellkamp-Studie vor. Die<br />
wissenschaftliche Studie der<br />
Kooperationsstelle Hochschulen<br />
und Gewerkschaften an der<br />
Universität Göttingen ermittelte<br />
in einer Gesamtbetrachtung die<br />
tatsächliche Arbeitszeit von 39<br />
Lehrkräften am Gymnasium<br />
Tellkampschule<br />
in<br />
Hannover.<br />
Im Ergebnis<br />
kann gezeigt<br />
werden, dass<br />
statt der zu<br />
erwartenden<br />
wöchentlichen<br />
Arbeitszeit<br />
von<br />
47:06 Stunden<br />
tatsächlich<br />
49:44<br />
Stunden an<br />
durchschnittlicher<br />
Arbeitszeit<br />
anfallen<br />
(Ferienzeiten<br />
eingerechnet).<br />
Hieraus leitet sich für die GEW<br />
die Notwendigkeit einer Ausweitung<br />
der Studie auf hundert<br />
Schulen ab. Zugleich wird die<br />
Auseinandersetzung um die<br />
Laura Pooth<br />
22<br />
Arbeitszeit ein Schwerpunkt der<br />
gewerkschaftlichen Arbeit in den<br />
nächsten Jahren werden.<br />
Der stellvertretende Vorsitzende<br />
Hans-Dieter Broek stellte<br />
die Aktivitäten des Kreisverbandes<br />
und des Vorstandes im<br />
Berichtszeitraum dar: Am<br />
26.11.13 und am 18.11.14<br />
führte der KV zwei ganztägige<br />
SPR-Schulungen mit der Referentin<br />
Astrid Müller (SBPR)<br />
durch. Halbtägige SPR-Info-<br />
Veranstaltungen fanden am<br />
04.06.13, am 18.03.14 (beide<br />
mit der Referentin Müller) statt.<br />
Die Informationsreihe für<br />
Schulleitungen der GEW (in<br />
Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden<br />
Wittmund und Jever)<br />
wurde fortgesetzt. Veranstaltungen<br />
fanden statt am 15.05.13 in<br />
Wilhelmshaven und am<br />
27.11.13 in Wittmund.<br />
Neu geschaffen wurde das<br />
Treffen der Wilhelmshavener<br />
GEW-Seniorinnen und Senioren<br />
auf Initiative von Renate<br />
Herde. Ein erstes Treffen fand<br />
statt am 13.06.14. (s. LT 120)<br />
Der KV sponserte die<br />
Teilnahme an der didacta in<br />
Köln (19.-23.02.13) für seine<br />
Mitglieder. Für die didacta 2015<br />
in Hannover (24.-28.02.15) wird<br />
der KV wieder einen Bus ab
23 LEUCHTTURM<br />
Wilhelmshaven bereitstellen.<br />
Weitere Aktivitäten mit Beteiligung<br />
des KV:<br />
- Beteiligung am „LEUCHT-<br />
TURM“<br />
- Bereitstellung eines Busses<br />
und Beteiligung an der Demo<br />
gegen Arbeitszeitverlängerung<br />
am 29.08.13 in Hannover<br />
- Initiative zur Arbeitszeiterfassung<br />
- Vertretung im Stadtverband<br />
des DGB (Hartmut Büsing)<br />
- Organisation und Verteilung<br />
des Schuljahresplaners<br />
Nicht zuletzt trafen sich die<br />
Vorstandsmitglieder einmal monatlich<br />
zu ihren Vorstandssitzungen.<br />
Wolfgang Niemann-Fuhlbohm<br />
und Hans-Dieter Broek<br />
wiesen die JHV auf die prekäre<br />
Nachwuchssituation für den<br />
Vorstand hin: es ist nicht<br />
gelungen, jüngere Mitglieder für<br />
die Vorstandsarbeit zu gewinnen!<br />
Aus der JHV wurden<br />
Vorschläge für eine Verbesserung<br />
der Situation gemacht:<br />
- Veranstaltung für neue Mitglieder<br />
- Ansprache auf Schulebene<br />
- Persönliche Ansprache<br />
Die Kasse geprüft hatten<br />
Dieter Meisel und Christoph<br />
Seifert. Christoph Seifert legte<br />
dar, dass die Kasse vom Kollegen<br />
Wolfgang Leuper ordnungsgemäß<br />
geführt wurde. Es wurden<br />
keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.<br />
Der Prüfbericht wurde<br />
dem Vorstand übergeben.<br />
Auf Antrag der Kollegin Inse<br />
Böhlke-Itzen wurden Vorstand<br />
und Schatzmeister einstimmig<br />
entlastet.<br />
Die Wahlen leitete Kollege<br />
Helmuth Cohrs:<br />
- der alleinige Vorschlag für<br />
den 1. Vorsitzenden Wolfgang<br />
Niemann-Fuhlbohm wurde<br />
einstimmig angenommen<br />
- der alleinige Vorschlag für<br />
den stellvertretenden Vorsitzenden<br />
Hans-Dieter Broek<br />
wurde einstimmig angenommen<br />
- der alleinige Vorschlag für<br />
den Schatzmeister Wolfgang<br />
Leuper wurde einstimmig<br />
angenommen<br />
Ehrung der Jubilarinnen und Jubilare für 40-jährige Mitgliedschaft in der GEW; alter und neuer<br />
Kreisvorsitzender Wolfgang Niemann-Fuhlbohm mit Almuth Jürgens-Lappe, Robert Meyer, Gisela<br />
Gerdes-Junklewitz, Helmut Welle und Herbert Kleemeier (von links nach rechts)<br />
- Weitere Mitglieder des Vorstandes:<br />
o Bernhard Opitz<br />
o Inge Lehmhus<br />
o Günter Wagner<br />
o Martin Toepel<br />
Die Wahl dieser Mitglieder<br />
erfolgte im Block und einstimmig.<br />
- Als Vorstandsmitglied für die<br />
Fachgruppe Senioren wurde<br />
einstimmig Renate Herde<br />
gewählt.<br />
- Als Delegierte für die Kreisdelegiertenkonferenz<br />
des DGB<br />
wurden einstimmig gewählt:<br />
o Hartmut Büsing<br />
o Inge Lehmhus<br />
- Als Kassenprüfer für die<br />
nächste Amtsperiode wurden<br />
gewählt:<br />
o Christoph Seifert<br />
o Hans-Werner Friedrichs<br />
- Als Delegierte für die Bezirksdelegiertenkonferenz<br />
Weser-<br />
Ems wurden einstimmig<br />
gewählt:<br />
o Renate Herde<br />
o Martin Toepel<br />
o Inge Lehmhus<br />
Für 40-jährige Mitgliedschaft<br />
in der GEW wurden geehrt:<br />
Gisela Gerdes-Junklewitz, Almuth<br />
Jürgens-Lappe, Herbert<br />
Kleemeier, Robert Meyer, Helmut<br />
Welle.<br />
GEW gewinnt weiterhin Mitglieder<br />
08.01.2015<br />
Die Bildungsgewerkschaft verzeichnet seit<br />
sieben Jahren stetig Zuwächse und legt 2014<br />
um gut 0,8 Prozent auf über 272.000<br />
Mitglieder zu<br />
Frankfurt a.M. – Die Gewerkschaft Erziehung<br />
und Wissenschaft (GEW) gewinnt weiterhin<br />
Mitglieder: Zum Jahreswechsel 2014/15<br />
zählte sie 272.309 Mitglieder. Sie gewann<br />
2014 per Saldo fast 2.300 Mitglieder. Das<br />
entspricht einem Plus von gut 0,8 Prozent.<br />
Rund 70 Prozent der GEW-Mitglieder sind<br />
Frauen.<br />
„Die GEW hat jetzt im siebten Jahr in Folge<br />
Mitglieder gewonnen. Diese Entwicklung<br />
spiegelt die Stärke der GEW als Bildungsgewerkschaft<br />
im Deutschen Gewerkschaftsbund<br />
(DGB)“, sagte GEW-Vorsitzende Marlis Tepe<br />
am Donnerstag in Frankfurt a.M. „Wir freuen<br />
uns, dass insbesondere sehr viele junge<br />
Pädagoginnen und Pädagogen in die<br />
Bildungsgewerkschaft eintreten. Das zeigt: Die<br />
Arbeit aller Landesverbände, Beschäftigte im<br />
Bildungsbereich von der GEW zu überzeugen,<br />
trägt Früchte. Zudem haben wir gerade in<br />
Tarifauseinandersetzungen unser Augenmerk<br />
verstärkt darauf gelegt, nicht organisierte<br />
Kolleginnen und Kollegen für eine<br />
Mitgliedschaft in der GEW zu gewinnen.<br />
Diese Arbeit werden wir auch in 2015<br />
fortsetzen: Es gibt im Bildungsbereich immer<br />
noch viele Beschäftigte, die nicht gewerkschaftlich<br />
organisiert sind.“
LEUCHTTURM<br />
Mitbestimmung, Tarifvertrag, Autonomie<br />
und Unterricht<br />
Eine Unterrichtseinheit zum Thema „Gewerkschaften und Mitbestimmung“<br />
Hasso<br />
Rosenthal<br />
Über den<br />
Autor:<br />
Hasso Rosenthal<br />
ist Vorsitzender<br />
des OV<br />
Rheiderland der<br />
Gewerkschaft<br />
Erziehung und<br />
Wissenschaft,<br />
Pressesprecher<br />
der Ostfriesischen<br />
Hochschultage<br />
der<br />
GEW und<br />
schreibt regelmäßig<br />
für das<br />
Magazin<br />
Auswege.<br />
Kontakt:<br />
HaRosenthal@tonline.de<br />
Web: www.gewrheiderland.homepage.tonline.de/gewov.htm<br />
magazinauswege.de<br />
–<br />
7.12.2014<br />
Mitbestimmung,<br />
Tarifvertrag,<br />
Autonomie<br />
und Unterricht<br />
6<br />
AUSWEGE –<br />
Perspektiven für<br />
den Erziehungsalltag<br />
Online-Magazin<br />
für Bildung,<br />
Beratung,<br />
Erziehung<br />
und Unterricht<br />
a) Wirtschaftsdemokratie<br />
Das Recht auf Mitgestaltung im<br />
Betrieb, der Schutz vor Missständen<br />
in Unternehmen, die<br />
Konflikte aus dem Widerspruch<br />
zwischen Arbeitnehmern und<br />
Betriebsinhabern machten nach<br />
dem Sieg der Umwandlung der<br />
Produktionsformen (Industrielle<br />
Revolution) bei der selbstbewussten<br />
Arbeitnehmerschaft die<br />
Forderung nach „Wirtschaftsdemokratie“<br />
in den 20er Jahren des<br />
letzten Jahrhunderts immer<br />
drängender.<br />
b) Formen der<br />
Mitbestimmung<br />
Derzeit gib es drei Formen der<br />
Mitbestimmung: die überbetriebliche<br />
(Sozialversicherungen<br />
usw.), die unternehmensbezogene<br />
(paritätische Mitbestimmung)<br />
und die betriebliche Mitbestimmung.<br />
Durch die Prozesse der<br />
Internationalisierung der Arbeits-<br />
und Produktionsbedingungen<br />
(Globalisierung) wird<br />
die überstaatliche Partizipation<br />
am Wirtschaftsleben immer<br />
wichtiger. Die Idee der Mitbestimmung<br />
beschränkt sich nicht<br />
nur auf einzelne Betriebe, es<br />
geht auch um eine demokratisch<br />
begründete Globalsteuerung der<br />
Marktwirtschaft.<br />
c) Humanisierung der<br />
Arbeitswelt<br />
Wirtschaftswissenschaftler wie<br />
K.G. Zinn und R. Hickel.<br />
Gewerkschafter z.B der IG-<br />
Metall versuchen seit 30 Jahren<br />
Argumente für den Prozess der<br />
Humanisierung der Arbeitswelt<br />
voranzutreiben und über Betriebsvereinbarungen<br />
und Tarifverträge<br />
Mitwirkungs-möglichkeiten<br />
am Arbeitsplatz vermehrt<br />
ins Bewusstsein der Öffentlichkeit<br />
zu rücken. Abgeordnete<br />
magazin-auswege.de – 7.12.2014<br />
Mitbestimmung, Tarifvertrag,<br />
Autonomie und Unterricht 1 im<br />
Bundestag sollen mitwirken,<br />
Gesetze für eine Ausweitung der<br />
Rechte der Arbeitnehmervertretungen<br />
fortzuschreiben (Betriebsverfassungsgesetz).<br />
d) Teilhabe der<br />
Arbeitnehmer im Betrieb<br />
Die Vorgänge in einem Betrieb<br />
sind gemeinsame Angelegenheiten<br />
aller am Arbeitsprozess<br />
beteiligten. Damit ist die<br />
Teilhabe, die Mitbestimmung<br />
eine selbstverständliche Forderung.<br />
Das Ziel der Interessenvertretungen<br />
der Arbeitnehmer (Gewerkschaften)<br />
ist es, den Einfluss<br />
der Lohn- und Gehaltsabhängigen<br />
zu erhöhen. Er umfasst auch<br />
die Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse<br />
in wirtschaftlichen<br />
und sozialen Bereichen.<br />
e) Sozialstaat und<br />
Interessenvertretung<br />
Der Sozialstaatsauftrag des<br />
Grundgesetzes erzwingt die<br />
Einhaltung der sozialen Grundrechte<br />
wie die Würde des<br />
Menschen, die Entfaltung seiner<br />
Persönlichkeit und die demokratische<br />
Teilhabe an Entscheidungsprozessen.<br />
Arbeitnehmer<br />
unterliegen vielfältig den Auswirkungen<br />
der Entscheidungen<br />
der Produktionsmittelbesitzer.<br />
Mitbestimmung ist ein Mittel,<br />
um diese Entscheidungen zu<br />
kontrollieren und Arbeitsnehmerinteressen<br />
(Arbeitsschutz,<br />
Arbeitszeit, Bedingungen am<br />
Arbeitsplatz usw.) durchzusetzen.<br />
f) Bezug zur Schule<br />
In Niedersachsen ist der Themenkomplex<br />
Mitbestimmung,<br />
Gewerkschaften und Tarifauseinandersetzungen<br />
Teil der Richtli-<br />
24<br />
nien und Curricula Wirtschaft:<br />
f1) Arbeit/Wirtschaft<br />
1997 (nds.* MK)<br />
In den nds. Rahmenrichtlinien<br />
(AWT), damals noch in einem<br />
Paket der Fächer Arbeitslehre<br />
(Arbeit/Wirtschaft), Technik und<br />
Hauswirtschaft wird der Ordnungsrahmen<br />
für die Arbeitsund<br />
Lebenssituationen der Bürgerinnen<br />
und Bürger in der<br />
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung<br />
beschrieben: „Die<br />
Qualität de Wirtschaftsverfassung<br />
() bestimmt weitgehend die<br />
ökonomische und soziale Leistungsfähigkeit<br />
einer Gesellschaft.<br />
Der Prozess () der<br />
Fortentwicklung der Wirtschaftsordnung<br />
eines Landes im<br />
Spannungsfeld unterschiedlicher<br />
ökonomischer, sozialer und<br />
politischer Interessen berührt<br />
alle arbeitenden () Menschen…()<br />
Betriebesleitungen und Betriebsräte<br />
verhandeln über die<br />
sozialverträgliche Gestaltung des<br />
Strukturwandels. () Deshalb ist<br />
für das Verstehen und Beurteilen<br />
wirtschaftlicher, arbeitsweltlicher<br />
und politischer Sachverhalte<br />
deutlich zu erkennen: Eine<br />
Marktwirtschaft wird nicht verfügt,<br />
sondern ist eine permanente<br />
gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe.<br />
() Die Folgen des<br />
Strukturwandels berühren alle<br />
Ebenen wirtschaftlichen Handelns.“<br />
magazin-auswege.de –<br />
7.12.2014 Mitbestimmung, Tarifvertrag,<br />
Autonomie und Unterricht<br />
2 Schülerinnen und<br />
Schüler (Ss) sollen<br />
1. Ökonomische und technische<br />
Sachverhalte () in ihren<br />
Zusammenhängen und in<br />
ihrer historischen Bedingtheit<br />
erfassen.<br />
2. Den Prozess zunehmender<br />
Internationalisierung von<br />
Wirtschaft und Gesellschaft
25 LEUCHTTURM<br />
erkennen.()<br />
3. Sie erwerben grundlegende<br />
Kompetenzen () für eine<br />
verantwortliche Teilhabe an<br />
derGestaltung der Technik,<br />
der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.<br />
()<br />
4. Sie erwerben grundlegende<br />
Kenntnisse über<br />
a) Betriebs- und Unternehmensverfassungen<br />
b) Entlohnung, Tarifverhandlungen<br />
c) Konflikten zwischen betrieblichen<br />
Zielsetzungen.<br />
f2) Wirtschaft<br />
Hauptschule 2009 (nds.<br />
MK)<br />
Die Ss<br />
1. untersuchen Fallbeispiele zur<br />
Aufbau-, Ablauf-, zur formalen<br />
und nicht formalen<br />
Organisationeines Unternehmens.<br />
2. untersuchen Strategien zur<br />
Durchsetzung der Interessen<br />
von Arbeitnehmerinnen und<br />
Arbeitnehmern und Arbeitgeberinnen<br />
und Arbeitgebern<br />
und Fälle zum Arbeitsund<br />
Tarifrecht.<br />
3. stellen Formen der Mitbestimmung<br />
im Betrieb dar.<br />
4. erklären Einflussfaktoren auf<br />
Entgeltsysteme.<br />
5. überprüfen Auswirkungen<br />
von Entscheidungen innerhalb<br />
der Organisation auf<br />
Abläufe in Unternehmen und<br />
auf Arbeitsplätze<br />
6. problematisieren Konflikte im<br />
Betrieb, nehmen dazu Stellung<br />
und entwickeln Lösungsmöglichkeiten.<br />
7. beschreiben wichtige Elemente<br />
der Regelung von Arbeitsbeziehungen<br />
in Unternehmen.<br />
f3) Wirtschaft Oberschule<br />
2013 (nds. MK)<br />
Die Ss<br />
1. untersuchen Fallbeispiele zur<br />
Aufbau-, Ablauf-, zur formalen<br />
und informalen Organisation<br />
eines Unternehmens.<br />
2. untersuchen Strategien zur<br />
Durchsetzung<br />
3. der Interessen von Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmern<br />
und Arbeitgeberinnenund<br />
Arbeitgebern und<br />
Fälle zum Arbeits- und<br />
Tarifrecht.<br />
4. untersuchen Konfliktfälle in<br />
der Ausbildung.<br />
5. stellen Formen der Mitbestimmung<br />
im Betrieb dar.<br />
6. erklären Einflussfaktoren auf<br />
Entgeltsysteme.<br />
magazin-auswege.de – 7.12.2014<br />
Mitbestimmung, Tarifvertrag,<br />
Autonomie und Unterricht 3<br />
g) Zielsetzungen für den<br />
Unterricht (DGB-<br />
Handreichungen)<br />
Mehr als 90% der Schülerinnen<br />
und Schüler werden nach der<br />
Schule abhängig arbeiten. Die<br />
Organisation, die ihre wirtschaftlichen<br />
und arbeitsrechtlichen<br />
Interessen vertreten wird, ist die<br />
Gewerkschaft, vereinigt im<br />
DGB. Es ist selbstverständlich,<br />
dass für den Unterricht Materialien<br />
zusammengestellt werden,<br />
mit denen die Fragen nach der<br />
Organisation und Mitgliedschaft<br />
der Interessenvertretung beantwortet<br />
werden können. Wissen<br />
über wirtschaftliche, soziale und<br />
politische Zusammenhänge ist<br />
die wesentliche Voraussetzung<br />
für gesellschaftliches Wirken und<br />
die Fähigkeit der solidarischen<br />
Interessenvertretung.<br />
Leitziele sollten deshalb sein,<br />
dass<br />
• Schülerinnen und Schüler die<br />
eigenen Interessen als Arbeitnehmer<br />
erkennen,<br />
• die Handlungsmöglichkeiten<br />
kennen,<br />
• die Bereitschaft zur solidarischen<br />
Interessenvertretung<br />
entwickeln<br />
• die Notwendigkeit von Gewerkschaften<br />
erkennen,<br />
• die konkrete Arbeit vor Ort<br />
(Jugendvertreter, Betriebsräte)<br />
kennen lernen,<br />
• Problemlösungsmöglichkeiten<br />
durch aktive Mitgestaltung<br />
in den Gewerkschaften erkennen.<br />
h) Unterrichtseinheit<br />
Die Ziele und Aufgaben der<br />
Gewerkschaften können nicht in<br />
ihrer Komplexität, sondern nur<br />
durch exemplarische Beispiele<br />
ausgehend von der Betroffenheit<br />
und der Erfahrung der Schüler<br />
vermittelt werden. Mögliche<br />
Unterrichtssequenzen können<br />
sein:<br />
h.1. Mitbestimmung<br />
h.1.1. Konflikt im Betrieb<br />
h.1.2. Interessenvertretung im<br />
Betrieb<br />
h.1.3. Aufgaben des Betriebsrats<br />
h.1.4. Wahl des Betriebsrats<br />
h.1.5. Jugendvertreter<br />
h.1.6. Jugendvertretung und Betriebrat<br />
h.1.7. Schwierigkeiten bei der<br />
Interessenvertretung<br />
h.1.8. Ziele der Mitbestimmung<br />
h.1.9. Paritätische Mitbestimmung<br />
magazin-auswege.de – 7.12.2014<br />
Mitbestimmung, Tarifvertrag,<br />
Autonomie und Unterricht 4<br />
h.2. Tarifvertrag und<br />
Autonomie<br />
h.2.1. „Die Gewinne steigen, die<br />
Löhne nicht!“<br />
h.2.2. Ein Tarifvertrag wird<br />
gekündigt.<br />
h.2.3. Ta r i fverhandlungen,<br />
Streik, Aussperrung<br />
h.2.4. Flussdiagramm Tarifauseinandersetzungen<br />
h.2.5. Tarifliche Autonomie<br />
h.3. Gewerkschaften<br />
h.3.1. Wie geht das? Interessenvertretung<br />
der Arbeitnehmer<br />
h.3.2. Innerbetriebliche Auseinandersetzungen<br />
h.3.3. Wie eine Gewerkschaft<br />
entstand.<br />
*Hinweis: Die niedersächsischen<br />
Bezüge lassen sich<br />
bruchlos auch auf andere<br />
Bundesländer übertragen.<br />
magazin-auswege.de – 7.12.2014<br />
Mitbestimmung, Tarifvertrag,<br />
Autonomie und Unterricht 5<br />
www.magazin-auswege.de<br />
auswege@gmail.com
LEUCHTTURM<br />
26<br />
Vom Computerspieler zum Drohnenpiloten<br />
Stütze, Hartz 4, Grundi – wer eine richtige Chance erhält, sich mit seinen Fähigkeiten daraus<br />
zu befreien, wird sie ergreifen. Darius ist Computerspieler, guter Spieler, herausragend. Als<br />
er die Chance erhält, Drohnenpilot zu werden, greift er selbstverständlich zu. Aber die virtuelle<br />
Welt ist nicht die reale, auch wenn die beiden ineinandergreifen.<br />
Thorsten Nesch:<br />
Der Drohnenpilot<br />
München: Mixtvision 2015<br />
www.mixtvision-verlag.de<br />
ISBN 978-3-95854—024-8<br />
288 S * 13,90 Euro * ab 14 J<br />
Ein wichtiges Thema, das<br />
leider ein wenig pädagogisierend<br />
daherkommt. Wir erleben<br />
den Aufstieg des 17-jährigen<br />
Jungen Darius, genannt Darry –<br />
ohne Schulabschluss und ohne<br />
Zukunftschancen. Wie sein alleinerziehender<br />
Vater lebt er<br />
vom »Grundi«, vom Grundeinkommen,<br />
und verbringt seine<br />
Zeit mit Computerspielen.<br />
Mehrzahl? Nein, er konzentriert<br />
sich auf das Spiel »Raid«, täglich<br />
6 bis 8 Stunden, öfter länger.<br />
Darius ist gut, Darius ist einer<br />
der wenigen, der jedes Niveau<br />
erreicht, das Spiel sogar zu Ende<br />
spielt. Dann passiert etwas<br />
Merkwürdiges auf seinem<br />
Schirm, denn er wird direkt<br />
angesprochen, auf Deutsch. Er<br />
erhält ein Angebot, das er<br />
zunächst als Testspieler interpretiert,<br />
aber es ist ein Angebot,<br />
Drohnenpilot zu werden. Viel<br />
Geld, Verantwortung, ein geregeltes<br />
Leben. Ein gemeinsames<br />
Leben mit seiner Freundin<br />
Evelyn scheint möglich.<br />
Ohne dass er das weiß, teilt<br />
sich damit sein Leben. Auf der<br />
einen Seite ist da die Gruppe um<br />
Sven und Evelyn, die sich für<br />
den Erhalt eines kleinen Parks<br />
mit See gegen die Verbreiterung<br />
einer Straße einsetzen, auf der<br />
anderen Seite die Privatfirma D-<br />
Air, die im Auftrag – von wem<br />
auch immer – sich um<br />
Aufklärung und – wenn nötig –<br />
auch um chirurgisch präzise<br />
Elimination kümmert.<br />
Durch die scharfe Trennung<br />
zwischen kleinem Bürgerbegehren<br />
und weltweiten Aufgaben<br />
verwandelt sich die Grenze von<br />
»Gut und Gut« zu »Gut und<br />
Böse«. Die Arbeit als Drohnenpilot<br />
erweist sich einerseits kaum<br />
anders als das Spielen eines<br />
Computerspiels, andererseits erfüllt<br />
man (Darry) Aufgaben im<br />
Mittelmeer (Flüchtlinge aus<br />
Afrika) und kurz darauf irgendwo<br />
im tiefen (chinesischen?)<br />
Asien und dann direkt um die<br />
Ecke am Schwanenteich.<br />
Wer bisher glaubte, dass die<br />
Drohnenfrage doch eine konsequente<br />
Fortführung wäre, vom<br />
Zweikampf der Soldaten über das<br />
Erschießen von Soldaten in der<br />
Ferne zu dem Abwurf von<br />
Bomben über der Stadt, der hat<br />
ganz sicher recht. Immer töteten<br />
sich im Krieg Menschen, die sich<br />
gar nicht kannten und schon gar<br />
nichts gegeneinander hatten. Je<br />
weiter die »Gegner« voneinander<br />
entfernt sind, desto weniger<br />
berührt den »Täter« seine Tat,<br />
desto »perverser« wird die Tat,<br />
falls es eine Steigerung von<br />
»pervers« gibt-<br />
Das Thema ist wichtig, die<br />
Darstellung allerdings sehr plakativ.<br />
Die Zeit, in der die<br />
Geschichte spielt, ist nicht die<br />
heutige, aber sie deutet auf<br />
unsere hin: Es gibt ein Gerät, das<br />
zwar nicht Smartphone, sondern<br />
Device (Gerät) heißt (mit fast<br />
nerviger Wiederholung im Text),<br />
auf dem man sein Passwort<br />
wischt. Man bewegt sich in der<br />
Welt mit heutigen Verkehrsmitteln.<br />
Es gibt Kleidung aus<br />
gebatiktem Stoff (1970er Zeit).<br />
Man hört Reggae, das Betriebssystem<br />
der »Geräte« heißt Android.<br />
Hinweise auf die »panem et<br />
circenses« Strategie der römischen<br />
Kaiser wird zitiert.<br />
Die Liebe zwischen Darry und<br />
Evelyn wird auf eine Probe<br />
gestellt durch die etwas ältere (20<br />
Jahre) Kira, eine Art Sekretärin<br />
der »anderen« Seite, sowie Sven<br />
von der Demo-Gruppe.<br />
Das Buch bezieht eindeutig<br />
Stellung – und übertreibt dabei<br />
ein wenig. Die Anlage ist<br />
Schwarz-Weiß, die Zwischentöne<br />
dienen allein einer Entwicklung<br />
der Geschichte, die jedoch recht<br />
einfach strukturiert ist.<br />
Neben den ganzen Kritikpunkten<br />
bleibt auf der Positiv-<br />
Seite, dass gerade junge Menschen,<br />
die ihren Lebenssinn in<br />
Spielen im oder zwischenmenschlichen<br />
Kontakt durch das<br />
Internet finden, wenigstens<br />
einen Moment lang anhalten<br />
und über ihr Dasein nachdenken.<br />
Menschen wie Evelyn<br />
brauchen es sicher nicht.<br />
Ulrich H. BASELAU * Ulrich.Baselau<br />
AD ajum.de
27 LEUCHTTURM<br />
Thema: Drohne<br />
Aspekte für den Unterricht<br />
• Drohne und Verkehrssicherheit<br />
• Intimsphäre / Ausspähen<br />
• Nutzen<br />
° Überwachung von Windrädern,<br />
Hochspannungsleitungen,<br />
Bergwegen<br />
° Genehmigung der Luftfahrtsbehörden<br />
° TV-Sender, z. B. FRF, Expeditionen<br />
ins Tierreich<br />
° Luftbilder<br />
° UFOs<br />
° Biene (biologischer Aspekt)<br />
• Militär<br />
° Kosten<br />
° Aufklärung<br />
° Bomben<br />
° Perversion des Krieges –<br />
vom Duell Auge in Auge<br />
über ... zu ...<br />
• Datenschutz<br />
• technische Aspekte<br />
° Fluggeräte<br />
° Hubschrauber-Prinzip<br />
° Flugantriebe<br />
• Computerspiele<br />
° RL (real life) vs SL (second<br />
life)<br />
° von der Beschäftigung zur<br />
Sucht<br />
• aktuelle Meldungen / Internet-Stichworte<br />
° Quadrocopter – Gefängnis-<br />
Marihuana<br />
° Drohne – Hamburg –<br />
Gefängnis – Handy<br />
° Tijuana – Drohne – Crystal<br />
Meth<br />
° Drohne - Fußball – Serbien<br />
– Albanien – Flagge<br />
° Apotheke – Drohne – Juist<br />
° Washington – Quadrocopter<br />
– Weißes Haus<br />
° Atommeiler Belleville-sur-<br />
Loire – Drohne<br />
° Heathrow – Drohne –<br />
Zusammenstoß – 22. Juli<br />
2014<br />
° film – nordseedrohne – kgs<br />
wittmund<br />
Ulrich H. BASELAU *<br />
Ulrich.Baselau AD ajum.de<br />
Viele neue Mitglieder in den letzten 3 bis 4 Jahren im GEW Kreisverband Aurich<br />
Mensch kann seine Interessen beigetreten. Als kleines Dankeschön,<br />
am Arbeitsplatz gemeinsam als Anerkennung und zum Kennenlernen<br />
besser durchsetzen. Dies haben 95<br />
hat der Kreisvorstand die<br />
Kolleginnen und Kollegen im Neuen zum Brunchen eingeladen.<br />
Bereich des GEW Kreisverbands Melanie Diehl und Nicole Bones<br />
Aurich kapiert und sind der GEW haben diese Veranstaltung organisiert.<br />
Schulinspektion vor über 85 Jahren<br />
(vgl.: Ostfriesischer Kurier, 2014, die<br />
Kurierserie „Schulgeschichten“, erzählt<br />
Geschichten aus der Schulzeit von 1880 bis<br />
1960, geplant waren 10 Geschichten doch<br />
es wurden viel mehr. Der Autor der Serie,<br />
Helmut Fischer, war erstaunt über die<br />
überwältigende Resonanz aus dem Kreis der<br />
Kurierleser/innen )<br />
Im Mai 1928 wollte der damalige<br />
„preussische Schulrat“ Schrader aus<br />
Emden eine einklassige Volksschule mit<br />
insgesamt 26 Kindern in der<br />
Krummhörn besuchen.<br />
Die Kinder befanden sich jedoch auf<br />
einer Wanderung.<br />
Im März 1929 versuchte es Herr<br />
Schrader zum zweiten Mal, doch<br />
diesmal erklärte der Lehrer, dass er<br />
krankheitshalber nicht unterrichten<br />
könne. Also übernahm der Schulrat den<br />
Unterricht.<br />
Im Mai 1929 besuchte der Schulrat<br />
dann noch einmal die kombinierte<br />
Klasse: 14 Kinder in der Unterstufe, 7<br />
in der Mittelstufe, 5 in der Oberstufe.<br />
Um „die Art der Unterrichtsarbeit des<br />
Lehrers St. kennenzulernen“, war der<br />
10. Mai 1929 angesetzt.<br />
Unter dem Aspekt „äußeres und<br />
inneres Schulleben“ fasste der<br />
Schulrat seinen Bericht zusammen:<br />
„Die Schule ist recht kümmerlich mit<br />
Lehrmitteln ausgestattet ... 6 Landkarten<br />
und einige geografische und geschichtliche<br />
Anschauungsbilder.“<br />
Der aufgestellte Beschaffungsplan sei<br />
nicht durchgeführt.<br />
In dem kleinen Schulraum sei nicht<br />
genügend Platz, war die Entschuldigung<br />
des Lehrers. Das konnte der Schulrat<br />
nicht akzeptieren, er meinte die<br />
Lehrmittel könnten auch in der<br />
Dienstwohnung des Lehrers untergebracht<br />
werden.<br />
Insgesamt kritisierte Herr Schrader<br />
die fehlende Ordnung: „Lehrbücher,<br />
Kreide, Geige, Tintenfass, Listen und<br />
Schulhefte liegen wirr und verstaubt im<br />
Schulpult durcheinander. Es fehlt dem<br />
Lehrer der Sinn für Ordnung. Ich habe<br />
ihn ernsthaft darauf aufmerksam<br />
gemacht, dass … Ordnung und<br />
Sauberkeit auch ein Stück der<br />
schulischen Erziehung sein muss....“<br />
Zum „inneren Schulleben“ schrieb<br />
Schulrat Schrader: „Obwohl der Lehrer<br />
St. erst 47 Jahre ist, macht er den<br />
Eindruck eines alten Mannes, seine<br />
unruhige Haltung, sein schreiender<br />
Lehrton, seine hastige und ungewählte<br />
Sprache verraten eine starke<br />
Nervosität........mechanische Stoffvermittlung........<br />
Der Rechenunterricht<br />
ohne Veranschaulichung …. Die<br />
einklassige Schule ist in einem<br />
unwürdigen Schulraum untergebracht,<br />
die Schularbeit des Lehrers leidet<br />
zweifellos unter diesen ungünstigen<br />
äußeren Schulverhältnissen. Trotzdem<br />
… ich habe dem Lehrer St. aufgegeben:<br />
1. Bessere Ordnung in seiner Klasse<br />
halten.<br />
2. Im Unterricht mehr als bisher den<br />
Geist der Richtlinien zu beachten.<br />
3. Sich in die Bestrebungen der<br />
neuzeitlichen Pädagogik einzuarbeiten.“<br />
Ob der Lehrer St. damals seine<br />
Hausaufgaben gemacht hat, wurde nicht<br />
überliefert.<br />
Anette Hillen
LEUCHTTURM<br />
Nepper, Schlepper, Bauernfänger<br />
Eine Welt und der Datenklau<br />
Hasso<br />
Rosenthal<br />
01. Es war einmal<br />
Unsere Industriewelt war 150<br />
Jahre geprägt von der industriellen<br />
Revolution. Fabriken, Märkte,<br />
Infrastruktur, Arbeitsbedingungen<br />
waren gestaltet von den<br />
Auswüchsen der serieller maschinellen<br />
Produktion. Dazu gehörten<br />
im Wesentlichen viele<br />
Formen der analogen Kommunikation.<br />
Ein Brief wurde geschrieben,<br />
in den Briefkasten geworfen,<br />
vom Postboten abgeholt, über<br />
ein Verteilersystem zugeordnet,<br />
mit der Bahn von A nach B<br />
gebracht, dort neu einem Bezirk<br />
und seinem Briefträger zugeordnet,<br />
der packte ihn in seine<br />
Posttasche, schwang sich auf das<br />
Fahrrad, fuhr zu der angegebenen<br />
Adresse, warf den Brief in<br />
den Hausbriefkasten. Dort lag<br />
der Brief so lange, bis die<br />
Sekretärin in den Betrieb kam,<br />
den Briefkasten öffnete: „Oh,<br />
wollen wir doch einmal schauen,<br />
was da gekommen ist.“, die Post<br />
entnahm, öffnete und den<br />
entsprechenden Büros zuordnete.<br />
Wenn ein Nachrichtendienst<br />
die Post überwachen wollte,<br />
musste er Zugang zu einem<br />
Verteilzentrum haben (Richterbeschluss),<br />
eine bestimmte Post<br />
herausfischen, sie geschickt öffnen,<br />
die Information herausle-<br />
sen, den Brief wieder hineinlege<br />
so verschließen, dass der<br />
Empfänger nichts davon mitbekommt.<br />
Manchmal las er<br />
grimmig, dass der Briefschreiber,<br />
die Überwachung vermutend,<br />
hineinschrieb: „Hallo Schnüffler,<br />
Du gehörst auch in die<br />
Gewerkschaft!“ (Vor der Rechtschreibreform)<br />
Eine Morsetelegraf erhielt die<br />
Botschaft, tippte sie mit seinem<br />
Ticker ein, der wandelte die<br />
Nachricht in Punkte und Striche<br />
um, schickte sie über die<br />
Telegrafenleitung von A nach B,<br />
dort wurde sie mit den<br />
Strichcodes ausgedruckt, decodiert<br />
und in einen für jedermann<br />
lesbaren Text umgewandelt. Wer<br />
die Nachricht ermitteln wollte,<br />
musste die Steigeisen anschnallen,<br />
mit einem Kabel einen<br />
Telegrafenmasten emporklettern,<br />
die elektrischen Impulse abfangen<br />
und decodieren, seinem<br />
Chef von der Firma „Horch und<br />
Guck“ auf den Tisch legen.<br />
Ein Fahrgast steigt in eine<br />
Straßenbahn, setzt sich auf<br />
seinen Platz, ist in B angekommen,<br />
steht auf und gibt dem<br />
Bahnfahrer das Signal, dass er<br />
aussteigen will. Vorn piept’s,<br />
eine Lampe leuchtet gelb auf.<br />
Ein Herr im grauen Mantel mit<br />
Schlapphut folgt ihm, notiert,<br />
wen er besucht.<br />
Viele Formen dieser betulichen,<br />
analogen Nachrichtenübermittlung<br />
gibt es heute noch,<br />
doch im Wesentlichen hat es<br />
einen Wandel in die digitale<br />
Kommunikation gegeben.<br />
28<br />
02. Ins Netz gegangen<br />
90% der Deutschen nutzen<br />
das Internet. Der Staat kann mit<br />
der IP-Adresse und Trojanern di<br />
Internetaktivität ausspähen. Die<br />
Handydaten verraten ihm, wo<br />
der Bürger sich aufhält. Das<br />
Internet integriert alle Aktivitäten<br />
und ist die zentrale<br />
Kommumkationsplattform geworden.<br />
Social Web ist nur ein Teil des<br />
Web 2.0, das beinahe jeden<br />
Aspekt menschlicher Kommunikation<br />
revolutioniert. Mit der<br />
entsprechenden Software können<br />
Bürger mit ihrer „Post“<br />
elektronisch überwacht, ihre<br />
Nachrichten gefiltert, die Empfänger<br />
kenntlich, die Inhalte<br />
deutlich, die Absicht an Andere<br />
übermittelt werden.<br />
03. Online-Gesellschaften<br />
Sobald man sich ein Profil<br />
z.B. bei Facebook anlegt, gibt<br />
man persönliche Daten preis, die<br />
von Konzernen zur Gewinnmaximierung<br />
verwaltet werden.<br />
Facebook wird von vielen wie<br />
ein verlässlicher Freund gesehen.<br />
Es erscheint ihnen wie ein<br />
zuverlässiger Begleiter, dem man<br />
sein Herz ausschütten kann wie<br />
einem Metafreund.<br />
04. Virtuelle Infrastruktur<br />
Ziel aller kostenlosen Angebote<br />
im Netz ist es, Werbeagenturen<br />
damit zu ködern, dass man<br />
es ihnen möglich macht, ihre<br />
Werbung für bestimmte Produkte<br />
gezielt „an den Mann“ zu<br />
bringen. Der soziale Aspekt lässt<br />
sich informationell ausbeuten<br />
für alle denkbaren gezielten<br />
Marketingbotschaften. Ursache<br />
ist, dass wir unser Sozial- und<br />
Arbeitsleben in eine kommerzielle<br />
digitale Infrastruktur verlegen.<br />
Facebook z.B. analysiert,<br />
wie unsere Konsumgewohnheiten<br />
beeinflusst werden können.<br />
Schreibe ich meiner Freundin<br />
einen Liebesbrief, kann es<br />
passieren, dass ich beim nächsten<br />
Aktivieren des Rechners eine<br />
Fleurop Werbung auf den<br />
Schirm bekomme. Das Soziale<br />
wird dem kommerziellen Diktat<br />
unterwerfe Die Kapitalisierung<br />
sozialer Netzwerke gleicht einer<br />
negativen Utopie (Dystopisches<br />
Szenario). Die Endzeitvision des<br />
Big Brother, der überall seine
29 LEUCHTTURM<br />
Lauscher und Finger hat, scheint<br />
eleganter, heimlicher, demokratiekompatibler<br />
Wirklichkeit zu<br />
sein. Jeder, der sich daran<br />
beteiligt, unterstützt die „galoppierende<br />
Kommerzialisierung<br />
des Soziallebens“.<br />
05. Was ist schon<br />
Privatsphäre?<br />
Google - Emails werden mit<br />
Algorithmen durchforstet, um<br />
passende Werbeanzeigen schalte)<br />
zu können. Jeder, der einen<br />
kostenlosen Email-Account<br />
nutzt, weiß, dass das über<br />
Werbeeinnahmen finanziert<br />
wird. Langsam nähern wir uns<br />
mit der Erfassung unserer Welt<br />
durch Mess- und Aufzeichnungsgeräte<br />
einer vollständigen<br />
Durchforstung unseres Lebens.<br />
Legislative und Exekutive unserer<br />
parlamentarischen Demokratien<br />
erweisen sich als unfähig,<br />
dem Netz etwas wirkungsmächtig<br />
vorzuschreiben. Es fehlen globale<br />
Rechtslösungen, denn das<br />
Internet ist eine „Verbreitungsund<br />
Auswertungsmaschine“<br />
ohne Vorbild.<br />
Die Regierung der Bundesrepublik<br />
propagiert als Lösung der<br />
Probleme die „Filtersouveränität“.<br />
Nach der ungemein<br />
erfolgreichen Reise unseres<br />
Robin Hood gegen die Datendiebe<br />
im amerikanischen Washington-Forrest<br />
gab er indirekt<br />
den Nutzern des Internet Schuld<br />
an der Misere. Man solle doch<br />
privat Vorsorge treffen, dass man<br />
nicht so sehr ausgespäht werden<br />
könne. Nicht das Ausmaß der<br />
vorhandenen Mitteilungen solle<br />
eingeschränkt werden, sondern<br />
das Zuhören. Mittel soll keine<br />
Zensur sein, die festlegt, was ii<br />
die Öffentlichkeit darf, sondern<br />
ein je individueller Filter, der<br />
alles ausblendet, was man als<br />
störend empfindet. Filtersouveränität<br />
würde Informationsflüsse<br />
abwehren, mit denen man<br />
keinen Kontakt wünscht.<br />
Problematisch ist dabei aber,<br />
die kritische Kontrolle dem<br />
Individuum zu überlassen. Der<br />
einzelne Bürger ist nicht nur<br />
damit überfordert, der Staat und<br />
gerade auch das Innenministerium<br />
begibt sich in die Rolle des<br />
Nachtwächters, der seine Aufgabe<br />
der Kontrolle und der<br />
Sanktion bei Missbrauch vernachlässigt.<br />
06. Ein Freund, ein guter<br />
Freund<br />
Wir sammeln virtuelle<br />
Freundschaften, die es real nie<br />
geben kann. Die Datensammlungen<br />
dafür werden von Firmen<br />
wie Google oder Facebook<br />
wirtschaftlich missbraucht. Im<br />
Dialog mit virtuellen Freundinnen<br />
und Freunden stellen wir<br />
uns vor, geben wir vieles von uns<br />
preis. Wir legen wechselseitig<br />
mit unserem Kommunikationspartner<br />
Wirklichkeitsbilder fest.<br />
Im „Gespräch“ wird die gemeinsame<br />
Sicht der Welt aufgebaut.<br />
Die Selbstoffenbarung beim<br />
gegenseitigen Sich-Selbst-Erzählen<br />
erzeugt eine Intersubjektivtät<br />
bei Gesprächspartnern. Dabei<br />
entwickeln sich aber auch<br />
Selbstbild und Identität der<br />
Beteiligten. Es kann sich im<br />
Internet sehr wohl eine Vertrautheit<br />
entwickeln, die man z. B.<br />
auch erfahrt, wenn man im<br />
Zugabteil mit einem Fremden<br />
ins Gespräch kommt („Stranger<br />
on the train phenomenon“). Es<br />
entstehen Situationen, die von<br />
besonderer Intimität und gegenseitiger<br />
Nähe gekennzeichnet<br />
sein können. Das Netz wird als<br />
geschützter Raum wahrgenommen<br />
(der es ja auf keinen Fall<br />
ist), der Selbstoffenbarung begünstigt.<br />
Es entsteht eine<br />
seltsame Mischung aus Flüchtigkeit<br />
und Kündbarkeit der<br />
Online-Beziehung einerseits<br />
und andererseits dem Empfinden<br />
von Nähe und Vertrautheit,<br />
die der Prozess des „wechselseitigen<br />
Sich-Selbst-Erzählens“ fördert.<br />
Darum wird Facebook auch<br />
als neo-romantisches Medium<br />
betrachtet.<br />
Imaginationen, Projektionen<br />
und Idealisierungen spielen hier<br />
eine große Rolle (monadische<br />
Selbstgespräche).<br />
07. Die Kosten der<br />
Kommunikation<br />
Die Personalisierung im Internet<br />
führt dazu, dass wir nur noch<br />
die Nachrichten erhalten, die zu<br />
uns ,passen’. Andere Meinungen<br />
gehen an uns vorbei.<br />
Der Nutzer, die Nutzerin<br />
akzeptiert, dass man in sozialen<br />
Netzwerken zur leichten Beute<br />
der Gewinnmaximierung eines<br />
Konzerns (Facebook, Google,<br />
Amazon, Yahooh usw.) geworden<br />
ist.<br />
Folge ist auch, dass Jugendliche<br />
sehr viel stärker dem<br />
digitalen Rufmord oder sexuellem<br />
Missbrauch ausgesetzt als<br />
vor dem Internetzeitalter.<br />
Der Missbrauch ist nicht<br />
allein ein kommerzielles Problem.<br />
Allein bei Facebook sollen<br />
l 1/2 Mio gefälschte, illegal<br />
missbrauchte Profile liegen.<br />
Sony musste zugeben, dass die<br />
Daten von 100 Mio Kunden<br />
von Hackern mit Passwörtern<br />
und Konto Verbindungen gestohlen<br />
werden konnten. Die<br />
vielfältigen Kämpfe um Datenschutz<br />
und Privatsphäre sind<br />
Rückzugsgefechte.<br />
Obwohl 85% der Nutzer<br />
nicht wollen, dass ihre Informationen<br />
gezielt für Werbung<br />
genutzt werden, machen viele<br />
bei Facebook mit, wo ihre<br />
Informationen zu 100% für<br />
Werbung eingesetzt wird. Konsumenten<br />
haben nur noch die<br />
Wahl, die nicht von persönlichen<br />
Vorlieben ausgeht, sondern<br />
von den wirtschaftlichen Zielen<br />
des entsprechenden Anbieters.<br />
08. Abgegriffen<br />
Was über die Datenleitungen<br />
eingegeben wird, egal ob über<br />
Telecom, Vodafone oder Ü2<br />
kann mittels entsprechender<br />
Software gelesen, gesammelt und<br />
ausgewertet werden.<br />
09. Was ist ein<br />
Nachrichtendienst?<br />
In der Nachrichtentechnik<br />
sprechen wir von einer Nachricht,<br />
wenn eine Information<br />
mit dem Ziel der Weitergabe<br />
erzeugt wird. Sie geht von einer<br />
Nachrichtenquelle aus, um über<br />
Signale (Nachrichtenträger) an
LEUCHTTURM<br />
eine davon räumlich entfernte<br />
Stelle gesendet zu werden<br />
(Nachrichtensenke). Die Nachrichtenübertragung<br />
erfolgt heute<br />
physikalisch über einen Nachrichtenkanal<br />
(z.B. Spannungen<br />
oder Ströme), an dessen Einund<br />
Ausgang jeweils eine<br />
Wandlung (Morsestreifen,<br />
Email-Programm, Smartphone)<br />
erfolgt.<br />
Nachrichtendienste wie der<br />
BND oder der NSA sind<br />
staatliche Geheimdienste zur<br />
Beschaffung überwiegend geheimer<br />
Informationen militärischer,<br />
politischer, wirtschaftlicher oder<br />
wissenschaftlicher Natur, die für<br />
die innere und äußere Sicherheit<br />
eines Staates von Bedeutung<br />
scheinen. Auch dienen die<br />
Nachrichtendienste der Abwehr<br />
ausländischer Spionage, Sabotage<br />
oder Terroranschlägen. Der<br />
britische SIS (Secret Intelligence<br />
Service) existiert seit dem 15.<br />
Jahrhundert. Andere Geheimdienste<br />
sind die Sürete (Frankreich),<br />
der CIA (USA) oder der<br />
MAD (Deutschland). Die deutschen<br />
Geheimdienste unterliegen<br />
der parlamentarischen Kontrolle.<br />
Daten sind übermittelte<br />
Nachrichten mit „sachhaltiger<br />
Bedeutung für Sender und<br />
Empfänger. Das Recht auf<br />
Information, auf den freien<br />
Zugang zu Information, wird in<br />
der Bundesrepublik Deutschland<br />
über Art. 5 (Meinungs- und<br />
Informationsfreiheit) des Grundgesetzes<br />
verbürgt. Durch Informationen<br />
werden einzelne soziale<br />
Systeme miteinander verbunden,<br />
aufeinander abgestimmt<br />
und am Funktionieren gehalten.“<br />
(Übermittelte Nachrichten)<br />
sind Daten „mit sachhaltiger<br />
Bedeutung für Sender und<br />
Empfänger. Das Recht auf<br />
Information, auf den freien<br />
Zugang zu Information, wird in<br />
der Bundesrepublik Deutschland<br />
über Art. 5 (Meinungs- und<br />
Informationsfreiheit) des Grundgesetzes<br />
verbürgt. Durch Informationen<br />
werden einzelne soziale<br />
Systeme miteinander verbunden,<br />
aufeinander abgestimmt<br />
und am Funktionieren gehalten.“<br />
(Encarta)<br />
Andererseits gibt es das Recht<br />
des Bürgers auf informationelle<br />
Selbstbestimmung. Jeder hat das<br />
Recht auf seine eigenen Texte<br />
und Kulturprodukte. Das Urheberschaftsrecht<br />
wird ausgehebelt<br />
durch die staatliche bzw.<br />
geschäftsmäßige Nutzung der<br />
individuellen Daten.<br />
10. Datenspione<br />
Frage ist, wo die Daten fließen<br />
und wo die „Bits aus dem<br />
eigenen Computer () genau<br />
hinsteuern.“<br />
Ursache des US-Überwachungsskandals<br />
ist die Arbeit der<br />
NSA (National Security Agency).<br />
Die Behörde soll hauptsächlich<br />
terroristische Gefahren<br />
abwehren. In ihrem Rechenzentrum<br />
filtert und sammelt sie<br />
Unmengen von Daten, die sie<br />
weltweit nach US-amerikanischem<br />
Recht ohne Gerichtsbeschluss<br />
auswertet. Dabei hackt sie<br />
sich in ausländische Computernetzwerke<br />
ein. Die NSA greift<br />
auch die privaten Daten von<br />
Apple, von Apple, Yahoo,<br />
Google oder Facebook ab.<br />
Mit den Algorithmen des<br />
Programms Prism wird die<br />
Internetnutzung der Bürger auf<br />
der ganzen Welt überwacht.<br />
Dafür arbeiten bei der NSA ca.<br />
30 000 Menschen. Snowden<br />
deckte unwidersprochen auf, dass<br />
allein im März dieses Jahres 97<br />
Millionen „Datenpunkte“ aus<br />
der ganzen Welt gesammelt<br />
wurden. Deutschland wird dabei<br />
ähnlich überwacht wie China.<br />
Der britische Abhördienst<br />
GCH8 sammelt ebenfalls regelmäßig<br />
Daten aus Deutschland.<br />
Mit Hilfe des Überwachungsprogramms<br />
Tempora wird das<br />
Überseekabel TAT-14 abgeschöpft.<br />
Der deutsche Knotenpunkt<br />
ist in der Stadt Norden<br />
(Seekabelendstelle). Der deutsche<br />
BND überwacht alle internationalen<br />
Telekommunikationsbeziehungen,<br />
auch Emails und<br />
Webforen. Allein der BND hat<br />
im Jahr 2010 37 Millionen<br />
Nachrichten filternd durchforstet,<br />
um nach vorgegebenen<br />
Kriterien bestimmte Daten genauer<br />
zu untersuchen. Da “nur“<br />
30<br />
209 relevant waren, entspricht<br />
das einem Nutzeffekt von<br />
1:10000. Durch bessere Spamerkennung<br />
wurden 2011 „nur“ 3<br />
Millionen Nachrichten gefiltert.<br />
Davon wurden 190 als „relevant“<br />
eingestuft, waren also<br />
erkennungsdienstlich von Bedeutung.<br />
Alle Nachrichtendienste analysieren<br />
die entsprechende Webadresse,<br />
die Logindaten, Aufenthaltsort<br />
des Senders und<br />
Empfängers, den Inhalt der<br />
Email. Dabei nutzen die Dienste<br />
auch Schadsoftware.<br />
11. Was ist normal?<br />
Der ehemalige Vizepräsident<br />
des BND, Rudolf Adam verweist<br />
darauf, dass es ganz normal sei,<br />
dass Nachrichtendienste Nachrichten<br />
sammeln würden. Es<br />
wäre eine einfache Übung, mit<br />
Computern Sprache zu erkennen,<br />
mit Suchbegriffen herauszufiltern<br />
und sie unbegrenzt zu<br />
speichern.<br />
Entscheidend sei, wie die 2,5<br />
Mio. Datensätze pro Tag<br />
ausgewertet würden. Realistisch<br />
sei, dass höchstens 01, % von<br />
den 50 000 Mitarbeitern des<br />
NSA qualifiziert ausgewertet<br />
werden können.<br />
Es sei in Deutschland kein<br />
Wunder, dass mit den traumatischen<br />
Erinnerungen an Gestapo<br />
und Stasi nachrichtendienstliche<br />
Strukturen kritisch beäugt werden.<br />
Diese Sichtweise gibt es in<br />
den USA trotz der McCarthy-<br />
Ära oder dem Watergate-Skandal<br />
nicht. Dort geht man davon aus,<br />
dass nur mit einem engen<br />
Datenaustausch globale Terrorstrukturen<br />
erfasst und wirksam<br />
bekämpft werden können. In<br />
einem aktuellen Interview mit<br />
dem BND-Chef Geiger fordert<br />
dieser internationale Abkommen<br />
wie zwischen Kanada, USA und<br />
Großbritannien. Diese Länder<br />
würden sich daraufhin nicht<br />
gegenseitig bespitzeln.<br />
12. Kafka und die<br />
Desinformation<br />
Im „Prozess“ von Kafka<br />
wusste Josef K., dass über ihn<br />
verhandelt und geurteilt wird.
31 LEUCHTTURM<br />
Das bleibt weltweit auch in<br />
Deutschland dem Telefon- und<br />
Internetnutzer verwehrt. Er wird<br />
nicht informiert, dass er ausspioniert<br />
wird. Und die Tatsache,<br />
dass Josef K. per Email seiner<br />
Schwester mitteilt, dass er Tante<br />
Frieda ein ungeliebtes Geschenk<br />
von Onkel Fritz weiterschenken<br />
will, kann von der Datenleitung<br />
zum Laptop der Schwester dank<br />
Prism in den Rechner eines US-<br />
Ermittlers landen, weil K.<br />
irgendwo die Wendung nutzte:<br />
„Oh, wie lecker ist RAMA,<br />
gekauft im Laden!“ dank der<br />
Lautiernähe zum String ,Osama<br />
bin Laden’. Freitag, den 19. Juli<br />
2ßl3 verkündete das USamerikanische<br />
Gericht FISC<br />
trotz der weltweiten Kritik an der<br />
Arbeit der NSA, dass die<br />
Geheimdienste weiter alle Telekommunikations-<br />
und Telefondaten<br />
sammeln dürfen. Außerhalb<br />
der USA.<br />
Nach dem Vietnamkrieg gab<br />
es jede Menge Einschränkungen<br />
der Geheimdiensttätigkeiten, die<br />
nach dem 11. September 2001<br />
aufgegeben wurden. Alle kooperierenden<br />
Staaten profitierten<br />
von den Schleppnetzaktivitäten<br />
der Schlapphüte der NSA.<br />
Die Verfassung der USA<br />
spricht von den unveräußerlichen<br />
Rechten seiner Bürger. Der<br />
FISC legitimiert aber Regierungsaktionen,<br />
satt die Bürger<br />
14. Quellenangaben:<br />
vor Totalüberwachung zu schützen.<br />
Von 34 000 Anträgen auf<br />
Überwachung lehnte der FISC<br />
nur 11 ab. Das den Vorgängen<br />
zugrundeliegende Geheimverfahren<br />
ist einer Demokratie<br />
unwürdig. Eigentlich gehört es<br />
in Inventar von Diktaturen.<br />
Betroffene werden nicht gefragt,<br />
sondern zu ihrem vermeintlichen<br />
Schutz totalitär bevormundet.<br />
Das Mitspracherecht, auch die<br />
Kenntnis aller Verfahren des<br />
FISC existiert nicht für die<br />
Betroffenen. Man spekuliert mit<br />
der Ahnungslosigkeit gegenüber<br />
dem „ausforschenden Staat“,<br />
dem die Bürger ausgeliefert sind<br />
und ihm gegenüber immer<br />
machtloser werden. Also gilt das<br />
Gegenteil des elementaren<br />
Grundsatzes jeder Demokratie:<br />
„Alle Macht geht vom Volk aus!“<br />
So ging die spanische Inquisition<br />
vor, so wird totalitär im 1984<br />
von Orwell gesetzt: „Nichtwissen<br />
ist Stärke.“<br />
Die verfassungsmäßige Dreiteilung<br />
(Exekutive, Legislative,<br />
Judikative) wird mit solchem<br />
Vorgehen aufgehoben und die<br />
Bevölkerung tendenziell in der<br />
Demokratie entmachtet. In der<br />
Washington-Post fragt ein Kommentator:<br />
„Wo sind unseren<br />
unveräußerlichen Rechte geblieben?“<br />
Genutzt wird vermutlich<br />
auch dieser Geist aus der Flasche<br />
der Graumäntel, um Drohnen<br />
für Tötungsflüge zu lenken. Und<br />
das ggf. auch mit Daten aus<br />
unserem Staat, in dessen<br />
Grundgesetz steht: „Die Todesstrafe<br />
ist abgeschafft!“<br />
13. Was heißt schon<br />
souverän?<br />
Europarechtler und Rechtsphilosoph<br />
Ulrich Haltern fordert<br />
die staatliche Souveränität<br />
der Bundesrepublik ein. Selbstbestimmung<br />
auch eines Staates<br />
ist eine Form der Gelassenheit,<br />
seine eigenen Geschicke zu<br />
gestalten. Deshalb könnte die<br />
deutsche Bundesrepublik es<br />
nicht zulassen, dass die USA<br />
oder ein anderer Staat von<br />
deutschem Boden aus Krieg<br />
führt. Genau so wenig dürfe die<br />
Bundesrepublik es „tolerieren,<br />
akzeptieren und respektieren“,<br />
dass „geheimkriegerisches Schalten<br />
und Walten“ die bundesdeutschen<br />
Netzwerke durchforstet. Es<br />
sei ein unhaltbarer Zustand, dass<br />
am Parlament, dem Repräsentanten<br />
des Volkes vorbei US-<br />
Drohnen gesteuert werden oder<br />
Folterung und Exekutionen von<br />
amerikanischen Standorten in<br />
Deutschland weltweit vorbereitet<br />
werden. Auf jeden Fall treten die<br />
US-Amerikaner das deutsche<br />
Recht auf absolute Befehls- und<br />
Selbstbestimmungsmacht mit<br />
Füßen.<br />
01 Andrejevic, Mark Facebook als neue Produktionsweise in: Wirklichkeit 2.0 - Reclam Sn. 20-27<br />
02 Droge, Kai Romantische Unternehmen im Netz in: WIRKLICHKEIT 2.0 -<br />
Reclam Sn. 43-47<br />
03 Heller, Christian Das Ende der Privatsphäre in: WIRKLICHKEIT 2.0 -<br />
Reclam Sn. 27-39<br />
04 Herausgeberteam Ins Netz gegangen Vorwort in: WIRKLICHKEIT 2.0 -<br />
Reclam Sn. 9-1 1<br />
05 Hrg. Kemper, Mentzer, Wirklichkeit 2.0 - Medienkultur Stuttgart 201 2 (reclam)<br />
Tillmanns<br />
im digitalen Zeitalter<br />
06 Meckel, Mirjam Virtuelle Nähe in: WIRKLICHKEIT 2.0 -<br />
Reclam Sn. 39-42<br />
07 Microsoft ® Encarta ® 2006 Enzyklopädie<br />
08 Sander, Dores, Sobota Die Welt der Datenspione TAZ vom 29.7. 2013 S. 8<br />
09 Süddeutsche Deutsche Naivität -Nachrichtensammeln Süddeutsche Zeitung; 26.7. 13; S. 1<br />
ist normal<br />
10Zielke, Andreas Schattenreiche der Justiz Süddeutsche Zeitung; 23. 7. 2013; S. 1
LEUCHTTURM<br />
32<br />
... isst Grünkohl<br />
am Freitag, dem<br />
6. März 2015, beginnend<br />
um 15 Uhr<br />
beim Forsthaus<br />
Upjever<br />
Krongutsallee 54<br />
26419 Schortens<br />
(liegt am Ende der jeverschen<br />
Boßelstrecke; ab da sind wir immer auf<br />
der Teerstr. nur gelaufen wg. der tiefen<br />
Gräben)<br />
Alle Kolleginnen und Kollegen<br />
aus den ost-friesischen<br />
KVs sind hierzu<br />
herzlich eingeladen.<br />
Gegen 17.30 Uhr gibt es dann<br />
schmackhaften Grünkohl.<br />
Um Anmeldung bis zum<br />
28.02.15 bei Jürgen Kramm<br />
04462/6102 (WTM) bzw.<br />
Heiner Wegener - 0446173133<br />
(FRI) wird gebeten.