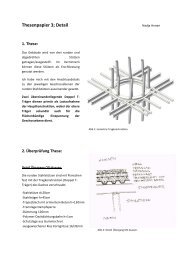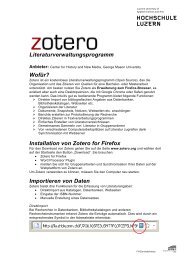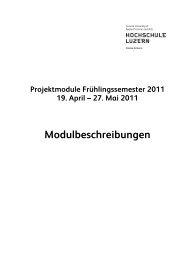Designwissenschaft und Designforschung: Ein einführender Überblick
Designwissenschaft und Designforschung: Ein einführender Überblick
Designwissenschaft und Designforschung: Ein einführender Überblick
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Issues � <strong>Designforschung</strong> � Wissen <strong>und</strong> Wissensbegriffe<br />
Den unterschiedlichen Ausprägungen <strong>und</strong> Facetten von<br />
Wissen folgend, wird dieses multiplen Klassifizierungs-<br />
<strong>und</strong> Differenzierungsschemata unterzogen. An dieser Stelle<br />
sollen exemplarisch nur einige davon genannt werden. So<br />
besteht vom Standpunkt des Wissensmanagements Wissen<br />
stets aus einem expliziten <strong>und</strong> einen impliziten Teil. Explizites<br />
Wissen kann übermittelt <strong>und</strong> gespeichert werden, etwa<br />
in Form von Text, Grafiken oder Symbolen (vgl. Nonaka,<br />
1997). Implizites (tacites) Wissen ist hingegen jenes Wissen,<br />
das ein Mensch im Laufe seines Lebens absorbiert<br />
(vgl. Polanyi, 1985, p. 24). Es besteht hauptsächlich aus Erfahrungswissen,<br />
Fähigkeiten, Werten <strong>und</strong> Lebensweisheiten.<br />
Anders als ein technisch-instrumentelles Erfahrungswissen<br />
folgt implizites Erfahrungswissen nicht unbedingt den<br />
Strukturen eines objektivierbaren Handelns. Vielmehr kann<br />
dieses intuitiven Mustern folgen, welche sich der Objektivierung<br />
entziehen. Dennoch kann implizites Erfahrungswissen<br />
ein nicht minder wirkungsvolles Handeln produzieren<br />
wie explizites Wissen. Der Differenzierung von Wissen<br />
in explizite <strong>und</strong> implizite Bestandteile schliessen sich auch<br />
weitere Definitionen an. So wird etwa in der Kognition-<br />
spsychologie zwischen deklarativem Wissen («Wissen-Was»<br />
oder Faktenwissen) <strong>und</strong> prozeduralem Wissen («Wissen-Wie»<br />
oder handlungsorientiertes Wissen) unterschieden (Benesch,<br />
1987, p. 199). In den Debatten der Erkenntnistheorie wird<br />
der Begriff des propositionalen Wissens verwendet. Als<br />
propositionales Wissen (engl. propositional knowledge) oder<br />
«Wissen-Dass» (engl. knowledge that) bezeichnet man hier<br />
das Wissen, dass etwas der Fall ist, dass eine bestimmte Proposition<br />
wahr ist. Es ist vom «Wissen-Von» <strong>und</strong> vom «Wissen-<br />
Wie» zu unterscheiden. Während «Wissen-Von» (auch «Wissen<br />
durch Bekanntschaft») auch mit «Kenntnis» gleichgesetzt<br />
werden kann <strong>und</strong> eher marginal reflektiert wird, beschreibt<br />
das «Wissen-Wie» das Wissen, wie etwas zu tun ist. Gilbert<br />
Rylen (1992) hat dafür den Begriff knowledge-how eingeführt.<br />
Ernst Pöppel (2000, p. 21) unterscheidet aus der Perspektive<br />
der Hirnforschung zwischen drei eigenständigen<br />
Formen des Wissens: begriffliches oder explizites Wissen<br />
(Nennen, Sagen), implizites oder Handlungs-Wissen<br />
(Schaffen, Tun, auch Know-how) <strong>und</strong> bildliches oder<br />
Anschauungs-Wissen (Sehen, Erkennen). Explizites Wissen<br />
wird in der Terminologie der Hirnforschung auch als<br />
linkshemisphärisches Wissen bezeichnet, womit die enge<br />
Verknüpfung von explizitem Wissen mit der Sprachfähig-<br />
30<br />
keit <strong>und</strong> der begrifflichen Repräsentation betont werden<br />
soll. Implizites, auch nonverbales Wissen, bezieht sich auf<br />
das, was wir können <strong>und</strong> was unser Handeln leitet, ohne<br />
dass es möglich ist, dafür exakte sprachliche Entsprechungen<br />
zu finden (Pöppel, 2000, p. 23). In anderer Umschreibung<br />
kann es auch als Erfahrungswissen oder handlungsgeleitetes<br />
Wissen bezeichnet werden. Bildliches Wissen schliesslich<br />
erscheint seinerseits in dreifacher Form, nämlich als<br />
sinnliches Anschauungswissen, als Erinnerungswissen <strong>und</strong><br />
als Vorstellungswissen (sich ein Bild von etwas machen)<br />
(Pöppel, 2000, p. 25). Obwohl die drei Formen des Wissens,<br />
das explizite, das implizite <strong>und</strong> das bildliche Wissen, an<br />
unterschiedliche Mechanismen des Gehirns geb<strong>und</strong>en sind,<br />
bilden sie ein gemeinsames Wirkungsgefüge. Das bedeutet,<br />
dass jede dieser drei Wissensformen wesentlich für die<br />
menschliche Kognition ist; weder kann auf eine verzichtet<br />
werden, sei es als <strong>Ein</strong>zelner oder als Gesellschaft, noch können<br />
sie für sich alleine stehen (Pöppel, 2000, p. 27, 31).<br />
Trotz ihres komplettierenden Charakters sind die unterschiedlichen<br />
Formen des Wissens keineswegs gleichgestellt:<br />
Explizites Wissen, also die rationale, verbale <strong>und</strong> schriftliche<br />
Benennung von Sachverhalten <strong>und</strong> Beobachtungen, gilt<br />
im wissenschaftlichen Kontext stets noch als einziger Garant<br />
für Begründbarkeit <strong>und</strong> Überprüfbarkeit. Somit kommt<br />
dort (zumindest vordergründig) Erfahrungswissen oder<br />
auch bildlichem Wissen nur eine marginale Bedeutung zu.<br />
Die Beharrung auf explizites <strong>und</strong> rationalistisches Wissen<br />
im Kontext der Wissenschaft lässt sich nach Helga Nowotny<br />
dadurch erklären, dass «sich die Autorität der Wissenschaft<br />
[…] nicht der Gesellschaft (verdankt), sondern […] sich<br />
direkt von der Beschäftigung mit den Naturgesetzen ableitet»<br />
(2000, p. 86). Naturwissenschaftliches Wissen entzieht<br />
sich gemäss dieser Vorstellung jeglicher Kontaminierung,<br />
beispielsweise durch gesellschaftliche <strong>und</strong> soziale <strong>Ein</strong>flüsse<br />
<strong>und</strong> behauptet für sich «kontext-insensitiv» (Nowotny, 2000,<br />
p. 86) zu sein. Demgegenüber betont Nowotny die Wichtigkeit<br />
von «(lokaler <strong>und</strong> heterogener) Kontextsensitivität<br />
der Wissenserzeugung» (2000, p. 90). Ähnlich argumentiert<br />
Armin Nassehi, wenn er schreibt, dass Wissen «kein selbstständiger<br />
Stoff, sondern immer Wissen von etwas sei» <strong>und</strong><br />
als «Repräsentationsform der Welt, die eng mit unserer<br />
Kultur verb<strong>und</strong>en ist» (Nassehi, 2000, p. 12) verstanden<br />
werden müsse. Wissen ist demnach niemals nur Abbild der