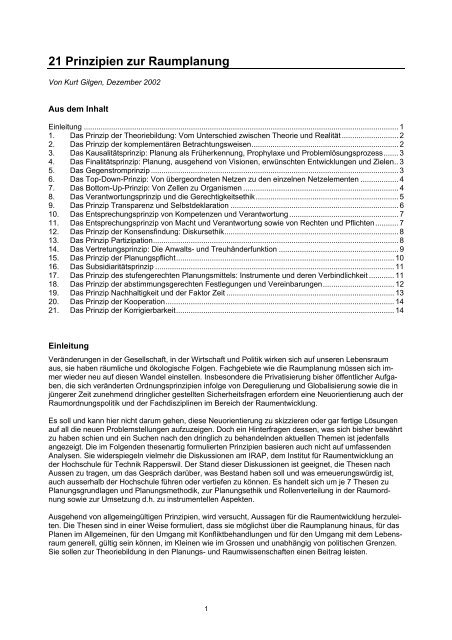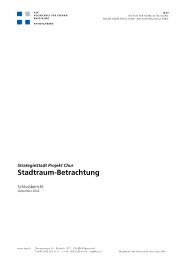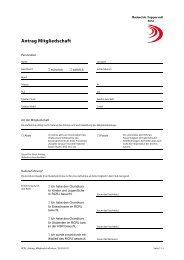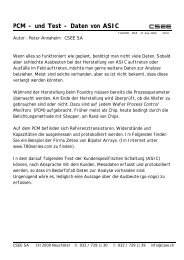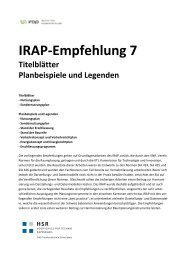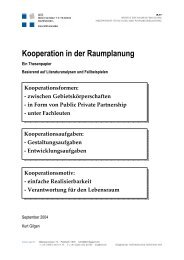21 Prinzipien zur Raumplanung - IRAP
21 Prinzipien zur Raumplanung - IRAP
21 Prinzipien zur Raumplanung - IRAP
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>21</strong> <strong>Prinzipien</strong> <strong>zur</strong> <strong>Raumplanung</strong><br />
Von Kurt Gilgen, Dezember 2002<br />
Aus dem Inhalt<br />
Einleitung ...................................................................................................................................................... 1<br />
1. Das Prinzip der Theoriebildung: Vom Unterschied zwischen Theorie und Realität ........................... 2<br />
2. Das Prinzip der komplementären Betrachtungsweisen...................................................................... 2<br />
3. Das Kausalitätsprinzip: Planung als Früherkennung, Prophylaxe und Problemlösungsprozess....... 3<br />
4. Das Finalitätsprinzip: Planung, ausgehend von Visionen, erwünschten Entwicklungen und Zielen.. 3<br />
5. Das Gegenstromprinzip ...................................................................................................................... 3<br />
6. Das Top-Down-Prinzip: Von übergeordneten Netzen zu den einzelnen Netzelementen .................. 4<br />
7. Das Bottom-Up-Prinzip: Von Zellen zu Organismen .......................................................................... 4<br />
8. Das Verantwortungsprinzip und die Gerechtigkeitsethik.................................................................... 5<br />
9. Das Prinzip Transparenz und Selbstdeklaration ................................................................................ 6<br />
10. Das Entsprechungsprinzip von Kompetenzen und Verantwortung .................................................... 7<br />
11. Das Entsprechungsprinzip von Macht und Verantwortung sowie von Rechten und Pflichten........... 7<br />
12. Das Prinzip der Konsensfindung: Diskursethik................................................................................... 8<br />
13. Das Prinzip Partizipation..................................................................................................................... 8<br />
14. Das Vertretungsprinzip: Die Anwalts- und Treuhänderfunktion ......................................................... 9<br />
15. Das Prinzip der Planungspflicht........................................................................................................ 10<br />
16. Das Subsidiaritätsprinzip .................................................................................................................. 11<br />
17. Das Prinzip des stufengerechten Planungsmittels: Instrumente und deren Verbindlichkeit ............ 11<br />
18. Das Prinzip der abstimmungsgerechten Festlegungen und Vereinbarungen.................................. 12<br />
19. Das Prinzip Nachhaltigkeit und der Faktor Zeit ................................................................................ 13<br />
20. Das Prinzip der Kooperation............................................................................................................. 14<br />
<strong>21</strong>. Das Prinzip der Korrigierbarkeit........................................................................................................ 14<br />
Einleitung<br />
Veränderungen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und Politik wirken sich auf unseren Lebensraum<br />
aus, sie haben räumliche und ökologische Folgen. Fachgebiete wie die <strong>Raumplanung</strong> müssen sich immer<br />
wieder neu auf diesen Wandel einstellen. Insbesondere die Privatisierung bisher öffentlicher Aufgaben,<br />
die sich veränderten Ordnungsprinzipien infolge von Deregulierung und Globalisierung sowie die in<br />
jüngerer Zeit zunehmend dringlicher gestellten Sicherheitsfragen erfordern eine Neuorientierung auch der<br />
Raumordnungspolitik und der Fachdisziplinen im Bereich der Raumentwicklung.<br />
Es soll und kann hier nicht darum gehen, diese Neuorientierung zu skizzieren oder gar fertige Lösungen<br />
auf all die neuen Problemstellungen aufzuzeigen. Doch ein Hinterfragen dessen, was sich bisher bewährt<br />
zu haben schien und ein Suchen nach den dringlich zu behandelnden aktuellen Themen ist jedenfalls<br />
angezeigt. Die im Folgenden thesenartig formulierten <strong>Prinzipien</strong> basieren auch nicht auf umfassenden<br />
Analysen. Sie widerspiegeln vielmehr die Diskussionen am <strong>IRAP</strong>, dem Institut für Raumentwicklung an<br />
der Hochschule für Technik Rapperswil. Der Stand dieser Diskussionen ist geeignet, die Thesen nach<br />
Aussen zu tragen, um das Gespräch darüber, was Bestand haben soll und was erneuerungswürdig ist,<br />
auch ausserhalb der Hochschule führen oder vertiefen zu können. Es handelt sich um je 7 Thesen zu<br />
Planungsgrundlagen und Planungsmethodik, <strong>zur</strong> Planungsethik und Rollenverteilung in der Raumordnung<br />
sowie <strong>zur</strong> Umsetzung d.h. zu instrumentellen Aspekten.<br />
Ausgehend von allgemeingültigen <strong>Prinzipien</strong>, wird versucht, Aussagen für die Raumentwicklung herzuleiten.<br />
Die Thesen sind in einer Weise formuliert, dass sie möglichst über die <strong>Raumplanung</strong> hinaus, für das<br />
Planen im Allgemeinen, für den Umgang mit Konfliktbehandlungen und für den Umgang mit dem Lebensraum<br />
generell, gültig sein können, im Kleinen wie im Grossen und unabhängig von politischen Grenzen.<br />
Sie sollen <strong>zur</strong> Theoriebildung in den Planungs- und Raumwissenschaften einen Beitrag leisten.<br />
1
1. Das Prinzip der Theoriebildung: Vom Unterschied zwischen Theorie und Realität<br />
Im Alltag wird der Unterschied zwischen Modellvorstellungen und Wirklichkeit oft verwischt, was zu gravierenden<br />
Fehlschlüssen führen und Fehlentscheidungen in Politik und Wirtschaft <strong>zur</strong> Folge haben kann.<br />
Das war bisher so und wird sich auch künftig kaum ändern. Dies mag trivial erscheinen. Ein unermüdliches<br />
Hinterfragen des Umstandes, dass wir Fehler begehen und das Aufdecken der Ursachen, weshalb<br />
diese begangen werden, ist deshalb unumgänglich.<br />
Bei Planungen – und allgemeiner bei planerischen und wissenschaftlichren Untersuchungen – werden<br />
verschiedene Elemente zum Gegenstand von Betrachtungen bzw. von Modellbildungen. Bereits in der<br />
Auswahl von Untersuchungs- bzw. Planungsgegenständen liegen erste Entscheidungen. Es werden zunächst<br />
Aspekte untersucht, welche für die Analyse der Phänomene einen hohen Erklärungswert aufweisen.<br />
Haben Erkenntnisse eine einfache Form, so stellt dies einen ersten Hinweis dar, dass sie sich für<br />
Verallgemeinerungen eignen. In der Verallgemeinerung liegt auch die Hoffnung und Erfahrung, dass sich<br />
Erkenntnisse aus anderen Disziplinen dank Analogieschlüssen auf das eigene Sachgebiet übertragen<br />
lassen.<br />
Auf diese Weise gefundene Erklärungen werden an weiteren Beispielen bzw. mittels Experimenten überprüft.<br />
Stossen sie nirgends auf Widersprüche bzw. können diese ausgeräumt oder ihrerseits erklärt werten,<br />
so verdichten sich Erklärungen zu Gesetzmässigkeiten. Es lassen sich ferner, vereinfachend gegenüber<br />
der Realität, Modelle entwickeln, welche diese zumindest in Teilaspekten zu erklären in der Lage<br />
sind.<br />
Es gilt Modelle und Planungstheorien zu entwickeln, die über die <strong>Raumplanung</strong> hinaus Gültigkeit haben;<br />
ihnen kommt in der Regel ein höherer Stellenwert zu, als fachspezifischen Theorien.<br />
Sie bilden sich häufig, wenn Untersuchungen bis zu jener Bearbeitungstiefe durchgeführt werden, dass<br />
die Resultate bzw. Planungslösungen in einfacher Form erscheinen. Theorien erhärten sich auf diese<br />
Weise nach und nach, wenn sie in der verallgemeinerten Anwendung zu keinen Widersprüchen mit der<br />
Realität führen.<br />
Modelle dürfen, auch wenn sie noch so perfekt erscheinen, dennoch nie mit der Realität verwechselt<br />
werden; Theorien können Prozesse noch so gut erläutern, sie erklären immer nur Aspekte der Wirklichkeit.<br />
2. Das Prinzip der komplementären Betrachtungsweisen<br />
Der Ausdruck der „komplementären Betrachtungsweise“ 1 meint, dass zwei sich zuwiderlaufende oder<br />
sich gar widersprechende Betrachtungsweisen nebeneinander Gültigkeit haben können, um bestimmte<br />
Phänomene erklären zu können.<br />
In diesem Sinne stehen Kausalität und Finalität nebeneinander und sind nicht – wie in der ersten Zeit<br />
nach Inkrafttreten des <strong>Raumplanung</strong>sgesetzes – gegeneinander auszuspielen. Individuelles und kollektives<br />
menschliches Verhalten lassen sich erklären sowohl als Folge der bisherigen Entwicklung als auch<br />
als Antwort auf Zukunftsbilder, Träume, Visionen. Der naturwissenschaftlich und philosophisch geführte<br />
Diskurs über die Teleologiefrage ist alt und bricht offenbar mehr oder weniger periodisch immer wieder<br />
auf. Die Frage, ob mit Blick auf Planungsaufgaben, das Ursache-Wirkungs-Denken im Vordergrund zu<br />
stehen hat oder ob Zukunftsbilder antizipiert werden müssen, wird hier in der Weise beantwortet, dass<br />
sich die beiden <strong>Prinzipien</strong> nicht ausschliessen, sondern dass beide zum Verständnis der individuellen und<br />
der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse notwendig sind.<br />
Planung soll analysierend Erfahrungswissen in Zukunftsstrategien übertragen; sie soll gleichzeitig anzustrebende<br />
Zukunftsbilder als Orientierungshilfe formulieren.<br />
2
3. Das Kausalitätsprinzip: Planung als Früherkennung, Prophylaxe und Problemlösungsprozess<br />
Die traditionelle Planungstheorie und Systemtechnik baut im wesentlichen auf dem Denkmuster auf, dass<br />
es bei Planungsaufgaben um die Lösung von Problemen geht. Dies ist an sich weiterhin ein richtiger Ansatz.<br />
Probleme haben ihre Ursachen; diese gilt es zu erfassen, künftig zu beeinflussen bzw. ihnen etwas<br />
entgegenzusetzen. Dabei soll das Einfluss- bzw. Handlungsfeld optimal ausgeschöpft werden. Die zu<br />
verfolgenden Ziele ergeben sich aus dem Bestreben, Probleme und Konflikte zu beheben oder zu mildern<br />
bzw. sie künftig zu vermeiden.<br />
Planung, als vorhausschauendes, prophylaktisches Handeln, fordert <strong>zur</strong>echt zweckmässige, d.h. aufgabengerechte<br />
Beobachtungsgrundlagen: Periodische statistische Erhebungen, Messreihen, Stichprobenermittlungen,<br />
Meinungsforschung, Raumbeobachtung usw. Diese dienen der Ursachen-Wirkungs-<br />
Analysen, der Zielfindung wie der Modellbildung und den Vorhersagen (Prognosen).<br />
Analysen sind unerlässlich für die Problemfrüherkennung, die Zielformulierung sowie die rechtzeitige<br />
Entwicklung von Konzepten, Strategien, Massnahmen und Programmen.<br />
4. Das Finalitätsprinzip: Planung, ausgehend von Visionen, erwünschten Entwicklungen<br />
und Zielen<br />
Antworten auf die Frage „Wohin soll die Reise gehen?“ lassen sich nicht in jedem Fall allein – nach dem<br />
Kausalitätsansatz - als Resultat des bisher Geschehenen verstehen. Zumindest in der Auseinandersetzung<br />
mit Fernzielen kommt, um mit Ernst Bloch zu sprechen, unseren Träumen, bzw. den Utopien eine<br />
grosse Bedeutung zu. Die Hoffnung stellt „die Energie <strong>zur</strong> Veränderung der Welt nach Massgabe unserer<br />
Wünsche bereit“ und vermittelt „diese Wünsche mit den objektiv realen Möglichkeiten der Welt und leitet<br />
zu planvollem Handeln an“. 2<br />
Wenn derzeit im Zusammenhang mit der erwünschten bzw. anzustrebenden Entwicklung häufig von „Visionen“<br />
gesprochen wird, so ist nicht hellseherisches Wissen, sondern es sind viel eher Zukunftsbilder im<br />
Sinne der Bloch’schen Utopien angesprochen.<br />
Zukunftsbilder und Ziele stehen in Wechselbeziehung zueinander: Aus Visionen lassen sich ganze Zielsysteme<br />
ableiten. Raumplanerische Visionen gehen dank ihrem räumlichen Bezug zum Beispiel von einer<br />
künftig erwünschten Entwicklung eines Ortes, einer Stadt, einer Region aus. Daraus lassen sich, im<br />
Vergleich mit der bisherigen Entwicklung, sowohl generelle Ziele als auch operable und operationale Ziele<br />
ableiten. Umgekehrt können bestimmte Ziele Zukunftsbilder erst auslösen: Ziele, wie die nachhaltige<br />
Entwicklung, der haushälterische Umgang mit dem Boden, die Erhaltung der Funktionstüchtigkeit einer<br />
Siedlung, hohe Gestaltqualität, vielfältiges kulturelles Leben, individuelle und gesellschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten<br />
oder Erhöhung des Wohlbefindens der Menschen können, zu einem Ganzen zusammengefügt,<br />
Visionen und Leitbilder erzeugen.<br />
Raumplanerische Zukunftsbilder, wie Visionen und Leitbilder, müssen einen Ortsbezug haben, d.h. auf<br />
die Frage Antwort geben: Wo ist was anzustreben? .<br />
5. Das Gegenstromprinzip<br />
Modelle dienen der analytischen wie der konzeptionellen Betrachtung von Entwicklungen, sie bilden die<br />
Realität jedenfalls in der Weise vereinfachend ab, dass die Zusammenhänge verständlich werden. Mittels<br />
Modellen können nur einige, nie aber alle Zusammenhänge erklärt werden. Gelegentlich hat man<br />
sich deshalb mehrerer Modelle gleichzeitig nebeneinander zu bedienen. Werden mittels dieses "Prinzips<br />
des Nebeneinanders" Prozesse betrachtet, so kann man sich auch schwer erfassbaren, komplexen Systemen<br />
nähern.<br />
Bei räumlichen Modellen bzw. Systemen sollen sich netzartige und zellenartige Betrachtungsweisen nicht<br />
gegenüberstehen, sondern müssen nebeneinander Platz haben. Typisch bei diesen räumlichen Modellen<br />
ist deren bildhafte, metapherartige Beschreibung der entsprechenden Modelle. Beim Netz sind es Fäden<br />
oder Bänder, die mittels Knoten zu Maschen verbunden werden. Es entstehen Maschenfelder bzw. Zwi-<br />
3
schenräume. Bei der Zellenbetrachtung werden demgegenüber einzelne Raumelemente - man beschränkt<br />
sich oft auch auf Flächenelemente - aneinander gefügt: Solche Modelle definieren ein Raumgefüge<br />
bzw. ein Patchwork von Elementen, welches gelegentlich einen Organismus höherer Organisationsstufe<br />
bildet.<br />
Beide Betrachtungsweisen eignen sich für gross- wie für kleinräumige Strukturen. Häufig gelangt man bei<br />
Netzsystemen von grob- zu feinmaschigen Betrachtungen während solche bei Zellsystemen eher von<br />
Einzelelementen zu Gesamtgefügen führen. Nationale und regionale Konzepte haben damit häufig Netzcharakter<br />
während lokale Planungsmodelle meistens zellenartig sind.<br />
Netzmodell und Zellenmodell sollen komplementär und zudem im Gegenstromprinzip, d.h. das Top-<br />
Down-Prinzip und das Bottom-Up-Prinzip gleichwertig nebeneinander, eingesetzt werden.<br />
6. Das Top-Down-Prinzip: Von übergeordneten Netzen zu den einzelnen Netzelementen<br />
Internationale, nationale und regionale Verkehrs-, Energie-, Versorgungs- und Kommunikationsnetze bilden<br />
einen wesentlichen Teil der Infrastruktur unserer Zivilisation. Die Siedlungsräume bzw. die Aktionsräume<br />
der Menschen entwickelten sich weitgehend im Einflussbereich dieser Netze. Zumindest lässt sich<br />
feststellen, dass die Verkehrs- und Versorgungsnetze sowie die Besiedlungsstrukturen in Wechselwirkung<br />
zueinander stehen. Analoge Beziehungen gibt es beispielsweise auch zwischen Lebensraumvernetzung<br />
und Populationsdichten.<br />
Basierend auf solchen Erkenntnissen werden Konzepte entwickelt, seien es Besiedlungs-, Verkehrs- oder<br />
Landschaftsentwicklungskonzepte. Aus dem Wissen beispielsweise, dass öffentliche Verkehrsnetze auf<br />
dicht besiedelte Räume bzw. Siedlungsachsen angewiesen sind, oder dass Ausgleichsflächen für die Erholungsnutzungen<br />
und aus ökologischen Gesichtspunkten vor allem in den dünnbesiedelten Maschenfeldern<br />
erhalten bleiben und gefördert werden sollen, ergeben sich räumliche Ordnungsmuster.<br />
Die Grundzüge der Raumordnung Schweiz und einige der darauf abgestimmten Konzepte der Kantone<br />
sehen entlang der Hauptachsen des Verkehrs denn auch die wichtigsten Siedlungsentwicklungsgebiete<br />
vor. Folgerichtig bilden die Knoten der Verkehrsnetze die Standorte für zentralörtliche Funktionen, Logistikzentren,<br />
Einkaufs- und Intensiverholungseinrichtungen. Bereiche um Stationen entlang den Hauptachsen<br />
des öffentlichen Verkehrs werden als Entwicklungsschwerpunkte behandelt, gewissermassen die<br />
"zentralen Orte" auf unterer Stufe. Regionale Netzstrukturen übernehmen in selbstähnlicher Weise das<br />
nationale Muster. Lokale und Stadtteilkonzepte gleichen, in einem anderen Massstab, jenen der Regionen.<br />
Auf diese Weise wird ein Modell, das Netzmodell, zu einem Planungsprinzip.<br />
Internationale, nationale und regionale Netze weisen die drei Elemente Bänder, Knoten und Zwischenräume<br />
auf. Siedlungs-/Verkehrsnetze werden – in der Regel nicht deckungsgleich – durch andere Netze<br />
überlagert, z.B. durch ökologische, soziale und Erholungsnetze.<br />
7. Das Bottom-Up-Prinzip: Von Zellen zu Organismen<br />
Von unten nach oben, vom Kleinen zum Grossen oder vom Einzelnen <strong>zur</strong> Gruppe gelangend, ergeben<br />
sich Gemenge von Einzelteilen bzw. Individuen und bei höheren Organisationsformen, komplexere Gebilde<br />
bzw. Organismen und Gesellschaften.<br />
In der Raumordnung kann ebenfalls von Zellen ausgegangen werden. Die kleinste Einheit im Siedlungsraum<br />
bildet in der Regel die Bauparzelle. Mehrere Parzellen mit einheitlicher Funktion oder Gestalt bilden<br />
die Siedlungszellen, mehrere solcher Siedlungszellen zusammen eine Gebietseinheit. Dabei handelt es<br />
sich um Stadtteile bzw. Ortschaften, d.h. um idealtypische kommunale <strong>Raumplanung</strong>seinheiten. Mehrere<br />
solcher Gebiets- bzw. <strong>Raumplanung</strong>seinheiten ergeben eine Planungsregion, sei dies eine städtische<br />
Agglomeration oder eine ländliche Region.<br />
Diese Betrachtungsweise enthält zugleich den Ansatz eines Planungszellenmodells: Einzelne Bauvorhaben<br />
beziehen sich in der Regel auf Parzellen, Gesamtüberbauungen auf Siedlungszellen (grössere auf<br />
Quartiere) und für kommunale Planungsaufgaben eignen sich die Gebiets- bzw. <strong>Raumplanung</strong>seinheiten.<br />
Mehrere dieser Einheiten zusammen bilden eine Planungsregion, welche sich für strategische Grundla-<br />
4
gen, d.h. für die Abwicklung konzeptioneller und programmatischer Aufgaben anbietet. Nach diesem Planungsmodell<br />
löst jede übergeordnete Planungsebene jene Aufgaben, welche die untergeordnete nicht in<br />
der Lage ist alleine zu tun. (vgl. Skalen gemäss „Netzstadt“ 3 )<br />
In traditionellen Strukturen entspricht die politische Gemeinde der Gebietseinheit. Zunehmend sind allerdings<br />
politische Abgrenzungen nicht mehr identisch mit funktional zweckmässigen Planungsperimetern.<br />
Bis in die Achtzigerjahre bildeten regionale Zweckverbände die nächst grössere Planungseinheit, in welchen<br />
die Gemeindeplanungen aufeinander abgestimmt und gemeinsame konzeptionelle Aufgaben wahrgenommen<br />
wurden. Mit Inkrafttreten des schweizerischen <strong>Raumplanung</strong>sgesetzes verloren die Regionalplanungen<br />
etwas an Bedeutung, weil sie durch die kantonalen Richtplanungen teilweise abgelöst wurden.<br />
Heute zeigen sich aufgrund dieser Veränderungen Planungsdefizite, indem sowohl in den Agglomerationen<br />
wie in den ländlichen Gebieten die strategischen Planungen der Regionen nicht in allen Teilen<br />
durch die kantonalen Planungen übernommen werden konnten.<br />
Es drängt sich eine neue Aufgabenteilung hinsichtlich Entwicklungs- und Verwaltungsaufgaben und deren<br />
zeitgerechte Abwicklung auf:<br />
Entwicklungsaufgaben in der <strong>Raumplanung</strong> sollen für die einzelnen Siedlungszellen gelöst werden. In der<br />
nächst grösseren Dimension (in den kommunalen Gebietseinheiten) sind die Entwicklungsstrategien und<br />
Massnahmen zu konkretisieren und umzusetzen, welche in Planungsregionen gemeinsam entwickelt<br />
worden sind.<br />
Die Instrumente dagegen, sind – unabhängig der funktional abgegrenzten Planungsebenen – nach wie<br />
vor in den politisch strukturierten, traditionellen Einheiten, den Gebietskörperschaften Bund, Kantone,<br />
Gemeinden zu verwalten.<br />
8. Das Verantwortungsprinzip und die Gerechtigkeitsethik<br />
Verantwortung lässt sich auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft beziehen.<br />
Wer Verantwortung für Vergangenes trägt, kann <strong>zur</strong> Rechenschaft gezogen werden. Bei Versäumnissen<br />
drohen rechtlich vorgesehene Verfahren, mit dem Ziel der Wiedergutmachung und / oder der Bestrafung.<br />
Verantwortung für die Gegenwart wird oft mit „moralisch handeln“ gleichgesetzt. Dabei gilt es, im Sinne<br />
der Gerechtigkeitsethik zumindest zwei Aspekte zu beachten. Zunächst soll das Handeln gut sein, d.h.<br />
klug, authentisch, auf die individuelle und die kollektive Interessenlage bezogen und es soll begründet<br />
sein. Es gibt insbesondere pragmatische und ethische Gründe. Das Handeln ist ferner moralisch, wenn<br />
es solidarisch (bezogen auf Gruppen und global) geschieht, wenn es für alle gleichermassen gut ist,<br />
wenn alle gleichberechtigt beachtet werden, wenn es von allen Betroffenen akzeptiert werden kann und<br />
wenn es verallgemeinerungsfähig ist.<br />
Bei der Verantwortung für die Zukunft geht es um das „Prinzip Verantwortung“ im Sinne von Hans Jonas,<br />
d.h. um eine Präventiv-Verantwortung, um eine „Sorge-für-Verantwortung“. 4 Im Zentrum steht dabei nicht<br />
allein der Mensch, sondern die Menschheit und deren langfristige Existenz. Damit ist zugleich die Existenzgrundlage,<br />
die Natur, angesprochen.<br />
Wer hat bei räumlichen Aspekten welche Verantwortung wahrzunehmen? Bezüglich der Versäumnisse<br />
der Vergangenheit stehen jene Probleme und Konflikte im Vordergrund, welche in der Gegenwart nachwirken<br />
und welche Sanierungen erforderlich machen. Dabei geht es um Altlasten (Bodenschutz), um<br />
Gewässerverschmutzung, Lärm- und Luftbelastungen, Landschaftsschäden, ökologische Verarmung,<br />
siedlungsgestalterische und infrastrukturelle Defizite (Gefahren, Verkehrskollapse) usw. Die Verursacher<br />
solcher Sanierungsaufgaben können häufig nicht eindeutig definiert werden, lassen sich nur schwer<br />
ausmachen, existieren nicht mehr oder können nicht <strong>zur</strong> Rechenschaft herangezogen werden. Die Folgen<br />
hat damit die öffentliche Hand zu tragen.<br />
Dem Gemeinwesen wird auch primär die Verantwortung für die Funktionstüchtigkeit der Infrastruktur zugeordnet.<br />
Mit der Privatisierung bisher öffentlicher Aufgaben und der Liberalisierung der Gesetzesgrundlagen<br />
kommt den politischen Gebietskörperschaften allerdings mehr und mehr die Funktion zu, lediglich<br />
noch die Voraussetzungen zu schaffen, dass wirtschaftlich organisierte Unternehmen Infrastrukturaufgaben<br />
wahrnehmen können. Die Gemeinwesen haben ferner dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung und<br />
die Wirtschaft ihre Bedürfnisse befriedigen können (Service public). Dazu gehört insbesondere auch,<br />
dass die weitere Besiedlung innert nützlicher Frist durch Neu- und Umbauten bedürfnisgerecht erfolgen<br />
5
kann. Sie haben dabei Ziele und Grundsätze zu beachten, wie das Prinzip Nachhaltigkeit, die haushälterische<br />
Bodennutzung, die erwünschte Gesamtentwicklung, eine geordnete Form der Besiedlung usw.<br />
Dies geschieht im Sinne der <strong>Raumplanung</strong> auch präventiv. Die <strong>Raumplanung</strong>sgesetzgebung ist hinsichtlich<br />
solcher Grundsätze und Ziele, aber auch mit der konkret ausformulierten Planungspflicht und dem<br />
Mitwirkungsgebot einer Ethik verpflichtet, die eine landesweite Solidarität anstrebt. Dabei geht es nicht<br />
um eine umfassende Gleichstellung aller Menschen, sie wäre ohnehin allein schon angesichts eines Bodenrechts,<br />
welches das private Grundeigentum zum Gegenstand hat, in ihrer absoluten Form unmöglich.<br />
Durch die Gesetze werden Verantwortungen dem Gemeinwesen zugeordnet; <strong>zur</strong> Wahrnehmung dieser<br />
Verantwortung fehlen dem Gemeinwesen jedoch einige wesentliche Mittel bzw. sie sind ihm nach und<br />
nach entzogen worden. Auch die Strukturierung der politischen Hoheitsgebiete erschwert ein effizientes<br />
Wahrnehmen der territorialen Verantwortungen.<br />
Jeder Einzelne hat deshalb seinen - und insbesondere auch die Akteure der Wirtschaft, die Grundeigentümer<br />
und die Interessengruppen haben ihren – Teil der Verantwortung zu übernehmen, d.h. sie haben<br />
gemäss den Einflussmöglichkeiten gerecht, gut und solidarisch zu handeln.<br />
9. Das Prinzip Transparenz und Selbstdeklaration<br />
Kenntnisse über Vergangenes, über die gegenwärtige Situation, über Zusammenhänge und Entwicklungen<br />
sind in der Regel unvollständig. Vorhersagen, soweit sie möglich sind, können nur ungenau sein. Die<br />
Folgen des Handelns lassen sich in der Regel nur abschätzen. Wenn verantwortliches Agieren auch darin<br />
besteht, unter Berücksichtigung der Neben- und Fernwirkungen zu handeln, so ist damit auch eine<br />
Pflicht verbunden: Der Verantwortungsträger hat sich entsprechendes Wissen zu verschaffen, wenigstens<br />
soweit es verfügbar und in dem Masse als es verhältnismässig ist.<br />
Wer handelt, hat sich darüber Rechenschaft abzugeben, worin die Auswirkungen bestehen könnten, was<br />
er darüber weiss und was er nicht weiss. Nicht nur sich selbst gegenüber ist diese Transparenz erforderlich,<br />
sondern auch gegenüber den Betroffenen. Hans Jonas fordert in diesem Zusammenhang eine Haltung<br />
der Furcht; er schliesst „die Heuristik der Furcht befähigt zum Vorausdenken.“<br />
Wer ein Projekt befürwortet bzw. wer eine Technik anwendet, wird beweispflichtig. Diese Forderung enthält<br />
nichts mehr und nichts weniger als die Umkehr der Beweislast, wie sie im Strafrecht üblich ist. Dort<br />
wird die Unschuld so lange angenommen, als die Schuld nicht bewiesen ist. Verantwortung in Bezug auf<br />
die Gegenwart und die Zukunft macht nun erforderlich, dass die Unschädlichkeit eines neu entwickelten<br />
Stoffes, die Gefahrlosigkeit einer neuen Technik, Erfindung bzw. eines Vorhabens nachgewiesen ist.<br />
Dem Verursacherprinzip folgend, ist zu deklarieren, was die Auswirkungen des Handelns sein könnten,<br />
insbesondere auch welches und wie sicheres Wissen darüber besteht. Es kann nicht Sache einer Bewilligungs-,<br />
Genehmigungs- bzw. Kontrollinstanz sein, solche Nachweise zu erbringen. Deren Aufgabe liegt<br />
vielmehr darin, Nachweise einzufordern und sie zu prüfen.<br />
Im Bau-, Planungs- und Umweltrecht ist diese Selbstdeklarationspflicht verbreitet und differenziert ausgeprägt.<br />
Plangenehmigungs-, Baubewilligungs- und Konzessionsverfahren sichern formal diese Pflicht.<br />
Auch bei der Kontrolle durch die zuständigen Behörden geht die Formalisierung recht weit: Zweckmässigkeitsprüfung<br />
für bedeutende raumwirksame und Umweltverträglichkeitsprüfung für grössere umweltrelevante<br />
Vorhaben. Damit können inhaltliche Qualitäten aber nicht abschliessend sichergestellt werden,<br />
auch wird in der Praxis zwischen Selbstdeklaration (Nachweis) und Kontrolle nicht durchwegs sauber getrennt.<br />
Das planungsmethodische Wissen über den Umgang mit Unsicherheit und Ungenauigkeit ist vielerorts<br />
ungenügend verbreitet. Es werden bei Kenntnisnotstand auch selten Korrekturmechanismen im<br />
Entscheidungsprozess mit eingebaut.<br />
Wer raum- und umweltwirksam handeln will, hat transparent zu machen, worin das Wissen über Nebenund<br />
Fernwirkungen liegt und was vorgesehen ist, um negativen Auswirkungen sowohl präventiv als auch,<br />
wenn diese später unerwartet auftreten, begegnen zu können.<br />
6
10. Das Entsprechungsprinzip von Kompetenzen und Verantwortung<br />
Der Begriff Kompetenz hat zwei Bedeutungen: Kompetenz meint zunächst Fähigkeiten (Jemand ist in<br />
seinem Fachgebiet kompetent). Kompetenz bedeutet aber auch Zuständigkeiten (Jemandem kommt die<br />
Kompetenz zu, Entscheidungen zu fällen, Massnahmen durchzuführen, etwas verfügen zu dürfen). Kompetenzen<br />
(im zweiten Sinne) sollen nur jenen Personen übertragen werden, die hierzu kompetent (im ersten<br />
Sinne) sind.<br />
Kompetenzen, in den beiden Wortbedeutungen, verpflichten zu Verantwortung. Die für einen bestimmten<br />
Sachbereich Zuständigen müssen in diesem Kompetenzbereich verantwortungsbewusst handeln. Wer<br />
Fähigkeiten besitzt - dies ist weit weniger selbstverständlich – soll, allein kraft seiner Fähigkeiten, Verantwortung<br />
übernehmen. Diese ethische Forderung wendet sich sowohl an Intellektuelle, an Personen<br />
mit Erfindungs- und Schöpfungskraft, als auch an solche mit sozialen oder handwerklichen Kompetenzen.<br />
Es geht dabei um ein solidarisches, d.h. dem Gemeinwohl und der individuellen Entwicklung verpflichtetes<br />
Nutzen der dem Individuum eigenen Talente.<br />
Nun muss aber auch die Umkehrung in all ihren Dimensionen gelten: Wer Verantwortung übernehmen<br />
muss, dem sollen entsprechende Kompetenzen zukommen, d.h. Befugnisse und Zuständigkeiten, aber<br />
auch die erforderlichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Zu dieser ethischen Forderung gesellt<br />
sich eine politische: Nur wer bereit und in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen, dem sind entsprechende<br />
Kompetenzen zu übertragen.<br />
Wem kommt territoriale Verantwortung zu? Und die Frage der Kompetenz: Wer ist in der Lage, Verantwortung<br />
für den Raum und die Umwelt zu übernehmen? „Der Staat?“. In der Schweiz handelt es sich<br />
primär um ein sorgfältig abgestuftes Kompetenznetz aus Staat, Kantonen und politischen Gemeinden.<br />
Die Deregulierung und die Privatisierung bisher öffentlicher Aufgaben verringern allerdings die staatlichen<br />
Kompetenzen im Sinne der Lenkungsmöglichkeiten vor allem in den operativen Bereichen. Strategien,<br />
die in Wahrnehmung von Verantwortlichkeiten entwickelt werden, können damit nicht, bzw. nicht mehr<br />
optimal umgesetzt werden. Es entstehen Defizite, wo sich Kompetenzen und Verantwortung nicht mehr<br />
entsprechen.<br />
Wem die Kompetenz zukommt, Standorte und die Nutzung von Einrichtungen festzulegen sowie Tätigkeiten<br />
auszuüben, welche wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt, auf deren Nutzung oder auf andere<br />
raumwirksame Aufgaben haben, soll auch hinsichtlich der Neben- und Fernwirkungen die Verantwortung<br />
wahrnehmen. Die Akteure sollen erst dann handeln dürfen, wenn sie nachgewiesen haben, wie sie dieser<br />
Verantwortung gerecht werden können.<br />
Das Gemeinwesen soll über ein Instrumentarium verfügen, welches erlaubt, der gemeinsam festgelegten<br />
Strategie gerecht, Einfluss auf die Standortentscheide sowie die Nutzung von Gebieten (Räumen) und<br />
Einrichtungen nehmen zu können. Auch Sanktionsmöglichkeiten müssten für die Erfüllung dieser Aufgabe<br />
vorhanden sein.<br />
11. Das Entsprechungsprinzip von Macht und Verantwortung sowie von Rechten und<br />
Pflichten<br />
Kompetenzen sind mit Macht verbunden. Wer Kompetenzen zuteilt bzw. abtritt (delegiert), übt in dieser<br />
Übertragung Macht aus. Wer Kompetenzen zugeteilt erhält, dem wird damit neu eine Machtposition verschafft.<br />
Diese Macht hat dabei verschiedene Gesichter, sie wird wirksam im Ausüben der Kompetenzen,<br />
d.h. in der Art und Weise, wie Kompetenzen wahrgenommen werden.<br />
Die politische Macht tritt als Gesetz, d.h. als Verbot bzw. als Erlaubnis, in Form einer Bewilligung oder<br />
Ablehnung eines Gesuches, als Einschränkung oder Erweiterung des Handlungs- und Bewegungsspielraumes<br />
in Erscheinung. Dabei geht es um Macht kraft Erlass- oder Weisungsbefugnis. Abhängig von der<br />
Verfügungsgewalt über Kapital, wird Macht in den getätigten Investitionen sichtbar aber auch in den potentiell<br />
möglichen wirksam: Macht kraft Portefeuille. Werden Regeln missachtet, Gesetze verletzt, so tritt<br />
sie in Form von Strafen oder Handlungseinschränkungen usw. auf: Macht kraft Sanktionsbefugnis.<br />
Die Entsprechung von Macht und Verantwortung erfährt mit ihrer zukunftsorientierten Dimension (gemäss<br />
Hans Jonas) eine Erweiterung: Macht ist auch mit Blick auf ihre Neben- und Fernwirkungen hin auszuüben.<br />
Die Formel – aus der Grundgesetzgebung (Verfassung) vertraut - wonach wer Rechte für sich in<br />
7
Anspruch nimmt, damit auch Pflichten zu übernehmen hat, lässt sich aufgrund des angesprochenen Prinzips<br />
Verantwortung in zweifacher Weise konkretisieren. Rechte und Pflichten, bzw. Macht und Verantwortung<br />
haben sich zu entsprechen (nicht nur das eine folgt aus dem andern).<br />
Macht verpflichtet <strong>zur</strong> Verantwortung. Nur wer dazu bereit ist, soll Macht ausüben dürfen.<br />
12. Das Prinzip der Konsensfindung: Diskursethik<br />
Zu den demokratischen Entscheidungsprozessen gehören, nach schweizerischem Verständnis, in erster<br />
Linie die Gemeindeversammlungen und Urnengänge. Das Mehrheitsprinzip, welches dabei <strong>zur</strong> Anwendung<br />
kommt, ist weitgehend auch Muster für kleinere Gremien, sei es in Legislativ-, Exekutiv- oder richterlichen<br />
Behörden; selbst im Vereinswesen werden Mehrheitsentscheide mittels Abstimmungsverfahren<br />
gefällt. Das Mehrheitsprinzip steht der diskursiven Konsensfindung gegenüber. Diese bildet in vielen<br />
Exekutivgremien, in Kommissionen und bei Entscheidungsträgern der Privatwirtschaft ganz selbstverständlich<br />
ein zentrales Entscheidfindungsprinzip. Nur wenn keine Einigung zustande kommt, wird mittels<br />
Abstimmungen auf Mehrheitsentscheide <strong>zur</strong>ückgegriffen.<br />
Die Diskursethik, wie sie von Jürgen Habermas 5 und Karl-Otto Apel vertreten wird, setzt auf den Konsens;<br />
es geht um die Verpflichtung, Konsens anzustreben. „Im Argumentieren müssen sie (die Teilnehmer)<br />
pragmatisch voraussetzen, dass im Prinzip alle Betroffenen als Freie und Gleiche an einer kooperativen<br />
Wahrheitssuche teilnehmen können, bei der einzig das bessere Argument zum Zuge kommen<br />
darf.“ 6 Dies bedeutet, dass bei fairen Bedingungen nach einem unparteiischen Ausgleich der Interessen<br />
bzw. der Konflikte gesucht wird und setzt ein Solidaritätsverhalten voraus, das zumindest zwei Momente<br />
umfasst: Die Gleichbehandlung und der gleichmässige Respekt vor der Würde eines jeden. Die Diskursethik<br />
rechnet mit der Überzeugungskraft des Argumentes, welches aber nicht mit der Fähigkeit des Argumentierens<br />
gleichgesetzt werden darf. Sie kann gar mit dieser in Widerspruch stehen. Auch daraus erklärt<br />
sich die Forderung nach fairen Bedingungen für alle.<br />
Bei komplexen Entscheidungssituationen bzw. bei schwierigen Entscheidungsinhalten, wie sie bei raumund<br />
umweltrelevanten Aufgaben die Regel sind, bedeuten faire Bedingungen insbesondere auch, dass<br />
die Diskursgegenstände „diskursfähig“ aufbereitet sind. Dies geschieht zum Beispiel in der Bildung von<br />
Varianten bzw. Szenarien: Bei der Suche nach der anzustrebenden Entwicklung soll mit Varianten etwa<br />
der Handlungsspielraum abgedeckt und abgesteckt werden.<br />
Bei Entscheidungssituationen bzw. in Konfliktlösungsprozessen (selbst in Friedensverhandlungen) sind<br />
zumindest vier Stufen der Konsensbildung zu beobachten:<br />
• Die Parteien einigen sich grundsätzlich, z.B. darin, ein Infrastrukturproblem gemeinsam lösen zu<br />
wollen (bzw. Frieden zu schliessen).<br />
• Sie kommen im besten Fall überein, konkrete Massnahmen einzuleiten, z.B. einen Verkehrsknoten<br />
zu sanieren (bzw. die Truppen <strong>zur</strong>ück zu ziehen und sie zu entwaffnen).<br />
• Wenn dies nicht möglich ist, versuchen die Parteien schrittweise Lösungen des Konfliktes zu entwickeln<br />
und umzusetzen, sie einigen sich auf eine Vorgehensstrategie.<br />
• Sollte dies nicht gelingen, werden nächste Verhandlungen terminiert oder zumindest ein gegenseitiges<br />
Orientieren über allfällige den Einigungsprozess beeinflussende einseitige Schritte vereinbart,<br />
man einigt sich auf einen ersten Stabilisierungsschritt.<br />
Für die Konsensbildung sind Hilfen bereitzustellen, in Form von echten Argumenten, der Darlegung des<br />
Entscheidungs- bzw. Handlungsspielraumes und der Konsensstufen.<br />
Die in der <strong>Raumplanung</strong> bereits instrumentell verankerten vier Stufen der Konsensbildung sind konsequent<br />
zu nutzen. (siehe Prinzip 18)<br />
13. Das Prinzip Partizipation<br />
Demokratie kann als Herrschaftsform aufgefasst werden, in welcher die Macht beim Volk liegt. Dabei<br />
können die einzelnen Bürger alle gleichermassen staatsbürgerliche Rechte ausüben und insbesondere in<br />
sozialer Gleichheit an Entscheidungen beteiligt werden. Mit dem Begriff Partizipation wird dieses Demokratieprinzip<br />
zum einen aufgeweitet und zum andern relativiert. Bei der Partizipation geht es nicht nur um<br />
Entscheidungskompetenzen, sondern vielmehr um die Beteiligung an den Entscheidungsprozessen. Da-<br />
8
mit sind auch die Entwicklung von Projekten bzw. Lösungen sowie deren Beurteilung und Auswahl, d.h.<br />
die Entscheidungsvorbereitungen angesprochen. Bereits bei der Umschreibung der Projekte und Aufgaben,<br />
der Auswahl von Experten, bei der Erteilung von Aufträgen, der Vorbereitung von Beurteilungsgrundlagen,<br />
der Beurteilung von Aus-, Neben- bzw. Fernwirkungen von Vorhaben und der Sichtung der<br />
Interessen werden Teilentscheide gefällt.<br />
Selbstverständlich können aus rein praktischen Gründen nicht jederzeit alle Interessierten und alle Betroffenen<br />
am Entscheidungsprozess teilnehmen. Es sind vielmehr die Voraussetzung zu schaffen, dass sich<br />
diese mit vertretbarem Aufwand, ihren Interessen entsprechend, optimal einbringen können. In der<br />
Schweiz ist für <strong>Raumplanung</strong>sprozesse der Rahmen der Partizipation durch die Gesetzgebung mit dem<br />
Informations- und Mitwirkungsgebot umschrieben. Die Bevölkerung muss bei Planungen in geeigneter<br />
Weise mitwirken können. Damit ist es aber der Verantwortung der Planungsträger überlassen, festzulegen,<br />
wie sie den Kreis der Bevölkerung eingrenzt und worin die geeignete Weise liegt. Betroffen ist in der<br />
Regel auch ein schwierig zu bestimmender Kreis der im Gebiet Wohnenden und Arbeitenden sowie der<br />
sich dort erholenden, vergnügenden und der dort einkaufenden Menschen.<br />
Es kann allerdings sinnvoll nur mitwirken, wer angemessen informiert ist. Mitwirkende sollen dank den<br />
verfügbaren und verdaubaren Informationen in die Lage versetzt werden, mitwirken zu können. Mit dieser<br />
Forderung verbindet sich die Notwendigkeit einer Konzentration der Information und der Partizipationsmöglichkeiten<br />
auf zentrale Inhalte zu bestimmten Zeitpunkten im Planungsablauf in denen effektiv Einfluss<br />
genommen werden kann. Dieses Verständnis von Partizipation bedeutet eine enorme politische und<br />
organisatorische Herausforderung, welche in der Schweiz bisher nur auf kommunaler Ebene befriedigend<br />
bewältigt worden ist. Auf dieser Ebene lassen sich in direktdemokratischer Weise faire Partizipationsformen<br />
praktizieren.<br />
Vermutlich muss auch für übergeordnete Planungsentscheide die Partizipationsebene jene der Siedlungseinheiten<br />
d.h. der Gemeinde bzw. des Stadtteils sein. In diesem Rahmen können die Auswirkungen<br />
regionaler Vorhaben und bundesweiter Konzepte beurteilt werden. Kommunale Partizipation bedeutet<br />
dann zum Beispiel Stellungnahme zu übergeordneten Planungen aus Sicht der Siedlungseinheit und in<br />
Verantwortung für das Ganze. Die Stellungnahme würde nach diesem Modell in basisdemokratischer<br />
Weise, d.h. in einem öffentlichen Diskurs unter den Betroffenen und Interessierten, erarbeitet.<br />
Basisdemokratische Partizipationsformen tragen <strong>zur</strong> Qualitätsverbesserung der Entscheide und <strong>zur</strong> Erweiterung<br />
des kreativen Potentials bei.<br />
Um nicht als Instrument im politischen Machtspiel missbraucht zu werden, muss Transparenz des Motivs<br />
jedes Teilnehmers für seine Partizipation gefordert werden.<br />
14. Das Vertretungsprinzip: Die Anwalts- und Treuhänderfunktion<br />
Die direkte Demokratie bzw. die Partizipation der Betroffenen und Interessierten stösst an Grenzen, insbesondere<br />
wenn der Kreis der Betroffenen gross ist und es rein praktisch nicht möglich ist, dass sich alle<br />
Interessierten im offenen Diskurs einbringen können. Der Gegenstand und die den Entscheid betreffenden<br />
Zusammenhänge können so komplex sein, dass es für die Betroffenen schwierig ist, sich ausreichend<br />
damit auseinanderzusetzen. Planungsprozesse machen häufig unzählige kurzfristig zu treffende<br />
Entscheide notwendig, was partizipatorische Verfahren überfordern würde. Selbst Gremien können zu<br />
träge sein, um zeitgerecht über alle wichtigen Details befinden zu können.<br />
Innerhalb unseren politischen Strukturen hat sich ein ausgeklügeltes, weitgehend gut funktionierendes<br />
Delegationssystem entwickelt. Abgestuft nach Bedeutung und Tragweite, liegen die Entscheidungskompetenzen<br />
beim Volk, beim Parlament, bei der Exekutivbehörde oder bei der Verwaltung. Diese Zuständigkeitsordnung<br />
besteht in der Schweiz auf allen drei politischen Ebenen, auf Ebene von Bund, Kantonen<br />
und Gemeinden.<br />
Das Delegationssystem birgt die Gefahr in sich, dass an den Betroffenen und Interessierten vorbei geplant<br />
und entschieden wird. Selbst wenn diese in optimaler Weise an den Prozessen partizipieren können,<br />
kann dieser Problematik nur teilweise begegnet werden. Denn auch für die Partizipation gilt, was<br />
oben für die direkte Demokratie ausgeführt wurde: In partizipatorischen Prozessen treten ebenfalls Personen<br />
auf, die sich im Namen anderer Personen äussern. Im Unterschied zu politischen Gremien handelt<br />
es sich dabei aber in der Regel um nicht gewählte, oft um selbst ernannte „Anwälte“ von Interessengruppen,<br />
um Sprecher von Minderheiten, Vertreter von Vereinen usw. Darin liegt an sich nichts Negatives.<br />
9
Denn, wer sonst könnte beispielsweise im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzipes die Interessen der künftigen<br />
Generationen wahrnehmen?<br />
Offiziell konstituierte Verbände werden oft <strong>zur</strong> Vorbereitung eines politischen Entscheides um ihre Meinung<br />
angefragt. Im Unterschied zu solchen Konsultations- und Vernehmlassungsverfahren, die auf gezielter<br />
Einladung basieren, spricht die Partizipation alle Betroffenen und Interessierten an. Lassen sich<br />
diese vertreten, so ist schwierig zu erkennen, in wessen Namen sich ein Treuhänder äussert. Dies ist allerdings<br />
nicht von allzu grosser Bedeutung. Im Sinne der Diskursethik zählt in erster Linie das Argument.<br />
Ausserdem sind nicht alle Interessierten und Betroffenen in der Lage, sich zu äussern.<br />
Gerade wenn die Meinung jedes Einzelnen gefragt ist, was insbesondere in der <strong>Raumplanung</strong> mit dem<br />
Mitwirkungsgebot gemeint ist, muss beachtet werden, dass nicht alle Menschen in gleicher Weise fähig<br />
sind, sich zu äussern. Es sollen also, stellvertretend für kleine Kinder, für der geschliffenen Sprache nicht<br />
Mächtige, für Abwesende oder für künftige Generationen, Personen auftreten und im öffentlichen Diskurs<br />
Anwaltsfunktionen übernehmen. Die damit verbundene Forderung ist noch wichtiger als bei der Delegation<br />
von politischen Kompetenzen, weil Treuhänder und Anwälte keinen Wahlkampf durchlaufen müssen:<br />
Es gehört <strong>zur</strong> Fairness der an Partizipation Beteiligten klarzulegen, welches Quartier sie beispielsweise<br />
vertreten, oder dass sie sich im Interesse eines bestimmten Sportvereins äussern, dass sie als Angehörige<br />
einer Umweltorganisation oder als Verwaltungsrat einer Firma sprechen.<br />
Viele Betroffene und Interessierte können sich nicht äussern. Sie sollen sich in partizipatorischen Prozessen<br />
vertreten lassen können.<br />
Im öffentlichen Diskurs ist transparent zu machen, welche Interessen vertreten werden: Es ist zu deklarieren,<br />
in welchem Namen jemand teilnimmt.<br />
Argumente gewinnen an Kraft, wenn die Motive ehrbar und bekannt sind.<br />
15. Das Prinzip der Planungspflicht<br />
Das <strong>Raumplanung</strong>sgesetz (RPG) verlangt, dass Bund, Kantone und Gemeinden die für ihre raumwirksamen<br />
Aufgaben nötigen Planungen erarbeiten und sie aufeinander abstimmen. Daraus lässt sich ableiten,<br />
dass sich auch Planungen mit grenzüberschreitenden Perimetern, d.h. dass Planungen für Gebiete,<br />
die nicht mit den Grenzen politischer Körperschaften übereinstimmen, ebenfalls der Planungspflicht unterliegen.<br />
Raumwirksame Projekte von privaten Trägern, welche gelegentlich wesentlich tiefgreifendere<br />
und langfristigere Folgen haben, sind dieser Gesetzesnorm dagegen nicht verpflichtet.<br />
Zur Abstimmung mit anderen Planungen lassen sich die Träger privater Vorhaben in der Regel noch bewegen,<br />
da daraus sich ergebende allseitige Vorteile offensichtlich sein können. Die weiteren Aspekte der<br />
Planungspflicht, wie sie im RPG umschrieben sind, betreffen zwei planungsethische Regeln, die sich nur<br />
sehr schwer auf private Planungsträger übertragen lassen. Zum einen geht es ganz allgemein und umfassend<br />
um die Beachtung der räumlichen Auswirkungen der Tätigkeiten und zum andern um das Erfordernis,<br />
den nachgeordneten Instanzen (Behörden) den <strong>zur</strong> Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Ermessensspielraum<br />
zu lassen.<br />
Angesichts der veränderten politischen Situation seit das RPG in Kraft getreten ist, sind Erweiterungen<br />
bezüglich der Definition der Planungspflicht angezeigt. Mit der Privatisierung bisher öffentlicher Aufgaben<br />
müssen, im Sinne einer Konkretisierung des Verantwortungsprinzips, Koordinationsaufgaben durch private<br />
Akteure mitgetragen werden. Hierzu ein Beispiel: Die Privatisierung des Telekommunikationswesens in<br />
Verbindung mit der Verbreitung der Mobiltelefone führte in der Schweiz zunächst zu einer Panne bei der<br />
Koordination der Standortplanung für Antennenanlagen, weil mit der Privatisierung die entsprechende<br />
Planungspflicht nicht geregelt wurde.<br />
Die Umweltverträglichkeitsprüfung strebt eine Interessenabwägung unter Beachtung der wirtschaftlichen,<br />
technischen und umweltrelevanten Aspekten an; sie greift allerdings erst im Stadium der Projektierung<br />
und nicht – wie in vielen Fällen erforderlich – bei der Festlegung von Standorten, d.h. bereits in der Konzeptphase.<br />
Daraus und in Konkretisierung des Prinzipes Nachhaltigkeit begründet sich die Forderung,<br />
dass auch private Akteure hinsichtlich raum- und umweltwirksamen Vorhaben in den Planungsprozess<br />
mit eingebunden werden müssen.<br />
10
Auch private Instanzen, die raum- und umweltwirksam agieren, sind der Planungspflicht zu unterstellen.<br />
Die Planungspflicht umfasst die Abstimmungs- und Koordinationspflicht, ferner - auch im Sinne des<br />
Nachhaltigkeitsprinzips - die Beachtung von Auswirkungen, d.h. von Neben- und Fernwirkungen sowie<br />
die Beachtung eines Ermessens- und Handlungsspielraumes für die in Hierarchie und Zeit nachgeordneten<br />
Instanzen.<br />
16. Das Subsidiaritätsprinzip<br />
Unterstehen alle Akteure der Planungspflicht, so kann das Verantwortungsprinzip besser greifen. Selbst<br />
wenn private Akteure ihre Pflichten nicht wahrnehmen sollten, müssten zunächst kommunale Planungsinstanzen<br />
stellvertretend die Aufgaben auf Kosten der säumigen Verantwortlichen übernehmen. Dem<br />
Subsidiaritätsprinzip folgend, wären bei Überforderung kommunaler Planungsträger zunächst regionale<br />
bzw. kantonale und schliesslich Bundesstellen angesprochen.<br />
Dieses Prinzip stösst allerdings an politische Grenzen die darin bestehen, dass es äusserst unpopulär ist,<br />
ersatzweise (subsidiär) für eine in der Hierarchie untergeordnete Ebene Planungen und Entscheidungen<br />
vorzunehmen und dann erst noch die Kosten dafür in Rechnung zu stellen. Kommt dazu, dass die nicht<br />
zeitgerechte Erfüllung einer Planungspflicht oft nur sehr schwer eindeutig festgestellt werden kann. Es<br />
gibt allerdings Fälle, wo subsidiäres Handeln angefordert wird. Wenn beispielsweise mehrere gleichgestellte<br />
Träger auf eine Kooperation und Koordination angewiesen sind, die aber durch eine Minderheit<br />
blockiert werden, wird gelegentlich der Antrag an die übergeordnete Instanz gestellt, stellvertretend einen<br />
Planungsprozess einzuleiten oder ihn gar durchzuführen.<br />
Ersatzvornahmen von Planungen bzw. Entscheidungen durch übergeordnete Instanzen stellen eine relativ<br />
sanfte Sanktions-Massnahme dar, bestünde nicht das Finanzierungsdilemma. Durch übergeordnete<br />
Instanzen initiierte, geleitete oder moderierte Entscheidungs- und Planungsprozesse werden in der Regel<br />
recht gut akzeptiert, wenn die Betroffenen und die Vertreter der an sich zuständigen Planungsebene im<br />
Prozess mit eingebunden sind und mitentscheiden können. Das Dilemma entsteht meistens nur aus dem<br />
Umstand, dass diese dabei gleichwohl <strong>zur</strong> Kasse gebeten werden. Denn das Prinzip „Wer befiehlt, soll<br />
auch bezahlen!“ wird durchbrochen.<br />
Dem Dilemma könnte durch Fördermittel begegnet werden. Es liegt nahe, dass gleichzeitig mit der Erweiterung<br />
der Planungspflicht (Prinzip 15) und einer konsequenten Handhabung der Ersatzvornahme bei<br />
Versäumnissen auch Mittel bereitgestellt werden. Übergeordnete Instanzen sollen sich an Planungen finanziell<br />
beteiligen und zwar bei zeitgerechter Planungspflichterfüllung wie bei säumigen Planungsträgern<br />
durch Ersatzvornahmen. Die Planungsverantwortlichen haben, gewissermassen im Gegenzug, darüber<br />
Bericht zu erstatten, inwiefern sie mit ihrer Planung die Planungspflichten erfüllen. Diese Form der<br />
Selbstdeklaration, wie sie bei Nutzungsplänen in der Schweiz vorgeschrieben ist (Art. 47 RPV), soll für alle<br />
Planungen zu einem Mittel der Qualitätssicherung werden.<br />
Planungs- und Entscheidungskompetenzen haben so nahe wie möglich beim Akteur und Betroffenen zu<br />
liegen. Übergeordnete Kontrollinstanzen sollen nur subsidiär eingreifen. Ersatzvornahmen bei Versäumnissen<br />
sind konsequent vorzunehmen. Die verantwortungsbewusste Erfüllung der Planungspflicht kann<br />
aber vermutlich nur erreicht werden, wenn sie durch den Staat gemäss dessen Kontrollkompetenzen<br />
subventioniert wird.<br />
17. Das Prinzip des stufengerechten Planungsmittels: Instrumente und deren Verbindlichkeit<br />
Öffentlich-rechtliche Festlegungen haben die Form von Erlassen (Gesetze, Verordnungen) und Verfügungen<br />
(z.B. Bewilligungen). Privatrechtliche Vereinbarungen kennen wir in Form von Verträgen und,<br />
wenn sie verbindlich den Boden betreffen, als Eintragungen im Grundbuch (Bodenkataster).<br />
Mit den Plänen nach <strong>Raumplanung</strong>srecht steht ein Instrumentarium <strong>zur</strong> Verfügung, welches ein differenziertes<br />
Festlegen von strategischen, konzeptionellen als auch programmatischen Inhalten ermöglicht. Es<br />
handelt sich dabei um Pläne mit Informations- oder Inventarcharakter, welche unverbindlich bleiben kön-<br />
11
nen, um Pläne, welche für die Behörden und um solche, welche für jedermann, insbesondere auch für die<br />
Eigentümer verbindlich sind.<br />
Die Forderung nach stufengerechtem Eisatz der Planungsmittel umfasst drei Mindestanforderungen an<br />
das Instrumentarium:<br />
• Strategische Inhalte sowie konzeptionelle Grundsätze und Abstimmungen, insbesondere betreffend<br />
Netzstrukturen, Standorte von Einrichtungen mit zentraler Bedeutung, funktioneller Zusammenhänge<br />
usw.: Sie werden in unverbindlichen Grundlageplänen dargestellt und – soweit sie behördenverbindlich<br />
sein sollen – in Richtplänen umgesetzt.<br />
• Programmatische Inhalte und die einzelnen Umsetzungsmassnahmen werden in behördenverbindlicher<br />
Weise in Richtplänen aufeinander abgestimmt oder – soweit sie nur beispielhaften Charakter<br />
haben sollen – als Testplanungen, Ideenkataloge und Beispielsammlungen in unverbindlicher Form<br />
festgehalten.<br />
• Soweit der Rahmen für private oder öffentliche Vorhaben verbindlich festgelegt werden soll, z.B. die<br />
Abgrenzung des Baulandes gegenüber dem Nichtbauland, die zulässige Nutzungsdichte und Nutzungsart,<br />
die Erschliessung usw., ist ein Planungsinstrument erforderlich, dessen Festlegung einen<br />
fairen, die betroffenen Eigentümer mit einbeziehenden Planungsprozess ermöglicht. In der Schweiz<br />
handelt es sich dabei um die Nutzungspläne in all ihren Ausprägungen.<br />
Solange grössere raum- und umweltrelevante Vorhaben allein der Planungshoheit der Gemeinwesen unterlagen,<br />
die privaten Vorhaben allein projektbezogen im Rahmen der Baubewilligungs-, Projektgenehmigungs-<br />
bzw. Konzessionsverfahren beurteilt werden konnten, genügten die drei erwähnten Stufen der<br />
Verbindlichkeit und die drei Mindestanforderungen an das Planungsinstrumentarium. Sind jedoch bei<br />
strategischen, konzeptionellen und programmatischen Planungen auch private und gemischtwirtschaftliche<br />
Träger beteiligt und Abstimmungen notwendig, genügen die <strong>Raumplanung</strong>sinstrumente nicht mehr.<br />
Wo beispielsweise Masterpläne entwickelt wurden, mussten die Inhalte zum Teil mittels Vertragswerken<br />
verbindlich erklärt werden. Diese haben den Nachteil, dass sie zwar kündbar, nicht aber – mit Rücksicht<br />
auf den Rechtsschutz – in jedem Fall an neue Gegebenheiten angepasst werden können, denn im Unterschied<br />
zu Plänen können Verträge bei Bedarf nicht kraft eines behördlichen Aktes zwingend aktualisiert<br />
werden. Entweder wird Einigkeit unter allen Partner erzielt oder eine zweckmässige Anpassung ist ohne<br />
entsprechende Rechtsgrundlage nicht möglich.<br />
Daraus entsteht die Forderung nach einem neuen Planungsinstrument, das Planungsresultate für private<br />
und gemischtwirtschaftliche Träger verbindlich festzulegen erlaubt. Dieses neue Instrument soll wie die<br />
vertrauten <strong>Raumplanung</strong>sinstrumente aktualisiert, angepasst und geändert werden können. Fordert man<br />
gemäss Prinzip 15 eine Planungspflicht auch für private Träger, so gewinnt ein solches neues Instrument<br />
an Bedeutung.<br />
Auf allen Planungsebenen gibt es strategische, konzeptionelle und programmatische Planungsinhalte.<br />
Die Forderung nach dem stufengerechten Planungsmittel meint den jeweils richtigen Einsatz von unverbindlichen,<br />
behördenverbindlichen bzw. allgemeinverbindlichen Planungsinstrumenten.<br />
Ähnlich dem Richtplan ist ein Planungsinstrument neu zu schaffen, das für alle beteiligten öffentlichen<br />
und privaten Akteure verbindlich ist und durch politische Behörden, basierend auf Mehrheitsentscheidungen<br />
unter allen Beteiligten, geändert werden kann.<br />
18. Das Prinzip der abstimmungsgerechten Festlegungen und Vereinbarungen<br />
In Problem- und Konfliktlösungsprozessen und bei der Entwicklung von Massnahmen oder der Konkretisierung<br />
von Ideen geht es, den <strong>Prinzipien</strong> der Konsensfindung folgend, um Abläufe, während denen auf<br />
verschiedenen Stufen Übereinstimmung erreicht werden kann (siehe Prinzip 12):<br />
• im Grundsätzlichen<br />
• in der konkreten Massnahme<br />
• bezüglich des weiteren Prozessablaufes<br />
• hinsichtlich erster zielsichernder Massnahmen<br />
Dabei sind, unter Beachtung der <strong>Prinzipien</strong> der Planungspflicht, die drei Aspekte des Abstimmungsgebotes<br />
zu beachten:<br />
• die Interessenabwägung, d.h. die Ermittlung, Bewertung und Beachtung der betroffenen Interessen<br />
• die Aus-, Neben- und Fernwirkungen der erwogenen Handlungen<br />
12
• der mit den erwogenen Massnahmen verbleibende Handlungs- und Ermessensspielraum für die in<br />
der Hierarchie und der Zeit nachgeordneten Akteure.<br />
Wo ein Abstimmungsstand erreicht ist, der festgehalten oder gar verbindlich vereinbart werden soll, hat<br />
dies, analog der 4 Stufen der Konsensbildung, stufengerecht und transparent zu erfolgen. Wenn man<br />
sich grundsätzlich über die Notwendigkeit einer Konfliktlösung einig ist, bedeutet dies noch nicht, dass<br />
man sich bei der zu ergreifenden Massnahme einig ist. Vielleicht lässt sich aber eine Einigung hinsichtlich<br />
des Planungs- und Entscheidfindungsprozesses finden. Zumindest einigen sich die Verantwortlichen vielleicht<br />
auf den Rahmen möglicher Lösungen und das dadurch betroffene Gebiet sowie auf Massnahmen<br />
<strong>zur</strong> Erhaltung der Realisierbarkeit.<br />
Diese Vierstufigkeit ist mit dem Instrumentarium der <strong>Raumplanung</strong> umgesetzt:<br />
• Grundsätze werden als solche in strategischen Instrumenten wie Leitbildern, sog. Grundzügen, Strukturkonzepte<br />
oder integriert als Leitsätze in Richtplänen behandelt.<br />
• Vereinbarungen, welche hinsichtlich der Ausgestaltung von Massnahmen definitiv getroffen werden<br />
können, da die Interessenabwägung abschliessend hat stattfinden können, werden in den Richtplänen<br />
als Festsetzung behandelt.<br />
• Vereinbarungen über den Prozessablauf führen in den Richtplänen zu Zwischenergebnissen.<br />
• Vereinbarungen hinsichtlich der zielsichernden Massnahmen, selbst noch recht visionäre Ideen und<br />
langfristige Massnahmen, werden als Vororientierung bezeichnet.<br />
Solche Richtplanvereinbarungen sind für die Behörden verbindlich und können im selben Prozess, wie<br />
sie getroffen werden, jederzeit aktualisiert, geändert oder weiterentwickelt werden. Vertragliche Vereinbarungen<br />
unter und mit privaten Akteuren bzw. die mit Prinzip 17 geforderten neuen Planungsinstrumente<br />
sollen nach denselben Vereinbarungsstufen konkretisiert werden.<br />
Instrumente die Vereinbarungen festhalten und sichern, insbesondere Richtpläne und das neu zu schaffende<br />
Planungsinstrument für alle Typen von Akteuren sollen Festlegungen in vier Stufen, d.h. im Grundsätzlichen,<br />
in der Massnahme, im Verfahren bzw. in der Zielsicherung enthalten können.<br />
Diese Festlegungsstufen sind transparent darzustellen.<br />
19. Das Prinzip Nachhaltigkeit und der Faktor Zeit<br />
Das Prinzip Nachhaltigkeit verbindet die Forderung nach Erfüllung dreier Verträglichkeiten, nämlich der<br />
ökologischen, der gesellschaftlichen und der wirtschaftlichen Verträglichkeit unseres Tuns. Dies betrifft<br />
gleichsam unsere Handlungen und deren Vorbereitung, unsere Aktivitäten und unsere Planungen. Die<br />
Forderung bezieht sich auf den eigenen Aktionsraum als auch auf andere Räume, insbesondere auch auf<br />
weniger privilegierte Regionen und Weltgegenden. Ferner geht es einerseits um die Auswirkungen in der<br />
Gegenwart und andererseits in der Zukunft: Im Sinne des Prinzips Verantwortung (Hans Jonas) ist die<br />
„Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden“ sicherzustellen.<br />
Hier liegt eine der grössten Herausforderungen der Wissenschaft, der Gesellschaft und der Politik und<br />
damit auch der Planungsdisziplinen: Sie haben Beurteilungs- und Entscheidungsgrundlagen bereitzustellen,<br />
welche erlauben, in dieser umfassenden Verantwortung zu handeln. Es geht darum, die sich in der<br />
Zeit verändernden Faktoren und die regionalen Umverteilungsmechanismen bei der Abschätzung der<br />
Auswirkungen von Handlungen zu berücksichtigen und diese verständlich und glaubhaft darzustellen.<br />
Solche Grundlagen sind auf den Handlungsbedarf und den Einflussbereich der Akteure abzustimmen.<br />
Das Prinzip Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Verträglichkeit unseres Handelns, hinsichtlich<br />
• Ökologie, Gesellschaft und Wirtschaft<br />
• aller Weltregionen<br />
• Der Gegenwart und der Zukunft.<br />
Das Wissensdefizit darüber worum es bei der Umsetzung des Prinzips Nachhaltigkeit geht, inwiefern Tätigkeiten<br />
Aus- und Nebenwirkungen verursachen können und worin die Einflussmöglichkeit der Akteure<br />
liegt, gilt es zu beheben bzw. durch anhaltende Bemühungen zu verringern.<br />
13
20. Das Prinzip der Kooperation<br />
In kleinen Aktionseinheiten lässt sich sehr effizient arbeiten, insbesondere hinsichtlich zeitlichem, personellem<br />
und finanziellem Aufwand. Grosse Produktions-, Entscheidungs- bzw. Verwaltungsapparate reagieren<br />
in der Regel träger auf Veränderungen und sind damit kleinen, schlanken Organisationsformen unterlegen.<br />
Grosse und komplexe Vorhaben erfordern dagegen vielschichtige Fachkompetenzen und eine<br />
Leistungsfähigkeit, wie sie nur grosse Unternehmen anbieten können. Sowohl bei öffentlichen, d.h. bei<br />
staatlichen Verwaltungsapparaten als auch bei privatwirtschaftlichen Betrieben erzielt man bisweilen eine<br />
hohe Effizienz mit Organisationsstrukturen, die auf teilautonomen, kleinen Einheiten beruhen. Umgekehrt<br />
erreichen kleine und mittlere Betriebe dank zweckmässiger Vernetzung und Kooperation effiziente Strukturen<br />
und eine Leistungsfähigkeit wie Grossfirmen.<br />
Vorhaben sind oft nur realisierbar, wenn verschiedene Akteure mit sich ergänzenden Kompetenzen zusammenarbeiten,<br />
zunehmend findet dies in Kooperation von öffentlichen und privaten Instanzen statt.<br />
Privaten Akteuren kommt neben den öffentlichen Körperschaften eine wachsende Bedeutung sowohl als<br />
Planungsträger wie auch als Realisatoren von grösseren umwelt- und raumrelevanten Vorhaben zu. Viele<br />
Planungen und Realisierungsprozesse werden deshalb in kooperativen Verfahren abgewickelt. Damit<br />
können Entscheidungsabläufe vielmals auch beschleunigt und erleichtert bzw. überhaupt erst ermöglicht<br />
werden. Wie bei rein öffentlichen Planungen besteht das Resultat bei kooperativer Vorgehensweise aus<br />
konzeptionellen Inhalten (z.B. in Form von Masterplänen) und aus programmatischen Teilen (z.B. Realisierungsprogrammen,<br />
Einzelmassnahmen).<br />
Mit dem <strong>zur</strong> Diskussion gestellten neuen Planungsinstrument, das den Festlegungen in gemischtwirtschaftlichen<br />
Planungen optimal gerecht zu werden vermag (Prinzip 17), werden private Planungsträger in<br />
die Planungspflicht mit eingebunden. Wo solche Instrumente fehlen oder nicht eingesetzt werden können,<br />
bleibt jedenfalls die Forderung, dass in kooperativen Planungsprozessen die Verpflichtungen und Verantwortungen<br />
der Partner gegenseitig respektiert werden müssen.<br />
Kooperative Planungsformen schaffen Situationen, in denen Synergien in grösserem Ausmasse möglich<br />
werden und in denen Planungen hinsichtlich Qualität der Resultate und zeitlichem Ablauf optimiert werden<br />
können.<br />
Gleichzeitig können die Planungspflichten in allseitiger Anerkennung der Verantwortungen in umfassender<br />
Weise wahrgenommen werden.<br />
<strong>21</strong>. Das Prinzip der Korrigierbarkeit<br />
Noch so sorgfältig abgewogene und mit allen Interessen abgestimmte Entscheidungen und Handlungen<br />
können sich als falsch bzw. fehlerhaft erweisen. Dies liegt häufig an der Nichtvorhersehbarkeit der Entwicklung,<br />
der Unvollständigkeit des Wissens bzw. der Ungenauigkeit, mit denen eine Entwicklung vorhergesagt<br />
werden kann.<br />
Wissend um diese Makel bei der Auseinandersetzung mit der Zukunft, geht es darum, Handlungsstrategien<br />
zu entwickeln: Feste, nicht korrigierbare Lösungen sind dagegen zu vermeiden oder erst im letzt<br />
möglichen Zeitpunkt, wenn die neusten Erkenntnisse noch einfliessen können, zu fällen. Oft ist es noch<br />
besser, Entscheidungen und Handlungsanweisungen in Varianten zu entwickeln, um in Abhängigkeit des<br />
Veränderungsprozesses die zweckmässigste noch wählen zu können. Planungsresultate können dann<br />
die Form von „Wenn ... dann“ – Aussagen haben. (Wenn sich die Entwicklung A einstellt, dann ist die<br />
Massnahme X zu treffen; wenn aber B eintritt, dann gilt die Massnahme Y.)<br />
Massnahmen kommt eine Qualität hinsichtlich ihrer Korrigierbarkeit zu: Wenn sie sich als falsch erweisen,<br />
sollten sie ersetzt, geändert, verbessert werden können. Was für Einzelmassnahmen gilt, lässt sich<br />
auch für Konzepte aussagen: Diese sollen flexibel sein, d.h. an neue Erkenntnisse und Randbedingungen<br />
abgepasst werden können.<br />
Die Forderung nach Flexibilität und Korrigierbarkeit gilt gleichsam auch für Organisationsformen, Planungsprozesse<br />
wie Planungsinstrumente. Die rasche Anpassungsfähigkeit von Planungsinstrumenten<br />
steht scheinbar in Widerspruch <strong>zur</strong> Forderung nach einer bestimmten Rechtsbeständigkeit von Gesetzen<br />
und Plänen. Doch das Prinzip Flexibilität bezieht sich in erster Linie auf Planungsinstrumente mit Verbindlichkeit<br />
für die Behörden und allgemein für die Planungsakteure. Wird es allerdings auch auf eigentümer-<br />
14
verbindliche Festlegungen angewendet, so muss das Änderungsverfahren nach längerfristigen und kurzfristig<br />
anpassbaren Inhalten sowie nach Tragweite der Änderungen differenziert werden.<br />
Die Planungsverfahren sollen unterscheiden zwischen längerfristig verlässlichen Inhalten und Elementen,<br />
die kurzfristig an neue Gegebenheiten angepasst werden dürfen.<br />
Beständigkeit sowie Flexibilität und Interpretationsspielraum sollen nebeneinander, für jeweils bestimmte<br />
Inhalte anwendbare <strong>Prinzipien</strong> darstellen, und dies in behördenverbindlichen, in akteurverbindlichen und<br />
in eigentümerverbindlichen Plänen.<br />
Quellen<br />
1 Der Ausdruck „komplementäre Betrachtungsweise“ ist dem Atomphysiker Niels Bohr entliehen, zitiert<br />
nach Werner Heisenberg: Der Teil und das Ganze, München 1969<br />
2 Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt 1959<br />
3 Peter Baccini, Franz Oswald: Netzstadt, Zürich 1999<br />
4 Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt 1979<br />
5 Jürgen Habermas: Erläuterungen <strong>zur</strong> Diskursethik, Frankfurt 1991<br />
6 Ebenda, S. 154<br />
15