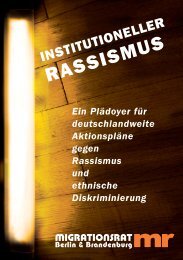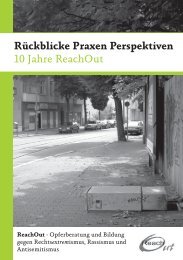Muslimische Kinder und Jugendliche in Deutschland - Konrad ...
Muslimische Kinder und Jugendliche in Deutschland - Konrad ...
Muslimische Kinder und Jugendliche in Deutschland - Konrad ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
34 35Schulformen die soziale Herkunft der <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n relativhomogen gehalten wird.Am Beispiel des Ruhrgebiets ist diese Entwicklung deutlich erkennbar.So wird häufig von dem Sozialäquator des Ruhrgebiets gesprochen (vgl.Kerst<strong>in</strong>g u.a. 2009). Geme<strong>in</strong>t ist hierbei die Autobahn 40 (Ruhrschnellweg/ B1). Nördlich der A40 ist die Sozialhilfe- <strong>und</strong> Arbeitslosenquotedeutlich höher, die Übergangsquote zum Gymnasium deutlich niedriger<strong>und</strong> der Ges<strong>und</strong>heitszustand der dort lebenden <strong>K<strong>in</strong>der</strong> deutlich schlechterals südlich der A40. Und im Norden des Ruhrgebiets leben auch mitgroßem Abstand die meisten Menschen mit Migrationsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>. DiesesSüd-Nord-Gefälle ist <strong>in</strong> allen Städten des Ruhrgebiets messbar – <strong>in</strong>anderen Ballungsgebieten <strong>Deutschland</strong>s ist e<strong>in</strong>e solche Differenzierungder Wohnverhältnisse <strong>in</strong> vergleichbarer Weise nachweisbar. Hieran wirdexemplarisch deutlich, dass die Integrationsebenen Erwerbsarbeit, Bildungsniveau<strong>und</strong> soziale Beziehungen im „kle<strong>in</strong>en Raum”, also <strong>in</strong>nerhalbder Stadt bzw. <strong>in</strong> Stadtteilen <strong>in</strong> Ersche<strong>in</strong>ung treten. Und es wird deutlich,dass die Integrationsebenen sich wechselseitig bed<strong>in</strong>gen.2.4. Emotionale Integration: Identität(en)Die drei genannten Bereiche laufen <strong>in</strong> der letzten Ebene der Integrationzusammen: die emotionale Integration. Sie ist nicht direkt bee<strong>in</strong>flussbar.Sie leitet sich vielmehr davon ab, <strong>in</strong>wieweit man sich mit <strong>Deutschland</strong>oder mit dem Wohnort identifiziert. Es ist leicht nachvollziehbar, dassman sich als gut gebildeter Mensch, der perfekt deutsch spricht, e<strong>in</strong>enguten Arbeitsplatz hat <strong>und</strong> viele bzw. <strong>in</strong>tensive soziale Beziehungen zuDeutschen pflegt, eher mit <strong>Deutschland</strong> identifizieren kann. Allerd<strong>in</strong>gsmuss ebenso erwähnt werden, dass die Möglichkeit, sich mit <strong>Deutschland</strong>zu identifizieren, auch mit der Mehrheitsgesellschaft zusammenhängt.Es wird auch sehr gut <strong>in</strong>tegrierten muslimischen Menschen nicht leichtgemacht, sich dazugehörig zu fühlen – wie u.a. die e<strong>in</strong>gangs zitiertenAussagen des arabischen Arztes zeigen. 5 Die emotionale Integration istalso gewissermaßen die Königsdiszipl<strong>in</strong>: Sie ist komplex, beruht auf Subjektivität<strong>und</strong> ist nicht mit Kausalität erklärbar.In der Migrationsforschung wird häufig von e<strong>in</strong>em Zustand „zwischenden Stühlen” gesprochen. Geme<strong>in</strong>t ist hiermit, dass sich Migranten derzweiten <strong>und</strong> dritten Generation weder zu der e<strong>in</strong>en noch zu der anderennationalen bzw. kulturellen Identität zugehörig fühlen. Dieser problembehafteteBef<strong>und</strong> liegt im Kern dar<strong>in</strong> begründet, dass man deutlicheDifferenzerfahrungen im Herkunftsland der Eltern sowie <strong>in</strong> der deutschenMehrheitsgesellschaft erkennt <strong>und</strong> erfährt. Die Tatsache, dass man sichnicht als Deutscher <strong>und</strong> nicht als Türke bzw. Araber fühlt, kann allerd<strong>in</strong>gsauch mit der Metapher des „dritten Stuhls” <strong>in</strong>terpretiert werden(vgl. Badawia 2002). Damit ist e<strong>in</strong>e hybride Identität umzeichnet, diee<strong>in</strong> Deutscher mit arabischen Wurzeln folgendermaßen konkretisiert:„Wenn ich sage, ich b<strong>in</strong> deutsch, aber nicht wie die Deutschen, <strong>und</strong>marokkanisch, aber nicht wie die Marokkaner, das ist für Deutsche e<strong>in</strong>Rätsel” (Badawia 2006, S. 183).Diese dritte Identität ist e<strong>in</strong>e Herausforderung, da viele Syntheseleistungendes Ichs selbstständig entwickelt werden müssen, <strong>und</strong> gleichzeitige<strong>in</strong>e große Chance, da die Widerstandsfähigkeit des <strong>Jugendliche</strong>n gestärktwird <strong>und</strong> der erweiterte Erfahrungsschatz e<strong>in</strong>e enorme Ressourcedarstellen kann. Die <strong>in</strong>ternational ausgerichtete Wirtschaft hat mit derStrategie des Diversity Managements bereits darauf reagiert. Die beschleunigteDynamik <strong>und</strong> Prozesshaftigkeit dieser hybriden Identitäten,nämlich weder deutsch noch ausländisch zu se<strong>in</strong> <strong>und</strong> trotzdem beideszugleich, führen unweigerlich zu komplexen Anforderungen an dieHeranwachsenden. Deutschen fällt es bereits schwer zu erläutern, wasDeutschse<strong>in</strong> bedeutet. Entsprechend stehen Migrantenjugendliche vore<strong>in</strong>er doppelten Herausforderung, da sie zwar e<strong>in</strong> Mehr an Möglichkeitender Identitätsbildung haben, allerd<strong>in</strong>gs auch e<strong>in</strong> Weniger an Orientierung.Vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> ist das Phänomen zu verstehen, dass sich die<strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> selbst als Türken bzw. Araber sehen. Dabeiist ihr Referenzpunkt nicht das tatsächliche Heimatland ihrer Eltern –darüber wissen sie <strong>in</strong> der Regel relativ wenig – sondern vielmehr e<strong>in</strong>eVorstellung, e<strong>in</strong> Narrativ desselben. Es wird gewissermaßen e<strong>in</strong>e Wunschvorstellungder eigenen Herkunft aufrechterhalten, was psychologischbetrachtet durchaus funktional ist. Fühlt man sich nicht zugehörig,gleichberechtigt oder erwünscht, dann werden Vorstellungen entwickelt,die es erleichtern, mit diesem subjektiv wahrgenommenen Zustand zuleben. Zu e<strong>in</strong>em Problem wird dies, wenn die ersten Erfahrungen mitdem Heimatland der Eltern gemacht werden. Beispielsweise werdendie türkeistämmigen <strong>Jugendliche</strong>n aus <strong>Deutschland</strong> <strong>in</strong> der Türkei als„Deutschländer” bezeichnet <strong>und</strong> damit wird e<strong>in</strong>e deutliche Abgrenzungkonstruiert. Ähnlich ist auch die häufig beobachtbare Selbstbeschreibungals Muslim zu <strong>in</strong>terpretieren. Die <strong>Jugendliche</strong>n suchen <strong>in</strong> dieser Kategorie