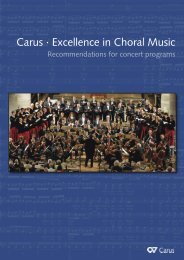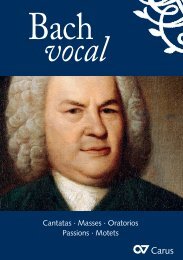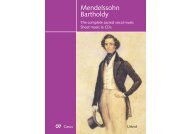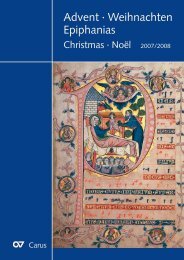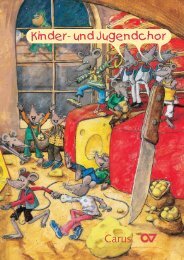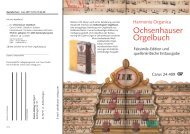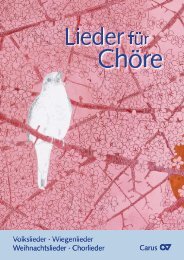Leseprobe - Carus
Leseprobe - Carus
Leseprobe - Carus
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
tributes zur Kennzeichnung von Musikern. Doch hier scheint es fast, als bestünde<br />
eine Verbindung zwischen dem Standbild des Gottes der Musik und<br />
dem Komponisten. Die Statue, der Kopf des Komponisten als helles Aufmerksamkeitszentrum<br />
des Bildes und die Notenblätter bilden zusammen ein Dreieck.<br />
Während Haydn reglos dargestellt ist und sein Blick geradeaus ins Leere,<br />
nach Innen gleichsam, geht, erscheint die Apoll-Figur belebt und aktiv: Sie<br />
blickt genau zu Haydn, und der Strahl, der diagonal von Apoll auf den Komponisten<br />
fällt, stellt recht eigentlich die Quelle für das Licht dar, das sein Gesicht<br />
hervorhebt. Teil dieser Suggestion von Aktivität auf Seiten des Musikgottes<br />
ist auch, dass sein Leierspiel echt wirkt. Haydns passive Haltung wäre<br />
insofern als Darstellung des Hörens zu deuten: Haydn lauscht den Klängen<br />
Apolls; eine besonders aparte Variante des Mythos von der göttlichen Inspiration<br />
des Komponisten.<br />
Viel weniger auffällig ist dann die im Halbdunkel des rechten Bildhintergrundes<br />
aufgestellte Büste, die bildkompositorisch ein Pendant zur Statue bietet. In<br />
Physiognomie und Beschriftung ist sie als Johann Sebastian Bach ausgewiesen,<br />
ergänzt mithin Musik-Mythos und Inspiration durch Tradition und Musik-<br />
Geschichte. Überraschend ist diese Bildidee nun gleich in mehrerer Hinsicht:<br />
Zum einen gab es um 1800 zwar Haydn-, aber keine Bach-Büsten, sondern lediglich<br />
Ölporträts und darauf basierende Kupferstiche, zum anderen ist Bach<br />
nicht derjenige Komponist, dem man allgemein viel Einfluss auf Haydn zuschreibt.<br />
Sein Sohn Carl Philipp Emanuel Bach oder Händel hätten hier viel<br />
näher gelegen.<br />
2. Ikonographische Spurensuche<br />
Das Haydn-Porträt von Neugaß lässt sich lesen wie eine spezifische Zusammenstellung<br />
von Zitaten aus der Tradition bestimmter Bildmotive, deren Identifizierung<br />
dieses erstaunliche Bild zu entschlüsseln hilft. Beginnen wir mit<br />
Haydn selbst: Eine Postierung wie bei Neugaß ist für einige Haydn-Darstellungen<br />
seit den 1790er Jahren bezeugt. Die größte Ähnlichkeit in der Erfindung<br />
weisen dabei die Porträts von Ludwig Guttenbrunn, A. M. Ott/Francesco Bartolozzi<br />
und Johann Zitterer auf. In der Porträtminiatur von Ott, die Francesco<br />
Bartolozzi 1791 in einem Londoner Stich ausführte, sitzt Haydn nach rechts<br />
gewandt ebenfalls in einem Armlehnstuhl an einem Tisch mit Notenblättern,<br />
seine Haltung ist hier freilich deutlich aktiver: Er hält die Feder – nur kurz das<br />
Schreiben unterbrechend – über dem Papier und schaut den Betrachter direkt<br />
an. Bei Guttenbrunn und Zitterer sitzt Haydn nach links gewandt an einem Klavier.<br />
Während Guttenbrunn Blickwinkel und fiktive Betrachterposition so<br />
7