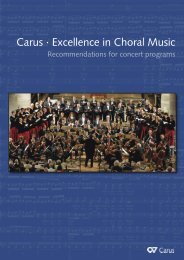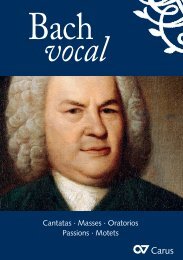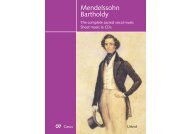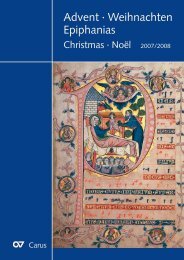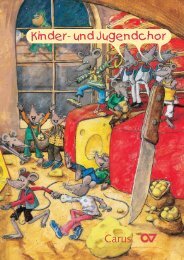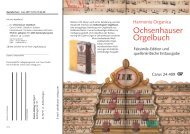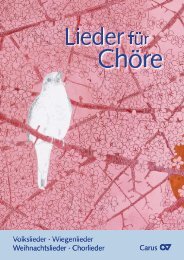Leseprobe - Carus
Leseprobe - Carus
Leseprobe - Carus
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
dem Medaillon ein – freilich sitzender – Apoll mit Leier, Draperie und übergeschlagenem<br />
linken Bein, der seinerseits auf die Darstellung des Apoll in einem<br />
Gemälde von Simon Vouet (1590–1649) anspielen könnte (Abb. 4).<br />
Dennoch bleibt die Bach-Büste in dem Haydn-Bild ein ikonographisches Kuriosum:<br />
Vor der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es sonst keine Komponisten-Bildnisse,<br />
in denen historische Traditionslinien thematisiert werden.<br />
Zwar hatte Felix Mendelssohn Bartholdy in seinem Leipziger Arbeitszimmer<br />
neben einer Goethe- tatsächlich auch eine Bach-Büste stehen, aber Teil seiner<br />
offiziellen Ikonographie wurde diese nicht. Daher dokumentiert das Gemälde<br />
von Neugaß außer dem Ruhm Haydns auch die sich zu diesem Zeitpunkt konsolidierende<br />
Kanonisierung Bachs. Ob Neugaß dabei aber tatsächlich eine Facette<br />
von Haydns Selbstverständnis zur Darstellung brachte, oder nicht vielmehr<br />
als Zeuge der Berliner Bach-Begeisterung agierte, wäre in einem<br />
nächsten Schritt zu fragen.<br />
3. Zur Entstehung des Bildes<br />
Bis im Zuge der Restaurierung des Bildes für die große Jubiläumsausstellung<br />
der Esterházy-Privatstiftung in ihrem Eisenstädter Schloss 2009 (mit dem sinnigen<br />
Titel „Haydn explosiv“) die Jahreszahl unter der Signatur des Malers<br />
eindeutig als 1806 identifiziert werden konnte, waren verschiedene Datierungen<br />
für das Neugaß’sche Haydn-Porträt im Umlauf. 1 Und spätestens, seit Robbins<br />
Landon ein Dokument gefunden hatte, in dem Neugaß den Fürsten Esterházy<br />
um die Abnahme seines Gemäldes bat, galt das Werk als Auftrag der<br />
Fürsten, die schon zwei frühere Bildnisse, darunter das Guttenbrunn-Porträt,<br />
bestellt hatten. 2 Dabei hatte Max Unger bereits 1910 die entscheidenden Informationen<br />
zur Datierung und Entstehung des Bildes gefunden. Er publizierte<br />
nämlich einen im Archiv der Firma Pleyel aufbewahrten Brief des Malers an<br />
Ignaz Pleyel vom 6. Januar 1806, in dem dieser von seiner Arbeit an einem<br />
Haydn-Porträt berichtet. 3 Aus diesem Brief geht hervor, dass er bereits vor ei-<br />
1 Die häufig begegnende Datierung auf 1801 geht auf Emil Vogel und einen Aufsatz über die überlieferten<br />
Haydn-Bildnisse zurück (in: Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 1898). H. C. Robbins Landon las<br />
in dem Gemälde 1805 (Haydn. Chronicle and works 5: The late years, London 1977, S. 350, Abb. als<br />
plate 1), eine Datierung, die Ludwig Finscher, Haydn und seine Zeit, Laaber 2000, 2 2002, S. 515, übernahm.<br />
2 Landon, Chronicle and works 5, S. 350.<br />
3 Max Unger, „Das Haydn-Bildnis von J. Neugaß im fürstlichen Schlosse zu Eisenstadt“, in: Neue Musik-<br />
Zeitung 31 (1910), S. 9–11. Der Brief ist seitdem, von einer englischen Übersetzung abgesehen (In: Letters<br />
to Beethoven and other correspondence, hrsg. v. Theodore Albrecht, Lincoln 1996, Bd. 1, Nr. 111,<br />
S.173f.) nicht wieder zur Kenntnis genommen worden.<br />
9