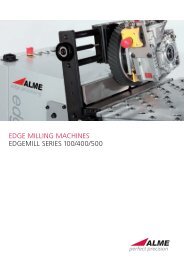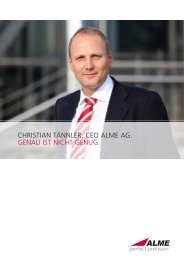Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kurzporträts der Aussteller nach Hallen 4 - 57<br />
Ausstellerliste 58 - 62<br />
Anreise, Tickets & Unterkunft 63<br />
Produkte und Dienstleistungen 64<br />
Geländeplan 64<br />
Serviceangebot vor Ort 64<br />
Wichtige Informationen 64<br />
Investitionskosten für kmU ebenso wie der reine<br />
Laserschweißprozess nur begrenzt einsetzbar.<br />
Doch bei einer Kombination aus Lichtbogen- und<br />
Laserprozess muss der Laser nicht zwangsläufig die<br />
Aufgabe des Schweißens übernehmen, sondern<br />
kann auch zur Stabilisierung und zur Lenkung des<br />
Lichtbogens eingesetzt werden. Das grundlegende<br />
Prinzip des lasergeführten und stabilisierten<br />
Schweißens (LGS) beruht auf der Wechselwirkung<br />
des Lichtbogens mit dem Laserstrahl, wobei der<br />
benötigte Anteil der Laserleistung zur Gesamt -<br />
energiebilanz nur 10-20 % beträgt. Mittels eines<br />
in der Wellenlänge speziell auf den Lichtbogen -<br />
prozess abgestimmten Diodenlasers ist eine<br />
Steigerung der Vorschub geschwindigkeit des<br />
MSG-Schweißprozesses auf Stahlwerkstoffen<br />
um bis zu 60 % realisierbar. Die Steigerung der<br />
Schweißgeschwindigkeit erzielt eine geringere<br />
Wärmeeinbringung, die sich neben einer gerin -<br />
geren Beeinflussung der Werkstoff gefüge vor<br />
allem in geringeren Wärmeverzügen widerspiegelt.<br />
Eine weitere Möglichkeit, die Stabilisierung des<br />
Lichtbogens auszunutzen, liegt in der Fertigung<br />
schlankerer Schweißnähte. Bei Steigerung der<br />
Schweißgeschwindigkeit, bei gleichzeitig stabilem<br />
Lichtbogen, können schmale Nähte erzeugt<br />
werden, die ansonsten nicht mit einem Lichtbogenprozess<br />
zu realisieren wären. Für das LGS-Verfahren<br />
sind die Investitionskosten deutlich geringer,<br />
da für die Lichtbogenstabi lisierung nur geringe<br />
Laser leistungen von wenigen 100 W installiert<br />
werden müssen.<br />
Im Bereich der Trenntechnik von Blechen ist der<br />
Laser seit Jahren etabliert. Wachstumspotenzial<br />
bietet hier vor allem die Integration in neue<br />
Fertigungsprozesse. Ein Beispiel ist der Einsatz des<br />
Lasers zum Trennen von Blechen im Rahmen des<br />
flexiblen Rollformprozesses, dessen weite Verbrei -<br />
tung insbesondere in der Automobilindustrie in den<br />
nächsten Jahren erwartet werden kann. Hierzu führt<br />
ein Konsortium aus 22 Partnern und 6 Ländern For -<br />
schungsarbeiten im integrierten Projekt PROFORM<br />
durch. Die Notwendigkeit für den Lasertrennprozess<br />
liegt hier in der veränderlichen Kontur des umgefor -<br />
mten Profils, wobei im Vergleich zu konventionellen<br />
Verfahren die Flexibilität und Verschleißfreiheit<br />
positiv zu Buche schlagen. Im Rahmen des Rollform -<br />
prozesses kann der Laser jedoch nicht nur die<br />
Aufgabe des Trennens übernehmen. Die Rollform -<br />
industrie steht stets unter dem Zwang, die<br />
geforderten Formgenauigkeiten von rollgeformten<br />
Bauteilen z.B. für die Automobilindustrie ein -<br />
zuhalten. Durch den zunehmenden Einsatz von<br />
hochfesten Stählen im Karosseriebau steigen die<br />
Anforderungen an die Bauteilfertigung. Erhöhte<br />
Umformkräfte und die Rückfederung nach dem<br />
Rollformprozess erfordern eine gute Anlageneinund<br />
-nachstellung. Hier kann der Laser durch<br />
Induzierung thermischer Spannungen als Biegewerk -<br />
zeug für kleine Umformgrade zum Einsatz kommen.<br />
Doch auch über das Schweißen und Trennen<br />
hinaus existieren vielfältige Einsatzgebiete für<br />
das Werkzeug Laser in der Blechbearbeitung. Ein<br />
Beispiel stellt das Auftragschweißen von Metall-<br />
Keramik-Verbundschichten auf sehr dünnen<br />
Blechen mit Stärken von 0,1 und 0,2 mm, wie sie<br />
für Stanzmatrizen in der papierverarbeitenden<br />
Industrie verwendet werden, zur Erzeugung von<br />
Konturen dar. Ziel ist dabei die Verbesserung der<br />
tribologischen Eigenschaften und die Reduzierung<br />
der Oberflächenadhäsion durch lokale Verstärkung<br />
der Blechoberfläche mit Stahl-Matrixpulver und<br />
keramischen Nanopartikeln. Dem Prozess des<br />
Auftragschweißens werden Partikel mit einer<br />
Größenordnung von etwa 50-200 nm zugeführt.<br />
Im Rahmen aktueller Forschungsarbeiten wird<br />
untersucht, inwieweit das Auftragschweißen<br />
ohne Verzug der Bleche möglich ist.<br />
Der Laser wird in der Blechbearbeitung jedoch<br />
nicht nur zur Materialbearbeitung des Werkstücks,<br />
sondern auch zur Modifikation der Werkzeuge<br />
eingesetzt. Durch den zunehmenden Einsatz<br />
von Aluminium- und hochfesten Stahlblechen<br />
im Leichtbau steigen die Anforderungen an<br />
die Umformwerkzeuge. So treten z.B. bei den<br />
Werkzeugen zum Scherschneiden komplexe<br />
tribologische und mechanische Beanspruchungen<br />
beim Schneidprozess auf, die wiederum einen<br />
erhöhten abrasiven bzw. adhäsiven Verschleiß der<br />
Schneidwerkzeuge zur Folge haben. Hier kann das<br />
Laserstrahldispergieren Abhilfe leisten, indem die<br />
Werkzeuge mit gradierten Dispersionsschichten<br />
versehen werden. Mit Hilfe der mit Zirkondioxid<br />
dispergierten Schneidwerkzeuge können längere<br />
Standzeiten erreicht werden, wodurch Produktions -<br />
ausfälle aufgrund von Werkzeugwechseln und die<br />
Kosten für neue Werkzeuge verringert werden.<br />
Durch die schnellen Aufheiz- und Abkühlraten des<br />
Laserprozesses wird die Härte im dispersionschicht -<br />
Inhalt<br />
nahen Bereich des Werkzeugs gegenüber derjenigen<br />
im Grundmaterial erhöht, was eine verbesserte<br />
Stützwirkung für die Dispersionsschicht zur Folge hat.<br />
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der<br />
Laser in der Blechbearbeitung immer vielfältigere<br />
Anwendungsgebiete findet. Dabei bleibt der<br />
Lasereinsatz durch neue Entwicklungen von<br />
brillanten Strahlquellen wie Scheiben- und<br />
Faserlaser höchster Ausgangsleistungen und<br />
Kombination mit dem Lichtbogenschweißprozess<br />
nicht mehr auf das Schweißen dünner Bleche<br />
beschränkt. Neue Anwendungsfelder in der<br />
Energie- und Transporttechnik können somit<br />
erschlossen werden und versprechen weiteres<br />
Wachstum. Besonderes Augenmerk liegt dabei<br />
immer auf der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit,<br />
bspw. durch Reduzierung der Investitionskosten,<br />
der Nacharbeit oder einer gesteigerten Produk -<br />
tivität. Dieses kann durch neuartige Schweiß -<br />
strategien im gepulsten Laserschweißverfahren<br />
erfolgen oder durch gänzlich neue Verfahrens -<br />
ansätze, wie durch das laserstabilisierte Licht -<br />
bogenschweißen gezeigt. Neben den etablierten<br />
schweiß- und trenntechnischen Anwendungen<br />
sind jedoch auch Anwendungen zur Modifikation<br />
von Blechoberflächen, zum Laserbiegen und zum<br />
Dispergieren von Schneidwerkzeugen für die<br />
Blechbearbeitung zu nennen, die nochmals die<br />
Flexibilität des Werkzeugs Laser verdeutlichen.<br />
Autoren: Dipl.-Ing. Dirk Herzog, Dipl.-Ing. Peter<br />
Kallage, Dipl.-Ing. Christian Stahlhut,<br />
Dipl.-Ing. André Springer, Dipl.-Ing. Nils Weidlich,<br />
Dipl.-Ing. (FH) Christian Hennigs, Dipl.-Ing. Sabine<br />
Claußen (Laser Zentrum Hannover e.V.)<br />
Laserdispergierprozess an einem Umformwerkzeug<br />
3