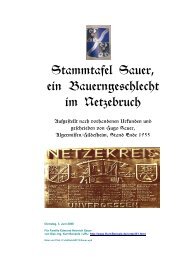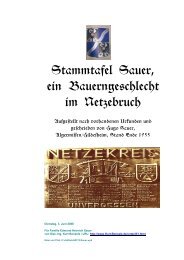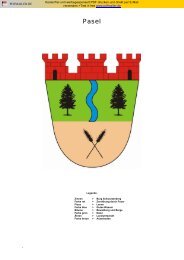- Seite 2 und 3: Vorwort zur vorliegenden bearbeitet
- Seite 4 und 5: g) Übergang des Warsteiner Besitze
- Seite 6 und 7: ) Verwandtschaftliche Beziehungen d
- Seite 8 und 9: Spruch"Das Leben ist wie ein Traum.
- Seite 10 und 11: EinleitungDie Familie Pape-Spiecker
- Seite 12 und 13: 3. Der Familienname Papepenburg im
- Seite 14 und 15: 4. Erste nachweisliche Verwendung d
- Seite 16 und 17: 5. Der Werler/Soester Raum als mög
- Seite 18 und 19: 1. Die ersten bekannten Träger des
- Seite 22 und 23: 2. Der Familienname Pape in Werl un
- Seite 24 und 25: 2. Der Familienname Pape in Werl un
- Seite 26 und 27: 3. Stammreihe der Werler Erbsälzer
- Seite 28 und 29: 3. Stammreihe der Werler Erbsälzer
- Seite 30 und 31: 3. Stammreihe der Werler Erbsälzer
- Seite 32 und 33: 3. Stammreihe der Werler Erbsälzer
- Seite 34 und 35: 3. Stammreihe der Werler Erbsälzer
- Seite 36 und 37: 3. Stammreihe der Werler Erbsälzer
- Seite 38 und 39: 3. Stammreihe der Werler Erbsälzer
- Seite 40 und 41: 3. Stammreihe der Werler Erbsälzer
- Seite 42 und 43: 3. Stammreihe der Werler Erbsälzer
- Seite 44 und 45: 3. Stammreihe der Werler Erbsälzer
- Seite 46 und 47: 3. Stammreihe der Werler Erbsälzer
- Seite 48 und 49: 4. Der Familienname Pape in Warstei
- Seite 50 und 51: 4. Der Familienname Pape in Warstei
- Seite 52 und 53: 4. Der Familienname Pape in Warstei
- Seite 54 und 55: 4. Der Familienname Pape in Warstei
- Seite 56 und 57: 5. Der Familienname Pape in Marpe,
- Seite 58 und 59: 6. Die Familienwappen als genealogi
- Seite 60 und 61: 7. Die verwandtschaftlichen Beziehu
- Seite 62 und 63: 2. Die Besitzverhältnisse des Gute
- Seite 64 und 65: 3. Die Familie von Marpe"1338-1368
- Seite 66 und 67: 4. Die Familie von Bonzel"Am 04.06.
- Seite 68 und 69: 4. Die Familie von Bonzel* um 1412+
- Seite 70 und 71:
4. Die Familie von Bonzel* um 1495.
- Seite 72 und 73:
6. Dietrich von Eppeempfangen den s
- Seite 74 und 75:
8. Die Familie Papezwei Bürgermeis
- Seite 76 und 77:
8. Die Familie PapeIm Jahre 1497 za
- Seite 78 und 79:
8. Die Familie Pape24.09.1489. Dari
- Seite 80 und 81:
8. Die Familie Pape1560 wurde die B
- Seite 82 und 83:
8. Die Familie PapeHermann Pape, ge
- Seite 84 und 85:
8. Die Familie PapeUrkunde Nr. Q 87
- Seite 86 und 87:
8. Die Familie PapeIm Stirnberg'sch
- Seite 88 und 89:
8. Die Familie Pape"Adam Dietrich R
- Seite 90 und 91:
8. Die Familie PapeUrkunde Nr. Q 20
- Seite 92 und 93:
9. Die Familie Strick1545 Wilhelm S
- Seite 94 und 95:
9. Die Familie Strickdessen Anteces
- Seite 96 und 97:
9. Die Familie Strick"1586 April 23
- Seite 98 und 99:
10. Die Familie Detmars10. Die Fami
- Seite 100 und 101:
12. Die Familie von Schledorndes Ka
- Seite 102 und 103:
12. Die Familie von SchledornJohann
- Seite 104 und 105:
12. Die Familie von Schledornvielge
- Seite 106 und 107:
12. Die Familie von SchledornMargar
- Seite 108 und 109:
13. Die Familie Höynckvor dem Lehn
- Seite 110 und 111:
13. Die Familie Höynck* 1610 in Ar
- Seite 112 und 113:
13. Die Familie HöynckPaten: Ferdi
- Seite 114 und 115:
13. Die Familie HöynckSie heiratet
- Seite 116 und 117:
13. Die Familie HöynckPaten: Chris
- Seite 118 und 119:
13. Die Familie HöynckPaten: Laure
- Seite 120 und 121:
13. Die Familie HöynckBaronessa Ma
- Seite 122 und 123:
13. Die Familie Höynck+ am 20.11.1
- Seite 124 und 125:
13. Die Familie Höynck+ 1802 in Fr
- Seite 126 und 127:
13. Die Familie Höynckh) Kaspar An
- Seite 128 und 129:
13. Die Familie Höyncklasten), son
- Seite 130 und 131:
14. Das Schulten-Gut in Marpeheirat
- Seite 132 und 133:
14. Das Schulten-Gut in MarpeRitter
- Seite 134 und 135:
2. Der Hof Spieckermann(1618-1648)
- Seite 136 und 137:
2. Der Hof Spieckermannbach (s. Zif
- Seite 138 und 139:
2. Der Hof Spieckermannund Abgaben.
- Seite 140 und 141:
3. Die weiteren Generationen auf de
- Seite 142 und 143:
4. Die finanziellen Lasten des Gute
- Seite 144 und 145:
5. Die Familie Hoffmann in Niedersa
- Seite 146 und 147:
6. Stammreihe der Familie Hoffmannb
- Seite 148 und 149:
6. Stammreihe der Familie Hoffmannd
- Seite 150 und 151:
6. Stammreihe der Familie HoffmannE
- Seite 152 und 153:
6. Stammreihe der Familie Hoffmanne
- Seite 154 und 155:
6. Stammreihe der Familie Hoffmanni
- Seite 156 und 157:
6. Stammreihe der Familie Hoffmann*
- Seite 158 und 159:
6. Stammreihe der Familie Hoffmannc
- Seite 160 und 161:
6. Stammreihe der Familie Hoffmannd
- Seite 162 und 163:
6. Stammreihe der Familie Hoffmannb
- Seite 164 und 165:
1. Das Gut Gnacke in WerntropE Die
- Seite 166 und 167:
2. Das Gut Henners in Fehrenbracht"
- Seite 168 und 169:
2. Das Gut Henners in FehrenbrachtE
- Seite 170 und 171:
2. Das Gut Henners in Fehrenbracht0
- Seite 172 und 173:
3. Die Familie Pape in Eslohesia Sc
- Seite 174 und 175:
3. Die Familie Pape in Eslohef) Mar
- Seite 176 und 177:
3. Die Familie Pape in Eslohe* im H
- Seite 178 und 179:
3. Die Familie Pape in EsloheF Stam
- Seite 180 und 181:
3. Die Familie Pape in Eslohec) Jos
- Seite 182 und 183:
3. Die Familie Pape in EsloheV1 Her
- Seite 184 und 185:
3. Die Familie Pape in Eslohe* am 0
- Seite 186 und 187:
3. Die Familie Pape in EsloheSie wa
- Seite 188 und 189:
3. Die Familie Pape in EsloheSie he
- Seite 190 und 191:
3. Die Familie Pape in Eslohe* um 1
- Seite 192 und 193:
3. Die Familie Pape in EsloheVII 7a
- Seite 194 und 195:
3. Die Familie Pape in EsloheSuiber
- Seite 196 und 197:
3. Die Familie Pape in Eslohe+ am 1
- Seite 198 und 199:
3. Die Familie Pape in EsloheVIII 5
- Seite 200 und 201:
3. Die Familie Pape in Eslohed) Joh
- Seite 202 und 203:
3. Die Familie Pape in Eslohec) Fra
- Seite 204 und 205:
3. Die Familie Pape in EsloheIX 6a)
- Seite 206 und 207:
3. Die Familie Pape in Eslohe+ am 1
- Seite 208 und 209:
3. Die Familie Pape in EsloheSie wa
- Seite 210 und 211:
3. Die Familie Pape in Eslohe+ am 2
- Seite 212 und 213:
3. Die Familie Pape in EsloheX 6a)
- Seite 214 und 215:
3. Die Familie Pape in EslohePaten:
- Seite 216 und 217:
3. Die Familie Pape in EslohePatin:
- Seite 218 und 219:
3. Die Familie Pape in Eslohe* am 0
- Seite 220 und 221:
3. Die Familie Pape in Eslohee) Mar
- Seite 222 und 223:
3. Die Familie Pape in Esloheb) oo
- Seite 224 und 225:
3. Die Familie Pape in Esloheh) Mar
- Seite 226 und 227:
3. Die Familie Pape in EslohePaten:
- Seite 228 und 229:
3. Die Familie Pape in Eslohef) Mar
- Seite 230 und 231:
3. Die Familie Pape in EsloheXI 10a
- Seite 232 und 233:
3. Die Familie Pape in EslohePaten:
- Seite 234 und 235:
3. Die Familie Pape in EsloheXI 16a
- Seite 236 und 237:
3. Die Familie Pape in Eslohec) Rud
- Seite 238 und 239:
3. Die Familie Pape in EsloheEr war
- Seite 240 und 241:
3. Die Familie Pape in EslohePaten:
- Seite 242 und 243:
3. Die Familie Pape in EsloheXII 8a
- Seite 244 und 245:
3. Die Familie Pape in Eslohed) Jos
- Seite 246 und 247:
3. Die Familie Pape in EslohePaten:
- Seite 248 und 249:
3. Die Familie Pape in EsloheEr war
- Seite 250 und 251:
3. Die Familie Pape in Eslohe* am 2
- Seite 252 und 253:
3. Die Familie Pape in Eslohe* am 0
- Seite 254 und 255:
3. Die Familie Pape in Eslohe* am 2
- Seite 256 und 257:
3. Die Familie Pape in Eslohe+ am 1
- Seite 258 und 259:
3. Die Familie Pape in Eslohe+ am 1
- Seite 260 und 261:
3. Die Familie Pape in Eslohe+ am 1
- Seite 262 und 263:
3. Die Familie Pape in EsloheXIII 7
- Seite 264 und 265:
3. Die Familie Pape in Eslohej) Pau
- Seite 266 und 267:
3. Die Familie Pape in EslohePaten:
- Seite 268 und 269:
Joseph Pape.Papes, seiner allzu gro
- Seite 270 und 271:
Heinrich Eduard PapeAnhang 2Heinric
- Seite 272 und 273:
Heinrich Eduard PapeNach dem für P
- Seite 274 und 275:
Heinrich Eduard Papemarkanteren Edu
- Seite 276 und 277:
Heinrich Eduard PapeWunsch der Komm
- Seite 278 und 279:
Heinrich Eduard PapeGewisse sprachl
- Seite 280 und 281:
Heinrich Eduard PapeQuellen und Sch
- Seite 282 und 283:
Heinrich Eduard PapeSpuren suchenSc
- Seite 284 und 285:
1. Einführung1. EinführungIm Rath
- Seite 286 und 287:
2. Eduard Pape auf der Spurten soll
- Seite 288 und 289:
3. Von "Früchten- "Bienenschwärme
- Seite 290 und 291:
4. Das Pape-Denkmal auf dem Brilone
- Seite 292 und 293:
4. Das Pape-Denkmal auf dem Brilone
- Seite 294 und 295:
4. Das Pape-Denkmal auf dem Brilone
- Seite 296 und 297:
4. Das Pape-Denkmal auf dem Brilone
- Seite 298 und 299:
4. Das Pape-Denkmal auf dem Brilone
- Seite 300 und 301:
4. Das Pape-Denkmal auf dem Brilone
- Seite 302 und 303:
4. Das Pape-Denkmal auf dem Brilone
- Seite 304 und 305:
4. Das Pape-Denkmal auf dem Brilone
- Seite 306 und 307:
4. Das Pape-Denkmal auf dem Brilone
- Seite 308 und 309:
7.0. QuellenverzeichnisBenutzte Lit
- Seite 310 und 311:
Bockum..27, 29, 31, 32, 33, 35, 36,
- Seite 312 und 313:
Fredeburg ...63, 85, 98, 103, 109,
- Seite 314 und 315:
IIsing.............................
- Seite 316 und 317:
Mönich ...........................
- Seite 318 und 319:
Reiste67, 69, 76, 88, 90, 91, 104,
- Seite 320 und 321:
Stute ........................79, 1
- Seite 322:
116, 119, 180, 195, 201, 207, 220,