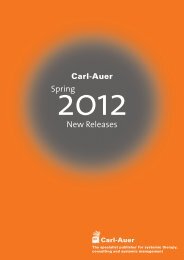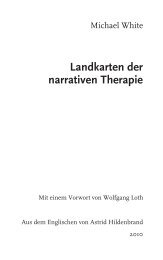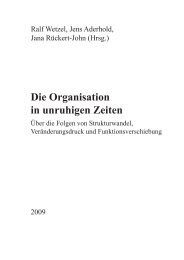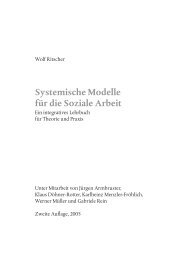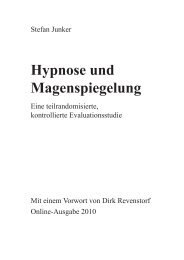B e rn h a rd K ru sch e, T o rste n G ro th E d ito ria l
B e rn h a rd K ru sch e, T o rste n G ro th E d ito ria l
B e rn h a rd K ru sch e, T o rste n G ro th E d ito ria l
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Be<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ha<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> K<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng><st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e, To<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>n G<strong>ro</strong><strong>th</strong> Ed<strong>ito</strong><strong>ria</strong>l<br />
Die Verwendung des Begriffs des systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Risikos hat durch die<br />
Finanzkrise eine Eigendynamik entwickelt, die bei näherer Betrachtung<br />
stutzen lässt. Skepsis ist angebracht, wenn ein Begriff sich modi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> gibt<br />
und das Feuilleton der Tagespresse e<strong>ro</strong>bert. Statt in den aufgeregten Ton-<br />
fall (anklagend, verteidigend, be<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>wörend, resignierend) einzustimmen,<br />
der sich <st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nd um diese Begrifflichkeit etabliert hat, vertieft die Revue<br />
für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management die Diskussion und überführt sie aus<br />
der Finanzwelt in weitere gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftliche Teilbereiche. Was heißt es für<br />
Management und Beratung, in einer Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft des unvermeidlichen Risikos<br />
zu agieren?<br />
Dass es riskant zugeht in dieser Welt: nachvollziehbar. Dass wir zu<br />
Beginn des Jahres ein T<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>obyl des Finanzsektors erlebt haben: ja doch.<br />
Was aber rechtfertigt die Einfüh<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng einer neuen Kategorie des Begriffs?<br />
Was heißt »systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>« in diesem Zusammenhang? Was unter<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidet ein<br />
systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es von einem nichtsystemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Risiko, und – viel wichtiger –<br />
welche <strong>th</strong>eoreti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en und prakti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en P<strong>ro</strong>bleme, also Bewegungsspielräume<br />
ergeben sich durch die Einfüh<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng einer solchen Unter<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung? Und<br />
wenn alle von systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Risiken sprechen: gibt es dann auch so etwas<br />
wie systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e Lösungen?<br />
Ein Leichtes wäre es, den Begriff als leere Wor<strong>th</strong>ülse für all die sich im<br />
Kontext t<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>delnder Finanzmärkte abspielenden Ereignisse zu entta<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>en.<br />
Ebenfalls einfach macht man es sich mit der Hypo<strong>th</strong>ese, dass es sich dabei<br />
um ein von uns selbst inszeniertes Ablenkungsmanöver handelt, mit dem<br />
wir uns über unsere eigene Unzulänglichkeit im Umgang mit komplexen<br />
Situationen hinwegtäu<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en. Hingegen ist der Begriff vor allem dort hilfreich,<br />
wo er uns daran erinnert, dass wir es immer mit instabilen Organisationen<br />
in chaoti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Umwelten zu tun haben. Folglich plädieren wir<br />
mit diesem Heft dafür, den Begriff des systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Risikos als Form der<br />
Selbstbeun<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>higung zu ve<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>hen. Es braucht immer wieder Anlässe, in denen<br />
deutlich wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>, was es heißt, sich in fragilen, miteinander verknüpften<br />
komplexen Systemzusammenhängen zu bewegen.<br />
Ob dieser Einsicht gibt es alle<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>ings noch lange keinen G<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nd, in einen<br />
passiven Modus des Erlebens zu wechseln. Ganz im Gegenteil! Ein gutes Beispiel<br />
dafür, was es bedeutet, sich mit systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Risiken auseinanderzusetzen,<br />
sind die in diesem Heft versammelten Beiträge, die sich g<strong>ro</strong>b drei<br />
Kategorien zuteilen lassen: Zum einen haben wir Beiträge von Autoren eingeholt,<br />
die gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftliche Aspekte des Risikos be<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>reiben. Zweitens haben<br />
wir – aus aktuellem Anlass – Beiträge aufgenommen, die sich mit dem<br />
Finanzsystem und seiner Krise auseinandersetzen. Einen Einblick in den<br />
prakti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>-unte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ehmeri<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Umgang mit Risiken erlauben <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ließlich die<br />
Interviews mit Manage<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>, die wir zu spezifi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Aspekten des Risikomanagements<br />
befragt haben.<br />
Den Anfang macht der Lawinenfor<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>er We<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er Munter, der sich über<br />
Jahrzehnte mit Lawinenrisiken be<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>äftigt hat und dabei zu überra<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>enden<br />
Erkenntnissen gekommen ist. Strategien zu Optimie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng von Risiken<br />
etwa we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en von den Bet<strong>ro</strong>ffenen nur dann verfolgt, wenn sie ein gewisses<br />
Ed<strong>ito</strong><strong>ria</strong>l 3 Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7
Restrisiko beinhalten, d. h. also individuelle Ermessensspielräume zulassen.<br />
Irritierend auch die Erkenntnis, dass einfache Me<strong>th</strong>oden in komplexen<br />
Situationen viel erfolgreicher sind als solche, mit denen versucht wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>, alle<br />
kriti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Faktoren in Betracht zu ziehen – Letzteres führt eher zur Paralyse<br />
in der konkreten Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungssituation. Intuition und Erfah<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng – die<br />
gängigen Antworten auf den Umgang mit Unbekanntem – hält er für wenig<br />
nützlich; eine konkrete Liste von Reduktionsfaktoren hingegen hilft, die<br />
größten Risiken zu vermeiden.<br />
Charles Per<strong>ro</strong>w hat uns Anfang der 80er Jahre die Augen geöffnet für<br />
»normale Katast<strong>ro</strong>phen«. Während er damals Unfälle in Atomkraftwerken, in<br />
Chemiewerken oder auf Tanke<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> untersucht hat, die aufg<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nd nicht planbarer<br />
Verkopplungen <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>einbar harmloser Abweichungen zu Katast<strong>ro</strong>phen<br />
führten, erinnert er im aktuellen Beitrag Wirt<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft und Politik daran,<br />
dass das Auftreten gesamtgesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftlicher Katast<strong>ro</strong>phen erwartbar ist. Dirk<br />
Baecker <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ließt daran an und zeigt, dass Krisen in der nächsten Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft<br />
als Komplexitätszusammenbrüche zu ve<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>hen sind, die eher dazu<br />
auf<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>fen, nach dem »Wie-geht’s-weiter« zu fragen, anstatt sich in Ursachenfor<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ungen<br />
zu verlieren.<br />
Mit der Krise am Finanzmarkt und der Angst vor einem Kollaps des<br />
Bankensystems hat der Begriff der »Systemic Risks« P<strong>ro</strong>minenz erlangt und<br />
dementsprechend auch Eingang in die Politik gefunden. Aufg<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nd »systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>er<br />
Risiken« müsse – so etwa der Tenor g<strong>ro</strong>ßer Parteien – die Politik<br />
stützend am Finanzmarkt intervenieren, aufg<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nd von »Systemrelevanz«<br />
müssen einzelne Banken künstlich am Leben gehalten we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en. Das Adjektiv<br />
»systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>« dient in dieser Argumentation eher zur Legitimation von<br />
Unvermeidlichkeiten, als dass damit eine besondere Qualität verknüpft<br />
wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>. Der Beitrag von Didier So<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ette zeigt nicht nur, wie es zu dieser Krise<br />
kommen konnte, er weist auch den Weg zu einer Wirt<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>afts- und Finanzpolitik,<br />
die auf »long-term g<strong>ro</strong>w<strong>th</strong>« setzt, hin. Die Überlegungen Fritz<br />
Stahels hingegen setzen am P<strong>ro</strong>blem des »too big to fail« an. In sechs Thesen<br />
verweist er auf notwendige und angemessene Möglichkeiten einer Krisenprävention,<br />
die gar nicht erst die Gefahr eines Kollapses ganzer Finanzsysteme<br />
aufkommen lässt. – Der Beitrag von Gün<strong>th</strong>er Ortmann kommentiert<br />
die aktuelle Finanzkrise aus organisations<strong>th</strong>eoreti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>er Perspektive: Bei der<br />
Diskussion zu volkswirt<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftlichen Regulie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ngsversuchen sollte nicht aus<br />
den Augen verloren we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en, dass sowohl die Eskalation wie auch die an<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ließende<br />
Krisenprävention auf adressierfähige Systeme angewiesen ist:<br />
Organisationen eben. Mut macht dies nicht unbedingt, aber womöglich ist<br />
der nüchte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>e Blick auf die wenigen Möglichkeiten der Organisation des<br />
Risikos angemessener als die naive Hoffnung auf eine gesamtgesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftliche<br />
Ve<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>unft.<br />
Wie Unte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ehmen die Wirt<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftkrise gemeistert haben und welche<br />
Lehren Füh<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ngskräfte für sich und ihr zukünftiges Füh<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ngshandeln aus<br />
den letzten Monaten ziehen, zeigen die Interviews mit Armin Golz, CFO<br />
Bo<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> Rex<strong>ro</strong><strong>th</strong> Niederlande, sowie Marlis Wallek, Leiterin »Strategic P<strong>ro</strong>jects«<br />
bei der A1 Telekom Aust<strong>ria</strong>. – Die Denkfigur <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ließlich, die von<br />
Ed<strong>ito</strong><strong>ria</strong>l 4 Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7
Helmut Willke entfaltet wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>, läuft darauf hinaus, dass systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e Risiken<br />
nicht nur systemati<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> im Kapitalismus verankert sind (ihn gewissermaßen<br />
begründen), sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> dass der Kapitalismus selbst ein systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es<br />
Risiko ist. Die Komplexität dieses Systems macht jede Hoffnung zunichte, die<br />
Aktionen und Transaktionen den beteiligten Akteuren zuzurechnen. An die<br />
Stelle loser gekoppelter, nationalstaatlich gebändigter Systemen treten mehr<br />
und mehr eng gekoppelte Systeme, deren Komplexität wir nicht mehr durchdringen<br />
können. Neben der soziologi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Be<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>reibung fokussiert der Beitrag<br />
auf mögliche Stellhebel, mit denen eine Rückfüh<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng zum Prinzip der<br />
losen Kopplung möglich sein könnte. Rudolf Wimmer wagt es <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ließlich,<br />
ein den Komplexitätsansprüchen der Gegenwart, die auch aber nicht nur<br />
Krisen ge<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>uldet sind, angemessenes <strong>th</strong>eoreti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Basiswerk für Organisationsberatung<br />
zu entwerfen,bevor A<strong>th</strong>anasios Karafillidis zum Ab<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>luss<br />
des Heftes die aktuelle Diskussion um den Stuttgarter Hauptbahnhof zum<br />
Anlass nimmt, über die Konst<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ktion und Organisation von Risiken in einer<br />
Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft nachzudenken, die sich weder auf die Rationalität der Argumente<br />
noch auf die Legitimität politi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>er Verfahren verlassen kann.<br />
Alle diese Beiträge, und auch unsere festen Kolumnisten, skizzieren unter<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>iedliche<br />
Perspektiven und Zugänge zum Umgang mit systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en<br />
Risiken. Zu guter Letzt sei auf Dörte Baecker hingewiesen; als »Featured<br />
Artist« dieser Ausgabe zeigt sie Aus<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>nitte ihrer Arbeit, in denen sie das<br />
Unerwarte inszeniert hat und in denen die Inszenie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ngen wiede<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>m unerwarte<br />
Ergebnisse lieferten.<br />
Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich davon anregen und irritieren zu lassen.<br />
Vor allem aber, fühlen Sie sich ermutigt, auch weiterhin Gefahren in<br />
Risiken zu wandeln, fühlen Sie sich also ermutigt, weiterhin zu ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eiden.<br />
Für das Redaktionsteam: Be<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ha<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> K<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng><st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e und To<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>n G<strong>ro</strong><strong>th</strong><br />
Ed<strong>ito</strong><strong>ria</strong>l 5 Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7
Inhalt<br />
3 Ed<strong>ito</strong><strong>ria</strong>l von Be<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ha<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> K<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng><st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e und To<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>n G<strong>ro</strong><strong>th</strong><br />
8 We<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er Munter im Interview<br />
Vom Wert des differenzierten Beurteilens und<br />
<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ablonenartigen Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidens<br />
14 Charles Per<strong>ro</strong>w<br />
Disasters Evermore? Reducing our Vulnerabilities<br />
to Natural, Indust<strong>ria</strong>l, and Ter<strong>ro</strong>rist Disasters<br />
26 Featured Artist<br />
Dörte Baecker<br />
Dörte Baecker im Interview<br />
30 Dirk Baecker<br />
Wie in einer Krise die Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft funktioniert<br />
44 Didier So<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ette<br />
Risk Management and Gove<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ance Lessons and P<strong>ro</strong>spects<br />
F<strong>ro</strong>m <strong>th</strong>e 2007 –20xx Crisis<br />
54 Fritz Stahel<br />
Kleine statt g<strong>ro</strong>ße Blasen platzen lassen<br />
60 Chris Steele-Perkins<br />
Mount Fuji<br />
62 Marlis Wallek im Interview<br />
No risk, much fun? Zur Frage des Risikomanagements<br />
in Telekommunikationsunte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ehmen<br />
66 Gün<strong>th</strong>er Ortmann<br />
Die (Ohn-)Macht der Moral und das Driften der Systeme:<br />
Der Fall der Finanzkrise<br />
74 Armin Golz im Interview<br />
Langfristige Unte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ehmenspolitik bedeutet ve<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ünftiges<br />
Risikomanagement<br />
80 Helmut Willke<br />
Systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e Risiken und cooler Kapitalismus<br />
88 Rudolf Wimmer<br />
Systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e Organisationsberatung – jenseits von Fachund<br />
P<strong>ro</strong>zessberatung<br />
104 Management für Fortge<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>rittene<br />
Auf nach China von Dirk Baecker<br />
108 Wozu Wirt<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft?<br />
Systemrisiko Vertrauen von Birger P. Priddat<br />
112 Hollywood<br />
Lohn der Angst von Fritz B. Simon<br />
116 A<strong>th</strong>anasios Karafillidis<br />
Risiken, ihre Organisation und die Technik ihrer Vermeidung<br />
121 Überblick, Bestellservice, Impressum<br />
122 Ausblick<br />
7<br />
Inhalt Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7
We<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er Munter ist Bergführer und Lawinenfor<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>er. Durch seine zahlreichen Publikationen zur Beurteilung von<br />
Lawinenrisiken und den unbestritten erfolgreichen Einsatz seiner Me<strong>th</strong>oden wu<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>e er zum anerkannten Experten.<br />
Vor seiner Pensionie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng arbeitete der Unsicherheitsexperte zehn Jahre für das Eidgenössi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e Institut für Schneeund<br />
Lawinenfor<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ung in Davos, Schweiz.<br />
Falk Busse hat Kultur- und Kommunikationswissen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aften an der Zeppelin University in Friedrichshafen studiert.<br />
Zuletzt war er für ver<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>iedene P<strong>ro</strong>jekte des Goe<strong>th</strong>e-Instituts Bangladesh in Chittagong verantwortlich.<br />
Interview mit We<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er Munter<br />
Vom Wert des differenzierten Beurteilens und<br />
<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ablonenartigen Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidens*<br />
Um 50 P<strong>ro</strong>zent sind die Opferzahlen bei Lawinenunglücken seit den<br />
80er Jahren zurückgegangen. Dieser Erfolg geht zu einem g<strong>ro</strong>ßen Teil<br />
auf die Arbeit von We<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er Munter zurück, dessen We<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>egang vom<br />
Sicherheitsgaranten zum Unsicherheitsexperten als exemplari<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> für<br />
Risikomanagement – auch außerhalb der Berge – gelten kann. Ge<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>e<br />
zitiert der Bergführer Nietz<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e und wirbt dafür, »die Wahrheit auf<br />
eine kluge Weise misszuve<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>hen, zum Zwecke des Überlebens«.<br />
Falk Busse im Gespräch mit dem Lawinenfor<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>er.<br />
Falk Busse: Herr Munter, Sie haben Knoten für Bergstei-<br />
ger entwickelt und wirksame Me<strong>th</strong>oden zur Beurteilung<br />
von Lawinenrisiken entwickelt. Man könnte sagen, Risiken<br />
sind das immer wiederkehrende Motiv in Ihrem Leben.<br />
Welche riskanten Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen haben Sie selbst während<br />
Ihres We<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>egangs get<strong>ro</strong>ffen?<br />
We<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er Munter: Nach meinem Studium der Ge<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ichte und<br />
Germanistik und meiner einjährigen Tätigkeit als Gymnasiallehrer<br />
musste ich mich ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eiden: Will ich da weitermachen<br />
oder will ich auf ein Gebiet umsatteln, das ich<br />
nicht studiert hatte. Das war die <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>were Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung.<br />
Aber ich fühlte so klar, dass ich dort mehr leisten könnte<br />
als auf einem Gymnasium. Da gibt es so viele Lehrer, da<br />
war ich leicht ersetzbar. Hingegen hatte ich von Anfang an<br />
das Gefühl, dass im Risikomanagement beim Bergsteigen<br />
ein Kopf fehlt, der sich der Herausfo<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>e<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng stellt und sich<br />
die Zeit nimmt, die Sache wirklich gründlich zu durchdenken.<br />
Ich habe dann den Lehrerbe<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>f an den Nagel gehängt<br />
und mich in die Lawinenkunde gestürzt.<br />
Wa<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>m sind Ihre Me<strong>th</strong>oden wirksamer als andere? Geht es<br />
da<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>m, möglichst viele Daten zu sammeln, also ein möglichst<br />
genaues Abbild der Realität zu konst<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ieren, oder<br />
was ist das Geheimnis?<br />
Da gibt es sicher sehr ver<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>iedene Gründe. Einmal muss<br />
die Me<strong>th</strong>ode einfach anwendbar sein. Jeder Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> muss<br />
das begreifen können. Und es muss allgemein akzeptiert<br />
we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en. Also, wenn ich eine Me<strong>th</strong>ode entwickle, bei der<br />
prakti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> keine Unfälle mehr passieren, dann wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> der<br />
Spielraum so einge<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ränkt, dass die Leute meine Me<strong>th</strong>ode<br />
nicht akzeptieren. Der Risikostanda<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> muss so gewählt<br />
we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en, dass die meisten damit einverstanden sind. Das<br />
heiß, man muss Risiken erlauben. Und meine Me<strong>th</strong>ode<br />
erlaubt kleine und mittlere Risiken, <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ließt eigentlich nur<br />
die g<strong>ro</strong>ßen Risiken aus, und das leuchtet den meisten<br />
Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en ein.<br />
Haben wir richtig gehört? Wenn eine Me<strong>th</strong>ode das Risiko<br />
ganz aus<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ließen wü<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>e …<br />
We<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er Munter im Interview 8 Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7
… dann wü<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>e kein Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> sie anwenden, ja. Also muss<br />
man ein Gleichgewicht finden, denn es sollten ja mög-<br />
lichst viele Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en die Me<strong>th</strong>ode akzeptieren. Das heißt,<br />
ich muss ein gewisses Risiko erlauben, damit man überhaupt<br />
ansp<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>chsvolle Touren machen kann. Im Nachhinein<br />
muss ich sagen, das war vielleicht das Schwierigste an der<br />
ganzen Angelegenheit. Denn wenn Sie diesen Risikostanda<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng><br />
festlegen wollen, stoßen Sie auf morali<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e Fragen:<br />
Wie viel Risiko will ich erlauben, also b<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>tal ausgedrückt:<br />
Wie viele Lawinenopfer sind wir bereit zu akzeptieren? Das<br />
ist im G<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nde genommen eine gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftliche Frage.<br />
Genau wie im Verkehr, wo Sie sich überlegen müssen, wie<br />
viele Tote sie akzeptieren wollen, damit wir Mobilität auf<br />
den Straßen haben. Genauso müssen wir uns in den Bergen<br />
überlegen, wie viele Lawinentote können wir akzeptieren,<br />
um unsere Freiheit zu haben. Die Schwierigkeit ist<br />
ja: Meine Me<strong>th</strong>ode muss freiwillig akzeptiert we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en. Das<br />
ist nicht wie im Straßenverkehr, wo ja jeder sich an die<br />
Regeln halten muss. Also muss ich Überzeugungsarbeit<br />
leisten und den Leuten erklären, dass das Risiko klein ist,<br />
wenn sie meine Me<strong>th</strong>ode anwenden.<br />
Nun habe ich meinen Risikostanda<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> natürlich nicht willkürlich<br />
festgesetzt, sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> ich orientiere mich am Verband<br />
Deut<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>er Sicherheitsingenieure. Die haben herausgefunden,<br />
dass bei der Arbeit in einer Fabrik auf hunderttausend<br />
unsichere Handlungen ein Todesopfer kommt.<br />
Und das wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> als akzeptabel betrachtet. Dieses Verhältnis,<br />
also eins zu hunderttausend, habe ich genommen und<br />
darauf meine Me<strong>th</strong>ode aufgebaut. Wenn Sie also einhunderttausend<br />
Touren machen, sind Sie ein Mal tot. Und das<br />
halten die meisten Bergsteiger für ve<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ünftig, das wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng><br />
akzeptiert.<br />
Anfangs war es auße<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>em eine ungeheuere Herausfo<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>e<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng,<br />
eine in der Anwendung einfache Me<strong>th</strong>ode zu entwickeln,<br />
denn die Schneedecke ist ein hochkomplexes,<br />
offenes, <strong>th</strong>ermodynami<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es System. Das ist so ungefähr<br />
das Schlimmste, was uns begegnen kann. Und jetzt habe<br />
ich gezeigt, dass einfache Denk und Handlungsmuster<br />
ausreichend sind, um sich in diese Komplexität weitgehend<br />
sicher zu bewegen. Für die meisten ist das ein solcher<br />
Widersp<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ch, dass sie nicht geglaubt haben, dass<br />
meine Me<strong>th</strong>ode funktioniert …<br />
… aber das tut sie.<br />
Ja, weil sie in der Anwendung einfach ist, aber im Hinterg<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nd,<br />
was niemand merkt und auch noch kaum jemand<br />
begriffen hat, die Komplexität angemessen abbildet. Da ent-<br />
We<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er Munter im Interview<br />
Abb. 1<br />
100 %<br />
50 %<br />
25 %<br />
12,5 %<br />
6,25 %<br />
Verzicht auf<br />
Hänge > 40°<br />
Verzicht auf<br />
Sektor No<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> (NW-N-NE)<br />
Verzicht auf selten<br />
begangene Hänge<br />
Verzicht auf g<strong>ro</strong>ße<br />
G<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ppen ohne Abstände<br />
Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungsbaum / Geburt der Reduktionsme<strong>th</strong>ode. »Um eine<br />
Lawinenauslösung möglichst unwahr<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>einlich zu machen, we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en<br />
eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen get<strong>ro</strong>ffen. Jeder Verzicht<br />
halbiert das Ausgangspotenzial.« Munter, Snow How Nr. 28, 1992<br />
spricht sie »Ashby’s Law«, der sagt, je komplexer die Situation,<br />
umso komplexer muss auch die Verhaltensregel sein.<br />
Ich versuche das mal zu erklären: Früher haben wir punktuell<br />
Stabilitäten in der Schneedecke gemessen und glaubten,<br />
damit die Sachen im Griff zu haben. Bei dieser Punktmessung<br />
haben wir angenommen, dass die Schneedecke<br />
am selben Hang weitgehend homogen ist. Das haben wir<br />
einfach vorausgesetzt! Dann haben wir aber gemerkt, dass<br />
die Streuung der Messwerte auße<strong>ro</strong><st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>entlich g<strong>ro</strong>ß war,<br />
und mussten eine Sicherheitsdistanz einbauen. Wenn Sie<br />
nur ein Kriterium wählen und das Risiko einigermaßen<br />
ein<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ränken wollen, müssen sie den Spielraum aber <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>on<br />
9 Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7<br />
Halbie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng<br />
Halbie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng<br />
Halbie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng<br />
Halbie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng<br />
* Zur Vertiefung der strategi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Lawinenkunde: W. Munter:<br />
3 3 Lawinen. Risikomanagement im Wintersport. 4. Auflage.<br />
Garmi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>-Partenkirchen 2009: Pohl & Schellhammer.
so weit ein<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ränken, dass niemand die Me<strong>th</strong>ode mehr<br />
akzeptiert. Ich hatte dann die Idee, dass man mit einem<br />
Kriterium nicht zu Rande kommt, sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> man mehrere<br />
Kriterien kombinieren muss. Wir haben in der Lawinenkunde<br />
aber nur Regeln, die eine Zuverlässigkeit von 50%<br />
haben. Nun geht es aber um Leben und Tod! Und dann<br />
Regeln mit einer Trefferquote von 50% zu verwenden, das<br />
<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eint den meisten absu<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>.<br />
Doch dann betreibe ich einfach Ma<strong>th</strong>ematik und nehme<br />
mir vier oder fünf Regeln mit einer Quote von 50%, die ich<br />
kombinieren kann. Ich nehme Regel Nummer eins, Risiko<br />
ist halbiert. Regel Nummer zwei, es bleiben 25% und so<br />
weiter. Nach drei Regeln bin ich <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>on fast bei einer<br />
Sicherheit von 90%, das ist das Prinzip der kombinierten<br />
Wahr<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>einlichkeiten und zwar mit ganz einfachen Rechnungen,<br />
wie sie jeder ve<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>ht. Nun habe ich eine Formel<br />
aufgestellt, die lautet: Risiko ist gleich Natur geteilt durch<br />
Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>, oder anders gesagt, Gefahr durch das Verhalten.<br />
Für die Va<strong>ria</strong>ble Gefahr ziehe ich die fünf Gefahrenstufen,<br />
wie wir sie in der Lawinenkunde haben, heran. Dieses<br />
Potenzial dividiere ich durch das Verhalten, also Reduktionsfaktoren,<br />
die das Risiko aber auch den Spielraum<br />
ein<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ränken.<br />
Wir wissen aus der Unfallstatistik, dass Lawinenunfälle<br />
zeitlich und örtlich konzentriert sind. Und das mach ich<br />
mir zu Nutze, indem ich die gefährlichsten Kombinationen<br />
herausgreife. Ein Beispiel, nehmen wir Gefahrenstufe drei,<br />
weil man da noch unterwegs ist, bei 4 und 5 ist kaum<br />
noch ein ve<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ünftiger Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> unterwegs, da ist man zu<br />
Hause. Durch die Kombination von Zeit und Ort habe ich<br />
meine e<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng> Va<strong>ria</strong>ble, dann noch extrem steiler Hang und<br />
Abb. 2<br />
Gefahr<br />
Vorsicht<br />
ausgewogen / optimiert<br />
gutes Risiko<br />
Gefahr<br />
drittens, no<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>exponierter Hang. Das wäre jetzt die unfall<br />
trächtigste aller Kombinationen, die ich »totgeiler Dreier«<br />
nenne, um die Leute abzu<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>recken. Dazu kommen noch<br />
zwei andere dieser Dreier-Kombinationen, die ich Limits<br />
nenne. Wenn Sie diese drei Limits vermeiden, dann haben<br />
Sie <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>on das Schlimmste weg. Und das ist nun einfach,<br />
weil wir die Gefahrenstufe offiziell per Lawinenlagebericht<br />
vom Institut in Davos erhalten, und der Rest ist Kartenlesen.<br />
Die Karten heute sind so genau, das wir aus dem Abstand<br />
der Höhenkurven die Steilheit des Hangs ablesen können<br />
und auch No<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>hänge sind einfach zu erkennen. Wer also<br />
ganz einfach arbeiten will und bereit ist, ein gewisses Risiko<br />
einzugehen, aber doch die Klumpenrisiken vermeiden<br />
möchte, arbeitet einfach mit diesen drei Limits. Ich habe<br />
mit vielen Leuten geredet, die so vorgehen. Viele sagen<br />
mir, dass sie den Spielraum, den ich ihnen lasse, bei<br />
Weitem nicht ausnutzen. Meine Me<strong>th</strong>ode kombiniert Einfachheit<br />
in der Anwendung mit einem g<strong>ro</strong>ßen Spielraum,<br />
und das gibt die Akzeptanz, und deshalb ist die Me<strong>th</strong>ode<br />
erfolgreich.<br />
Meinen Sie, man könnte Ihre Erkenntnisse über die Wah<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ehmung<br />
und den Umgang mit Risiken verallgemeine<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>?<br />
Ja. Also die Me<strong>th</strong>ode ist ganz sicher allgemeingültig. Sie<br />
können die Schneedecke durch jede andere komplexe<br />
Situation ersetzen. Die Lösung ist dann, nach einfachen<br />
Lösungen zu suchen. Das ist kein Widersp<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ch, wie ich gezeigt<br />
habe. Dafür muss es aber einen Kopf geben und das<br />
ist am Anfang auch sehr mühsam. In meinem Fall musste<br />
ich erst nach verlässlichen Faktoren suchen, habe jahrelang<br />
mit Statistiken gearbeitet und an die tausend Schneefestigkeitsmessungen<br />
vorgenommen. Das war die Basis<br />
Vorsicht<br />
stop!<br />
<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>lechtes Risiko<br />
Gefahr<br />
Vorsicht<br />
sehr vorsichtig<br />
vielleicht verpasst du eine Chance …<br />
»Erst wägen, dann wagen.« Den berühmten Aussp<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ch des preußi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Generalstab<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>efs Helmu<strong>th</strong> von Moltke können wir in der Reduktionsme<strong>th</strong>ode<br />
wörtlich nehmen, denn wir haben ja die Risikowaage. Die ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidende Frage des Richters nach einem Unfall: »Waren die Vorsichtsmaßnahmen<br />
der Gefahr angepasst?« muss bei Risiko 1 mit »Ja« beantwortet we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en, weil die Risikowaage im Gleichgewicht ist, d. h., das Gefahrenpotenzial<br />
ist gleich dem Risikopotenzial. Die »Goldene Regel« – eine Me<strong>th</strong>ode, mit der man in Minuten<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>nelle aus den 600 Kombinationen (den möglichen<br />
Situationen, deren Anzahl sich aus der multiplikativen Ve<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>etzung von fünf in Klassen eingeteilter Schlüsselva<strong>ria</strong>blen ergibt) die guten resp.<br />
<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>lechten Risiken herausfilte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> kann – sagt uns, wann die Waage im Gleichgewicht ist:<br />
• bei Gering benötigt man einen beliebigen Reduktionsfaktor • bei Mäßig benötigt man zwei beliebige Reduktionsfaktoren<br />
• bei Erheblich benötigt man drei Reduktionsfaktoren, wovon einer erstklassig sein muss. Der RF »weniger als 35°« zählt doppelt (= 2 RF)<br />
We<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er Munter im Interview 10 Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7
100/0<br />
Todesopfer in %<br />
50/50<br />
40/60<br />
30/70<br />
20/80<br />
10/90<br />
Jeder kann das und Experten<br />
sind genauso blöd wie wir, also<br />
weg mit dem Heiligen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ein.<br />
Wir brauchen eine Me<strong>th</strong>ode, die<br />
von jedem angewendet we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en<br />
kann. Und das trifft so auch auf<br />
andere Situationen zu.<br />
Abb. 3<br />
Risiko 3<br />
Risiko 2,2<br />
Risiko 2<br />
Risiko 1,5<br />
Risiko 1<br />
Risiko 0,9 (Pareto-Optimum 20 : 80)<br />
Risiko 0,5<br />
(Risiko Luf<strong>th</strong>ansa)<br />
0 10 20 30 40 50 Verzicht in % 100<br />
Klumpenrisiken, jenseits der Limits. Unbedingt meiden<br />
Optimaler Bereich für P<strong>ro</strong>fis und engagierte Amateure.<br />
Kalkulierte Risiken<br />
Bereich für Anfänger und Gelegenheitstouristen<br />
case<br />
fatality<br />
rate<br />
1 : 50.000<br />
1 : 100.000<br />
1 : 1.000.000<br />
Risiko vs. Verzicht – Optimie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng.<br />
Der Scheitelpunkt der »Hyperbel« liegt interessanterweise ziemlich<br />
genau im Pareto-Optimum, das besagt, dass sich mit 20 % Aufwand<br />
(hier Verzicht) 80 % Wirkung (hier Reduktion der Todesopfer) erzielen<br />
lässt. Beim Risikostanda<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> 1 müssen wir im Durch<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>nitt 1 x p<strong>ro</strong><br />
Woche verzichten. Das ist zumutbar, vor allem, wenn man bedenkt,<br />
dass an diesem Tag oft auch noch <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>lechtes Wetter herr<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>t.<br />
Zug<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nde gelegt ist ein diversifiziertes Tourenp<strong>ro</strong>gramm mit leichten<br />
bis ansp<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>chsvollen Touren. Um den Risikostanda<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> der Luf<strong>th</strong>ansa zu<br />
erreichen, müssten wir in 4 von 5 Fällen verzichten …<br />
Die Klumpenrisiken, Risiko > 2, sind klar erkennbar: Konzentrieren sich<br />
doch 60 % der tödlichen Unfälle in nur 10 % der Aktivitäten!<br />
We<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er Munter im Interview<br />
.............<br />
11<br />
der Me<strong>th</strong>ode, die den Anwender aber gar nicht interessie-<br />
ren muss. Wichtig ist dann aber, entsprechend der drei<br />
kybe<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>eti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Prinzipien – auswählen, gewichten und<br />
ve<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>etzen – Schritt zwei und drei auch zu gehen. Als ich<br />
mit dieser Arbeit begonnen habe, hat man noch mit wissensbasierten<br />
Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen gearbeitet, also Expertenwissen.<br />
Das heißt, da gab es einen Gu<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng> und alle anderen<br />
sind dumm. Damit habe ich geb<strong>ro</strong>chen und gesagt: Jeder<br />
kann das und Experten sind genauso blöd wie wir, also<br />
weg mit dem Heiligen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ein. Wir brauchen eine Me<strong>th</strong>ode,<br />
die von jedem angewendet we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en kann. Und das trifft so<br />
auch auf andere Situationen zu.<br />
Und bei der Wirt<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftskrise, was ist da fal<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> gelaufen?<br />
Ich glaube, dass man wahr<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>einlich den Faktor Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng><br />
ausgeklammert und zu sehr an die Formeln geglaubt hat.<br />
Dabei wu<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en diese ja hinterfragt und auch gezeigt, dass<br />
die Formeln nur in bestimmten Situationen funktionieren.<br />
Zum Beispiel hat man vorausgesetzt, dass sich der Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng><br />
rational verhält, was natürlich überhaupt nicht stimmt,<br />
die Krise hat es bewiesen. Der Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> benimmt sich wie<br />
ein He<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>entier.<br />
Die Me<strong>th</strong>oden waren also auf fal<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Prämissen aufgebaut?<br />
Der freie Markt kann nur funktionieren, wenn jeder frei<br />
ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidet und rational ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidet. Und diese beiden<br />
Voraussetzungen sind eben nicht erfüllt. Der Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> ist<br />
nicht rational und das gilt auch für den Bergsteiger. Aber<br />
dort habe ich meine Regeln entwickelt, um diese fehlende<br />
Rationalität zu korrigieren. Wenn man jetzt stur nach<br />
Regeln arbeitet, dann verhält man sich einigermaßen richtig,<br />
und man muss vor allem die Intuition aus<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>alten. Es<br />
gibt immer wieder Leute, die an die Intuition glauben.<br />
Aber die Beweisfüh<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ngen sind mir da oft zu einfach. Und<br />
vor allem wenn es dann um Leben und Tod geht, da sind<br />
unverbindliche Ratespiele nicht das richtige Mittel.<br />
Deshalb habe ich versucht, Intuition – die zwar hier und da<br />
funktioniert, aber hier und da auch nicht – und wir wissen<br />
eben nicht, wann sie es tut – auszu<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>alten. Meine<br />
Me<strong>th</strong>ode ist eigentlich nichts anderes, als die Irrationalität<br />
durch Rationalität zu ersetzen. Ihr Credo lautet: weg von<br />
dem Gefühl.<br />
Ich habe Lawinenunfälle <st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nd um die Welt untersucht,<br />
und kann Ihnen sagen, Intuition funktioniert nicht. Auch<br />
an der Börse funktioniert Intuition nicht. Da haben Sie<br />
immer diese Ge<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ichten von irgendwelchen Gu<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>s, die<br />
eine Zeit lang Erfolg, also einfach Glück haben. Und dann<br />
Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7
machen sie aus diesem Glück eine Me<strong>th</strong>ode, die dann von<br />
Tausenden angewendet wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>, von denen viele ihr gesamtes<br />
Vermögen verlieren. Wa<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>m? Sie haben kein Glück gehabt.<br />
So geht es natürlich nicht. Die persönliche Erfah<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng<br />
ist sehr unzuverlässig, da muss man sich nichts drauf einbilden.<br />
Deswegen sind meine Me<strong>th</strong>oden auf Unfällen aufgebaut,<br />
also Situationen, wo die Leute Unrecht gehabt<br />
haben und fal<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen get<strong>ro</strong>ffen wu<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en. Wenn<br />
Sie nur Ihre eigene Erfah<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng heranziehen, dann ist eine<br />
Lawine oder ein Wirt<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftskollaps ein sehr seltenes Ereignis,<br />
das man wahr<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>einlich nur einmal miterlebt. Um<br />
die Komplexität zu erfassen, brauchen Sie aber viele Fälle,<br />
und bei Fehlurteilen hat man sofort eine g<strong>ro</strong>ße Zahl zusammen.<br />
Es geht nicht mehr um die persönliche, sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng><br />
um die kollektive Erfah<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng. Und das ist meine Basis: die<br />
Unfälle, nicht der persönliche Erfolg.<br />
Um die Komplexität zu erfassen,<br />
brauchen Sie aber viele Fälle, und<br />
bei Fehlurteilen hat man sofort<br />
eine g<strong>ro</strong>ße Zahl zusammen. Es geht<br />
nicht mehr um die persönliche, sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng><br />
um die kollektive Erfah<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng.<br />
Und das ist meine Basis: die Unfälle,<br />
nicht der persönliche Erfolg.<br />
In den Bergen we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en manchmal künstlich Lawinen aus-<br />
gelöst, um Risiken zu vermeiden. Kann die Wirt<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>afts-<br />
politik hier etwas le<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>en?<br />
Ja, natürlich. Also wenn eine Bank in der Schweiz pleite<br />
geht und so g<strong>ro</strong>ß ist, dass das einen Staatsbank<strong>ro</strong>tt auslöst,<br />
dann muss man die Bank auflösen oder in mehrere<br />
Teile zerlegen. Das ist doch selbstverständlich.<br />
Ganz aus<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ließen lassen sich Risiken nie, sei es in der<br />
Wirt<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft oder am Berghang. Ist Vorbeugen also Pflicht?<br />
Vorbeugen ist das Einzige, das funktioniert. Aber auch die<br />
Weltwirt<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft funktioniert nicht ohne Risiko, dann gäbe<br />
es ja keine Gewinne mehr. Man muss das Risiko limitieren<br />
und deshalb rede ich ja von Reduktionsfaktoren. Das ist<br />
der Sinn jedes Risikomanagements. Ich habe dafür eine<br />
Risikowaage entwickelt. In der einen Waage<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ale ist das<br />
Risikopotenzial, welches uns durch den aktuellen Lawinen-<br />
lagebericht vorgegeben wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>. Und auf der anderen Seite<br />
haben Sie das men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>liche Verhalten. Je höher die Risikostufe,<br />
auf desto mehr muss ich verzichten. Wenn die<br />
Waage im Gleichgewicht ist, spreche ich von einem guten<br />
Risiko, was natürlich unheimlich viele Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en p<strong>ro</strong>voziert<br />
hat. Mein Schluss ist, wir müssen die guten Risiken<br />
erkennen können und die <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>lechten vermeiden.<br />
Sie müssen erstmal die wichtigsten Schlüsselva<strong>ria</strong>blen finden,<br />
dann gewichten und ve<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>etzen Sie. Letzteres ist ganz<br />
wichtig, denn in komplexen Systemen funktionieren additive<br />
Me<strong>th</strong>oden nicht. Es bringt Ihnen nichts, alle Daten zu<br />
sammeln, wenn sie nicht in ein Koo<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>inationssystem eingeo<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>net<br />
we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en können. Im Gegenteil: Je mehr Daten sie<br />
haben, desto <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>wieriger ist die Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungsfindung.<br />
Wenn Sie sich etwa überlegen, ob Sie heiraten wollen oder<br />
nicht, gibt es am Ende wie häufig bei <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>wierigen Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen<br />
eine 50:50 Situation – und dann gibt meist<br />
ein ganz unwichtiger Faktor den Aus<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>lag. So funktioniert<br />
es nicht. In komplexen Situationen brauchen wir<br />
mindestens eine multiplikative Ve<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>etzung und regelbasiertes<br />
Wissen.<br />
Was ist der größte Fehler, den man Im Umgang mit Risiken<br />
machen kann?<br />
Überzeugt zu sein, dass ich die Sache im Griff habe. Sobald<br />
man risikobewusst ist, ändert sich die Sachlage <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>lagartig.<br />
Bei Unfällen in den Bergen passiert es oft, dass jemand<br />
einen Fehler macht und es Tote gibt. Dann fallen alle über<br />
denjenigen her und sagen: Wie hat der nur diesen Mist<br />
bauen können? Stattdessen sollten wir sagen: Ve<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>ammt.<br />
Das hätte mir auch passieren können. Das ist Risikobewusstsein.<br />
Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten<br />
in der Lawinenkunde viel geändert. Sie können mir zum<br />
Beispiel kein Lehrbuch aus den 70er Jahren zeigen, welches<br />
im Untertitel nicht das Wort »Sicherheit« hat. Heute<br />
hat jedes gute Lehrbuch das Wort »Risiko« oder »Risikomanagement«<br />
im Titel, und daran sieht man die ungeheure<br />
Wandlung. Das ist vor allem ein Wandel in der<br />
Mentalität.<br />
Herr Munter, vielen Dank für das anregende Gespräch!<br />
¶<br />
.............<br />
Die Grafiken sind adaptiert aus:<br />
Munter, We<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er (2008): Auf der Suche Nach dem Gleichgewicht.<br />
bergundsteigen. Zeit<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>rit für Risikomanagement, Nr. 04/2008, S. 40-45<br />
We<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er Munter im Interview 13 Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7
Management für Fortge<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>rittene<br />
Dirk Baecker<br />
Auf nach China<br />
Es ist ein bekanntes Phänomen, dass<br />
das Interesse der Praxis an der System<strong>th</strong>eorie<br />
antizykli<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> zu jenem in<br />
der Wissen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft verläuft. Während<br />
man in der Wissen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft immer<br />
wieder in Situationen gerät, in denen<br />
man darauf hinweisen muss, dass es<br />
neben dem Erklä<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ngsprinzip der<br />
Kausalität und neben dem Nachweis<br />
statisti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>er Korrelationen von Daten<br />
Phänomene einer chaoti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Selbstorganisation<br />
gibt, denen man allenfalls<br />
mit dem Erklä<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ngsprinzip der<br />
Kommunikation und mit dem Nachweis<br />
nichtlinearer Rekursivität beikommt,<br />
ist das in der Praxis zwar<br />
nicht begrifflich, aber doch sachlich<br />
so selbstverständlich, dass man hier<br />
eher auf Ungeduld als auf paradigmati<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e<br />
Einwände stößt. Kein Politiker,<br />
Kirchenfürst, Unte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ehmer,<br />
Fußballtrainer, Galerist, Intendant,<br />
General oder Oberarzt rechnet nicht<br />
längst mit einer Vielzahl unabhängiger<br />
Va<strong>ria</strong>blen, deren vertrackteste<br />
Eigen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft darin besteht, dass sie<br />
sich ihre Abhängigkeiten voneinander<br />
selber aussuchen. Sie kommunizieren<br />
untereinander, wie dies das<br />
Bild von den kommunizierenden<br />
Röhren so <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ön auf den Punkt<br />
bringt, ohne dass man eine Chance<br />
hätte, das kausal zu o<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>nen oder<br />
statisti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> zu vereinheitlichen. Jeder<br />
gute Praktiker hat dafür längst ein<br />
Gefühl und verbittet sich eine Wissen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft,<br />
die ihm dies ve<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ebelt,<br />
ebenso wie eine Esoterik, die ihm<br />
sein Gefühl in ein Ge<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>wätz verwandelt.<br />
Im Moment, so hat man den Eind<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ck,<br />
sind die Chinesen am Zug.<br />
Während die evidence-based Wissen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft<br />
in ihren double-blinded peerreviewed<br />
A-jou<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>als im Westen bü<strong>ro</strong>krati<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e<br />
Purzelbäume <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>lägt, interes-<br />
Kolumne<br />
siert sich ein Teil der chinesi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en<br />
Wissen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft aus durchaus prakti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en<br />
Gründen für die System<strong>th</strong>eorie.<br />
Es geht um Bevölke<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ngsmigration,<br />
Staudammbau, Bewässe<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ngsanlagen,<br />
Wirt<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftsplanung, urbanes<br />
Wachstum und ökologi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e P<strong>ro</strong>bleme<br />
eines Ausmaßes, das den westlichen<br />
Beobachter <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>windeln lässt. Die<br />
Chinesen entdecken das Verhältnis<br />
von Mik<strong>ro</strong>diversität und Selbstorganisation,<br />
dem Niklas Luhmann einen<br />
seiner letzten Artikel gewidmet hat<br />
und das den un<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>higen Unterbau aller<br />
emergenten Phänomene am Beispiel<br />
der liberalen Individualisie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng präzise<br />
auf den Punkt bringt, 1 und versuchen<br />
herauszufinden, wieviel Un<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>he<br />
erfo<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>erlich und erträglich ist,<br />
um auf welchen Ebenen eine Emergenz<br />
zum Tragen zu bringen, die<br />
dann auch wieder mit der Planwirt<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft<br />
kompatibel ist. Der Durchgriff<br />
auf das Individuum wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> aufgegeben,<br />
weil man Anlass hat, die Umerziehung<br />
nicht mehr auf der<br />
G<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ppenebene, da war sich alle Welt<br />
noch Mitte des 20. Jahrhunderts erstaunlich<br />
einig (und Kurt Lewin ihr<br />
une<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>annter Papst), sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> auf einer<br />
kollektiven Ebene, die mal den<br />
Namen des Schwarms, das ist die<br />
westliche Va<strong>ria</strong>nte, mal den Namen<br />
der Masse, das ist die östliche<br />
Va<strong>ria</strong>nte, trägt. 2 Aber was ist das<br />
für eine Masse und aus welchen<br />
Elementen besteht sie? Einer der systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en<br />
Vo<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>enker an der Akademie<br />
der Wissen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aften in Peking,<br />
Wenyuan Niu, hat auf diese Frage<br />
auf der 1. Inte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ationalen Konferenz<br />
für komplexe Wissen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aften in<br />
Shanghai im Feb<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ar 2009 (die nächste<br />
ist für 2011 angekündigt) eine<br />
eigenwillige Antwort gegeben. Im<br />
An<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>luss an Hermann Hakens<br />
Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7
Synergetik entwickelt er eine »social<br />
combustion <strong>th</strong>eory«, die auszurechnen<br />
versucht, wieviel Verbrennung<br />
(combustion) sich ein System leisten<br />
kann und muss, um den ent<strong>ro</strong>pi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en<br />
Tendenzen, denen es unterliegt,<br />
einerseits nachzukommen, das<br />
ist <strong>th</strong>ermodynami<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> unvermeidlich,<br />
und andererseits gegenzusteue<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>,<br />
um negent<strong>ro</strong>pi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> auch wieder<br />
O<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>nung aufzubauen. 3<br />
Ent<strong>ro</strong>pie, so Niu, entsteht aus der<br />
Ansammlung von mik<strong>ro</strong>kosmi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en<br />
Elementarpartikeln, auch »Individuen«<br />
genannt, deren soziale Energie<br />
genutzt wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>, indem sie verbraucht<br />
wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>. Dabei kann eine »soziale Temperatur«<br />
entstehen, deren inhärente<br />
Uno<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>nung die Möglichkeit der Akkumulation<br />
von Energie übe<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>igt.<br />
Dann hilft nur, so erfährt man aus<br />
einem weiteren Artikel Nius mit einigen<br />
seiner Mitarbeiter, 4 rechtzeitig<br />
auf eine öffentliche Meinung zu achten,<br />
die selbst nichts anderes als<br />
Brennmate<strong>ria</strong>l sei, deren Infektionsp<strong>ro</strong>zesse<br />
jedoch durch Meinungsführer<br />
kont<strong>ro</strong>lliert we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en können.<br />
Max Weber hatte auf das Ingenium<br />
einer chinesi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Politik, die am<br />
Lächeln der Mandarine ablas, ob sich<br />
die Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft im harmoni<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en<br />
Gleichgewicht befindet oder nicht,<br />
bereits hingewiesen. 5 Schon damals<br />
war der Konfuzianismus, den man<br />
heute als Religion interpretiert, eine<br />
Gegenmaßnahme zu jeder Religion,<br />
die etwas mit Ekstase, Askese oder<br />
auch nur Kontemplation zu tun hatte.<br />
Stattdessen ging es um Verwaltung<br />
und Erziehung, mit der Pointe, dass<br />
die Erziehung im Medium einer<br />
durch ständige Prügelei erzeugten<br />
Verbieste<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng (meng) stattfand und<br />
man sich nur daraus die Entstehung<br />
jener »Güte« vo<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>llen konnte, die<br />
.....<br />
Die Chinesen versuchen herauszufinden, wie<br />
viel Un<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>he erfo<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>erlich und erträglich ist.<br />
<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ließlich mit allem einverstanden<br />
war, was sich die Verwaltung ausdachte,<br />
solange die Harmonie des<br />
Ganzen, abzulesen am Lächeln der<br />
Mandarine, gegeben war. Und die<br />
Mandarine, ein typi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>er Fall von<br />
»Mittelstufendasein« 6 , lächelten nur,<br />
wenn weder der D<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ck von oben zu<br />
g<strong>ro</strong>ß noch die Unzufriedenheit von<br />
unten zu stark war. Wer sind in den<br />
un<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>higen Zeiten der aktuellen Krise<br />
im Westen unsere Mandarine, an deren<br />
Befinden wir ablesen könnten,<br />
wie es um uns steht?<br />
Was also wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> in China verbrannt?<br />
Und wie wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> das Feuer gebändigt?<br />
Gerald Midgley und Jennifer Wilby<br />
aus der angelsächsichen Schule des<br />
Critical Systems Thinking (C. West Churchman,<br />
Peter Checkland, Russell L.<br />
Ackoff und andere) haben vor einigen<br />
Jahren ein Themenheft der Zeit<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>rift<br />
Systems Practice and Action<br />
Research (13. Jahrgang, Heft 1) der<br />
Rezeption der System<strong>th</strong>eorie in China<br />
gewidmet und festgestellt, dass der<br />
Konfuzianismus bereits wesentliche<br />
Elemente eines systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Denkens<br />
vor allem dann, wenn es prakti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en<br />
Ansprüchen genügen soll, en<strong>th</strong>ält.<br />
Jifa Gu und Zhichang Zhu vom<br />
Institut für Systemwissen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aften<br />
der chinesi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Akademie der Wissen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aften<br />
erläute<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> in diesem<br />
Themenheft, dass der Konfuzianismus<br />
von exakt jenen Bedingungen<br />
der Harmonie in differenzierten Systemen<br />
handelt, von denen die System<strong>th</strong>eorie<br />
ebenfalls spricht. 7 Diese<br />
Bedingungen sind denkbar ansp<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>chs-<br />
voll. Harmonie stellt sich nicht von<br />
selber her. Objektive Existenz (wu),<br />
subjektive Modellie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng (shi) und<br />
men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>liche Beziehungen (ren) müssten<br />
auf eine Art und Weise miteinander<br />
abgestimmt we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en, die man nur<br />
ve<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>hen kann, wenn man berücksichtigt,<br />
dass alle drei Elemente sowohl<br />
Ansprüche aneinander stellen<br />
als auch Abstand voneinander halten.<br />
Deshalb ist die Differenzie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng<br />
(li) der für alles andere ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidende<br />
Punkt. Taoismus, Buddhismus und<br />
1 Siehe Niklas Luhmann, Selbstorganisation<br />
und Mik<strong>ro</strong>diversität: Zur Wissenssoziologie<br />
des neuzeitlichen Individualismus, in:<br />
Soziale Systeme 3, Heft 1 (1997), S. 23-32.<br />
2 Siehe zu beidem: Philip Ball, Critical Mass:<br />
How One Thing Leads to Ano<strong>th</strong>er, Being<br />
an Enquiry into <strong>th</strong>e Interplay of Chance and<br />
Necessity in <strong>th</strong>e Way <strong>th</strong>at Human Culture,<br />
Customs, Institutions, Cooperation and<br />
Conflict Arise, London: Ar<strong>ro</strong>w Books, 2004.<br />
3 Siehe Wenjuan Niu, Social Combustion<br />
Theory: Dynamics of Social System Deterioration,<br />
in: Jie Zhou (Hrsg.), Complex<br />
Sciences, Bd. 5, Berlin: Springer, 2009,<br />
S. 2293-2299.<br />
4 Siehe Yijun Liu, Wenyuan Niu und Jifa Gu,<br />
Study on Public Opinion Based on Social<br />
Physics, in: Yong Shi et al. (Hrsg.), Cutting-<br />
Edge Research Topics on Multiple Crite<strong>ria</strong><br />
Decision Making: 20<strong>th</strong> Inte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ational Conference,<br />
MCDM 2009 Chengdu/Jiuzhaigou,<br />
China, June 21-26, 2009, Berlin: Springer,<br />
2009, S. 318-324.<br />
5 Siehe Max Weber, Die Wirt<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftse<strong>th</strong>ik<br />
der Weltreligionen, in: ders., Gesammelte<br />
Aufsätze zur Religionssoziologie, Nachd<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ck<br />
Tübingen: Mohr, 1988, S. 237-574,<br />
hier insbes. S. 430 ff.<br />
6 Mit dem Begriff von Niklas Luhmann,<br />
Funktionen und Folgen formaler Organisation<br />
[1964], 4. Aufl., Berlin: Duncker<br />
& Humblot, 1995.<br />
7 Siehe Jifa Gu und Zhichang Zhu, Knowing<br />
Wuli, Sensing Shili, Caring for Renli: Me<strong>th</strong>odology<br />
of <strong>th</strong>e WSR App<strong>ro</strong>ach, in: Systems<br />
Practice and Action Research 13, Heft 1<br />
(2000), S. 11-20.<br />
Kolumne Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7
Konfuzianismus kommen daher<br />
darin überein, Öffnung nur im Zusammenhang<br />
mit Reflexion (»Dreimal<br />
am Tag denke ich über mich<br />
selber nach«, Konfuzius) und Vollständigkeit<br />
nur im Zusammenhang<br />
mit Komplementarität und Flexibilität<br />
zu lehren. Damit ist jenes Wissen<br />
um Komplexität formuliert, das auch<br />
das antike Abendland bereits kannte<br />
(Diophantus): ein Wissen um die<br />
Komplementarität des Ver<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>iedenen,<br />
ein Wissen um die Form der<br />
Unter<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung, ein Wissen um die<br />
immer mitlaufende Notwendigkeit<br />
einer Ergänzung. 8<br />
Vertieft man dieses chinesi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e Modell,<br />
dreht es sich insbesondere um<br />
die Differenz (li), die als Substantiv<br />
und als Verb gleichermaßen verstanden<br />
wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>, als Textur, Markie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng,<br />
Linie, Kö<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>igkeit, Form, Muster, Wesen,<br />
Prinzip, Gesetz, O<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>nung, Regel,<br />
Regulie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng, Maxime, Logik, Wahrheit,<br />
G<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nd, Argument, Ve<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>unft,<br />
Die mit den Quadraten<br />
Verlag für Systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e For<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ung<br />
253 Seiten, Kt, 2010<br />
€ (D) 24,95/€ (A) 25,70<br />
ISBN 978-3-89670-927-1<br />
Weg, Eigen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft, aber auch als managen,<br />
betreiben, o<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>nen, aufräumen,<br />
aufmerksam sein auf, anerkennen,<br />
unter<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eiden, gerade rücken,<br />
führen, dienen, engagieren. 9 Wuli,<br />
shili und renli sind daher zusammengenommen<br />
nichts anderes als Praktiken<br />
der Akkomodation des denkbar<br />
Unter<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>iedlichen, Praktiken jedoch,<br />
die deshalb, weil das Unter<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>iedliche<br />
unter<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>iedlich ist, immer nur aus<br />
einer Position der Reflexion auf den<br />
eigenen Unter<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ied heraus vorgenommen<br />
we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en können. 10 Wir haben<br />
es oft genug gehört.<br />
Die Chinesen <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>einen jedoch vielfach<br />
mutiger als wir darin zu sein,<br />
der Reflexion eine eigene Praxis auf<br />
den Leib zu <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>neide<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>, die durchaus<br />
etwas mit Planung und Management<br />
zu tun hat. Jifa Gu etwa entwirft einen<br />
meta-syn<strong>th</strong>esis app<strong>ro</strong>ach, in dem auf<br />
denkbar klassi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e Art und Weise<br />
Hypo<strong>th</strong>esenentwurf und -validie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng<br />
mit einem denkbar unklassi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en,<br />
284 Seiten, Kt, 2010<br />
€ (D) 24,95/€ (A) 25,70<br />
ISBN 978-3-89670-929-5<br />
503 Seiten, Kt, 2010<br />
€ (D) 39,95/€ (A) 41,10<br />
ISBN 978-3-89670-931-8<br />
aber prakti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> immer <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>on betriebenen<br />
Vorgehen der Zusammenstellung<br />
hete<strong>ro</strong>gener Experteng<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ppen, der<br />
Suche nach überra<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>enden Informationen<br />
und der Verpflichtung ver<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>iedener<br />
Disziplinen auf eine dann<br />
nur ad hoc, nur »<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>mutzig« (mein<br />
Wort, db, nicht Gus Wort) zu formulierenden<br />
Theorie einhergeht. 11 Das<br />
gibt es im Westen alles auch, ich<br />
weiß. Peter Heintel hat es sogar als<br />
neue Form einer erst noch zu institutionalisierenden,<br />
auf den P<strong>ro</strong>zess und<br />
nicht die Arbeitsteilung konzentrierten<br />
Philosophie entworfen. 12 Aber interessant<br />
ist es doch, dass ausgerechnet<br />
die Sprachen der Differenz und<br />
der Komplexität hier wie dort, im<br />
Westen wie im Osten und in der Praxis<br />
wie in der Theorie, zu finden sind.<br />
Aber wie passt das mit der Verbrennung<br />
zusammen, über die Wenyuan<br />
Niu nachdenkt? Ich weiß es nicht,<br />
aber wenn ich in meinem Zettelkasten<br />
nach<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aue, was ich dort unter dem<br />
Die wissen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftliche Edition bei Carl-Auer • Bei Publikationsinteresse we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en Sie sich bitte an:<br />
Rita Niemann-Geiger • 0 62 21-64 38 13 • vsf@carl-auer.de • www.systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e-for<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ung.de<br />
Kolumne 106 Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 6<br />
448 Seiten, Kt, 2010<br />
€ (D) 34,95/€ (A) 36,–<br />
ISBN 978-3-89670-938-7
Stichwort »Evolution« finde, auf das<br />
sich auch Niu bezieht, dann stoße<br />
ich auf eine Bemerkung Heinz von<br />
Foe<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>rs, die auch wieder mit dem<br />
<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>on genannten Stichwort der »Mik<strong>ro</strong>diversität«<br />
korrespondiert. Heinz<br />
von Foe<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>r glaubt nicht an das<br />
Prinzip der natürlichen Selektion:<br />
»Die Natur wählt nichts. Da sitzt ja<br />
nicht ein g<strong>ro</strong>ßer Selektor mit dem<br />
Zwicker und der Pinzette, der fein<br />
säuberlich die Saurier von der Spielfläche<br />
entfe<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>t, sie ver<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>winden<br />
einfach.« 13 Und wie immer hat er<br />
Recht. Darwin dachte zunächst nur<br />
deshalb an P<strong>ro</strong>zesse der Selektion,<br />
weil er seine Studien der Evolution<br />
auf einem Pflanzenfeld vo<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ahm, auf<br />
dem immer auch ein Gärtner unterwegs<br />
war, der die einen Pflanzen entfe<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>te<br />
und die anderen stehen ließ.<br />
Das war von vo<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>eherein eine soziale<br />
Selektion, wie sie mit Herbert<br />
Spencer, hochgetrieben zum ideologi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en<br />
Prinzip, dann zu Recht unter<br />
Ver<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>f kam, und keine natürliche<br />
Selektion. Was aber findet man vor,<br />
wenn man nur auf die Natur <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aut?<br />
Mannigfaltigkeit und Tod. Das seien<br />
die beiden fundamentalen Prinzipien<br />
der Evolution, sagt von Foe<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>r, nicht<br />
Selektion und Fitness.<br />
Ahnt man, welche Entlastung und<br />
welche Herausfo<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>e<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng diese Umstellung<br />
bedeutet? Wir alle ver<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>winden<br />
wieder aus dem Spiel.<br />
»Egal, wie gut der Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> ist, er<br />
wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> zu einem toxi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Ärge<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>is,<br />
wenn er zu lange he<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>mhängt. Die<br />
Tafel, auf der sich all die Informationen<br />
sammeln, muss abgewi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>t<br />
we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en, und die <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>öne Schrift darauf<br />
muss sich in zufälligen Kreidestaub<br />
verflüchtigen,« <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>reibt Gregory<br />
Bateson. 14 Aber bis es so weit ist,<br />
arbeiten wir an der Mannigfaltig-<br />
keit der <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>önen Schrift. Was das<br />
heißt? Es heißt, dass wir uns auf die<br />
Verlockungen der Synergetik, zwi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en<br />
brennbarem Mate<strong>ria</strong>l und<br />
emergenten O<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>nungen zu unter<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eiden,<br />
nicht einlassen. Wir müssen<br />
mit den Chinesen reden. Aber<br />
nicht über social combustion, die ist<br />
ge<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>enkt, sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> über li, die Differenz.<br />
¶<br />
8 Siehe auch den Begriff der Ergänzung bei<br />
Martin Heidegger, Die G<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ndbegriffe der<br />
Metaphysik: Welt – Endlichkeit – Einsamkeit,<br />
Frankfurt am Main: Klostermann,<br />
1985, § 73; und den Begriff des supplément<br />
bei Jacques Derrida, Grammatologie,<br />
dt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974.<br />
9 So die Übersetzung von Zhichang Zhu,<br />
Dealing wi<strong>th</strong> a Differentiated Whole:<br />
The Philosophy of <strong>th</strong>e WST App<strong>ro</strong>ach, in:<br />
Systems Practice and Action Research 13,<br />
Heft 1 (2000), S. 21-57, hier: S. 25.<br />
10 So François Jullien, Über die Wirksamkeit,<br />
aus dem Französi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en von Gabriele Ricke<br />
und Ronald Vouillé, Berlin: Merve, 1999.<br />
11 Siehe Jifa Gu, Meta-Syn<strong>th</strong>esis App<strong>ro</strong>ach to<br />
Complex Systems Modeling, in: Eu<strong>ro</strong>pean<br />
Jou<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>al of Operational Research 166 (2005),<br />
S. 597-614.<br />
12 Siehe Peter Heintel, Motivfor<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ung und<br />
For<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ungsorganisation – ein neuer integrativer<br />
Ansatz, in: Heinz Fi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>er (Hrsg.),<br />
For<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ungspolitik für die 90er Jahre, Wien:<br />
Springer, 1985, S. 373-414; und Wilhelm<br />
Berger und Peter Heintel, Die Organisation<br />
der Philosophen, Frankfurt am Main:<br />
Suhrkamp, 1998.<br />
13 So Heinz von Foe<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>r, Der Anfang von<br />
Himmel und E<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>e hat keinen Namen:<br />
Eine Selbster<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>affung in 7 Tagen, hrsg.<br />
von Albert Müller und Karl H. Müller,<br />
Nachd<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ck Berlin: Kulturverlag Kadmos,<br />
2002, S. 121.<br />
14 In: Gregory Bateson, Geist und Natur:<br />
Eine notwendige Einheit, aus dem Amerikani<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en<br />
von Hans Günter Holl, Frankfurt<br />
am Main: Suhrkamp, 1982, S. 255.<br />
Dirk Baecker hat seit Herbst 2007 den<br />
Lehrstuhl für Kultur<strong>th</strong>eorie und -analyse<br />
an der Zeppelin University in Friedrichshafen<br />
inne. Zuvor war er P<strong>ro</strong>fessor für<br />
Soziologie an der Universität Witten/<br />
He<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>ecke, und von 1996 bis 2000 hatte er<br />
die Reinha<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>-Mohn-Stiftungsp<strong>ro</strong>fessur<br />
für Unte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ehmensfüh<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng, Wirt<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftse<strong>th</strong>ik<br />
und gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftlichen Wandel an<br />
der Universität Witten/He<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>ecke inne.<br />
Kolumne Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7
A<strong>th</strong>anasios Karafillidis studierte Sozialwissen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aften mit dem Schwerpunkt Soziologie der Organisation an der<br />
Universität Wuppertal und war an<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ließend wissen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Soziologie der<br />
Universität Witten/He<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>ecke. In seiner Dissertation hat er an der Entwicklung einer soziologi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Form<strong>th</strong>eorie<br />
gearbeitet. Momentan lehrt und for<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>t er zu Netzwerken, Organisationen, Management, Grenzen, System- und<br />
Form<strong>th</strong>eorie am Institut für Soziologie der RWTH Aachen. Der Autor veröffentlichte zuletzt: »Soziale Formen.<br />
Fortfüh<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng eines soziologi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en P<strong>ro</strong>gramms« (Bielefeld: transcript).<br />
A<strong>th</strong>anasios Karafillidis<br />
Risiken, ihre Organisation und die Technik ihrer Vermeidung<br />
Stuttgart<br />
War die Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung für das G<strong>ro</strong>ßp<strong>ro</strong>jekt »Stuttgart 21«<br />
riskant? Natürlich war sie riskant. Zumindest lässt sich<br />
kaum leugnen, dass es mittlerweile zahlreiche Beobachter<br />
gibt, die es so sehen – und nur das kann bei der Ein<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ätzung,<br />
ob etwas riskant ist oder nicht, maßgebend<br />
sein. Dass man ein Risiko eingegangen ist, <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eint nun<br />
offensichtlich, denn man hatte den Kostenaufwand<br />
fal<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> einge<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ätzt, das Vertrauen in politi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungsverfahren<br />
über<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ätzt und das Engagement<br />
und Mobilisie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ngspotenzial der »bürgerlichen Mitte«<br />
unter<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ätzt. Nun beklagt man von allen Seiten die<br />
Schäden, die vor allem als zukünftig zu erwartende<br />
Verluste markiert we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en, aber <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>on jetzt Konsequenzen<br />
zeitigen, obwohl über ihr Eintreten keinerlei<br />
Sicherheit bestehen kann: Man rechnet mit Verlust von<br />
Wählerstimmen, mit Imageverlust, mit einem Verlust<br />
von Standortattraktivität, mit Gewinnverlust oder Vertrauensverlust.<br />
Aber natürlich sollte man dabei nicht<br />
außer Acht lassen, dass andere Beobachter gerade deshalb<br />
auch Gewinne witte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> können. Mit eigenen wie<br />
fremden Risiken lässt sich spekulieren, man kann Wetten<br />
auf sie ab<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ließen, wie sich an der Finanzwelt und<br />
ihren P<strong>ro</strong>dukten besonders gut studieren lässt (vgl.<br />
Espos<strong>ito</strong> 2010).<br />
In diesem Zusammenhang fällt auf, dass man immer<br />
wieder, sei es explizit oder nur implizit, hört, dass man<br />
all das hätte wissen können. Das ist alles andere als ein<br />
bloßer Hinweis darauf, dass jedes Handeln auch nichtintendierte<br />
und nicht-antizipierte Folgen haben kann.<br />
Vielmehr verweist diese semanti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e Formel gleichsam<br />
auf eine bestimmte Form der Beobachtung von Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen,<br />
die entsprechende Auseinandersetzungen<br />
(und mi<strong>th</strong>in sogar Konflikte) befeue<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> kann, wenn auch<br />
nicht: muss. »Man hätte es wissen können« ist ein<br />
wesentliches Element der Kommunikation über Risiken,<br />
das im Prinzip jede ex post als riskant beobachtete<br />
Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung begleitet. Die Konsequenzen der damit<br />
verknüpften und deshalb stets mittransportierten Annahmen<br />
sind fatal, weil sie Kommunikation im Fall<br />
Stuttgart 21 zunächst auf nur zwei Möglichkeiten ein<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ränkt.<br />
Denn nun muss man entweder behaupten,<br />
dass all diese P<strong>ro</strong>bleme in der Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung zwar antizipiert<br />
und bisweilen bekannt, aber letzten Endes wissentlich<br />
ignoriert und in Kauf genommen wo<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en sind<br />
oder aber dass sich die politi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en und wirt<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftlichen<br />
Risiken, ihre Organisation und die Technik ihrer Vermeidung 116 Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7
Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eider so weit von den Interessen und dem Willen<br />
der Bürger entfe<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>t haben, dass sie erst gar nicht in der<br />
Lage sind, solche P<strong>ro</strong>bleme zu antizipieren und zu berücksichtigen.<br />
Wie auch immer unter diesen Umständen<br />
an<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ließende Rechtfertigungsversuche für diese oder<br />
irgendeine andere Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung auch ausfallen und wie<br />
auch immer die Motive und Interessen aussehen, die<br />
man da hinzuerfindet: Es ist ein Dilemma. Man hätte es<br />
wissen können.<br />
Risiko<br />
Eine Ver<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>iebung dieses vor allem politi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> diskutierten<br />
P<strong>ro</strong>blems in eine Soziologie des Risikos hinein (vgl.<br />
Luhmann 1991), trägt zwar nicht zur politi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Lösung<br />
des P<strong>ro</strong>blems bei, kann aber dabei helfen, etwas <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ärfer<br />
zu sehen, wie Risiken eigentlich p<strong>ro</strong>duziert we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en und<br />
welche kommunikativen Vorkeh<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ngen man trifft, um<br />
sie bisweilen nicht auffallen zu lassen und um sich gegen<br />
sie abzusiche<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>.<br />
Generell hält sich hartnäckig die Vo<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>llung, man könne<br />
mehr oder weniger riskante oder gar riskante von sicheren<br />
Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen unter<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eiden. Das lässt jedoch<br />
außer Acht, dass Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen immer Risiken bergen<br />
und fe<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er, dass Risiken nicht objektiv gegeben sind und<br />
auch nicht ein für alle Mal feststehen, sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> dass man<br />
vor einer Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung womöglich andere Risiken beobachtet<br />
und einzugehen glaubt als nach der Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung.<br />
Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en kommuniziert und setzen<br />
sich dadurch der Beobachtung aus. Das zeigt sich in<br />
Stuttgart eindrücklich. Man wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> immerfort mit anderen<br />
Beobachte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>, mit zeitlichen Ver<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>iebungen der<br />
Beobachtung von Risiken und nicht zuletzt mit Überra<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ungen<br />
im Hinblick darauf rechnen müssen, was<br />
jeweils als <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>adhafte Konsequenz einer Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung<br />
beobachtet wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>. Wer beobachtet wann welche Schäden,<br />
die als Konsequenz der Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung für dieses<br />
P<strong>ro</strong>jekt er<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>einen? Geht es um Schäden für die repräsentative<br />
Demokratie, für die investierenden Unte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ehmen,<br />
für die Natur oder für andere P<strong>ro</strong>jekte, die dann aus<br />
finanziellen Gründen nicht mehr realisiert we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en können?<br />
Es ist demnach ratsam, in solchen Fragen immer<br />
auch eine Systemreferenz anzugeben, um sortieren zu<br />
können, was für wen zu welchem Zeitpunkt ein Risiko<br />
ist. 1 Risiko ist ein Systemzustand, kein Weltzustand.<br />
Insofe<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> ist jedes beobachtete Risiko systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> – P<strong>ro</strong>dukt<br />
eines Systems.<br />
.......<br />
Risiken sind gleichsam ein<br />
Abfallp<strong>ro</strong>dukt der Kommunikation<br />
von Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen. Sichere<br />
Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen sind unmöglich.<br />
Risiken sind gleichsam ein Abfallp<strong>ro</strong>dukt der Kommunikation<br />
von Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen. Sichere Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen<br />
sind unmöglich. Gewissheit braucht keine Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung<br />
und kennt keine Alte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ativen. Jede Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung ist<br />
somit riskant, denn jede Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung kommuniziert<br />
nicht nur, was ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ieden wo<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en ist, sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> auch dass<br />
ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ieden wo<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en ist (Luhmann 2000, S. 123 ff.). Wir<br />
haben es mit einer Form der Kommunikation zu tun, mit<br />
der sich die Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft ihre Kontingenz immerzu selbst<br />
vorführt. Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen sind aus diesem G<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nd Wohl<br />
und Übel einer Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft, die sich selbst als immer<br />
auch anders möglich be<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>reibt. Die Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft braucht<br />
einerseits Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen, um die durch ihr Kontingenzbewusstsein<br />
entstehende Unsicherheit aufzufangen,<br />
aber andererseits lassen Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen durch ihre<br />
temporäre Festlegung der Zukunft die Unsicherheit<br />
nicht ver<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>winden, sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> erzeugen sie zugleich auch,<br />
weil sich an ihnen stets mit ablesen lässt, dass sich die<br />
sozialen, sachlichen und zeitlichen Bedingungen ihres<br />
Zustandekommens morgen <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>on wieder geändert haben<br />
können.<br />
Organisation<br />
Man kann sich nur wunde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>, dass es unter diesen<br />
Umständen überhaupt noch jemand wagt zu ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eiden.<br />
Wenn die Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft jedoch auf die durch Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen<br />
und Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungszusammenhänge ermöglichte<br />
Unsicherheitsabsorption angewiesen ist, muss<br />
sie Formen entwickelt haben, die t<strong>ro</strong>tz allem zur Kommunikation<br />
von Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen motivieren können.<br />
Die Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft verlässt sich in dieser Hinsicht auf die<br />
Kommunikationsform der Organisation. Durch Organisationen<br />
lässt sich Motivation für Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen be<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>affen,<br />
weil sie so gebaut sind, dass sie die damit ver-<br />
1 Und auch: was für wen zu welchem Zeitpunkt eine Gefahr ist.<br />
Deshalb auch die in Risikofragen immer anzutreffende Differenzie<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng<br />
von Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eide<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> und Bet<strong>ro</strong>ffenen.<br />
Risiken, ihre Organisation und die Technik ihrer Vermeidung 117 Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7
undenen Risiken invisibilisieren können. Das ge<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ieht<br />
nicht positiv, zum Beispiel durch entsprechende Anreize,<br />
sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> negativ, durch ein Netzwerk von Formen<br />
der Hierarchie, der Autorität und der Arbeitsteilung, das<br />
Beobachter demotiviert, Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen im Hinblick auf<br />
ihre Risiken zu beobachten. 2 Das heißt keinesfalls, dass<br />
Risikokommunikation dort nicht stattfindet. Gerade Organisation<br />
bietet genug Anlässe, Risiken zu beobachten<br />
und zu diskutieren. Aber man hat immer auch die<br />
Möglichkeit, an der Spitze eine Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung zu treffen,<br />
die nicht mehr hinterfragt we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en kann (Hierarchie);<br />
oder die Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung so lange wande<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> zu lassen, bis<br />
sich eine entsprechende Autorität findet, die ein weiteres<br />
Nachhaken automati<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> blockiert; oder eine Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung<br />
aus einem Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich<br />
in einen anderen zu entlassen, sodass sich weitere<br />
Rückfragen erübrigen (Arbeitsteilung). Der Trick besteht<br />
im Wesentlichen darin, dass Organisation die Beobachtung<br />
von Risiken selbst riskant macht, denn nun muss man<br />
<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>on die Hierarchie in Frage stellen, Autorität missachten<br />
oder Arbeitsteilung unterlaufen, wenn man auf<br />
Risiken bestimmter Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen hinweisen möchte.<br />
Auch das kommt vor. Aber es ist alles andere als der<br />
Normalfall.<br />
Organisation kann hingegen nicht alle Konsequenzen<br />
der Risikokommunikation kompensieren. Risiken<br />
we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en inte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> wie exte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> noch häufig genug beobachtet.<br />
Es braucht deshalb auch Formen der Absiche<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng für den<br />
Fall, dass das Risiko einer anstehenden Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung<br />
dennoch ans Licht gezerrt wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> oder die ausge<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>lossenen<br />
Alte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ativen zurückliegender Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen erinnert<br />
we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en. Die in dieser Hinsicht bekanntesten Formen<br />
sind Rationalität, Legitimität und Partizipation<br />
(vgl. B<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nsson 1985, Luhmann 1969). Rationalität setzt<br />
auf das Vertrauen in sachlich gute Gründe, die sich finden<br />
lassen und entsprechend bereitgehalten we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en<br />
müssen, um das Eingehen eines Risikos rechtfertigen zu<br />
können. Legitimität setzt auf das Vertrauen in eine<br />
letztlich auch rechtmäßig kont<strong>ro</strong>llierbare Einhaltung<br />
bestimmter Verfahrensregeln. Sie setzt so gesehen auf<br />
Zeit, also mi<strong>th</strong>in auf P<strong>ro</strong>zesse, die ein Risiko zwar nicht<br />
minimieren (was sich mit Rationalität immer noch suggerieren<br />
lässt), aber das Versprechen implizieren, dass<br />
man eine Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung im Laufe des Verfahrens hinlänglich<br />
durch ver<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>iedene Beobachter hat prüfen können.<br />
Und Partizipation bezeichnet eine Kommunika-<br />
tionsform, die daran zu arbeiten versucht, Konsens und<br />
Vertrauen in Bezug auf die beobachteten und die ausge<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>lossenen<br />
Alte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ativen wahr<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>einlicher zu machen.<br />
Man beachte, dass alle drei Absiche<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ngsformen selbst<br />
keine Sicherheit bieten können, auch kombiniert auftreten<br />
und fe<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er nicht nur innerhalb von Organisationen<br />
vorkommen, sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftliche Formen des<br />
Umgangs mit offen kommunizierten Risiken sind, auch<br />
wenn sie sich im Kontext von Organisation vermutlich<br />
am leichtesten identifizieren lassen.<br />
Technik<br />
Das führt uns zurück nach Stuttgart. Was dort augenblicklich<br />
passiert, wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> nun sichtbar als ein Phänomen,<br />
in dem die soeben aufgeführten Absiche<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ngsmechanismen,<br />
auf die sich die Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft bislang verlassen<br />
hat, nicht mehr in dem Maße greifen, wie man es<br />
früher vielleicht noch erwarten konnte. Die unermüdlichen<br />
Verweise auf die Legitimität entsprechender Verfahren<br />
der Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungsfindung reichen nicht aus.<br />
Man lässt dies einfach nicht mehr gelten. Die immerzu<br />
vorgeführte Rationalität der Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung (Anbindung<br />
an das eu<strong>ro</strong>päi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e Schnellverkehrsnetz; Zeitgewinne<br />
für Bahnreisende; entsprechende Gutachten, dass auch<br />
bei nur acht Gleisen keine Nachteile für Reisende entstehen<br />
etc.) wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> durch die Gegner des P<strong>ro</strong>jekts ebenfalls<br />
nicht akzeptiert und dadurch konterkariert, dass man<br />
sich interessanterweise selbst auf Rationalität be<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ft und<br />
dabei auf andere Gutachten setzt und andere gute Gründe<br />
findet, um das Risiko dieser Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung weiterhin<br />
zur Schau zu stellen. In Bezug auf Partizipation sind<br />
sich eigentlich beide Seiten einig. Aber es herr<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>t<br />
Uneinigkeit darüber, welche Form der Partizipation<br />
<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>on in diesem Fall und dann auch zukünftig zum Einsatz<br />
kommen sollte. Auf die repräsentative Demokratie<br />
will sich bei den Gegne<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> des P<strong>ro</strong>jekts, jedenfalls im<br />
Moment, niemand mehr verlassen, und es gibt deshalb<br />
e<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>eut Diskussionen über die Vor- und Nachteile basisdemokrati<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>er<br />
Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungsverfahren.<br />
Was kann man unter diesen Umständen tun? Da<br />
sich nicht voraussagen lässt, welche Modi des Umgangs<br />
mit diesem P<strong>ro</strong>blem die gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftliche Evolution erzeugt,<br />
könnte man versucht sein, nach Möglichkeiten<br />
zu suchen, Risiken zu vermeiden. Will man aber Risiken<br />
vermeiden, wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> man Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen vermeiden müssen.<br />
Gemeint ist nicht eine Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung darüber, nicht<br />
Risiken, ihre Organisation und die Technik ihrer Vermeidung<br />
118 Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7
zu ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eiden, denn auch sie ist riskant. Vielmehr müs-<br />
ste man dann dafür sorgen, dass Beobachter gar nicht<br />
erst auf die Idee kommen zu ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eiden; dass sie also<br />
daran gehindert we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en, Kommunikation überhaupt als<br />
Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung zu beobachten.<br />
Will man aber Risiken vermeiden,<br />
wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> man Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen vermeiden<br />
müssen.<br />
Technik ist so eine Möglichkeit – und vielleicht sogar<br />
die einzige. Technik zeichnet sich dadurch aus, dass<br />
Wah<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ehmung, Körper, Dinge und Kommunikation<br />
derart gekoppelt we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en, dass es, wenn und solange sie<br />
funktioniert, gerade unnötig wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>, jeden Schritt mit<br />
Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungsnotwendigkeiten zu belasten (vgl. Luhmann<br />
1997, S. 517 ff.). Das gilt für Computertechnik<br />
genauso, wie für Atomkraft, Meditationstechniken oder<br />
Organisations<strong>ro</strong>utinen. Ich muss während des Autofahrens<br />
nicht ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eiden, in den nächsten Gang zu <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>alten.<br />
Ich <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>alte einfach, ohne das laufende Gespräch mit<br />
meiner Beifahrerin zu unterbrechen. Ebenso wenig muss<br />
man bei einer einmal eingerichteten Routine in jedem<br />
Moment ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eiden, wohin welches Formular als<br />
nächstes gereicht we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en muss. Man gibt es einfach weiter.<br />
Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen fallen nur dann an, wenn Stö<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ngen<br />
auftreten oder das Funktionieren der Technik sogar<br />
zusammenbricht (vgl. Winograd/Flores 1986). Technik<br />
entlastet so gesehen von der Beobachtung von Alte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ativen,<br />
also von der Beobachtung von Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen<br />
und damit von der Beobachtung von Risiken. Sie selbst<br />
ist in diesem Sinne, und entgegen geläufiger Vo<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>llungen,<br />
gerade nicht riskant. Keine Technik ist riskant.<br />
Riskant sind aber Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen über ihre Entwicklung,<br />
ihre Umsetzung und ihren Einsatz. Technik ist permanent<br />
von Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen umstellt. 3 Techni<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e Abläufe<br />
erfo<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>e<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> zwar keine Zwi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>enent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen. Aber sie<br />
lassen sich eben auch nicht gegen das Soziale isolieren.<br />
Sie sind letzten Endes selbst sozial (vgl. Latour 2007).<br />
Wir können uns solche Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen folglich<br />
nicht ersparen und versuchen demgemäß lieber, Technik<br />
durch Organisation zu kont<strong>ro</strong>llieren – und umgekehrt.<br />
Organisationen <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>einen mi<strong>th</strong>in techni<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>er eingerichtet<br />
zu sein als die Technik selbst, und vielleicht ist<br />
das ja das eigentliche P<strong>ro</strong>blem von Stuttgart 21: dass es<br />
im Verlauf des ganzen Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungsp<strong>ro</strong>zesses, und vor<br />
allem auch nach dem Ausb<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ch der P<strong>ro</strong>teste, aus gleichsam<br />
techni<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Gründen nicht zu viel, sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> zu<br />
wenig Gelegenheiten gab und gibt, Risiken zu beobachten.<br />
Und zwar auf beiden Seiten. ¶<br />
......<br />
2 Zu dieser Idee, dass Netzwerke Handlungen in e<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>r Linie blockieren<br />
siehe White 1992, insb. S. 230 ff. Netzwerke sind andererseits<br />
aber auch die einzige Möglichkeit für »getting action«, wie<br />
es dort heißt.<br />
3 Oder mit Heidegger (1954): Technik ist das Ge-stell von Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen.<br />
Sie fo<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>ert sie heraus, sie stellt sie und ist durch sie<br />
bestellt.<br />
B<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nsson, Nils (1985): The Irrational Organization. Irrationality<br />
as a Basis for Organizational Action and Change, Chichester et al.:<br />
Wiley.<br />
Espos<strong>ito</strong>, Elena (2010): Die Zukunft der Futures. Die Zeit des Geldes<br />
in Finanzwelt und Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft, Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.<br />
Heidegger, Martin (1954): Die Frage nach der Technik, in ders.,<br />
Vorträge und Aufsätze, Stuttgart: Klett-Cotta, 2004, S. 9-40.<br />
Latour, B<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>no (2007): Eine neue Soziologie für eine neue<br />
Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.<br />
Luhmann, Niklas (1969): Legitimation durch Verfahren, Frankfurt<br />
am Main: Suhrkamp.<br />
Luhmann, Niklas (1991): Soziologie des Risikos, Berlin/New York:<br />
Walter de G<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>yter.<br />
Luhmann, Niklas (1997): Die Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft der Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft, Frankfurt<br />
am Main: Suhrkamp.<br />
Luhmann, Niklas (2000): Organisation und Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidung, Opladen/Wiesbaden:<br />
Westdeut<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>er Verlag.<br />
White, Harrison C. (1992): Identity and Cont<strong>ro</strong>l. A St<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ctural<br />
Theory of Social Action, Princeton: Princeton UP.<br />
Winograd, Terry/Flores, Fe<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ando (1986): Understanding Computers<br />
and Cognition. A New Foundation for Design, Reading,<br />
Mass.: Addison-Wesley.<br />
Risiken, ihre Organisation und die Technik ihrer Vermeidung 119 Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7
Einzelheft € (D) 25,– zzgl. Versandkosten<br />
Heft 1<br />
Das X der<br />
Organisation<br />
ISBN 978-3-89670-696-6<br />
Heft 3<br />
Organizational<br />
Capabilities<br />
ISBN 978-3-89670-698-0<br />
Heft 5<br />
Transnationale<br />
Utopie?<br />
ISBN 978-3-89670-714-7<br />
Heft 7<br />
Systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e Risiken<br />
ISBN 978-3-89670-760-4<br />
Heft 2<br />
Konsultanten<br />
ISBN 978-3-89670-697-3<br />
Heft 4<br />
Intelligent<br />
ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eiden<br />
ISBN 978-3-89670-699-7<br />
Heft 6<br />
Zufälle<br />
ISBN 978-3-89670-723-9<br />
Heft 8<br />
Design Thinking REVUE für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management<br />
Heft 8<br />
Design Thinking<br />
ISBN 978-3-89670-779-6<br />
Er<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eint<br />
Frühjahr 2011<br />
Design Thinking<br />
ISBN 978-3-89670-779-6, € 25 ,–<br />
Heft 8<br />
Haben Sie<br />
sich <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>on Ihr<br />
Abonnement<br />
gesichert?<br />
Hiermit abonniere ich die REVUE für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management<br />
ab Heft Nr. (bitte angeben) zu folgenden Bedingungen:<br />
Abonnement: 40,– Eu<strong>ro</strong> jährlich, zzgl. Versandkosten<br />
Er<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>einungsweise: 2 Hefte p<strong>ro</strong> Jahr (Frühjahr und Herbst)<br />
Kündigung: Das Abonnement gilt mindestens<br />
ein Jahr (Bezug von 2 Heften).<br />
Danach ist es jederzeit kündbar.<br />
Bestellungen:<br />
www.carl-auer.de/revue<br />
revue@carl-auer.de<br />
Tel. 0 62 21-64 38 0<br />
Fax 0 62 21-64 38 22<br />
oder per Post an:<br />
Carl-Auer Verlag GmbH<br />
– Abonnentenservice –<br />
REVUE<br />
Häusserstr. 14<br />
69115 Heidelberg<br />
Deut<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>land<br />
Weitere Informationen zur REVUE:<br />
www.pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es-management.de<br />
Absender:<br />
Firma<br />
Name | Vo<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ame<br />
Straße | Hausnr.<br />
Land | PLZ | Ort<br />
Tel.<br />
E-Mail<br />
Datum | Unter<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>rift<br />
Bitte liefe<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> Sie mit Rechnung<br />
Bitte belasten Sie mein Konto (nur innerhalb Deut<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>lands möglich)<br />
Bank | Ort<br />
BLZ<br />
Kontonr.<br />
Bei Bestellungen aus dem Ausland empfehlen wir die Zahlung mit Kreditkarte.<br />
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Überblick<br />
Impressum Abonnement<br />
Heft 1 – Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management<br />
Das X der Organisation Mit Beiträgen von Dirk Baecker, Nils M. G.<br />
B<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nsson, Birger P. Priddat, Johannes Rüegg-Stürm, Fritz B. Simon u. a.<br />
Featured Artist Annett Zinsmeister<br />
ISBN 978-3-89670-696-6<br />
Heft 2 – Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management<br />
Konsultanten Mit Beiträgen von Peter Slote<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>ijk, James G. March,<br />
Thomas G. Cummings, Ka<strong>th</strong>rin Röggla, Alfred Kieser, Rudolf Wimmer,<br />
Roswita Königswieser u. a. Featured Artist Ingeborg Lü<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>er<br />
ISBN 978-3-89670-697-3<br />
Heft 3 – Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management<br />
Organizational Capabilities Mit Beiträgen von Georg Schreyögg,<br />
Stefan Kühl, Peter Claussen, Ka<strong>th</strong>leen Sutcliffe, Amar Bhidé, Stefan Braun,<br />
Stefan Jung, Be<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ha<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> K<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng><st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e u. a. Featured Artist Marcus Bredt<br />
ISBN 978-3-89670-698-0<br />
Heft 4 – Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management<br />
Intelligent ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eiden Mit Beiträgen von Be<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ha<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> von Mutius,<br />
Rudolf Wimmer, Claus Otto Scharmer, Henrik Pontzen, Christoph Kahlert,<br />
Ulrich Renz u. a. Featured Art Datenkunst<br />
ISBN 978-3-89670-699-7<br />
Heft 5 – Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management<br />
Transnationale Utopie? Mit Beiträgen von Henry Minzberg, Elena Espos<strong>ito</strong>,<br />
Reinhart Nagel, Thomas Schumacher, Stefan Kühl, Stefan Friedrichs,<br />
Stefan Jung u. a. Featured Artist Dirk Hupe<br />
ISBN 978-3-89670-714-7<br />
Heft 6 – Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management<br />
Zufälle Mit Beiträgen von James G. March, Michael D. Cohen & Johan P. Olsen,<br />
Maren Lehmann, Fritz B. Simon u. a. Featured Artist Do<strong>ro</strong><strong>th</strong>ea Gold<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>midt<br />
ISBN 978-3-89670-723-9<br />
Abonnieren Sie die »Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management«:<br />
2 Ausgaben p<strong>ro</strong> Jahr zum Preis von € 40,– (incl. MwSt.) zzgl. Versandkosten<br />
Tel: +49 (0)6221-6438-0, E-Mail: revue@carl-auer.de<br />
oder über www.carl-auer.de und www.pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es-management.de<br />
Herausgeber: Management Zent<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>m Witten GmbH, To<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>n G<strong>ro</strong><strong>th</strong> (V.i.S.d.P.)<br />
Redaktionsleitung: Be<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ha<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> K<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng><st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e, To<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>n G<strong>ro</strong><strong>th</strong><br />
Redaktion: Dirk Baecker, Fritz B. Simon, Rudolf Wimmer<br />
Redaktionsassistenz: Falk Busse<br />
An<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>rift und Kontakt: Management Zent<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>m Witten GmbH<br />
B<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nnenstraße 196, 10119 Berlin, Tel. +49 (0)30 246 284-0, Fax +49 (0)30 246 284-10<br />
revue@pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es-management.de, www.pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es-management.de<br />
Er<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>einungsweise: 2-mal jährlich<br />
Preis Einzelheft: € 25,– (incl. MwSt.), zzgl. Porto/Versand<br />
Anzeigen: Falk Busse, Tel. +49 (0)30 246 284-0, busse@mz-witten.de<br />
Vertrieb: Carl-Auer Verlag GmbH, Häusserstraße 14, 69115 Heidelberg,<br />
Tel. +49 (0)6221-6438-0, Fax +49 (0)6221-6438-22, www.carl-auer.de<br />
Bestellungen/Abonnement: Rita Niemann-Geiger, Tel. +49 (0)6221-6438-13, revue@carl-auer.de<br />
Buchhaltung: Elvira Schwebler, Tel. +49 (0)6221-6438-18, <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>webler@carl-auer.de<br />
Lektorat: Dörte Hausbeck, Stefan Moos (Hamburg), engli<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>: Jaqueline Todd (Berlin)<br />
Gestaltung und Layout: antonberta design (Hamburg)<br />
Cover und Bildstrecke: Dörte Baecker (Cover: ohne Titel, 2000)<br />
D<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ck: mediaprint (Paderbo<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>), November 2010<br />
ISBN 978-3-89670-760-4 ISSN 1864-726x
Ausblick<br />
Heft 8 – Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management<br />
design <strong>th</strong>inking Er<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eint im April 2011<br />
Computer ände<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> alles<br />
Schon 1991 <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>rieb Peter Fuchs dazu: »Verborgen oder offenkundig durchdringen<br />
sie, was immer gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aftlich vorkommt.« Dass wir in Organisationen,<br />
Management und Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft mehr und mehr mit Compute<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng><br />
rechnen (le<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>en) müssen, ist einsichtig. Und auch die Frage, auf welche<br />
Weise dieses Medium uns (über)fo<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>ert und zu Lösungen zwingt, an die<br />
wir bislang nur im Traum zu denken wagten – diese Fragen fanden nicht<br />
zuletzt in den Denkfiguren der neueren System<strong>th</strong>eorie einige Beachtung.<br />
Doch wie Organisationen und Manager in der »nächsten Gesell<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft«<br />
solche und andere Irritationen in Aufmerksamkeit transformieren können<br />
(die wiede<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>m einen aufge<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>lossenen und unaufgeregten Umgang mit<br />
weiteren Irritationen erlauben) – welche Kulturtechniken also auf und<br />
unter der Hand entwickelt we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en müssen, um mit der selbstve<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>rsachten<br />
Komplexität Schritt zu halten: All dazu gibt es bisher allenfalls nur e<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng><br />
Vo<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>llungen. 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 Zu den vielversprechenderen<br />
davon gehört, was in unter<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>iedlichen Communities of<br />
Practice griffig unter dem Namen design <strong>th</strong>inking diskutiert wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>. Wir ve<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>hen<br />
da<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>nter zunächst eine Denkhaltung, bei der es da<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>m geht, aus<br />
einem gesetzten Zukunftsentwurf heraus den Status quo mit möglichen<br />
Optionen aufzuladen, anstatt Bestehendes nur zu variieren. Designer setzen<br />
auf Wandel; doch nicht, indem sie Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungen treffen, sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng><br />
zu jedem Zeitpunkt versuchen, Ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidungsprämissen stimmig auszurichten.<br />
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 Was aus Sicht von Designe<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> bei P<strong>ro</strong>dukten<br />
und Dienstleistungen mittlerweile zum Standa<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>repertoire eines designorientierten<br />
Arbeitsp<strong>ro</strong>zesses gehört, bleibt mit Blick auf ein Design von<br />
Organisationen zunächst einmal seltsam unbestimmt. Aus einer system<strong>th</strong>eoreti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en<br />
Perspektive wu<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>e dazu bereits einiges gesagt: Ob im Zusammenhang<br />
einer sich systemi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> ausflaggenden Strategieentwicklung oder<br />
bei der Beobachtung von so genannten HRO’s – stets ist die Wiedereinfüh<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng<br />
von Form in die Funktion geknüpft an die Hoffnung auf Geländegewinne<br />
bei der Füh<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng und Steue<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ng von kausal indifferenten, d. h.<br />
intelligenten Organisationen. 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 In der nächsten<br />
Ausgabe der Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management wollen wir dieses<br />
Pfe<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> einmal von hinten aufzäumen. Uns interessiert die Frage: Was sagen<br />
eigentlich die Designer selbst dazu? Wie lässt sich deren Vielfalt an Ansätzen<br />
und Me<strong>th</strong>oden auf den Aspekt des Organisationsdesigns beziehen?<br />
Welche blinden Flecke we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en sichtbar, wenn mit den Augen eines Designers<br />
auf die Gestaltung von Organisationen geblickt wi<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>? 1 0 1 1 0 1 0<br />
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 Wie gewohnt gehen wir im nächsten Themen<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>werpunkt<br />
der Revue den unter<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>iedlichen Ansätzen nach und unterziehen<br />
diese einer system<strong>th</strong>eoreti<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> informierten Prüfung. Und freuen uns nicht<br />
zuletzt ein Loch in den Bauch, wenn wir Sie dabei wieder zu unserer<br />
Leser<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>aft zählen dürfen.<br />
Für die Herausgeber … Be<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ha<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng> K<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng><st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>e<br />
Ausblick 122 Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7