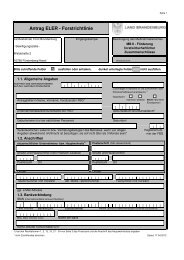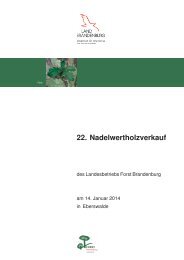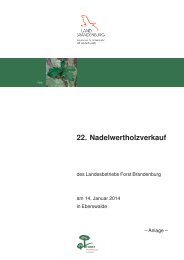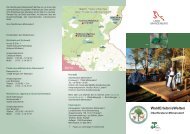Naturnahe Waldwirtschaft-Dauerwald heute? - Landesbetrieb Forst ...
Naturnahe Waldwirtschaft-Dauerwald heute? - Landesbetrieb Forst ...
Naturnahe Waldwirtschaft-Dauerwald heute? - Landesbetrieb Forst ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
10<br />
Der <strong>Dauerwald</strong>gedanke – seine waldwirtschaftlichen Hintergründe und Visionen<br />
– Die Holzernte und zugleich Waldpflege erfolgt auf<br />
der Betriebsfläche i.S. einer häufigen aber moderaten<br />
Nutzung anstelle eines einmaligen und starken<br />
Eingriffs.<br />
– Der Holzwert ist durch permanente Entnahme des<br />
„Schlechten und Kranken“ ständig zu steigern. Es<br />
wird nicht die höchstmögliche Volumenanreicherung<br />
angestrebt.<br />
– Der <strong>Dauerwald</strong> ist ein ungleichaltriger Wald – aber<br />
keineswegs mit allen Altersklassen auf einer Fläche.<br />
– Der <strong>Dauerwald</strong> ist ein gemischter Wald,<br />
• in dem standortsgerechte aber nicht vorhandene<br />
Mischbaumarten angebaut werden,<br />
• in dem in (Nadelholz-)Reinbeständen jede Art<br />
von Laubholz als Samenbäume erhalten und<br />
gepflegt wird.<br />
– Im Falle der künstlichen Verjüngung erfolgt diese<br />
in der Reihenfolge Saat vor Pflanzung, denn<br />
„… eine aus Saat entsprossene Pflanze kann niemals<br />
schlecht gepflanzt sein.“.<br />
– Im <strong>Dauerwald</strong> werden bestmöglich die in ihm ablaufenden<br />
biologischen Automatismen genutzt<br />
(Prozesssteuerung).<br />
– Die <strong>Forst</strong>einrichtung muss waldökologischen Belangen<br />
untergeordnet werden und darf nicht den<br />
Waldbau diktieren.<br />
– <strong>Dauerwald</strong>wirtschaft erfordert sachkundiges Personal,<br />
das von der Schreibtischarbeit weitgehend<br />
befreit und vorwiegend im Walde tätig ist.<br />
– Es werden Wilddichten vorausgesetzt, die eine<br />
Erhaltung des Gleichgewichtes des Waldwesens<br />
sicherstellen (waldgerechte, angepasste Wilddichten).<br />
MÖLLER (1920) geht mit folgender Formulierung explizit<br />
auf das Schalenwild und dessen Regulation ein:<br />
„Freilich mußte der Wildbestand in zulässigen Grenzen<br />
gehalten werden; der Jäger und <strong>Forst</strong>mann in der<br />
Person des Herrn Besitzers mussten den unvermeidlichen<br />
Kampf miteinander zu einem Ausgleich bringen;<br />
es galt vor allem die den ganzen Tag herumziehenden<br />
Rehe nicht zu zahlreich werden zu lassen“.<br />
Gemessen an der intensiven aktuellen Diskussion um<br />
die Reduzierung des Schalenwildes i. S. des Waldentwicklungszieles<br />
hatte jedoch der waldwirtschaftlich<br />
begrenzende Faktor „Schalenwild“ im <strong>Dauerwald</strong>konzept<br />
aus folgenden Gründen eine vergleichsweise<br />
geringe Wichtung:<br />
1. Die Schalenwilddichte in Nordostdeutschland war<br />
in der Entstehungsphase des <strong>Dauerwald</strong>gedankens<br />
wesentlich geringer als dies <strong>heute</strong> im nordostdeutschen<br />
Tiefland der Fall ist (STRAUBINGER<br />
1996).<br />
2. Aufgrund der vorliegenden Baumartenstruktur bildete<br />
der Kieferndauerwald einen wesentlichen<br />
Ausgangspunkt der <strong>Dauerwald</strong>idee. Der waldbaulich<br />
limitierende Einfluss des Schalenwildes war in<br />
den großflächigen Kiefernreinbeständen zunächst<br />
weniger deutlich erkennbar. Erst mit der zunehmenden<br />
waldbaulichen Einbeziehung von Laubbaumarten<br />
bei der Entwicklung strukturierter na-<br />
turnaher Waldbilder wurde die konsequente Reduzierung<br />
des Schalenwildes als entscheidende<br />
waldbauliche Rahmenbedingung erkannt.<br />
Letztendlich soll die möglichst störungsfreie Entwicklung<br />
ökosystemspezifischer Stoffkreisläufe auf der<br />
gesamten Betriebsfläche gewährleistet werden, um<br />
eine den gesamtgesellschaftlichen Erwartungen entsprechende<br />
multifunktionale Waldnutzung nachhaltig<br />
sicherzustellen.<br />
2.2. Kritik und Missverständnisse<br />
Das Dilemma der <strong>Dauerwald</strong>diskussion liegt wohl<br />
darin begründet, dass Möller kurz nach der Veröffentlichung<br />
seiner Schrift „Der <strong>Dauerwald</strong>gedanke“ im<br />
Jahr 1922 verstarb. Gegner und Befürworter missverstanden<br />
oder fehlinterpretierten das <strong>Dauerwald</strong>konzept.<br />
Erstere freilich in Form grundsätzlicher Ablehnung.<br />
Aber auch in der <strong>Dauerwald</strong>schule der Ära<br />
nach Möller kam es zur Fehlinterpretation einiger Teilaspekte.<br />
Möller konnte in die Verselbstständigung<br />
dieser Diskussion nicht mehr lenkend oder klarstellend<br />
eingreifen.<br />
Zu Lebzeiten Alfred Möllers bestimmten aus seiner<br />
Sicht folgende Hauptkritikpunkte die Diskussion um<br />
den <strong>Dauerwald</strong>:<br />
1. <strong>Dauerwald</strong> = Plenterwald.<br />
Es wurde bereits darauf verwiesen, dass das<br />
<strong>Dauerwald</strong>konzept an keine spezielle Waldaufbauform<br />
gebunden ist. Dem Grundsatz der nutzungsgesteuerten<br />
Stetigkeit des Waldwesens folgend,<br />
entspricht der Plenterwald (nach heutigem<br />
begrifflichen Verständnis) einer flächenhaften Komprimierung<br />
der <strong>Dauerwald</strong>wirtschaft.<br />
2. Zweck der <strong>Forst</strong>wirtschaft ist nicht die Stetigkeit<br />
des Waldwesens, sondern die nachhaltig größtmögliche<br />
Holzwerterzeugung.<br />
Diese Kritik ist nicht nachvollziehbar. Ausdrückliches<br />
und primäres Ziel der <strong>Dauerwald</strong>wirtschaft<br />
ist die nachhaltig größtmögliche Holzwertproduktion<br />
– aber bei gleichzeitigem Erhalt<br />
der biologisch-ökosystemaren Prozesse. Diese<br />
Zielformulierung spiegelt vor allem den wirtschaftlich<br />
entscheidenden Grundsatz der unbedingten<br />
Erhaltung und Verbesserung der Stabilität<br />
wider.<br />
3. Eine stetig-gleichbleibende Holzproduktion kann<br />
schon deshalb nicht gewährleistet werden, weil<br />
die Holzernte dem Waldökosystem kolossale Mengen<br />
Nährstoffe entzieht.<br />
Demnach würde <strong>Dauerwald</strong>wirtschaft zwangsläufig<br />
eine permanente Nährstoffzufuhr erfordern.<br />
Dieser Gedanke verdeutlicht den prägenden Einfluss<br />
landwirtschaftlicher Nutzungsprozesse auf<br />
den waldbaulichen Zeitgeist Anfang des 20. Jahrhunderts.<br />
Möller lehnt leistungssteigernde Düngung<br />
ab, toleriert jedoch zwingend erforderliche<br />
bodenzustandsverbessernde Sanierungsdüngung.<br />
4. <strong>Dauerwald</strong>wirtschaft erbringt weniger Holzvolumen<br />
als schlagweiser Hochwald.