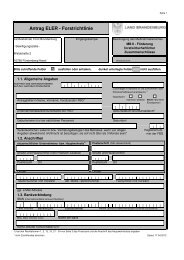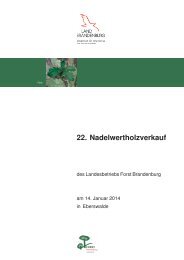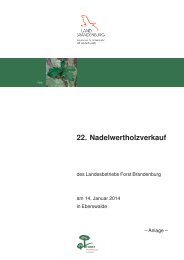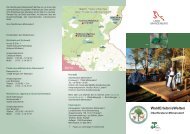Naturnahe Waldwirtschaft-Dauerwald heute? - Landesbetrieb Forst ...
Naturnahe Waldwirtschaft-Dauerwald heute? - Landesbetrieb Forst ...
Naturnahe Waldwirtschaft-Dauerwald heute? - Landesbetrieb Forst ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
38<br />
Veränderungen von Vegetation und Standort traditioneller <strong>Dauerwald</strong>reviere<br />
im Verlaufe von eineinhalb Jahrhunderten<br />
Gleichzeitig lässt der Vegetationszustandsvergleich der<br />
Zeitreihe – Istzustand der Vegetation zu Möllers Lebzeiten<br />
im Jahre 1911 (Abbildung 8) – Istzustand der Vegetation<br />
im Jahre 1934 (Abbildung 11) – Istzustand<br />
der Vegetation im Jahre 1960 (Abbildung 13) mit dem<br />
Vegetationszustand im Jahre 1990, die anfangs ganz<br />
allmähliche, nunmehr bereits fast 80 Jahre dauernde<br />
Herausbildung einer differenzierten Wald- und <strong>Forst</strong>vegetation<br />
in Bärenthoren erkennen, die in den letzten<br />
beiden Jahrzehnten durch den Stickstoff als Katalysator<br />
beschleunigt verlief und die natürlichen Standortsunterschiede<br />
immer klarer widerspiegelt (siehe hierzu<br />
Abbildungen 2 und 3). Mit der Deindustriealisierung<br />
großer Teile der ehemaligen DDR und den Einbau von<br />
Filteranlagen gehen die Stickstoffeinträge seit Anfang<br />
der 90er Jahre im Vergleich zu den 80er Jahren um bis<br />
zu 40 % zurück (EINERT UND BARTH (2001)). Dieser<br />
N-Rückgang lässt sich anhand des Rückgangs der<br />
Calamagrostis-Kiefernforsten und der in Sukzession<br />
befindlichen Kiefernforsten auch in der Vegetation Bärenthorens<br />
erkennen, siehe Abbildung 15 in der vergleichenden<br />
Betrachtung zu Abbildung 14.<br />
Neben der weiteren Ausbreitung der Spätblühenden<br />
Traubenkirsche in die Kiefern- und Lichtlaubholzforsten<br />
fällt insbesondere im Norden und Nordosten Bärenthorens<br />
der hohe Anteil an Laub- und Nadelholzkulturen<br />
auf, die ihre Ursache an den Sturmschäden<br />
des Orkans Kyrill im Winterhalbjahr 2007 haben, siehe<br />
Abbildung 16. Der Anteil der Kiefern-Buchenhalbforste<br />
und Kiefern-Laubholzmischforste hat sich im Vergleich<br />
zu 1990 auf den lehmbeeinflußten Standorten<br />
im Westen Bärenthorens vergrößert.<br />
Als neue Vegetationseinheit hat sich im Nordosten<br />
und Osten Bärenthorens, auf den plaggenbeeinflussten<br />
Nedlitzer Sandbraunerden, der Blaubeer-<br />
Drahtschmielen-Kiefernforst (ockerfarben in Abbildung<br />
15 dargestellt) herausgebildet. KRUTZSCH UND<br />
WECK (1934) beschrieben das Fehlen dieser Vegetationseinheit.<br />
Bärenthoren hat ca. 130 Jahre nach Erstbeschreibung<br />
(1872/84) mit dem Einwandern der Blaubeere in die<br />
Kiefernforsten den Vegetationszustand des <strong>Dauerwald</strong>es<br />
Gross Ziethen Anfang bis Mitte des 19. Jahrhundert<br />
erreicht, dessen Entwicklung im folgenden beschrieben<br />
wird:<br />
Die Waldentwicklung des Reviers Groß Ziethen<br />
von 1820 bis zur Gegenwart<br />
Im Unterschied zu Bärenthoren handelt es sich nach<br />
den Untersuchungen von HAUSENDORFF (1941) bei der<br />
Waldfläche des Reviers Groß Ziethen um einen alten<br />
Waldstandort. Abbildung 17 gibt den Waldzustand des<br />
Reviers Groß Ziethen im Jahr 1822 wieder, der sich<br />
etwa zur Hälfte aus Birken- (rosa dargestellt) und Kiefernbeständen<br />
(braune Farbgebung) zusammensetzte.<br />
Im Betriebswerk von 1820 war zusätzlich vermerkt,<br />
dass alle Waldbestände Groß Ziethens einen zweischichtigen<br />
Bestandesaufbau hatten. Bis auf eine Fläche<br />
im äußersten Südosten, in der ein zweischichtiger<br />
Kiefernbestand im Jahre 1820 kartiert wurde, bestand<br />
der Oberstand bzw. Überhalt aus Traubeneichen und,<br />
mit geringeren Anteilen, auch Rotbuche. So stockten<br />
57 ha Birken- und Birken-Kiefern-Mischbestände mit<br />
200jährigen Traubeneichen und Rotbuchen im Überhalt,<br />
z. T. mit Wacholder unterwachsen, im Jagen 104,<br />
im Nordosten des Reviers. Der Anteil der mit Rotbuche<br />
bestockten Fläche geht in den folgenden Jahrzehnten<br />
durch Nutzung zurück. Im Betriebsplan von<br />
1865 ist nur noch von der westlichen Teilfläche des<br />
Jagens 104, der 104 Bg, auf etwa 8 Hektar „von Birken<br />
im lichten Stande, …, durchmischt mit sehr ungleichaltrigen<br />
Kiefern Stangen und Baumhölzern und<br />
wenig Buchen… Durchstanden mit überhaubaren<br />
meist anbrüchigen Eichen..“ die Rede. Daneben existiert<br />
noch in der späteren Abteilung 222 ein kleiner<br />
Kiefernbestand im Nordwesten des Reviers, der mit<br />
einzelnen Traubeichen und Rotbuchen im Oberstand<br />
durchsetzt ist.<br />
Abb. 16: CIR Luftbild aus dem<br />
Jahr 2007 (vom Landebetrieb<br />
<strong>Forst</strong> Sachsen-Anhalt freundlicherweise<br />
zur Verfügung<br />
gestellt). Im Nordosten ist das<br />
Ausmaß der durch Kyrill geworfenen<br />
Baumbestände (120 000 fm<br />
Holz im Revier) zu erahnen.