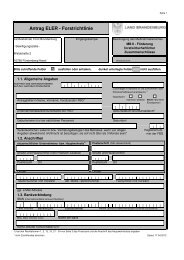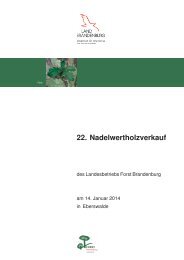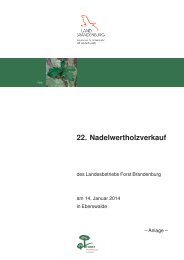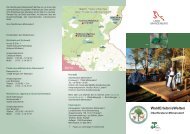Naturnahe Waldwirtschaft-Dauerwald heute? - Landesbetrieb Forst ...
Naturnahe Waldwirtschaft-Dauerwald heute? - Landesbetrieb Forst ...
Naturnahe Waldwirtschaft-Dauerwald heute? - Landesbetrieb Forst ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
22<br />
<strong>Dauerwald</strong> <strong>heute</strong> – was geht, vor allem mit Blick auf die Lichtbaumarten?<br />
(United Nations 1993) deutlich gemacht, dass es der<br />
Weltgemeinschaft <strong>heute</strong> um mehr geht, als um die<br />
bloße Nachhaltigkeit von Erträgen.<br />
Durch die Konferenz der Landwirtschafts- und <strong>Forst</strong>minister<br />
der Staaten der Europäischen Union (Second<br />
Ministerial Conference 1993) wurden für die Waldbewirtschaftung<br />
schließlich sowohl ökonomische, als<br />
auch ökologische und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit<br />
gleichwertig genannt. Gleichzeitig wurde deutlich,<br />
dass die Biodiversität und die Produktivität der Waldökosysteme<br />
als Voraussetzung für die Funktionalität der<br />
Zukunft gesichert werden müssten.<br />
Hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Erträge sind <strong>Forst</strong>leute<br />
seit von CARLOWITZ (1713) davon überzeugt, dass<br />
mit der Regel „nur soviel nutzen, wie im Nutzungszeitraum<br />
nachwächst“ richtig gehandelt würde und dass<br />
von dieser Regel nicht abgewichen werden sollte. Eine<br />
Nutzung, die bei vollständigem Erhalt des Naturkapitals<br />
stattfindet, wird <strong>heute</strong> allgemein als eine Bewirtschaftung<br />
bezeichnet, die dem Anspruch der „starken<br />
Nachhaltigkeit“ genügt (V. EGAN-KRIEGER und OTT 2007).<br />
Die Regel des Herrn von Carlowitz entspricht dieser<br />
Forderung.<br />
Dem gegenüber steht die „schwache Nachhaltigkeit“,<br />
die davon ausgeht, dass das Naturkapital – wenn<br />
schon nicht vollständig – so doch zu großen Teilen<br />
durch menschliche Handlungen und menschliche Erfindungen<br />
ersetzbar sei. Kennzeichnend für die Anwendung<br />
der schwachen Nachhaltigkeit ist der Servicegedanke:<br />
Es geht nicht um das Naturkapital als sol-<br />
ches, sondern um die Nutzbarmachung desselben für<br />
den Menschen. Vertreter der schwachen Nachhaltigkeit<br />
verweisen darauf, dass es möglich ist, nachfolgenden<br />
Generationen den gleichen Wohlstand durch<br />
die Kompensation von Naturkapital durch menschlichen<br />
Erfindergeist zu gewährleisten. Diese Sicht geht<br />
davon aus, dass die Ansprüche gegenwärtiger und<br />
zukünftiger Generationen prinzipiell gleich seien. Das<br />
macht sich auch bemerkbar in einer als dauerhaft angesehenen<br />
ungleichen Wertigkeit verschiedener Naturgüter:<br />
Sauerstoff ist wichtig und bleibt wichtig,<br />
<strong>heute</strong> wirtschaftlich unbedeutende Arten werden dagegen<br />
auch in Zukunft unbedeutend sein.<br />
Es fällt auf, dass in der <strong>Forst</strong>wirtschaft – und wohl<br />
auch in <strong>Dauerwald</strong>betrieben – die Neigung und das<br />
Bewusstsein, für die Biodiversität im Wald die gleiche<br />
starke Nachhaltigkeit in voller Konsequenz zu akzeptieren,<br />
wie das für die Holzproduktion selbstverständlich<br />
ist, eher gering ausgebildet sind. Wäre das nicht<br />
so, müsste es sehr viel mehr Diskussionen unter <strong>Forst</strong>leuten<br />
über Probleme des Erhalts und der Erhöhung<br />
der Artendiversität auch bei Baumarten geben.<br />
4.2 Einzelbaumnutzung als einziges Störungsregime<br />
verhindert größere Artenvielfalt<br />
Wir wollen nach diesen allgemeinen Ausführungen einen<br />
Blick auf den Umgang mit der Artenvielfalt im<br />
<strong>Dauerwald</strong>betrieb werfen. Die Abbildung 13 soll deutlich<br />
machen, dass sich die forstwirtschaftlichen Eingriffe<br />
im <strong>Dauerwald</strong>betrieb von den Störungen im Naturwald<br />
in mehrfacher Hinsicht unterscheiden.<br />
Abb. 13: Lückengrößen-Häufigkeitsverteilung<br />
in einem nordamerikanischen<br />
Eichen Urwald (oben,<br />
aus CLINTON et al. 1993) und in<br />
Buchen-Urwäldern Japans und<br />
Europas (unten, aus WAGNER et al.<br />
2010c).