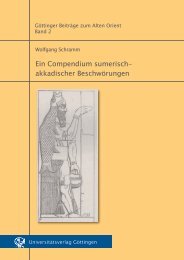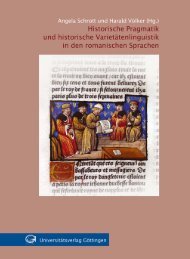inhalt impressum
inhalt impressum
inhalt impressum
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
38 thema<br />
ZfL 2/2009<br />
VRiVG a. D. Bernward Büchner, Freiburg<br />
Lebensrecht nach Maßgabe der Selbstbestimmung anderer?<br />
– Zum Gesetz zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes –<br />
I. Vorgeschichte<br />
Der Bundestag hat am 13. Mai 2009 ein Gesetz zur Änderung<br />
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes beschlossen,<br />
mit dem eine langjährige Auseinandersetzung um<br />
Maßnahmen zur Vermeidung von Spätabtreibungen<br />
ein Ende gefunden hat. Dieser Streit war ausgelöst<br />
worden durch die Reform des Abtreibungsstrafrechts<br />
von 1995. Die bis dahin geltende Gesetzesfassung sah<br />
noch eine embryopathische Indikation zum Schwangerschaftsabbruch<br />
wegen gesundheitlicher Behinderung<br />
des ungeborenen Kindes vor. Sie ermöglichte<br />
dessen Tötung „nicht rechtswidrig“ innerhalb von zweiundzwanzig<br />
Wochen seit der Empfängnis. Als nun das<br />
Abtreibungsurteil des Bundesverfassungsgerichts von<br />
1993 eine Neuregelung des Paragrafen 218 StGB aus<br />
anderen Gründen notwendig machte, wurde die embryopathische<br />
Indikation, wie von den Kirchen und Behindertenverbänden<br />
gefordert, in der derzeit geltenden<br />
Gesetzesfassung von 1995 zwar gestrichen. Gleichzeitig<br />
wurden die Fälle der embryopathischen Indikation<br />
nunmehr der medizinischen Indikation untergeordnet.<br />
Embryopathisch motivierte Abtreibungen sollten in der<br />
medizinischen Indikation – wie im Gesetzgebungsverfahren<br />
ausdrücklich erklärt – „aufgehen“ bzw. von ihr<br />
„aufgefangen“ werden. Mit der Streichung der embryopathischen<br />
Indikation entfiel auch die insoweit obligatorisch<br />
gewesene Beratung der Schwangeren und<br />
zugleich die gesetzliche Befristung mit der Folge, dass<br />
auch die vorgeburtliche Tötung eines Kindes infolge<br />
seiner Behinderung während der gesamten Dauer der<br />
Schwangerschaft nach dem Gesetz „nicht rechtswidrig“<br />
ist. Nach dem bereits 1994 im Grundgesetz verankerten<br />
speziellen Diskriminierungsverbot (Art. 3 Abs. 3 S.<br />
2 GG) jedoch darf niemand wegen seiner Behinderung<br />
benachteiligt werden.<br />
Das geltende Gesetz verlangt für den nicht rechtswidrigen<br />
Abbruch der Schwangerschaft aufgrund der medizinisch-sozialen<br />
Indikation, dass er „unter Berücksichtigung<br />
der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse<br />
der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis<br />
angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die<br />
Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des<br />
körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der<br />
Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf<br />
eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden<br />
kann“ (§ 218a Abs. 2 StGB). Obwohl der Schwangerschaftsabbruch<br />
dementsprechend „nach ärztlicher<br />
Erkenntnis angezeigt“ sein muss, hat sich die Praxis der<br />
medizinisch-sozialen Indikation so entwickelt, dass sie<br />
in Fällen einer diagnostizierten Behinderung des ungeborenen<br />
Kindes vielfach einer Tötung auf Wunsch der<br />
Schwangeren gleichkommt.<br />
Weil Schwangerschaftsabbrüche nach der medizinischsozialen<br />
Indikation zeitlich unbefristet möglich sind,<br />
kommt es nicht selten zu Spätabtreibungen nach Ablauf<br />
der zwölften Schwangerschaftswoche und selbst<br />
dann noch, wenn das Kind – ab etwa der 22. Woche<br />
– bereits außerhalb des Mutterleibs lebensfähig ist.<br />
Die durch das Statistische Bundesamt erfasste Zahl der<br />
Schwangerschaftsabbrüche ab der 23. Woche betrug in<br />
den Jahren 1996 bis 2008 jeweils zwischen 154 und 231.<br />
Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe<br />
(DGGG) meldete hiergegen in einem Papier<br />
„Schwangerschaftsabbruch nach Pränataldiagnostik“<br />
(2003) erhebliche Zweifel an. Berichte aus der Praxis<br />
zeigten, dass in mehreren Kliniken in der Bundesrepublik<br />
Spätabbrüche erfolgten, die dann offenbar teilweise<br />
als Totgeburten registriert würden. 1 Der frühere Vorsitzende<br />
des Marburger Bundes, Frank Ulrich Montgomery,<br />
sprach von jährlich rund 800 Abtreibungen jenseits der<br />
22. Woche. 2<br />
Bei extrauterin lebensfähigen Kindern kommt es vor,<br />
dass diese ihre Abtreibung überleben. Der bekannteste<br />
Fall ereignete sich am 6. Juli 1997 in der Städtischen<br />
Klinik in Oldenburg. Ein Junge sollte in der 26. Schwangerschaftswoche<br />
wegen eines Down-Syndroms abgetrieben<br />
werden. Er überlebte die Abtreibung und wurde,<br />
wie in solchen Fällen üblich, in Erwartung seines baldigen<br />
Todes in Tücher gewickelt liegen gelassen. Als er<br />
nach neun Stunden immer noch lebte, wurde er zur neonatologischen<br />
Behandlung in die Kinderklinik verlegt.<br />
Infolge der langen Verweigerung einer medizinischen<br />
Versorgung ist das Kind zusätzlich behindert. 3 Unter<br />
dem Eindruck solcher Fälle nannte die frühere Bundesjustizministerin<br />
Herta Däubler-Gmelin Spätabtreibungen<br />
im März 1999 „grauenvoll“. Man müsse sie „unterbinden,<br />
schlichtweg unterbinden, wenn die Gesundheit<br />
der Mutter nicht gefährdet ist.“ 4<br />
II. Initiativen im Bundestag<br />
Bereits vor dem „Oldenburger Fall“ gab es im Deutschen<br />
Bundestag Initiativen zur Bewältigung des Pro-<br />
1 ZfL 2003, 28 ff., 36.<br />
2 Zitiert bei Manfred Spieker, Recht auf Abtreibung, F.A.Z. vom 6.<br />
März 2009.<br />
3 Hierzu Manfred Spieker, Kirche und Abtreibung in Deutschland.<br />
2. Aufl. 2008, S. 258.<br />
4 Zitiert nach Manfred Spieker (Fn. 3), S. 259.