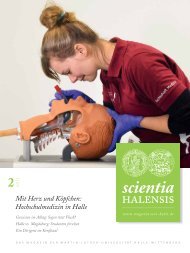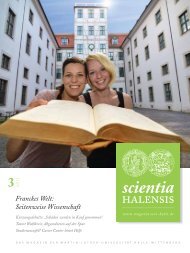WISSENSCHAFTS JOURNAL
WISSENSCHAFTS JOURNAL
WISSENSCHAFTS JOURNAL
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
scientia halensis 2/2004<br />
....................................................................................<br />
Fachbereich Physik<br />
................................................................................<br />
für Mikrostrukturphysik (AG Hesse, AG<br />
16 Woltersdorf) werden Untersuchungen zu<br />
Phasenbildungsprozessen ausgeführt, welche<br />
bei neuartigen Herstellungsverfahren<br />
von Elektrokeramiken mit gezielt verbesserten<br />
Eigenschaften ablaufen (»Nanochemisches<br />
Konstruieren«). In Abb. 1 und 2<br />
sind zwei elektronenmikroskopische Abbildungen<br />
(TEM) wiedergegeben: Mit Hilfe<br />
von Modellexperimenten an Einkristallen<br />
ist am MPI das Bildungsverhalten von Ba-<br />
Ti-O- und Ba-Ti-Si-O-Phasen bei Zusatz<br />
von SiO zu BaTiO untersucht worden.<br />
2 3<br />
Hintergrund ist der Einsatz von SiO als 2<br />
Sinterhilfsmittel bei der Herstellung von<br />
Elektrokeramiken.<br />
Abb. 2: Hochauflösende TEM-Querschnittsabbildung. Man erkennt eine lamellenartige, mit<br />
elastischen Spannungen beauflagte Struktur der Ba 3 Ti 11 O 25 /BaTiO 3 -Grenzfläche, an der das<br />
Wachstum der Ba 3 Ti 11 O 25 -Phase in den BaTiO 3 -Einkristall hinein erfolgt.<br />
Strukturen werden über eine intramolekulare<br />
Phasenseparation erzeugt (vgl. auch den<br />
Beitrag von Mario Beiner und Thomas<br />
Thurn-Albrecht in diesem Heft). Durch die<br />
Kombination von unterschiedlichen Polymeren<br />
auf der Nanometerskala lassen sich<br />
damit durch Variation der Zusammensetzung<br />
und der molekularen Architektur die<br />
Abb. 3: Atomare Details der Pt-katalysierten Reaktionskinetik im System Si-.C.<br />
Im zweiten Beispiel geht es um die Untersuchung<br />
strukturbildender Nanoprozesse<br />
im technologisch vielseitig nutzbaren System<br />
Silizium-Kohlenstoff, das zu hochtemperaturfesten,<br />
superharten und darüber<br />
hinaus elektronisch interessanten Werkstoffen<br />
führt. Abb. 3 zeigt in atomarer Auflösung<br />
Einzelheiten der Grenzflächen-Reaktionskinetik<br />
im Falle einer Platin-katalysierten<br />
Kohlenstoff-Strukturierung. Man<br />
erkennt das Hineinwachsen von Platinsilicid-Partikeln<br />
(Pfeile) in die oberflächennahen<br />
Atomebenen des kristallinen SiC und<br />
die gleichzeitige Abscheidung von Graphitatomebenen<br />
(»C«) auf der dem SiC abgewandten<br />
Seite, wodurch die graphitbildende<br />
Funktion des Platins illustriert wird.<br />
Abb. 4 zeigt ein Beispiel für Nanostrukturen<br />
in Polymeren – sogenannte lamellare<br />
Blockcopolymere, wie sie am Institut für<br />
Werkstoffwissenschaft (AG Michler) untersucht<br />
werden. Diese hochgeordneten<br />
makroskopischen Eigenschaften wie z. B.<br />
die Zähigkeit maßschneidern.<br />
Auswirkungen<br />
Die Arbeit des SFB hat eine nachhaltige<br />
Wirkung auf die beteiligten Institutionen<br />
ausgeübt. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen<br />
Arbeit in den ersten beiden Antragsperioden<br />
(1996–1999 und 1999–2002) fanden<br />
hohe Anerkennung durch die Gutachter<br />
der DFG, die schließlich zu einer erneuten<br />
Verlängerung der Arbeit des SFB bis Ende<br />
2005 geführt haben. Zahlreiche wissenschaftliche<br />
Publikationen in renommierten<br />
Zeitschriften, eingeladenen Vorträgen auf<br />
internationalen Fachtagungen sowie in Beiträgen<br />
zu aktuellen Problemen der Entwicklung<br />
und der Technologie neuer Werkstoffe,<br />
z. B. der Optimierung moderner<br />
Funktions- und Konstruktionskeramiken,<br />
Abb. 4: TEM-Abbildung des typischen Chevronmusters<br />
eines Styrol-Dien-Blockcopolymers.<br />
Das Muster bildet sich durch Belastung<br />
(σ) senkrecht zu der Lamellenausrichtung des<br />
Blockcopolymers.<br />
dem atomaren Design von Hochleistungs-<br />
Verbundwerkstoffen, der Entwicklung metallischer<br />
Nanodrähte und dem Maßschneidern<br />
von Beschichtungen und Grenzflächen<br />
spiegeln die große Breitenwirkung des<br />
SFB wider. Darüber hinaus wurden viele<br />
wirksame Kooperationen zwischen den<br />
beteiligten Gruppen geknüpft. Die Auswirkung<br />
auf das wissenschaftliche Klima und<br />
die Lehre sind enorm. Die Attraktivität des<br />
SFB dokumentiert sich nicht zuletzt darin,<br />
dass es problemlos gelungen ist, Neuanträge<br />
in das Forschungskonzept des SFB<br />
zu integrieren. Einer erfolgreichen Weiterführung<br />
des SFB in einer letzten Antragsperiode<br />
ab 2006 sehen wir mit Optimismus<br />
entgegen.<br />
■<br />
Prof. Dr. Horst Schneider studierte Physik<br />
in Leipzig, Promotion und Habilitation an<br />
der Universität Leipzig, kam über die ehemalige<br />
TH-Merseburg an die Uni Halle,<br />
Forschung: Festkörper-NMR an weicher<br />
Materie.<br />
Prof. Dr. Steffen Trimper, Studium der Physik<br />
in Leipzig, Promotion und Habilitation<br />
an der Uni in Leipzig. An der halleschen<br />
Universität Sprecher des SFB 418, Forschung:<br />
Statistische Physik und Phasenübergänge.