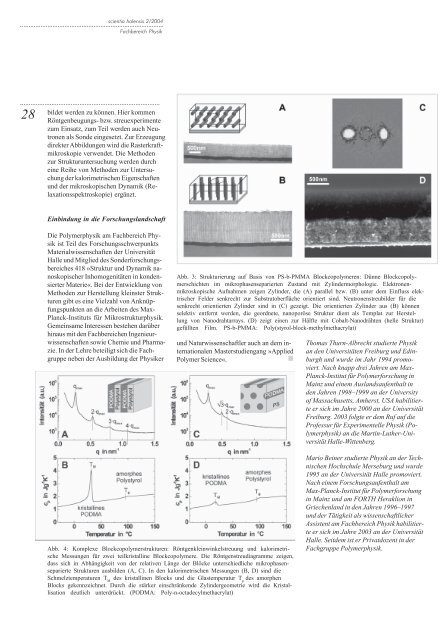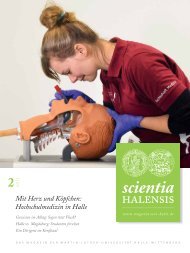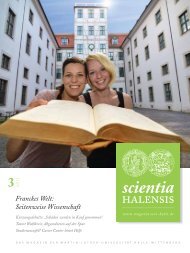WISSENSCHAFTS JOURNAL
WISSENSCHAFTS JOURNAL
WISSENSCHAFTS JOURNAL
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
scientia halensis 2/2004<br />
....................................................................................<br />
Fachbereich Physik<br />
................................................................................<br />
bildet werden zu können. Hier kommen<br />
28 Röntgenbeugungs- bzw. streuexperimente<br />
zum Einsatz, zum Teil werden auch Neutronen<br />
als Sonde eingesetzt. Zur Erzeugung<br />
direkter Abbildungen wird die Rasterkraftmikroskopie<br />
verwendet. Die Methoden<br />
zur Strukturuntersuchung werden durch<br />
eine Reihe von Methoden zur Untersuchung<br />
der kalorimetrischen Eigenschaften<br />
und der mikroskopischen Dynamik (Relaxationsspektroskopie)<br />
ergänzt.<br />
Einbindung in die Forschungslandschaft<br />
Die Polymerphysik am Fachbereich Physik<br />
ist Teil des Forschungsschwerpunkts<br />
Materialwissenschaften der Universität<br />
Halle und Mitglied des Sonderforschungsbereiches<br />
418 »Struktur und Dynamik nanoskopischer<br />
Inhomogenitäten in kondensierter<br />
Materie«. Bei der Entwicklung von<br />
Methoden zur Herstellung kleinster Strukturen<br />
gibt es eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten<br />
an die Arbeiten des Max-<br />
Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik.<br />
Gemeinsame Interessen bestehen darüber<br />
hinaus mit den Fachbereichen Ingenieurwissenschaften<br />
sowie Chemie und Pharmazie.<br />
In der Lehre beteiligt sich die Fachgruppe<br />
neben der Ausbildung der Physiker<br />
und Naturwissenschaftler auch an dem internationalen<br />
Masterstudiengang »Applied<br />
Polymer Science«.<br />
■<br />
Abb. 4: Komplexe Blockcopolymerstrukturen: Röntgenkleinwinkelstreuung und kalorimetrische<br />
Messungen für zwei teilkristalline Blockcopolymere. Die Röntgenstreudiagramme zeigen,<br />
dass sich in Abhängigkeit von der relativen Länge der Blöcke unterschiedliche mikrophasenseparierte<br />
Strukturen ausbilden (A, C). In den kalorimetrischen Messungen (B, D) sind die<br />
Schmelztemperaturen T M des kristallinen Blocks und die Glastemperatur T g des amorphen<br />
Blocks gekennzeichnet. Durch die stärker einschränkende Zylindergeometrie wird die Kristallisation<br />
deutlich unterdrückt. (PODMA: Poly-n-octadecylmethacrylat)<br />
Abb. 3: Strukturierung auf Basis von PS-b-PMMA Blockcopolymeren: Dünne Blockcopolymerschichten<br />
im mikrophasenseparierten Zustand mit Zylindermorphologie. Elektronenmikroskopische<br />
Aufnahmen zeigen Zylinder, die (A) parallel bzw. (B) unter dem Einfluss elektrischer<br />
Felder senkrecht zur Substratoberfläche orientiert sind. Neutronenstreubilder für die<br />
senkrecht orientierten Zylinder sind in (C) gezeigt. Die orientierten Zylinder aus (B) können<br />
selektiv entfernt werden, die geordnete, nanoporöse Struktur dient als Templat zur Herstellung<br />
von Nanodrahtarrays. (D) zeigt einen zur Hälfte mit Cobalt-Nanodrähten (helle Struktur)<br />
gefüllten Film. PS-b-PMMA: Poly(styrol-block-methylmethacrylat)<br />
Thomas Thurn-Albrecht studierte Physik<br />
an den Universitäten Freiburg und Edinburgh<br />
und wurde im Jahr 1994 promoviert.<br />
Nach knapp drei Jahren am Max-<br />
Planck-Institut für Polymerforschung in<br />
Mainz und einem Auslandsaufenthalt in<br />
den Jahren 1998–1999 an der University<br />
of Massachusetts, Amherst, USA habilitierte<br />
er sich im Jahre 2000 an der Universität<br />
Freiburg. 2003 folgte er dem Ruf auf die<br />
Professur für Experimentelle Physik (Polymerphysik)<br />
an die Martin-Luther-Universität<br />
Halle-Wittenberg.<br />
Mario Beiner studierte Physik an der Technischen<br />
Hochschule Merseburg und wurde<br />
1995 an der Universität Halle promoviert.<br />
Nach einem Forschungsaufenthalt am<br />
Max-Planck-Institut für Polymerforschung<br />
in Mainz und am FORTH Heraklion in<br />
Griechenland in den Jahren 1996–1997<br />
und der Tätigkeit als wissenschaftlicher<br />
Assistent am Fachbereich Physik habilitierte<br />
er sich im Jahre 2003 an der Universität<br />
Halle. Seitdem ist er Privatdozent in der<br />
Fachgruppe Polymerphysik.