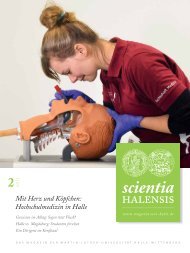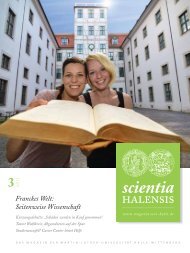WISSENSCHAFTS JOURNAL
WISSENSCHAFTS JOURNAL
WISSENSCHAFTS JOURNAL
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
scientia halensis 2/2004<br />
....................................................................................<br />
Fachbereich Physik<br />
................................................................................<br />
Maßgeschneiderte Eigenschaften<br />
32<br />
Ein zweites Beispiel aus dem Themenbereich<br />
organischer Moleküle an Oberflächen:<br />
Ungesättigte und insbesondere konjugierte<br />
organische Moleküle werden als aktive Elemente<br />
in diversen elektronischen und optoelektronischen<br />
Bauelementen, wie z. B.<br />
Leuchtdioden, Feldeffekttransistoren und<br />
photovoltaischen Zellen, verwendet. Zu<br />
den Vorteilen solcher »organic devices« gehören<br />
unter anderem einfache Präparation,<br />
mechanische Flexibilität und geringe Kosten.<br />
Mit kleiner werdenden Strukturen<br />
solcher Bauelemente werden die Eigenschaften<br />
der Grenzflächen der Molekülschicht<br />
zum Halbleitersubstrat bzw. zur<br />
Oxidschicht wesentlich, über die z. B. Ladungsträger<br />
injiziert oder elektrische Felder<br />
kontrolliert werden. Die Grenzfläche bestimmt<br />
auch die Qualität des Schichtwachstums.<br />
Die Forschungsarbeiten reichen<br />
von der Untersuchung der Oberflächen-Molekül-Wechselwirkung<br />
für kleine<br />
Moleküle mit isolierten funktionellen<br />
Gruppen (einzelne π-Bindung, konjugierte<br />
und aromatische π-Bindungen) – dies auch<br />
mit Blick auf Anwendungen in der heterogenen<br />
Katalyse – bis zum Schichtwachstum<br />
von großen organischen Molekülen<br />
mit einem ausgedehnten π-Elektronensystem,<br />
wie sie in der Optoelektronik eingesetzt<br />
werden. Die oben stehende Abbil-<br />
dung zeigt die Adsorptionsstruktur, die<br />
sich auf der Halbleiteroberfläche Si(100)<br />
für das kleinste Molekül mit aromatischen<br />
π-Bindungen, Benzol, ergibt. Mit Hilfe der<br />
UV-Photoelektronenspektroskopie und der<br />
hochaufgelösten Schwingungsspektroskopie<br />
konnten hier Adsorptionsstruktur und<br />
-mechanismus aufgeklärt werden. Solche<br />
Modellsysteme bilden die Basis für das<br />
Verständnis größerer organischer Moleküle.<br />
Laterale Strukturierung, die intrinsisch<br />
durch das Substrat bzw. extern kontrolliert<br />
durch Oberflächenterrassierung vorgegeben<br />
wird oder sich durch die Molekül-Molekül-Wechselwirkung<br />
selbst organisiert,<br />
kann zu modifizierten Eigenschaften führen.<br />
Hierzu zählt die Ausbildung von eindimensionalen<br />
Molekülketten mit sehr anisotropen<br />
elektronischen Eigenschaften. Solche<br />
und ähnliche Konzepte von selbst organisiertem<br />
Wachstum führen schon heute<br />
Ein Student an einer Ultrahochvakuum-Apparatur zur Charakterisierung einer Oxidoberfläche<br />
mit Rastertunnelmikroskopie.<br />
Modell und Schwingungsspektrum für Benzol adsorbiert auf einer Siliziumoberfläche. Die verschiedenen<br />
Bewegungen des schwingenden Moleküls sind durch Pfeile veranschaulicht. Berechnete<br />
Frequenzen sind unten als Balken dargestellt.<br />
zu maßgeschneiderten Materialeigenschaften<br />
dünner Filme.<br />
In der Fachgruppe Oberflächen- und<br />
Grenzflächenphysik des Fachbereichs<br />
Physik konzentrieren sich die Forschungsarbeiten<br />
auf Übergangsmetalloxid-Oberflächen<br />
bzw. die Metalloxid-Metall-Grenzfläche<br />
und auf die Adsorption von organischen<br />
Molekülen auf diesen Oberflächen.<br />
Das in der Fachgruppe eingesetzte methodische<br />
Instrumentarium reicht dabei von<br />
Rastertunnelmikroskopie und -spektroskopie<br />
über Photoelektronenspektroskopie<br />
mit Synchrotronstrahlung und Schwingungsspektroskopie<br />
bis zu geplanter Ultrakurzzeitspektroskopie<br />
und -mikroskopie.<br />
Letztere Methode, die zwei Femtosekunden-Laserpulse<br />
zur Zweiphotonen-Photoemission<br />
verwendet, kann mit Photoelektronenmikroskopie<br />
kombiniert eine extrem<br />
hohe Zeitauflösung bei Nanometer-Ortsauflösung<br />
erreichen. Dies erlaubt die Dynamik<br />
photoinduzierter elektronischer Anregungen<br />
an nanostrukturierten Oxidoberflächen<br />
und Adsorbatstrukturen in Echtzeit<br />
zu verfolgen. Mit diesem methodisch breiten<br />
Ansatz will die Fachgruppe ihren Beitrag<br />
zum materialwissenschaftlichen<br />
Schwerpunkt in Halle leisten. ■<br />
Der Autor absolvierte 1982–1988 ein Physikstudium<br />
an der Philipps-Universität<br />
Marburg, wurde dort und am Max-Planck-<br />
Institut für Kernphysik in Heidelberg 1991<br />
promoviert. Nach zwei Jahren Postdoc am<br />
Chemical Engineering Department der UC<br />
Santa Barbara, USA kam er 1994 als Assistent<br />
an die TU München. Nach Habilitation<br />
im Jahr 2000 nahm er 2001 einen Ruf<br />
der TU Berlin auf eine Professur für experimentelle<br />
Physik, verbunden mit der Abteilungsleitung<br />
am Max-Born-Institut für<br />
Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie<br />
an. 2003 folgte er dem Ruf an die<br />
Martin-Luther-Universität und leitet seither<br />
die Fachgruppe Oberflächen- und<br />
Grenzflächenphysik.