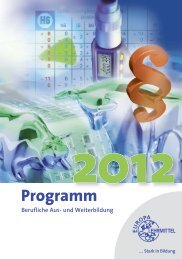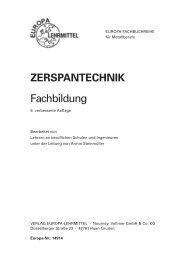Fachwissen Gebäudereinigung
Fachwissen Gebäudereinigung
Fachwissen Gebäudereinigung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2<br />
12 12<br />
Chemie der Inhaltsstoffe<br />
2.1 Wasser 2.1.2 Aufbereitung von Wasser<br />
Abwasser<br />
Abwasser ist durch den Gebrauch verändertes Wasser. Der Gebäudereiniger transportiert mit dem Wasser den entfernten<br />
Schmutz und die verbrauchte Reinigungschemie ab. Dieses verschmutzte Wasser darf dem Wasserkreislauf<br />
nicht ohne weiteres zugeführt werden.<br />
Es wird in kommunales und industrielles Abwasser unterschieden. Kommunales Abwasser stammt aus den Haushalten<br />
und ist verunreinigtes Trinkwasser. Es enthält in der Regel Substanzen, die leicht biologisch abbaubar sind.<br />
In einer Mischwasserkanalisation wird es zusammen mit dem gesammelten Regenwasser in die kommunale Kläranlage<br />
geleitet und dort aufbereitet.<br />
Industrielles Abwasser stammt aus Gewerbe- und Industriebetrieben oder aus der Landwirtschaft. Es enthält meist<br />
schwer biologisch abbaubare Substanzen. Je nachdem, wie stark das Abwasser belastet ist, muss es einer Vorbehandlung<br />
zugeführt werden, bevor es in die Kläranlage gelangt.<br />
Aufbau und Funktion der Kläranlage<br />
Moderne Kläranlagen (Bild 1) arbeiten in vier Stufen:<br />
Mechanische Stufe<br />
Das Abwasser wird zunächst durch einen Rechen geleitet,<br />
um grobe Partikel heraus zu sieben. Anschließend werden<br />
im Sandfang kleinere Partikel entfernt und schließlich<br />
im Vorklärbecken durch Absetzung weitere unlösliche<br />
organische Stoffe abgetrennt (Bild 2a). Der entstandene<br />
Rohschlamm wird beseitigt und weiter behandelt. Die erste<br />
Stufe entfernt ca. 30% der Schmutzsubstanzen.<br />
Biologische Stufe<br />
Hier werden Mikroorganismen in einem aeroben Abbauprozess<br />
dazu eingesetzt, die organischen Schmutzstoffe als<br />
Nahrung zu verstoffwechseln. Dies geschieht im Belebungsbecken<br />
(Bild 2b). Die Mikroorganismen bilden den sogenannten<br />
Klär- oder Belebtschlamm. Der sich durch Vermehrung<br />
bildende Überschussschlamm wird weiter behandelt,<br />
der Rest nach der Absetzung im Nachklärbecken rückgeführt.<br />
Chemische Stufe<br />
In der dritten, chemischen Stufe werden vor allem Stickstoffverbindungen<br />
wie Ammonium, Nitrate, Nitrite und<br />
Phosphate entfernt, damit später keine Überdüngung<br />
der Gewässer stattfinden kann. Meist werden Phosphate<br />
durch Fällung bzw. Flockung mit Eisensalzen beseitigt.<br />
Stickstoffverbindungen können mit Hilfe bestimmter<br />
Bakterienarten in speziellen Prozessen abgebaut werden.<br />
Filtration<br />
Der Einbau von Filtern zur Entfernung der gebundenen<br />
Phosphate wird oft auch als vierte Stufe (Filtration) bezeichnet.<br />
Die entsprechenden Filtermaterialien sind<br />
Quarzsand oder Blähschiefer. Das nun zu 96 - 97 % gereinigte<br />
Wasser kann in den Vorfluter, d. h. in ein Gewässer<br />
abgegeben werden.<br />
Die Schlämme, die bei der Abwasserreinigung entstehen, werden eingedickt, um eine Reduzierung des Volumens zu<br />
erreichen. Meist geschieht dies in speziellen hydraulischen Pressen (Bild 2c). In den Faulbehältern wird der eingedickte<br />
Schlamm unter anaeroben Bedingungen bei ca. 37 °C vergoren (Bild 2d). Dabei entsteht Methangas, das in einem Gasbehälter<br />
gesammelt und weiter verwertet wird. Klärschlamm kann je nach Schadstoffgehalt später auch als Düngemittel<br />
verwendet werden. Bei zu hohem Gehalt an umweltschädlichen Stoffen muss er deponiert oder verbrannt werden.<br />
Gesetze und Verordnungen zum Gewässerschutz<br />
Bild 1: Kläranlage Metzingen, Luftbild<br />
a) b)<br />
c) d)<br />
Bild 2: a) Vorklärbecken, b) Belebungsbecken,<br />
c) Schlammpresse, d) Hauptgebäude mit Faultürmen<br />
In Deutschland gelten vor allem folgende Regelungen zum Schutz von Oberflächen- und Grundwasser:<br />
Wasserhaushaltsgesetz, Trinkwasserverordnung, Direkteinleiterverordnung, Indirekteinleiterverordnung, Wasch- und<br />
Reinigungsmittelgesetz, Tensidverordnung, Phosphathöchstmengenverordnung, Klärschlammverordnung, kommunale<br />
Vorschriften usw.