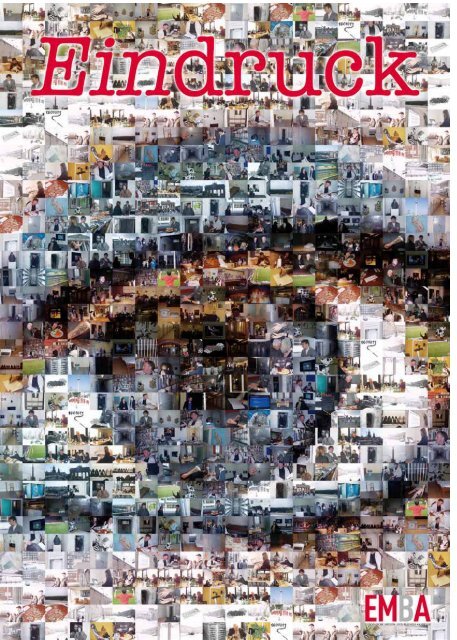Zeitschrift "Eindruck", EMBA Berlin (PDF-Datei; ca. 4
Zeitschrift "Eindruck", EMBA Berlin (PDF-Datei; ca. 4
Zeitschrift "Eindruck", EMBA Berlin (PDF-Datei; ca. 4
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Eindruck<br />
04 Vorwort<br />
05 „Wir sind zu Flüsterern geworden!“<br />
DDR-Aufarbeitung mit Rainer Eppelmann<br />
07 Die Abgründe der Staatssicherheit<br />
Ein Besuch im „Stasi-Knast“ <strong>Berlin</strong>-Hohenschönhausen<br />
09 Akten, Akten, Akten<br />
Der spezielle Geheimdienst der DDR<br />
11 Das (Über)Leben der Kunstgalerien<br />
Kunstszene <strong>Berlin</strong><br />
13 Malen mit Maus<br />
Digitale Kunst<br />
14 Das Universum begreifen<br />
Forschungszentrum CERN<br />
15 Eine Fotografenlegende<br />
Robert Lebeck<br />
16 <strong>Berlin</strong>, du bist so wunderbar…<br />
Tips für den Trip in die Hauptstadt<br />
Inhalt<br />
Impressum<br />
18 Das Auge isst mit<br />
Hooters in <strong>Berlin</strong><br />
Herausgeber <strong>EMBA</strong> GmbH<br />
Friedrichstraße 50-55 (Checkpoint Charlie), 10117 <strong>Berlin</strong><br />
Chefredakteur/Schlussredaktion Holger Doetsch (V.i.S.d.P.)<br />
Chef vom Dienst Maximilian Fritz<br />
Redaktion Annalena Jung, Franziska Seilkopf, David Koch, Maximilian Fritz<br />
Layout/Grafik/Bildredaktion/Cover Maximilian Fritz<br />
Druck digibook GmbH, Hollenstedt<br />
Stand <strong>Berlin</strong>, Sommer 2010<br />
Dieses Magazin ist im Rahmen eines Lehrprojekts der <strong>EMBA</strong> <strong>Berlin</strong> – Europäische Medien- und Business-<br />
Akademie, Friedrichstraße 50 - 55, 10117 <strong>Berlin</strong> (www.emba-medienakademie.de) entstanden.<br />
Seite 03<br />
19 Ein Friedhof der besonderen Art<br />
Interessantes über den Alten St.-Matthäus-Kirchhof<br />
20 „Randgruppe“ im Mainstream<br />
Schwule im Profifußball<br />
22 Eine etwas andere Zeitung<br />
Redaktionsbesuch bei der TAZ<br />
23 Politisches Urgestein<br />
Prof. Dr. Bernhard Vogel im Gespräch<br />
26 Das neue Sprachrohr der Mode<br />
Blogs und Modetrends<br />
27 Blogs sind kein Ersatz<br />
Jungdesigner und Blogger Konstantin Siegel<br />
28 Investigativer Journalismus<br />
Ein Blick hinter die Kulissen von Ulrich Meyers Akte<br />
29 Ein Buch entsteht<br />
Interview mit einem Schriftsteller<br />
Annalena Jung Franziska Seilkopf David Koch Maximilian Fritz Foto: Holger Doetsch
Seite 04 Eindruck<br />
Vier Studentinnen und<br />
Studenten, Annalena<br />
Jung, Franziska Seilkopf,<br />
David Koch und<br />
Maximilian Fritz, im Studiengang<br />
Angewandte<br />
Medien an der Europäischen<br />
Medien- und Business-<br />
Akademie (<strong>EMBA</strong>) in <strong>Berlin</strong> haben als<br />
Praxisprojekt „Eindruck“ entwickelt. „Eindruck“<br />
steht hier schlicht für ein einmalig<br />
erscheinendes Magazin – mit Beiträgen, die<br />
einen Eindruck hinterlassen sollen.<br />
Entstanden ist das Heft am Ende des ersten<br />
Semesters zu dem Module „Journalistische<br />
Grundlagen“. Damit ist es auch ein Ergebnis<br />
der Kernphilosophie der <strong>EMBA</strong>, aufbauend<br />
auf fundierter theoretischer und wissenschaftlicher<br />
Vermittlung der Lehrinhalte,<br />
Erlerntes praxisbezogen umzusetzen, gemäß<br />
dem Motto „Learning by doing“.<br />
Für den journalistischen Teil des Studiums<br />
bedeutet das beispielhaft: Es ist nicht nur<br />
wichtig für unsere Studierenden, dass sie<br />
verstehen, was eine Reportage ist und wie<br />
sie sich von anderen journalistischen Darstellungsformen<br />
unterscheidet. Es geht<br />
auch darum, ihnen zu zeigen, wie man eine<br />
Reportage gelungen formuliert, und was es<br />
beim Entstehungsprozess des Textes zu beachten<br />
gilt.<br />
Vorwort<br />
Die Studentinnen und Studenten der StudienrichtungPR-/Kommunikationsmanagement<br />
haben dabei Medienmacher kennengelernt,<br />
sie in ihren Redaktionen besucht,<br />
interviewt und gelernt, auch vor prominenten<br />
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern<br />
keine Scheu zu haben. Für<br />
die Kooperation aller Beteiligten, insbesondere<br />
der Interviewpartner, möchte ich<br />
mich ganz herzlich bedanken.<br />
Dass die <strong>EMBA</strong> <strong>Berlin</strong> ihren Sitz inmitten<br />
von zahlreichen Zeitungs-, Online- und TV-<br />
Redaktionen, sowie in unmittelbarer Nähe<br />
zu Regierungsinstitutionen, Verbänden und<br />
Unternehmen hat, ist kein Zufall, sondern<br />
gehört zu einem umfassenden Konzept für<br />
ein Studium unter optimalen Bedingungen.<br />
Und auch für Eindruck hat es die Arbeit<br />
ganz zweifellos vereinfacht.<br />
Ein Dank auch an den verantwortlichen<br />
Dozenten Holger Doetsch, der die Studierenden<br />
mit dem für uns gewohnten Engagement<br />
tatkräftig angeleitet und beflügelt<br />
hat.<br />
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!<br />
Prof. Frank Heinrich<br />
Ein besonderer Dank geht an:<br />
Unsere Interviewpartnerinnen und Interviewpartner und an die, die uns den Weg zu ihnen bereitet<br />
haben: Monika Schoettel (Büro Prof. Dr. Vogel); Helvi Abs und Steffen Mayer (BStU); den Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern der <strong>Berlin</strong>er Galerie „<strong>Berlin</strong> Art Projects“; Karl-Heinz Richter (Stasigefängnis<br />
<strong>Berlin</strong>-Hohenschönhausen); Monika von Wahl, Dr. Dirk Klapperich (META Productions);<br />
Mirko Freiwald (Werkstattgalerie) und natürlich an die <strong>EMBA</strong> und vor allem an unseren Akademieleiter<br />
Prof. Frank Heinrich, sowie unseren Dozenten Holger Doetsch, die uns die Möglichkeit<br />
gegeben haben, dieses Magazin gestalten zu können.
Eindruck Seite 05<br />
DDR-Aufarbeitung mit Rainer Eppelmann<br />
„Wir sind zu<br />
Flüsterern geworden!“<br />
R<br />
ainer Eppelmann, evangelischer<br />
Pfarrer und ehrenamtlicher<br />
Vorsitzender des Vorstandes<br />
der Stiftung zur<br />
Aufarbeitung der Geschichte und<br />
der Folgen der SED-Diktatur,<br />
sprach mit uns über seine Vergangenheit<br />
in der DDR.<br />
Bei Recherchen über Sie taucht immer<br />
wieder der Begriff Staatsfeind<br />
Nr. 1 auf. Was hat es damit auf sich?<br />
Das hing sicherlich mit den Bluesmessen in<br />
meiner Kirchengemeinde zusammen. Da<br />
kamen Tausende aus der gesamten DDR,<br />
was die Stasi fürchterlich provoziert hat.<br />
Eine weitere Provokation war der „<strong>Berlin</strong>er<br />
Appell“, den ich zusammen mit Robert<br />
Havemann verfasst habe (siehe Kasten).<br />
Diesen Text haben wir über westliche Medien<br />
verbreitet, so dass dieser DDR-weit<br />
bekannt wurde, weil die allermeisten DDR-<br />
Bürger ihre Informationen aus den Westmedien<br />
bezogen. So wurde ich für die Stasi<br />
spätestens nach Havemanns Tod „Staatsfeind<br />
Nr. 1“. Grund genug für die, mein Leben<br />
verkürzen zu wollen.<br />
Da gab es einen fingierten Autounfall...<br />
Einige MfS-Mitarbeiter (s. Kasten) wurden<br />
bei illegalen Tätigkeiten erwischt und mussten<br />
der Stasi dann insgesamt ihre Vergehen<br />
gestehen, um nicht entlassen zu werden. Sie<br />
haben dann berichtet, sie hätten im Auftrag<br />
ihrer Vorgesetzten ein paar Modelle entwickeln<br />
sollen, wie man mich auf eine unauffällige<br />
Weise liquidieren könnte. Eine dieser<br />
Überlegungen war dieser Verkehrsunfall. Allerdings<br />
ist er in diesem Fall nicht durchgeführt<br />
worden, da nicht auszuschließen war,<br />
dass auch Unschuldige zu Schaden kommen,<br />
womit sie wohl meine Frau meinten,<br />
die öfter mit mir fuhr. Also hat mir wahrscheinlich<br />
meine Frau das Leben gerettet...<br />
Also hatte die Stasi so etwas wie<br />
Moral?<br />
Naja, ich hatte eher den Eindruck, dass sie<br />
so etwas wie Moral eben nicht hatten.<br />
Bei einem weiteren Versuch, mich zu töten<br />
Foto: Holger Doetsch<br />
Rainer Eppelmann<br />
(*12.02.1943 in <strong>Berlin</strong>) besuchte bis zur 11.<br />
Klasse eine Schule in Westberlin, was nach<br />
dem Mauerbau nicht mehr möglich war. Da<br />
er kein FDJ-Mitglied war, wurde es ihm verboten<br />
sein Abitur zu machen. Nach einer<br />
Maurerlehre studierte er Theologie und<br />
wurde Pfarrer der <strong>Berlin</strong>er Samaritergemeinde<br />
und Kreis-Jugendpfarrer in <strong>Berlin</strong>-<br />
Friedrichshain. Dort wurden die bekannten<br />
„Bluesmessen“ abgehalten. Er engagierte<br />
sich als DDR-Oppositioneller.<br />
hatte ich während der Fahrt auf einmal<br />
mein Lenkrad in den Händen…<br />
Zum Glück passierte das auf einem sandigen<br />
Waldweg, auf dem ich mit geringer<br />
Geschwindigkeit fuhr. Einen Tag vorher<br />
aber sind wir noch auf der Autobahn gefahren,<br />
und wenn das da passiert wäre,<br />
dann wäre es nicht nur mir, sondern auch<br />
meiner Frau und meinen vier Kindern<br />
schlecht ergangen.<br />
Sind sie von der Stasi abgehört worden?<br />
Meine gesamte Wohnung war verwanzt, sogar<br />
Schlafzimmer und Klo! Ihr Pech war<br />
nur, dass ich diese Wanzen gefunden habe.<br />
Allerdings war das Abhören auch nach<br />
DDR-Gesetzen verboten! Man durfte nur<br />
mit einer offiziellen Genehmigung abhören<br />
– allerdings die Staatssicherheit war ja der<br />
Staat im Staat gewesen.<br />
Ich brachte die Abhörmaßnahmen also zur<br />
Anzeige und als ich fragte, was unternommen<br />
würde, sagte mir der Staatsanwalt, das<br />
MfS hätte sich in jedem Einzelfall bei der<br />
deutschen Post der DDR eine Erlaubnis<br />
zum Abhören einholen müssen. Und da die<br />
Stasi so eine Erlaubnis nicht eingeholt habe,<br />
könne ich von denen auch nicht abgehört<br />
worden sein. Was für eine Logik...<br />
Noch mal zurück zu den „Bluesmessen“:<br />
Warum durften Sie diese Form<br />
des Gottesdienstes überhaupt abhalten?<br />
Die Kirche ist der einzige Raum gewesen,<br />
wo es zumindest stückweise möglich war,<br />
Grenzen zu überschreiten. Es gab in der<br />
DDR eine so genannte Veranstaltungsordnung,<br />
die regelte wer unter welchen Voraussetzungen<br />
eine Demonstration oder<br />
Veranstaltung durchführen konnte. Rein<br />
theoretisch konnte jeder DDR-Bürger so<br />
etwas anmelden, doch wurde es dann nicht<br />
genehmigt. Die Durchführung von Demonstrationen<br />
und Veranstaltungen war<br />
die Sache der Staatspartei SED und ihrer<br />
Organisationen, und die waren alle gleich<br />
geschaltet. Eine Ausnahme aber gab es da:<br />
Die Kirchen.<br />
Sie sprachen von „Grenzen“. Wie<br />
wurden diese überschritten?<br />
Ein Beispiel ist die praktische Bibelarbeit in<br />
den evangelischen Kirchen. Wir haben etwa<br />
junge Menschen danach gefragt, was ihre<br />
Hoffnungen, Ängste und Probleme sind. Sie<br />
meinten etwa, dass sie sich davor fürchten,<br />
zu kurz zu kommen. Sie hatten Angst, Probleme<br />
zu bekommen, weil sie etwas mit der<br />
Kirche zu tun haben, Angst, keine vernünftige<br />
Berufsausbildung machen oder nicht<br />
studieren zu können, Angst vor der Polizei<br />
oder der Staatsmacht. Damit bot die Kirche<br />
einen Raum dafür, dass gesagt werden<br />
konnte, was fast alle dachten. Außerhalb<br />
der Kirchen waren wir nämlich zu Flüsterern<br />
geworden! Natürlich hatten wir alle<br />
unsere Hoffnungen, Träume und Ängste im<br />
Kopf. Aber wir wussten, wenn man diese<br />
Gedanken zum Beispiel in einer Gaststätte<br />
laut sagt, wird man dafür bestraft. Es wurde<br />
sogar erzählt, dass Menschen bis zu fünf<br />
Jahre eingesperrt worden, weil sie einen<br />
politischen Witz erzählt hatten…
Seite 06 Eindruck<br />
Blieben viele Menschen den Messen<br />
fern, nachdem bekannt wurde, dass<br />
sie als Staatsfeind eingeschätzt wurden?<br />
Wer zu uns kam, wusste von dem Risiko,<br />
das er eingeht. Manche fühlten sich durchaus<br />
überfordert, andere sahen sich als Held.<br />
Manchmal war es auch frustrierend für die<br />
Besucher dieser Messen, denn sie merkten<br />
ja, dass sie zwar ein Risiko eingehen, sich<br />
aber in diesem Staat ungeachtet dessen<br />
überhaupt nichts verändert! Viele blieben<br />
dann irgendwann fern. Daher haben viele<br />
nur ein-, oder zweimal bei uns reingeguckt.<br />
Unser harter Kern bestand allenfalls aus 25<br />
Frauen und Männern.<br />
Gerd Poppe, auch er ein Bürgerrechtler, hat<br />
mal gesagt, es gab nur 500 bis 800 DDR-<br />
Bürger, die Mitte der 70er Jahre durch ihr<br />
öffentliches Auftreten zu erkennen gaben,<br />
dass sie mit der Entwicklung der DDR<br />
nicht einverstanden waren. Eine Massenbewegung<br />
ist es erst im Sommer 1989 geworden.<br />
Ein DDR-Bürger sagte mal: Uns wird<br />
eine Weltanschauung offenbart,<br />
ohne dass wir uns die Welt anschauen<br />
dürfen... Sie haben sich darüber<br />
mal bei Erich Honecker beklagt.<br />
Honecker war bei einem Staatsbesuch in<br />
Japan, wo ihm nach politischen Gesprächen<br />
auch Land und Leute gezeigt wurden. Beim<br />
Rückflug setzte er ein sogenanntes „Überflugtelegramm“<br />
an Japans Regierungschef<br />
ab und bedankte sich darin. Sinngemäß<br />
schrieb er: Ich habe mich natürlich auf diese<br />
Reise vorbereitet und mir viele Fotos<br />
angeschaut und viele Bücher gelesen, aber<br />
was sind Fotos und Bücher gegen das Erleben?<br />
Beeindruckend war natürlich das, was<br />
ich jetzt alles in der einen Woche erlebt<br />
habe.<br />
Dieses Telegramm stand am nächsten Tag in<br />
allen DDR-Zeitungen! Eine Unverschämtheit,<br />
denn jeder DDR-Bürger wusste ja,<br />
dass er hier nicht raus kommt!<br />
Ich habe dann in einem Brief an den Genos-<br />
sen Honecker meine „Freude“ darüber<br />
ausgedrückt, dass er so eine erfolgreiche<br />
Reise gehabt hat. Und mit dieser „Freude“<br />
habe ich dann auch meiner Hoffnung Ausdruck<br />
verliehen, dass nun die notwendigen<br />
Konsequenzen folgen, und er uns vergleichbare<br />
gute und hilfreiche Erfahrungen machen<br />
lässt. Eine Antwort bekam ich nie…<br />
Irgendwann wurde Ihnen dann nahe<br />
gelegt, entweder auszureisen oder<br />
ins Gefängnis zu gehen.<br />
Nachdem wir den „<strong>Berlin</strong>er Appell“ verfasst<br />
und veröffentlicht hatten, wurde ich<br />
drei Tage festgehalten. Die ersten Fragen<br />
des Vernehmers bezogen sich merkwürdigerweise<br />
darauf, ob wir irgendwelche wertvollen<br />
Kunstwerke oder Immobilien besitzen.<br />
Dafür gab es nur eine Erklärung: Die<br />
wollten mich abschieben. Aber die Mächtigen<br />
in der evangelische Kirche der DDR<br />
haben der Staatsführung dann klar gemacht,<br />
dass das nicht geht!<br />
Denn ich war im westlichen Ausland nicht<br />
unbekannt, und eine Sorge der Stasi war es,<br />
dass, sitze ich im Gefängnis oder würde ich<br />
abgeschoben, es im Ausland eine Diskussion<br />
darüber geben würde, und die wäre für<br />
die DDR und das Ansehen des Landes sicherlich<br />
nicht hilfreich gewesen.<br />
Der Deutsche Bundestag hat Sie<br />
zum Vorsitzenden der Stiftung Aufarbeitung<br />
gewählt. Was tut die Stiftung?<br />
Wir unterstützen und fördern etwa Bücher<br />
und andere wissenschaftliche Druckwerke,<br />
aber auch Dokumentarfilme für<br />
Multiplikatoren in Schulen und anderswo.<br />
Vieles kann im Schulunterricht verwendet<br />
werden. Weiterhin veranstalten und fördern<br />
wir Ausstellungen, die das Unrecht,<br />
das Menschen in der DDR angetan worden<br />
ist, thematisieren. Auch haben wir Gespräche<br />
mit der Kultusministerkonferenz<br />
geführt, die für die Inhalte der Bildung an<br />
Schulen zuständig ist. So gibt es in den 16<br />
Bundesländern keinen Lehrplan mehr, in<br />
Rainer Eppelmann (Mitte), Bürgerrechtler, Ex-Minister und Ex-Bundestagsabgeordneter, im Interview.<br />
Foto: Holger Doetsch<br />
Robert Havemann (*11.03.1910,<br />
†09.04.1982), bekennender Kommunist<br />
und Verfechter eines demokratischen Sozialismus,<br />
war anfangs noch SED-Mitglied und<br />
zeitweise Kontaktperson der Stasi. Als er<br />
mit der Vorgehensweise der Regierung unzufrieden<br />
wurde, gab er dies öffentlich<br />
kund und erhielt daraufhin Berufsverbot<br />
und Hausarrest. Nach Beendigung des Arrestes<br />
gründete er eine Friedensbewegung<br />
mit Gerd Poppe, Bärbel Bohley und dem<br />
Theologen Rainer Eppelmann, mit dem er<br />
den <strong>Berlin</strong>er Appell verfasste, ein Schriftstück,<br />
das zur Friedensschaffung durch Abrüstung<br />
in Ost und West aufruft.<br />
Das Ministerium für Staatssicherheit<br />
(kurz MfS; umgangssprachlich Stasi),<br />
gegründet am 08.02.1950, war als Geheimdienst<br />
tätig und zuständig für die Verfolgung<br />
politischer Straftaten. Es galt als „Schild und<br />
Schwert“ der Staatspartei SED und diente<br />
als Mittel zur Überwachung und Unterdrückung<br />
der DDR-Bürger und damit letztendlich<br />
dem Machterhalt. Zum Schluss waren<br />
es 91 000 hauptamtliche Spitzel. Der<br />
bekannteste Stasi-Chef Erich Mielke war<br />
von 1957 bis 1989 dort tätig.<br />
dem die Beschäftigung mit deutscher Nachkriegsgeschichte<br />
und damit die DDR-Geschichte<br />
fehlt. Trotzdem: Die meisten<br />
Jugendlichen wissen leider sehr wenig über<br />
die Nachkriegsgeschichte und die Geschichte<br />
der DDR, dies müssen wir ändern.<br />
Es wird Zeit, dass sich die Erwachsenen, die<br />
Eltern, Lehrer, sowie die Kirchen und Vereine<br />
darum kümmern. Denn noch besteht<br />
die Chance Menschen zu befragen, die in<br />
dieser Diktatur gelebt haben und darüber<br />
sehr gut erzählen könnten. Also: Die Vermittlung<br />
jüngerer deutscher Zeitgeschichte<br />
kann nicht mit dem 08. Mai 1949 aufhören.<br />
Es muss vermittelt werden, dass es eine<br />
zweite Diktatur in Deutschland gegeben<br />
hat, nämlich in der DDR. Die beiden Diktaturen<br />
lassen sich nur bedingt vergleichen -<br />
die Nazi-Diktatur war so barbarisch, so<br />
unmenschlich, dass sie uns fast ausradiert<br />
und aus der Völkergemeinschaft rausgeschmissen<br />
hätte. Die DDR-Diktatur hat 17<br />
Millionen Bürgern das Luftholen verboten<br />
und, um es zu wiederholen, uns zu „Flüsterern“<br />
gemacht!<br />
Franziska Seilkopf
Eindruck Seite 07<br />
Ein Besuch im „Stasi-Knast“ <strong>Berlin</strong>-Hohenschönhausen<br />
Die Abgründe der<br />
Staatssicherheit<br />
ennen Sie den Staats- und<br />
„KParteichef der ehemaligen<br />
DDR?“<br />
Schüler antwortet: „Nein, keine<br />
Ahnung.“<br />
Ein weiterer Schüler meldet sich:<br />
„Edmund Stoiber?!“ Schweigen.<br />
„Nein, es war Erich Honecker –<br />
können Sie etwas mit dem Namen<br />
anfangen?“<br />
Die Klasse unisono: „Nein.“<br />
Diese und ähnlich erschreckende Antworten<br />
erhielten zwei Journalisten in einer<br />
<strong>Berlin</strong>er Berufsschule 2004. Das Beunruhigende<br />
daran: die Schüler sind größtenteils<br />
Ostberliner und zu DDR-Zeiten geboren.<br />
Von der eigenen Geschichte haben sie keine<br />
Ahnung. Und so geht es nicht nur ihnen.<br />
Die DDR-Geschichte geht in den heutigen<br />
Geschichtsstunden unter. Die griechische<br />
Antike und der erste Weltkrieg werden gelehrt,<br />
die Weimarer Republik und letztendlich<br />
der Nationalsozialismus. Schnitt.<br />
Foto: Holger Doetsch<br />
Kein Durchgang, sondern eine Stehzelle.<br />
Warum kam es denn wirklich zum Mauerfall<br />
am 9. November 1989? Das wissen viele<br />
nicht und das Problem liegt nicht an dem<br />
fehlenden Interesse, sondern an den Lehrplänen.<br />
Es ist viel Stoff, was Geschichtslehrer<br />
in den Jahren unterbringen müssen, nur<br />
geschieht das oftmals auf Kosten der DDR,<br />
wie sie bei Umfragen selbst angeben.<br />
Gerade in <strong>Berlin</strong> kann man sehr viel über<br />
die jüngste deutsche Vergangenheit lernen.<br />
In der Gedenkstätte Hohenschönhausen,<br />
auch „Stasi-Knast“ genannt, werden in Führungen<br />
die Abgründe des Wirkens der<br />
Staatssicherheit vor Augen geführt.<br />
Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS)<br />
war die Geheimpolizei der SED und zuständig<br />
für die Überwachung der gesamten<br />
Bevölkerung. Wer sich dem Regime nicht<br />
fügen wollte oder versuchte zu flüchten,<br />
wurde in eines der 17 Untersuchungsgefängnisse<br />
des MfS gebracht. Der „Stasi-<br />
Knast“ Hohenschönhausen war die Zentrale.<br />
Von dort aus wurden alle Gefängnisse<br />
gesteuert.<br />
Menschenverachtend.<br />
Erschreckend.<br />
Nicht nachvollziehbar, was Menschen anderen<br />
Menschen mutwillig zufügen können.<br />
Solche Gedanken überkommen einen,<br />
wenn man an einer Führung im „Stasi-<br />
Knast“ teilnimmt. Die, die durch die Ausstellung<br />
führen, waren selbst einmal Häftlinge<br />
in der heutigen Gedenkstätte oder in<br />
anderen Stasi-Knästen. Sie berichten unverzerrt<br />
von den Grausamkeiten, die sie erlebt<br />
haben.<br />
So auch Karl-Heinz Richter, verurteilt wegen<br />
„versuchter Republikflucht“. Über 30<br />
Jahre lang sprach er nicht über seine Erlebnisse<br />
während der Inhaftierung, 2009 aber<br />
brach er sein Schweigen. „Die DDR wird<br />
heutzutage verschönt“, sagt der 63-Jährige.<br />
Er möchte Verklärungen in den Köpfen auflösen<br />
und aufzeigen, welche Leidenswege<br />
die SED-Diktatur verursachte.<br />
Die erste Station: Das „U-Boot“ im Altbau<br />
des ehemaligen Gefängnisses. Das Gebäude<br />
übernahm 1951 das Ministerium für Staatssicherheit<br />
von den Sowjets. „U-Boot“, so<br />
wurde der Keller von den Häftlingen genannt,<br />
denn man wurde gezwungen abzutauchen<br />
und hatte keinen Bezug mehr<br />
zur Außenwelt. Die Gefängniszellen sind<br />
kaum größer als eine Abstellkammer. Auf<br />
der einen Seite befindet sich eine Holzpritsche.<br />
Es ist es kahl, kalt, verliesartig. Ohne<br />
Fenster. Ohne Tageslicht.<br />
Verhört wurden die Häftlinge nachts, tagsüber<br />
galt ein Schlafverbot. Durch diese Foltermethode<br />
wollten die Verhörer von den<br />
Gefangenen eine möglichst schnelle Unterschrift<br />
ihrer Aussage erzwingen.<br />
Doch was, wenn man unschuldig war, wie<br />
unzählige Inhaftierte? „Entweder war man<br />
für oder gegen das System“, sagt Karl-<br />
Heinz Richter, „egal, ob Freidenker oder<br />
einfach politisch anders orientiert: Verhaftet<br />
wurde jeder wegen allem.“<br />
Für die Verurteilten bedeutet der „Stasi-<br />
Knast“ eine menschenunwürdige Lebenssituation.<br />
Kübel standen als Toilettenersatz in<br />
den Zellen. „Ein bestialischer Geruch“, so<br />
beschreibt es Richter. Mit zwölf Personen<br />
in einer „Großraumzelle“ zusammengefercht<br />
- kaum auszuhalten.<br />
Auch wenn es keine Belege dafür gibt, dass<br />
die Stasi die folgenden Folterungsmethoden<br />
selbst anwendete, gibt es entsprechende<br />
Einrichtungen, wie zum Beispiel die<br />
„Wasserzellen“. Das waren Zellen mit Installationen,<br />
durch die dem Häftling ununterbrochen<br />
ein Tropfen Wasser auf dem<br />
Hinterkopf prallte, was sich nach Stunden<br />
wie Hammerschläge anfühlte. Viele wurden<br />
wahnsinnig und drehten durch. Eine weitere<br />
Folterungsmethode war die sogenannte<br />
„Stehzelle“. Eingefercht zwischen zwei<br />
Türen mussten die Häftlinge auf engstem<br />
Raum stehen. Wenn man größer war, wurde<br />
man dazu genötigt sich tage- und nächtelang<br />
zu ducken (s. Bild).<br />
Ortswechsel. Vom Altbau aus gelangt man<br />
mit wenigen Schritten zum Neubau, der<br />
von Häftlingen errichtet wurde. Beide Gebäude<br />
sind heute noch im Originalzustand.<br />
In den 100 Zellen und 120 Vernehmerräumen<br />
wurden vor allem Republikflüchtlinge<br />
unter Arrest gestellt. „Es war ein geheimes<br />
Gefängnis“, so Richter. Unvorstellbar, aber<br />
wahr: Niemand wusste von dem Gefängnis.<br />
Es befand sich in einem Sperrgebiet der
Seite 08 Eindruck<br />
ehemaligen DDR und kein Außenstehender<br />
hatte Zutritt. Das Gebiet rund um das Gefängnis<br />
wurde mit Mehrfamilienhäusern bebaut,<br />
in denen die Gefängnisbeschäftigten<br />
mit ihren Familien wohnten. Zum Teil tun<br />
sie das noch heute.<br />
Der Neubau grenzt sich äußerlich sehr<br />
stark vom Altbau ab. Die Zellen sind nun<br />
größer und heller, mit Fenstern ausgestattet.<br />
Auf einigen Pritschen wurden Decken<br />
und Kissen gelegt. Eine Toilette gibt es auch.<br />
Der Geruch nach dem Reinigungsmittel<br />
„Wofasept“ verfolgt einen auch heute noch<br />
während des Rundganges.<br />
Auch wenn einem der Eindruck des Neubaus<br />
„humaner“ erscheint, blieben die Umgangsformen<br />
und Folterungen doch grausam.<br />
Es wurde nun vor allem psychisch<br />
gefoltert. Die Inhaftierten lebten in Ungewissheit,<br />
wussten nicht, wo sie sich überhaupt<br />
befanden, zusätzlich wurden sie isoliert,<br />
hatten keinen Bezug zu anderen<br />
Gefangenen. Schon im Vernehmungsraum<br />
begann die psychische Qual. Die Psychologen<br />
wandten spezielle angelernte Psychotricks<br />
an, um selbst den Unschuldigen ein<br />
schnelles Geständnis zu entlocken. Viele<br />
hielten die psychische Qual nicht aus und<br />
bejahten verzweifelt die vermeintlichen<br />
Vorwürfe. Dazu kam, dass bei einigen Neuinhaftierten,<br />
die im Vernehmerraum saßen,<br />
Telefonate inszeniert wurden, in denen es<br />
um schwere Familienunglücke ging. Dabei<br />
wurde der Häftling aber in Ungewissheit<br />
gelassen, ob es sich dabei um die eigenen<br />
Verwandten handelt oder nicht.<br />
Besonders perfide: Bei der „erkennungsdienstlichen<br />
Bestandsaufnahme“, sprich bei<br />
der Fotoaufnahme des Häftlings, vernahm<br />
Rudolf Bahro ein summendes Geräusch<br />
hinter ihm. Der Politiker und bekannte<br />
DDR-Dissident saß stundenlang auf einem<br />
Stuhl vor dem Fotoapparat und wartete.<br />
Was niemand ahnen konnte: Das Summen<br />
Vernehmerzimmer der Stasi.<br />
Foto: Maximilian Fritz<br />
kam von der radioaktiven Bestrahlung, der<br />
er ausgesetzt war. Rudolf Bahro erkrankte<br />
an Krebs.<br />
Er starb 1997 an den Folgen.<br />
Die Folterungen und die unmenschliche<br />
Lebenssituation haben bis heute Auswirkungen<br />
bei den Opfer. Richter etwa leidet<br />
an einem Waschzwang, der ihn dazu verleitet,<br />
morgens, mittags und abends zu duschen.<br />
Trotzdem fühlt er sich dreckig, erzählt<br />
er. Die mangelnden hygienischen<br />
Verhältnisse im „Stasi-Knast“ haben ihn geprägt.<br />
So auch die Isolation in den Dunkelkammern.<br />
Tage und Nächte waren die Inhaftierten<br />
in Kammern mit Zwangsjacken<br />
eingeschlossen. Nichts als Dunkelheit. Sie<br />
verloren ihr Zeitgefühl und allmählich den<br />
Verstand. Jahrelang konnte Richter nicht in<br />
der Dunkelheit sein, zu groß war die Angst<br />
davor.<br />
12 000 Gefangene wurden insgesamt im<br />
Neubau des Gefängnisses zwischen 1958<br />
und 1990 inhaftiert. Auch nach dem Mauerfall<br />
im November 1989 wurde das Gefängnis<br />
weitergeführt. Der „Stasi-Knast“ Hohenschönhausen,<br />
so wie die anderen<br />
Stasi-Gefängnisse, waren nun Teil der Verwaltungsarbeit<br />
des Ministeriums des Innern<br />
der DDR. Nachdem der letzte Häftling im<br />
Frühjahr 1990 entlassen wurde, wurde der<br />
„Stasi-Knast“ Hohenschönhausen Ende<br />
desselben Jahres geschlossen. Seit 1994 besteht<br />
die Gedenkstätte Hohenschönhausen<br />
und wirkt mit bei der Aufarbeitung der<br />
SED-Diktatur sowie deren Folgen. Bisher<br />
haben 1,7 Millionen Menschen, darunter<br />
vor allem Schüler und Studenten, den ehemaligen<br />
Knast besucht. Laut Prognosen<br />
wird im Herbst dieses Jahres der zweimillionste<br />
Besucher erwartet.<br />
Annalena Jung<br />
Gedenkstätte Hohenschönhausen<br />
Genslerstraße 66<br />
13055 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 98 608 230<br />
www.stiftung-hsh.de<br />
• Führungen werden täglich angeboten.<br />
• Der Eintritt liegt bei vier Euro, ermäßigt zwei Euro.<br />
• Jeden Montag ist der Eintritt frei.<br />
Anfahrt:<br />
• S-Bahn bis Landsberger Allee von dort aus<br />
MetroTram 6 bis Haltestelle Genslerstraße<br />
• Metro Tram 5 und 6 vom Alexanderplatz bis<br />
Genslerstraße<br />
• Bus 256 vom Bahnhof Lichtenberg bis zur<br />
Haltestelle Liebenwalder Straße/Genslerstraße<br />
• Von Gesslerstraße cir<strong>ca</strong> 800 Meter per Fuß<br />
Foto: Maximilian Fritz
Eindruck Seite 09<br />
Ein spezieller Geheimdienst der DDR<br />
Akten, Akten, Akten<br />
I<br />
n <strong>Berlin</strong>-Lichtenberg, mit der<br />
Straßenbahn nur 15 Minuten<br />
vom Alexanderplatz entfernt, befindet<br />
sich die ehemalige Zentrale<br />
des Ministeriums für Staatssicherheit<br />
(MfS) der DDR. In dem riesigen<br />
Gebäudekomplex werden<br />
Hunderttausende Akten gelagert.<br />
Hier war außerdem das Büro des<br />
letzten Stasi-Ministers der DDR,<br />
Erich Mielke.<br />
Die Geschichte der Stasi beginnt am 8. Februar<br />
1950. Die SED, Staatspartei der DDR,<br />
gründete das MfS als Inlands- und Auslandsgeheimdienst<br />
sowie als Ermittlungsbehörde<br />
für „politische Straftaten“. Erster Minister<br />
für Staatssicherheit der DDR war<br />
Wilhelm Zaisser, der entlassen wurde, weil<br />
er die SED nicht ausreichend über Arbeiteraufstände<br />
(in den Tagen um den 17. Juni<br />
1953 kam es in der Deutschen Demokratischen<br />
Republik zu einer Welle von Streiks,<br />
Demonstrationen und Protesten – die<br />
Red.) informiert haben soll. Daraufhin wurde<br />
Ernst Wollweber Nachfolger von<br />
Zaisser. Wollweber wiederum wurde nach<br />
dem Vorwurf, einen Putsch zu planen, im<br />
Jahre 1957 von Mielke ersetzt. Mielke hatte<br />
das Amt des Ministers für Staatssicherheit<br />
bis zum 7. November 1989 inne.<br />
Mielke war ein ausgemachter Parteisoldat,<br />
der Erich Honecker, Generalsekretär der<br />
SED, jedoch nicht vollkommen untergeben<br />
war. In einem unscheinbaren Koffer führte<br />
er Beweise mit sich, aus denen hervorgeht,<br />
dass Honecker, „der große Antifaschist“, in<br />
der Nazizeit seine Mitstreiter verraten hatte.<br />
Einer der Verratenen, Bruno Baum, wurde<br />
deswegen zu 13 Jahre Zuchthaus verurteilt.<br />
Beim MfS wurde in verschiedenen Abteilungen<br />
mit den unterschiedlichsten Methoden<br />
gearbeitet. Dabei kam der Stasi zugute,<br />
dass sie handeln konnte wie sie wollte. Das<br />
diktatorische System der SED ließ das zu.<br />
Zu erkennen ist das an der Tatsache, dass<br />
die Verfassung der DDR erst an dritter<br />
Stelle kam – nach dem Programm der SED<br />
und den Beschlüssen des SED-Zentralkomitees<br />
und des Politbüros.<br />
Zur „Beweisfindung“ wurden die Menschen<br />
der DDR systematisch abgehört und<br />
bespitzelt. Filmmaterial wurde aufgezeichnet<br />
und die Post kontrolliert. Jugendliche<br />
wurden etwa bei den Konzerten der Beatles<br />
oder den Rolling Stones aufgezeichnet,<br />
um „nonkonformes“ Verhalten auszumachen.<br />
Verschiedene Werkzeuge kamen bei<br />
Wohnungsdurchsuchungen zum Einsatz.<br />
Türen wurden mit Schlüsselrohlingen oder<br />
Schlüsselkopien geöffnet und die Wohnung<br />
mit Kameras gefilmt. Bei Verhören und<br />
Wohnungsdurchsuchungen hatte die Stasi<br />
Geruchsproben mit Tüchern genommen,<br />
und diese in Einweggläsern konserviert. Sogenannte<br />
„Geruchsidentifizierungshunde“<br />
konnten die Gerüche der Betroffenen so<br />
noch nach zehn Jahren identifizieren. Fast<br />
immer wurden konspirative (geheime)<br />
Wohnungsdurchsuchungen und Verhaftungen<br />
durchgeführt, um kein Aufsehen zu<br />
erregen.<br />
Bei der Bespitzelung halfen Tausende IM,<br />
Inoffizielle Mitarbeiter der Stasi. In der gesamten<br />
DDR gab es Dienststellen des MfS<br />
und ein großes Netz an geheimen Treff-<br />
Foto: Maximilian Fritz<br />
punkten mit IM. Diese Inoffiziellen Mitarbeiter<br />
wurden oftmals auch im Ausland<br />
eingesetzt. Dadurch konnte die DDR-Stasi<br />
auch auf die politischen und gesellschaftlichen<br />
Prozesse in der Bundesrepublik<br />
Deutschland stark einwirken. Generaloberst<br />
Markus Wolf, ein Stellvertreter Mielkes,<br />
sagte einmal: „Wir sind mit Fraktionsstärke<br />
im Bundestag vertreten!“ Das lässt<br />
durchblicken, wie viel Druck die Stasi auf<br />
die westdeutsche Politik ausüben konnte.<br />
Dies gipfelte 1974 in dem Rücktritt Willy<br />
Brandts, dem damaligen Bundeskanzler.<br />
Brandt trat zurück, da sich sein persönlicher<br />
Berater, Günter Guillaume, als Stasispion<br />
entpuppte. Er wäre somit erpressbar<br />
gewesen. Erpressung war ebenfalls eine<br />
beliebte Arbeitsmethode des MfS.<br />
Die Zahlen der offiziellen und inoffiziellen<br />
Mitarbeiter des MfS zeigen den hohen Stellenwert<br />
des politischen Geheimdienstes.<br />
Im Jahre 1955 waren es noch 10.000 hauptamtliche<br />
Mitarbeiter. Im Jahr 1989 waren es<br />
dann 91.500 Mitarbeiter. Allein in <strong>Berlin</strong><br />
waren 39.000 Hauptamtliche tätig. 1989<br />
betrug die Zahl der inoffiziellen Mitarbeiter<br />
191.000, davon waren zehn Prozent Jugendliche.<br />
Dazu der Vergleich mit der Bundesrepublik<br />
Deutschland, die, mit einer<br />
In der Stasi-Unterlagenbehörde in <strong>Berlin</strong> sind tausende Akten gelagert. Aneinandergereiht ergibt das 50 Kilometer.
Seite 10 Eindruck<br />
deutlich höheren Einwohnerzahl nur 6000<br />
offizielle Mitarbeiter in drei Geheimdiensten<br />
hatte, wobei die Stasi insgesamt<br />
nicht mit dem Geheimdienst von demokratischen<br />
Staaten verglichen werden kann.<br />
Alles was beobachtet wurde, Verurteilungen,<br />
Informationen über Mitarbeiter und<br />
Opfer, ist in Akten abgelegt worden.<br />
Nach dem Fall der Mauer im Herbst 1989<br />
fing die Stasi an ihre Akten zu vernichten. Es<br />
wurden Reißwölfe aus dem Westen besorgt.<br />
Nachdem die Reißwölfe heiß gelaufen<br />
waren wurde per Hand weiter vernichtet.<br />
Die Papierfetzen wurden dann auf<br />
Säcke verteilt, verbrannt oder in Papierfabriken<br />
gebracht.<br />
Am Morgen des 4. Dezember 1989 wurde<br />
die Bezirksstelle des MfS in Erfurt von Bürgern<br />
besetzt, nachdem bekannt geworden<br />
war, dass die Stasi-Akten vernichtet werden<br />
sollten. Am Abend desselben Tages<br />
wurden die Dienststellen in Leipzig und<br />
Rostock besetzt. Besetzungen in den anderen<br />
Bezirksstädten folgten, zuletzt am 15.<br />
Januar 1990 in der Zentrale in <strong>Berlin</strong>. Die<br />
Stasi öffnete die Tore der Zentrale, ließ die<br />
Menschen hinein und schickte diese erstmal<br />
in ein falsches Gebäude. Es flogen haufenweiße<br />
Schriftstücke in den Hof, aber<br />
kein brauchbares Material war zu finden.<br />
Einer Gruppe gelang es jedoch in das richtige<br />
Gebäude zu gelangen und die Vernichtungen<br />
der Akten zu stoppen.<br />
Heute sind noch 160 Kilometer Schriftgut<br />
(50 Kilometer alleine in <strong>Berlin</strong>), und tausende<br />
Bild- und Tonaufnahmen vorhanden. Es<br />
Foto: Maximilian Fritz<br />
42 Millionen Karteikarten müssen den Stasiakten zugeordnet werden.<br />
wurde begonnen die zerstörten Akten wieder<br />
zusammenzusetzen und zu ordnen, ein<br />
Prozess, der bis heute andauert.<br />
Im Jahre 1993 wurde ausgerechnet, dass es<br />
alleine 375 Jahre dauern würde, die Schnipsel<br />
in den 15.000 Säcken zusammenzusetzen.<br />
Das Lesen und Sortieren ist dabei<br />
noch nicht mit eingerechnet. Mit moderner<br />
Technik kann die Zeit zum Zusammensetzen<br />
von 375 Jahren auf sechs bis sieben Jahre<br />
verkürzt werden. Anhand der Risskanten<br />
finden spezielle Maschinen heraus, welche<br />
Schnipsel zusammengehören. Nachdem die<br />
Papierschnipsel einges<strong>ca</strong>nnt wurden, werden<br />
die Daten auf einem Server gespeichert<br />
und können zusammengesetzt werden.<br />
Es wir aber noch Jahre dauern bis alle<br />
Akten gelesen und archiviert sind.<br />
Ein großer Teil erhaltener beziehungsweise<br />
neu zusammengesetzter Akten befindet<br />
sich in der ehemaligen MfS-Zenrale in Lichtenberg.<br />
Um die Übersicht zu gewährleisten,<br />
wird, wie schon zu Stasi-Zeiten, mit<br />
einem Karteikartensystem gearbeitet. Auf<br />
42 Millionen Karteikarten sind Namen, Geburtsorte,<br />
Anschriften und Berufe vermerkt.<br />
In der Decknamenkartei sind alle<br />
Decknamen der IM vermerkt und verweisen<br />
auf deren Akten.<br />
Zudem sind Personenkarteien vorhanden<br />
auf denen alle Verurteilungen von Betroffenen<br />
zu finden sind. Auf einer Karteikartei<br />
kann bis zu 40 Jahren „Rechtsprechung“<br />
notiert sein.<br />
Welche Menge an Akten sich in den ehemaligen<br />
Gebäuden des MfS befindet, lässt sich<br />
mit der Größe eines Magazinraumes verdeutlichen.<br />
Der Magazinraum ist 645 Quadratmeter<br />
groß und hat ein Fassungsvermögen<br />
von 8365 Meter Gleitregalanlagen.<br />
Die Beschaffenheit einer Akte ist meistens<br />
sehr ähnlich, sie besteht in der Regel aus<br />
drei Teilen: Der Vorlauf, in dem das Umfeld<br />
des Mitarbeiters erfasst ist, welcher Zielgruppe<br />
der Mitarbeiter angehört und welche<br />
Gespräche mit diesem geführt wurden.<br />
Zudem die Erklärung zur Mitarbeit des IM<br />
und die Aufzeichnungen und Berichte, die<br />
der IM angefertigt hat. Ein Inoffizieller Mitarbeiter<br />
hatte gesellschaftliche und berufliche<br />
Vorteile und bekam besondere Geschenke<br />
zum Geburtstag.<br />
Durch die Wiederherstellung der quasi<br />
schon zerstörten Akten kann jede Menge<br />
herausgefunden werden. So können Opfer<br />
erfahren, ob und von wem sie bespitzelt<br />
wurden. Sogar der Ehepartner oder andere<br />
Familienmitglieder werden dabei als Stasispitzel<br />
entlarvt. Außerdem hat man herausgefunden,<br />
dass in der DDR schon Kinder<br />
gedopt wurden, um bessere<br />
Sportleistungen zu bringen. Durch das Doping<br />
sind einige Kinder gestorben, meint<br />
der Mitarbeiter der BStU.<br />
Jeder hat das Recht seine Akte einzusehen<br />
und kann deshalb bei der BStU einen Antrag<br />
auf Einsicht stellen.<br />
David Koch<br />
Zentralstelle <strong>Berlin</strong><br />
Hausanschrift:<br />
Karl-Liebknecht-Straße 31-33<br />
10178 <strong>Berlin</strong><br />
Postanschrift:<br />
BStU<br />
10106 <strong>Berlin</strong><br />
Homepage: www.bstu.bund.de<br />
Telefon: (030) 23 24 - 50<br />
Fax: (030) 23 24 - 77 99<br />
E-Mail: post@bstu.bund.de
Eindruck Seite 11<br />
Kunstszene <strong>Berlin</strong><br />
Das (Über)Leben<br />
der Kunstgalerien<br />
B<br />
erlin bietet mit seinen unzähligen<br />
Museen, Sammlungen<br />
und Galerien eine vielseitige<br />
und kreative Kunstszene.<br />
Viele Künstler aus aller Welt sorgen<br />
für einen ständigen kreativen<br />
Nachschub für die verschiedensten<br />
Ausstellungen. Um einen<br />
kleinen Überblick zu erhalten, haben<br />
wir drei unterschiedliche Galerien<br />
besucht und auf uns wirken<br />
lassen.<br />
Es ist ganz schön was los in der Tucholskystraße.<br />
Alles hier scheint sich der Kunst<br />
verschrieben zu haben, was man an den<br />
großen Schaufenstern erkennen kann, in<br />
denen so manche Kunstwerke ausgestellt<br />
sind. Immer wieder ist in der Straße eine<br />
neue kleine Galerie zu entdecken. Mittendrin<br />
befindet sich unser erstes Ziel: Die<br />
[DAM]<strong>Berlin</strong>, die eine Gruppenausstellung<br />
Foto: Franziska Seilkopf<br />
Gewöhnungsbedürftige Kunstobjekte für die Wand.<br />
namens GaMe! zum Thema Computerspiele<br />
und elektronisches Spielzeug zeigt.<br />
Die Galerie ist Teil eines umfassenden Konzeptes<br />
der Kunstvermittlung, welches sich<br />
ausschließlich dem Einfluss des Computers<br />
und des Digitalen auf Kunst und Gesellschaft<br />
widmet, wie uns die Homepage verrät.<br />
Daher werden hier seit 2003 Ausstellungsstücke<br />
junger und zeitgenössischer<br />
Künstler gezeigt, die sich mit dem Thema<br />
digitale Kunst beschäftigen.<br />
Als wir durch die Tür treten, fallen uns zunächst<br />
ein paar Tierköpfe an der Wand gegenüber<br />
ins Auge: Ein Nashorn, ein Leopard<br />
und ein Zebra. Dabei handelt es sich nicht<br />
etwa um ausgestopfte Jagdtrophäen, son-<br />
dern um kleine Roboterköpfe, die uns nicht<br />
mehr aus den Augen lassen und unsere Bewegungen<br />
verfolgen. Während wir uns einen<br />
ersten Eindruck verschaffen, kommt<br />
eine freundliche Dame auf uns zu und animiert<br />
uns dazu, die Computerspiele, die Teil<br />
der Ausstellung sind, auszuprobieren. Gesagt<br />
- getan. Und so stürzen wir uns die<br />
nächsten Minuten abwechselnd in drei unterschiedliche<br />
Computerspiele. Nach dem<br />
Ausflug in die Welt der Spiele sehen wir<br />
uns in Ruhe die ausgestellten Bilder an, bei<br />
denen das Thema die Erschaffung künstlichen<br />
Lebens durch Klonen ist. So entsteht<br />
zum Beispiel aus den unterschiedlichen<br />
Komponenten Hund, Schwein, Mensch und<br />
Nacktheit ein „Flyingpig“. Zusätzlich sind<br />
Fotos ausgestellt, die Jugendliche auf einer<br />
LAN-Party zeigen. Die Atmosphäre in der<br />
Galerie ist sehr entspannt, ein kleiner Hocker<br />
lädt zum Verweilen vor einem Bildschirm<br />
ein, auf dem unterschiedliche animierte<br />
Welten zu sehen sind. Nur wenn<br />
jemand dem Sockel mit einem Hund-<br />
Schaukelpferd-Roboter zu nahe kommt,<br />
wird die Stille kurz von den mechanischen<br />
Geräuschen, die das „Tier“ beim Vor- und<br />
Zurückschaukeln erzeugt, unterbrochen.<br />
Nachdem wir uns alle Ausstellungsgegenstände<br />
angesehen haben, machen wir uns<br />
auf den Weg zu unserem zweiten Ziel: Eine<br />
Vernissage in einer Galerie in der Straße<br />
Unter den Linden namens Showroom.<br />
Dies ist einer von zwei Standorten, die die<br />
Galerie <strong>Berlin</strong> Art Projects in <strong>Berlin</strong> führt.<br />
Laut ihres Prospektes hat es sich diese zur<br />
Aufgabe gemacht, junge und internationale<br />
in <strong>Berlin</strong> arbeitende Künstler aufzubauen.<br />
Sie begleitet und fördert mit wechselnden<br />
Ausstellungen und Veranstaltungen die<br />
Künstler auf ihrem Weg in die internationale<br />
Kunstwelt.<br />
Als wir dort ankommen, ist es draußen bereits<br />
dunkel geworden und ein paar Neugierige<br />
stehen vor den großen, hell erleuchteten<br />
Schaufenstern. Sie spähen nach innen,<br />
um ein paar Blicke auf die ausgestellten Fotografien<br />
des Künstlers Carsten Sander<br />
werfen zu können. Wir haben heute das<br />
Privileg auf der Gästeliste zu stehen und<br />
betreten wenig später einen großen, offenen<br />
und hellen Raum, in dem mannsgroße<br />
Hochglanzfotos an den Wänden hängen.<br />
Das Motto der Ausstellung lautet to surface,<br />
was im Deutschen „zum Vorschein kommen“<br />
bedeutet. Es handelt sich um Portraitfotografien<br />
von bekannten Film- und<br />
Showgrößen, dargestellt auf eine ungewöhnliche<br />
und zum Teil sehr fantastische<br />
Art und Weise, zum Beispiel als Ritter, Kapitän<br />
oder Rotkäppchen. Anfangs ist die<br />
Galerie noch nicht überfüllt und wir nutzen<br />
die Gelegenheit, die Werke ausgiebig zu bewundern<br />
und hier und da ein paar Fotos für<br />
dieses Magazin zu schießen.<br />
Während im Hintergrund ein DJ beginnt<br />
Elektrobeats zu spielen, füllt sich die Galerie<br />
langsam mit immer mehr Gästen in<br />
feiner Abendgarderobe. Die Stimmen wer-<br />
Foto: Maximilian Fritz<br />
Mirko Freiwald erläutert einer Besucherin iranische Kunst.<br />
den mit jedem Glas Wein etwas lauter, die<br />
Aussicht auf die Bilder dafür immer kleiner.<br />
Ein ganz besonderes Flair entsteht und man<br />
wird von der Aufregung, die in dem Raum<br />
durch das Stimmengewirr entsteht, mitgezogen.<br />
Zwischen den Gästen entdecken<br />
wir sogar den ein oder anderen Prominenten.<br />
Auch für die „Außenwelt“ wird es<br />
immer interessanter, was in dieser Galerie<br />
los ist, und so sieht man immer wieder<br />
plattgedrückte Nasen an den Schaufenstern.<br />
Allerdings: Wer sich die Bilder ohne<br />
Einladung ansehen möchte, der muss sich<br />
bis zum nächsten Tag gedulden. Erst dann<br />
wird die Ausstellung für die Öffentlichkeit<br />
zugänglich gemacht und jeder kann sich die<br />
Fotografien von Nahem ansehen. Wer da-
Seite 12 Eindruck<br />
gegen versucht einen Prominenten zu sehen,<br />
der muss noch ein wenig vor den<br />
großen Scheiben verweilen. Mittlerweile<br />
wird es immer schwieriger einen Platz vor<br />
den Ausstellungsstücken zu ergattern, da<br />
die Zahl der Gäste immer größer wird und<br />
sich immer mehr „Gesprächstrauben“ vor<br />
diesen aufhalten.<br />
Rufus Beck vor seinem Portrait.<br />
Foto: Maximilian Fritz<br />
Also machen wir uns auf zu unserer nächsten<br />
Vernissage. Sie findet in der Werkstattgalerie<br />
nahe dem Nollendorfplatz statt<br />
und trägt den Titel Iranian Bodies - iranische<br />
Körper. Die Ausstellung beschäftigt sich,<br />
wie es der Name bereits verrät, mit zeitgenössischer,<br />
iranischer Kunst. Diese beschäftigt<br />
sich - entgegen den meisten, heutzutage<br />
vorherrschenden westlichen Vorstellungen,<br />
häufig mit dem menschlichen Körper. Deshalb<br />
sind auf den Kohlezeichnungen, Acryl-,<br />
Print- und Ölbildern dieser Ausstellung nur<br />
leicht bekleidete oder nackte Menschen<br />
abgebildet.<br />
Als wir ankommen ist schon einiges los in<br />
der kleinen Galerie, die in mehrere Räume<br />
aufgeteilt ist. Wir gehen durch den vorderen<br />
geschäftigen Raum und entdecken im<br />
hinteren Teil der Galerie das Bild, das auf<br />
unserer Einladung zu sehen war. Mitten in<br />
diesem Raum ziehen eine weibliche und<br />
eine männliche Figur die Blicke der Besucher<br />
aus sich: sie bestehen aus einer Mischung<br />
aus Stahl, Holz, Pflaster, Fasern und<br />
Wachs.<br />
Unter den zahlreichen Gästen finden wir<br />
Mirko Freiwald, der Betreiber dieser Galerie.<br />
Er erklärt uns später auf unsere Frage,<br />
nach welchen Kriterien Künstler für die<br />
Ausstellungen ausgewählt werden, dass<br />
dies vollkommen unterschiedlich geschehe.<br />
Grundsätzlich gebe es ein Thema, nach dem<br />
die Kunstobjekte ausgesucht werden. Die<br />
Wahl erfolge dann zum Beispiel über Projektausschreibungen,<br />
eine persönliche Vorstellung<br />
des oder der Künstler, aber auch<br />
mittels eigener Suchen und auch auf Empfehlungen<br />
anderer hin. Ausstellungsgegenstände<br />
seien spezielle figurative Kunst, maleristische<br />
Fotografie, allgemeine Fotografie,<br />
seltener Skulpturen und Video. Grundsätzlich<br />
herrsche eine Offenheit gegenüber allen<br />
Weltbeiträgen - ausgewählt werde eben<br />
nach dem jeweiligen Thema.<br />
Als wir Freiwald fragen, wie Galerien überleben<br />
können erklärt er uns, dass dies<br />
hauptsächlich durch den Verkauf der ausgestellten<br />
Bilder möglich sei. Einen Anteil des<br />
Verkaufspreises erhält die ausstellende Galerie,<br />
die damit auch die Miete und Kosten<br />
wie Strom, Wasser und anderes ausgleicht.<br />
Daher sei es wichtig, sich zu einer renommierten<br />
Galerie zu entwickeln, um einen<br />
Gewinn erzielen zu können. Wirtschaftlich<br />
betrachtet benötige eine Galerie im Durchschnitt<br />
drei bis vier Jahre nach der Eröffnung,<br />
bis sie alle Investitionskosten „rein<br />
geholt“ hat.<br />
v. l. n. r.: Franziska Seilkopf, Holger Doetsch, Dieter „Didi“ Hallervorden, David Koch und Annalena Jung<br />
Foto: Maximilian Fritz<br />
Allerdings müsse man nicht unbedingt<br />
selbstständig sein, um eine Galerie zu betreiben.<br />
Da gebe es zum Beispiel auch institutionell<br />
geförderte Galerien oder Kunstvereine,<br />
die neben dem Verkauf der Werke<br />
auch durch Spenden finanziert werden.<br />
Oder man besitzt einen lukrativen Nebenerwerb,<br />
der es ermöglicht eine Galerie<br />
selbst zu finanzieren.<br />
Es herrscht hier in der Werkstattgalerie<br />
zwar nicht ganz so ein Tumult wie auf der<br />
Vernissage zuvor, aber auch hier verbergen<br />
zu späterer Stunde die Köpfe der Gäste so<br />
manchen Blick auf die Kunstwerke. Als wir<br />
alle Werke gesehen haben, beschließen wir,<br />
den Abend in einer gemütlichen Bar in der<br />
Nähe ausklingen zu lassen.<br />
Auf den ersten Blick haben wir heute drei<br />
ganz unterschiedliche Galerien gesehen.<br />
Die Unterschiede lagen in der Größe der<br />
Räumlichkeiten, den Besucherzahlen – die<br />
bei einer Eröffnung meist viel höher liegen,<br />
in der Wahl der Themen und den daher<br />
ausgestellten Kunstobjekten.<br />
Bei genauerer Betrachtung lassen sich jedoch<br />
die Ähnlichkeiten erkennen: Jede Galerie<br />
hegt eine besondere Liebe zur Kunst<br />
und auch zu den unterschiedlichen Arten<br />
der Künstler, diese darzustellen und auszudrücken.<br />
Für den einen Galerieinhaber ist<br />
es vielleicht wichtig, junge und unbekannte<br />
Künstler zu fördern, andere wiederum<br />
möchten nur ganz bestimmte Themen behandeln<br />
oder nur bestimmte Maltechniken<br />
zeigen. Allerdings haben sie alle ein gemeinsames<br />
Ziel: Sie wollen die Kunst der Öffentlichkeit<br />
zugänglich machen. Die<br />
Galeriebesucher sollen sich an den Kunstobjekten<br />
erfreuen, sich von ihnen inspirieren<br />
lassen. Die Ausstellungsstücke sollen<br />
aber auch neue Denkanstöße bringen, den<br />
Betrachter einen neuen Blick auf die Welt,<br />
mit all ihren positiven und negativen Veränderungen,<br />
werfen lassen oder auch einfach<br />
nur schockieren und wachrütteln.<br />
Wie Johann Wolfgang von Goethe einmal<br />
passend schrieb: Man weicht der Welt nicht<br />
sicherer aus als durch die Kunst, und man verknüpft<br />
sich nicht sicherer mit ihr als durch die<br />
Kunst.<br />
Franziska Seilkopf
Eindruck Seite 13<br />
Digitale Kunst<br />
Malen mit Maus<br />
D<br />
ie Kunst ist ein Spiegel ihrer<br />
Zeit. Die gesellschaftlichen<br />
Umstände und die Verfügbarkeit<br />
der Produktionsmittel haben direkten<br />
Einfluss auf das geschaffene<br />
Kunstwerk. Nur allzu verständlich<br />
ist es dann, dass in einer<br />
Welt, in der das Leben zum Teil<br />
digital im Internet stattfindet,<br />
auch in der Kunst das Medium des<br />
Computers an Attraktivität gewinnt.<br />
Welche „Werkzeuge“ verwendet werden,<br />
um ein Kunstwerk zu schaffen, ist irrelevant.<br />
Allein das Ergebnis zählt. Dem Künstler<br />
sollte also niemand vorschreiben, ob er<br />
hierfür einen Pinsel, eine Fotokamera oder<br />
eben einen Computer benutzt. Die Musik-<br />
Szene macht es vor: Der Großteil der aktuellen<br />
Unterhaltungs-Musik besteht aus am<br />
Computer programmierten Melodien und<br />
Rhythmen, gespielt von digitalen Instrumenten.<br />
Ob Computergrafik, Animation, 3D, Software,<br />
Internet-Kunst, virtuelle Realität<br />
oder interaktive und computerunterstützte<br />
Kunst-Installation – die digitale Kunst bietet<br />
vielfältige Stilmittel. Digitale Kunst stellt<br />
eine Verbindung aus Wissenschaft und<br />
Kunst dar und ist somit weitgehend experimentell.<br />
Eine Maschine oder ein Computer<br />
wird darauf programmiert was er zu tun<br />
hat, worauf er es ausführt. Die ersten<br />
Zeichnungen die so entstanden, waren sogenannte<br />
Plotterzeichnungen, eine veraltete<br />
aber qualitativ hochwertige Technik. Wie<br />
auch bei anderen Computerprogrammen<br />
liegt einer Plotterzeichnung ein Algorithmus<br />
zu Grunde. Algorithmen sind komplexe Anweisungen<br />
in einer Computersprache, die<br />
sich viele Künstler autodidaktisch aneigneten.<br />
Ein vereinfachter Algorithmus kann<br />
beispielsweise eine Bauanleitung für ein Regal<br />
sein. Befolgt man die Anweisungen, so<br />
wird immer dasselbe Ergebnis erzielt. Der<br />
Künstler schreibt die Anweisung, den Algorithmus,<br />
und die Maschine führt ihn aus,<br />
zeichnet also das Bild. Oft spielt dabei auch<br />
der Zufall eine Rolle. Zufallsvariablen wer-<br />
den als künstlerisches Stilmittel eingesetzt,<br />
unter Anderem um ein entstehendes Werk<br />
Einzigartig zu gestalten. Vom Computer<br />
ausgeführte Zeichnungen könnten unendlich<br />
reproduziert werden, durch einen programmierten<br />
Zufall jedoch erhält jedes<br />
Werk eine individuelle Handschrift.<br />
Digitale Kunst wird neben realen und greifbaren<br />
Werken auch komplett elektronisch<br />
und virtuell realisiert. Man spricht von sogenannter<br />
Net Art, der Netzkunst, die ausschließlich<br />
im Internet zu finden ist. Dies<br />
meint nicht den Verkauf von Kunstwerken<br />
über das Word Wide Web, sondern die<br />
Darbietung von Kunst auf einer Internet-<br />
Plattform. Die Internet-Künstler Joan<br />
Heemskerk und Dirk Paesmans ließen sich<br />
von ihrem Besuch im Silicon Valley, Kalifornien,<br />
inspirieren, und gründeten daraufhin<br />
die Website wwwwwwwww.Jodi.org. Sie experimentierten<br />
mit vorhandenen HTML-<br />
Skripten, die sie bunt durcheinander<br />
mischten. Das Ergebnis erinnert an die<br />
Kunstform des Dadaismus. Auf dieser Website<br />
werden digitale Konstrukte aufgebrochen<br />
und scheinen das Internet wieder dekonstruieren<br />
zu wollen. Man glaubt, sich auf<br />
einer von Viren verseuchten Website wiederzufinden.<br />
Ein weiteres, auf den ersten Blick ebenfalls<br />
verstörendes Netzkunstwerk, ist die Website<br />
www.mouchette.org, kreiert von einem<br />
bis heute unbekannten Autor. Auf der Seite<br />
wird eine virtuelle Persönlichkeit namens<br />
Mouchette, französisch für „Kleine Fliege“,<br />
kreiert. Mouchette beruht sowohl auf<br />
einem Roman von Georges Bernanos aus<br />
dem Jahre 1937, als auch dem dazugehörigen<br />
Film von Robert Bresson von 1967.<br />
Ihre Person und Geschichte ist geprägt von<br />
Armut, Vergewaltigung, Depression und<br />
schließlich Selbstmord, was auf der Website<br />
mit grotesken Abbildungen und kleinen<br />
Fliegen, die als Links fungieren, thematisiert<br />
wird.<br />
Ebenfalls im Internet zu finden, genauer gesagt<br />
auf You-Tube, sind die computerbasierten<br />
Animationen von John Whitney wie<br />
„Arabesque“, „Catalog“ oder<br />
„Permutations“. Diese oft mit<br />
psychedelischer Musik unterlegten<br />
Video-Kunstwerke stellen<br />
erste Schritte dar, sich<br />
mit digitalen Mitteln<br />
künstlerisch<br />
cken.auszudrü-<br />
Digitale Kunst hat seitdem<br />
einen mühseligen<br />
Weg hin zu ihrer Anerkennung<br />
hinter sich. Der<br />
Einsatz von Maschinen und Computern galt<br />
in der Künstlerszene als verpönt, da in ihnen<br />
ein unkreatives, ausdrucks- und emotionsloses<br />
Arbeitsmittel gesehen wurde. Im<br />
Jahr 1971 in Frankreich erfuhr Manfred<br />
Mohr, ein Computerkünstler, dies am eigenen<br />
Leib. Bei einem Vortrag zu einem Digitalen<br />
Kunstwerk wurde er mit Tomaten<br />
beworfen und seine Produktionsmittel als<br />
„kapitalistisches Kriegswerkzeug“ beschimpft.<br />
Jedoch fanden solche Arbeiten Unterstützung<br />
in einer der ersten und wichtigsten<br />
Ausstellung zu diesem Thema, der Cybernetic<br />
Serendipity, die 1968 in London stattfand.<br />
Zudem wird alle zwei Jahre der mit 20.000<br />
Euro dotierte d.velop digital art award [ddaa]<br />
vom Digital Art Museum in <strong>Berlin</strong> [DAM]<br />
verliehen. Das DAM ist neben dem Zentrum<br />
für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe<br />
[ZKM] das bedeutendste Museum,<br />
welches sich der Digitalen Kunst verschrieben<br />
hat.<br />
Es ist für die Zukunft nur zu hoffen, dass<br />
weiter mit „digitalen Werkzeugen“ experimentiert<br />
wird, und sich die Skepsis am<br />
Kunstmarkt gegenüber der technoiden und<br />
neuartigen Ausdrucksform legen wird.<br />
Maximilian Fritz
Seite 14 Eindruck<br />
Forschungszentrum CERN<br />
Das Universum<br />
begreifen<br />
D<br />
as 1954 gegründete Forschungszentrum<br />
CERN (Conseil<br />
Européen pour la Recherche Nucléaire)<br />
bei Genf in der Schweiz ist eine<br />
europäische Organisation zur Aufklärung<br />
essenzieller wissenschaftlicher<br />
Fragen, um die Welt in ihrer<br />
Beschaffenheit besser verstehen<br />
zu können. Die Einrichtung ist unabhängig<br />
von kommerziellen Konzernen,<br />
um die Ergebnisse der<br />
Forschung öffentlich zugänglich<br />
machen zu können. Zudem werden<br />
im CERN zukünftige Wissenschaftler<br />
und Ingenieure ausgebildet.<br />
Dabei drängen sich<br />
wesentliche Fragen auf, um die<br />
Arbeitsweise des CERN zu verstehen.<br />
Was wird erforscht?<br />
Materie.<br />
7000 internationale Wissenschaftler wollen<br />
herausfinden, woraus Materie besteht, wie<br />
diese zusammengesetzt ist und reagiert.<br />
Jeder dem Menschen bekannten existierenden<br />
Form liegen vier Teilchen zu Grunde:<br />
Up-Quarks, Down-Quarks, Elektron<br />
und Elektron-Neutron. Diese Elemente bilden<br />
zusammen ein Atom. Atome bilden<br />
Moleküle, und Moleküle setzen sich letztlich<br />
zu greifbarer Materie zusammen. Erforscht<br />
werden viele der uns bekannten<br />
Teilchen und auch „exotische“ Kerne.<br />
Diese werden unter anderem auf ihre Beschaffenheit,<br />
Lebensdauer, Energie, Dichte<br />
und Strahlung hin untersucht.<br />
Wie wird geforscht?<br />
Mit einem Teilchenbeschleuniger.<br />
Der Hadron-Speicherring LHC (Large Hadron<br />
Collider) ist in einem unterirdischen,<br />
27 Kilometer langen Tunnel unter dem Forschungszentrum<br />
CERN installiert. In diesem<br />
wird Materie nahezu auf Lichtgeschwindigkeit<br />
beschleunigt. Dies geschieht<br />
durch das Erzeugen enormer elektromagnetischer<br />
Felder in der kreisförmigen<br />
Rohr-Konstruktion. Diese Felder übertragen<br />
Energie auf die Teilchen, die sich in dem<br />
Rohr befinden, und beschleunigen diese.<br />
Die Forschung besteht darin, die Materien<br />
kollidieren zu lassen. In der Rohr-Konstruktion<br />
dreht sich ein Teilchenstrahl mit 99,9<br />
Prozent der Lichtgeschwindigkeit im Kreis,<br />
wohingegen ein anderer Materie-Strahl in<br />
einer kleineren, zweiten Umlaufbahn in<br />
entgegengesetzter Richtung beschleunigt<br />
wird. Die zweite Materie wird darauf in den<br />
größeren Ring hinein geschossen, wo beide<br />
Strahlen frontal aufeinander prallen und reagieren.<br />
Hierbei kollidieren von 200 Milliarden<br />
Teilchen nur etwa 20. Durch diesen<br />
Prozess entstehen viele neue kleinere Teile<br />
und Energie wird freigesetzt. Dem Umwandeln<br />
von Masse (m) mit Lichtgeschwindigkeit<br />
(c) in Energie (E), liegt Albert Einsteins<br />
Formel E=mc 2 zu Grunde.<br />
Die Entstehung des neuen Produkts wird<br />
mit hoch aufwändigen technischen Sensoren<br />
von vier riesigen Detektoren gemessen<br />
und rekonstruiert. Die Auswertung der<br />
Daten gibt Aufschluss auf die Zusammensetzung<br />
und Reaktion der Teilchen. Die<br />
horrende Menge an erhobenen Daten<br />
könnten im Zeitraum eines Jahres einen 20<br />
Kilometer hohen Stapel an CDs füllen.<br />
Foto: Maximilien Brice © CERN<br />
Die LHC-Maschine, in der Materie zur Kollision gebracht wird.<br />
Wieso wird geforscht?<br />
Um Fragen des Universums zu beantworten.<br />
CERN liefert Kenntnisse über die Zusammensetzung<br />
von Materie und ihrer Entstehung.<br />
Im weiteren Sinne liefert dies Einsichten<br />
über die Entstehung der Welt. Im<br />
Forschungszentrum CERN werden unter<br />
anderem Elemente erzeugt, wie sie vermutlich<br />
kurz nach dem Urknall vorhanden waren.<br />
Das Wissen über Materie findet in unterschiedlichen<br />
Bereichen seine Anwendung.<br />
Ein am CERN entwickelter Teilchendetek-<br />
tor wird beispielsweise in der Medizin angewendet,<br />
um bestimmte Diagnosen stellen<br />
zu können. CERN war zudem „Geburtsort“<br />
des World Wide Web, welches dort<br />
entwickelt wurde, um Physikern die weltweite<br />
Kommunikation zu erleichtern. Erkenntnisse,<br />
welche im CERN gewonnen<br />
werden, finden des Weiteren in der Tief-<br />
Temperaturtechnik, Supra-Leitung, Vakuumtechnik,<br />
Mikroelektronik und im Bauingenieurswesen<br />
ihre Anwendung.<br />
Welche Gefahren gehen von der<br />
Forschung aus?<br />
Der Weltuntergang?<br />
Gewisse Experimente des Forschungszentrums<br />
CERN befassen sich mit der Produktion<br />
von Antiteilchen. Diese sind Teil der<br />
Antimaterie, welche das Negativ zu Materie<br />
darstellt. Antimaterie ist die Grundlage<br />
für ein Schwarzes Loch. Kritiker befürchten,<br />
dass Schwarze Löcher entstehen<br />
könnten, welche die Welt in sich „einsaugen“.<br />
Die Thematik der Antimaterie im Forschungszentrum<br />
CERN wurde unter anderem<br />
in Dan Browns Roman Illuminati<br />
behandelt. Wenn solche Schwarzen Löcher<br />
entstehen, werden diese jedoch so klein<br />
sein, dass sie sofort wieder verstrahlen<br />
würden, so der Forschungsphysiker des<br />
CERN, Dr. Rolf Landua in einem Interview<br />
des P.M.-Magazins. Landua argumentiert unter<br />
anderem so, dass, wenn Schwarze Löcher<br />
entstehen würden und potentiell gefährlich<br />
wären, die Erde gar nicht mehr<br />
existieren dürfte. Der Biochemiker und<br />
Chaosforscher Prof. Dr. Otto E. Rössler<br />
vermutet dagegen, dass diese Mini-Löcher<br />
nicht wie nach dem Astrophysiker Stephen<br />
Hawking sofort, sondern erst nach unendlich<br />
langer Zeit verstrahlen. Bis dahin<br />
könnten diese Löcher mit Materie in Berührung<br />
kommen, sie „auffressen“ und<br />
wachsen. Es gibt unterschiedliche Theorien,<br />
wie schnell so ein Loch wachsen kann und<br />
die Erde verschlingt. Es ist die Rede von bis<br />
zu fünf Milliarden Jahren – eine Zeit, in der<br />
die Erde von der Sonne ohnehin schon zerstört<br />
sein wird.<br />
Maximilian Fritz
Eindruck Seite 15<br />
Robert Lebeck<br />
Eine Fotografenlegende<br />
E<br />
s dauerte seine Zeit, bis der<br />
1929 in <strong>Berlin</strong> geborene Robert<br />
Lebeck von seinen Fotos leben<br />
konnte. Aber sein starker<br />
Wille und sein Talent, seine Umgebung<br />
so wahr zu nehmen, wie<br />
sie ist, sowie sein besonderer<br />
Charme haben ihn zu einem der<br />
bekanntesten Fotografen dieses<br />
Landes gemacht.<br />
Bereits als Kind träumte Robert Lebeck davon,<br />
zu verreisen und Abenteuer zu erleben.<br />
Ein paar Semester eines Völkerkundestudiums<br />
brachten ihn zwar theoretisch<br />
den Völkern und Kulturen der Welt näher,<br />
aber es sollte das Geschenk seiner ersten<br />
Frau Ruth zum 23. Geburtstag sein, das ihn<br />
zu einem der bedeutendsten Fotojournalisten<br />
der deutschen Nachkriegszeit<br />
machte: Eine Retina 1A. Dies war nicht seine<br />
erste Kamera, aber es war das erste Mal,<br />
dass er die beiliegende Gebrauchsanweisung<br />
aufmerksam las und seine Fotografien<br />
„brauchbar“ wurden. Einzig aus dieser Anweisung<br />
und dem genauen Studium der Arbeiten<br />
der Größen seines Fachs bestand<br />
seine autodidaktische Fotoschule.<br />
Schon bald entdeckten Chefredakteure<br />
sein Talent und er arbeitete für <strong>Zeitschrift</strong>en<br />
wie GEO, Revue, Kristall und Stern,<br />
und wurde für seine Leistungen als erster<br />
Fotojournalist überhaupt mit dem Henri-<br />
Nannen-Preis ausgezeichnet.<br />
Mit seinen Fotoreportagen, die ihn durch<br />
Afrika, Sowjetunion und Asien führten, ermöglichte<br />
er den Menschen in Deutschland<br />
Einblicke in andere Völker und Kulturen, die<br />
vielen nach dem zweiten Weltkrieg verwehrt<br />
blieben. Er brachte so ein Stück der<br />
fremden Welt nach Deutschland. Dabei<br />
zeigte er den Aufbau und Aufschwung eines<br />
Landes genauso, wie den Verfall und Abschwung.<br />
Er fotografierte Menschen mit<br />
Hoffnungen und Träumen, Obdachlose und<br />
Hungernde, wütende und lachende Menschen.<br />
Kurz gesagt, er lichtete die Menschen<br />
und ihr Land genau so ab, wie sie<br />
waren.<br />
Eines seiner berühmtesten Fotos entstand<br />
in den 1960er Jahren, als sich Europas Kolonialmächte<br />
aus den afrikanischen Gebieten<br />
zurückzogen: König Baudouin von Belgien<br />
fuhr mit seinem offenem Cabriolet bei<br />
einer Abschiedsparade durch die Straßen in<br />
Léopoldville, als ein junger Mann ihm seinen<br />
Degen, ein Zeichen der Macht, entriss<br />
und ihn somit sinnbildlich entwaffnete. Lebeck<br />
war genau zum richtigen Zeitpunkt<br />
zur Stelle und konnte so diesen sehr bedeutungsvollen<br />
Moment mit seiner Kamera<br />
festhalten.<br />
Dass dieses Foto entstehen konnte, ist zum<br />
einen Lebecks intuitiver Fähigkeit zu zuschreiben,<br />
genau im richtigen Moment<br />
nicht davor zurückzuschrecken, mit der Kamera<br />
einfach „drauf zu halten“ während<br />
etwas besonderes passiert. Zum anderen<br />
liegt es auch daran, dass Lebeck ein Glückspilz<br />
ist:<br />
Foto: Holger Doetsch<br />
Robert Lebeck in seinem Archiv.<br />
Er konnte damals nämlich nicht von einem<br />
leckeren Dessert lassen, verspätete sich so<br />
und bekam Baudouin nur noch von hinten<br />
zu sehen - was sich am Ende als der beste<br />
Platz für einen Fotografen herausstellte. Er<br />
selbst hat dazu passenderweise einmal gesagt:<br />
„Ohne Glück kannst du nichts werden“.<br />
Nicht nur mit seinen Reportagen-, sondern<br />
auch mit seinen Portraitfotografien hat sich<br />
Lebeck einen Namen gemacht. Die Liste<br />
portraitierter Prominenter ist lang: Alfred<br />
Hitchcock, Elvis Presley, Andy Warhol,<br />
Romy Schneider, Konrad Adenauer, Willy<br />
Brandt, Klaus Kinski, Joseph Beuys, Loriot,<br />
Sophia Loren, Maria Callas und viele, viele<br />
mehr.<br />
Eine ganz besondere Bindung hatte er zu<br />
Romy Schneider. Als sie 1976 in <strong>Berlin</strong><br />
„Gruppenbild mit Dame“ drehte, wurde er<br />
vom Stern beauftragt, Fotografien für eine<br />
Geschichte zu machen. Schon von Anfang<br />
an mochte Romy den unaufdringlichen Lebeck<br />
und flirtete gerne mit seiner Kamera.<br />
Dass Lebeck mehr als nur irgendein Fotograf<br />
für sie war, erkennt man an einem von<br />
ihr geschriebenen Zettel, den er eines<br />
Abends unter seiner Hotelzimmertür fand.<br />
Auf diesem stand geschrieben: „Du machst<br />
mir Angst, und ich mach mir Angst, vergiss<br />
mich schnell, aber bitte sag mir gute Nacht“.<br />
Er verstand, dass sie reden wollte und<br />
machte sich zusammen mit seiner Kamera<br />
auf den Weg in ihr Hotelzimmer. Sie redeten<br />
die ganze Nacht hindurch, tranken<br />
Rotwein und schossen ein paar Fotos, bis<br />
sie nebeneinander einschliefen.<br />
Das von gegenseitiger Zuneigung geprägte<br />
Verhältnis hielt von da an, ganz egal, wie lange<br />
sie sich nicht gesehen hatten. Sogar zu<br />
Zeiten, als Romy Schneider eine Abneigung<br />
gegen die Presse und ihre Fotografen hegte,<br />
freute sie sich dennoch ihren „Lebo“, wie<br />
sie ihn liebevoll nannte, zu sehen und sich<br />
von ihm für eine weitere Stern-Geschichte<br />
fotografieren zu lassen.<br />
Hätte man Romy gefragt, warum sie sich zu<br />
ihm hingezogen fühlte, sie hätte wohl<br />
geantwortet: Weil er so charmant ist. Weil<br />
er mir keine Anweisungen gibt wie ich mich<br />
inszenieren soll, sondern mir die Möglichkeit<br />
gibt, mich selbst darstellen zu können.<br />
Und weil er nie versucht hat, das Negative<br />
eines Menschen absichtlich darzustellen.<br />
Auf seinen Aufnahmen bin ich Ich!<br />
Robert Lebeck kann mittlerweile auf eine<br />
über 50 Jahre andauernde Karriere zurückblicken.<br />
Heute überlässt er es seinem Sohn<br />
Os<strong>ca</strong>r die Welt zu bereisen und Bilder zu<br />
knipsen – vielleicht einer der nächsten bedeutenden<br />
Fotojournalisten.<br />
Franziska Seilkopf
Seite 16 Eindruck<br />
Tips für den Trip in die Hauptstadt<br />
<strong>Berlin</strong>, du bist so<br />
wunderbar…<br />
D<br />
ass <strong>Berlin</strong> wunderbar ist,<br />
stellte nicht nur die Gruppe<br />
Kaiserbase mit ihrem gleichnamigen<br />
Songtitel klar. Die Hauptstadt<br />
Deutschlands hat mit ihren<br />
unterschiedlichen Bezirken und<br />
verschiedensten Sehenswürdigkeiten<br />
vieles zu bieten. Vor allem<br />
junge Menschen können in der<br />
Spreestadt einiges erleben: Tagsüber<br />
beim Sightseeing und Shopping,<br />
abends in coolen Bars und<br />
Clubs. Da <strong>Berlin</strong> für Vielfältigkeit<br />
steht, ist für jeden etwas dabei<br />
und niemand wird diese Stadt unverzaubert<br />
verlassen.<br />
Clubs, Diskotheken, Lounges<br />
40seconds<br />
Die Clublounge im 8. Stockwerk erreicht<br />
man über einen Aufzug. In den verschiedenen<br />
Bereichen des Clubs kann man Tanzen<br />
unter lauten Beats und den ein oder<br />
anderen Longdrink genießen. Auf der angrenzenden<br />
Terrasse können die Partygäste<br />
rauchen und über den Potsdamer Platz hinweg<br />
bis zum Alexanderplatz schauen. Classic<br />
House, Electro und R´n´B wird gespielt.<br />
Der Eintrittspreis liegt bei zehn Euro und<br />
die Longdrinkpreise starten bei acht Euro.<br />
Hier trifft man u. a. die Schickeria der Stadt.<br />
www.40seconds.de<br />
Potsdamer Straße 58<br />
10785 <strong>Berlin</strong>-Schöneberg<br />
Bellini Lounge<br />
Modernes Ambiente und gemütliche Clubsessel<br />
warten auf den Gast. An der Bar gibt<br />
es auch Sitzmöglichkeiten, von wo man den<br />
Barkeeper beim Cocktailmixen beobachten<br />
kann. Die Cocktailkarte ist üppig: Hier<br />
findet jeder seinen Lieblingscocktail. Bei ruhiger<br />
Loungemusik kann man sich optimal<br />
mit seinen Freunden unterhalten.<br />
Die Preise liegen bei sieben Euro und aufwärts.<br />
In der Happy Hour gibt es bis 21<br />
Uhr die Cocktails für 4,90 Euro.<br />
www.bellinilounge.de<br />
Oranienburger Straße 42/43<br />
10117 <strong>Berlin</strong><br />
Club der Visionäre<br />
Diese Lo<strong>ca</strong>tion ist besonders an warmen<br />
Sommertagen zu empfehlen. Der CdV ist<br />
weniger ein Club, sondern mehr eine<br />
Open-Air-Lounge. Der Eintritt ist frei. Die<br />
Lo<strong>ca</strong>tion liegt direkt an einem Neben-Kanal<br />
der Spree, weshalb man direkt am Wasser<br />
sitzt. Eine kleine Tanzfläche gibt es auch.<br />
Der CdV wird bevorzugt abends besucht,<br />
um dort etwas zu trinken und bei angenehmer<br />
Musiklautstärke zu reden.<br />
Musikstil: Minimal, Elektro<br />
www.clubdervisionaere.de<br />
Am Flutgraben<br />
12435 <strong>Berlin</strong>-Treptow<br />
Hackescher Markt und die<br />
Oranienburger Straße<br />
Diese Gegend bietet viele Möglichkeiten<br />
den Abend zu gestalten. Hier befinden sich<br />
Restaurants, Bars, Lounges und Clubs ganz<br />
in der Nähe. Wer gerne um die Häuser<br />
zieht und sich erstmal nicht festlegen<br />
möchte, ist hier genau richtig.<br />
S-Bahnhof Hackescher Markt<br />
(eine Station vom Alexanderplatz entfernt)<br />
S-Bahnhof Oranienburger Straße<br />
Simon-Dach-Straße<br />
und Umgebung<br />
Die Simon-Dach-Straße ist das Zentrum<br />
des Friedrichshainer Kiez. Ein Ort mit unzähligen<br />
Cocktail-, Sushi- und Shisha-Bars<br />
sowie originellen Restaurants. Neben der<br />
Vielzahl an Möglichkeiten zur Abendgestaltung<br />
gibt es auch einfallsreiche und individuelle<br />
Geschäfte zum Shoppen sowie kleine<br />
Kunstgalerien.<br />
Soda<br />
Über die Soda-Lobby gelangt man schnell<br />
zu den vielen Floors, in denen verschiedene<br />
Musikstile angeboten werden. Neben<br />
House, R´n´B und Black Music gibt es z.B.<br />
auch Salsa. Der Eintritt liegt bei zehn Euro,<br />
wobei Frauen bis ein Uhr kostenlos in den<br />
Club kommen. Die Longdrinkpreise starten<br />
bei cir<strong>ca</strong> acht Euro.<br />
www.soda-berlin.de<br />
Knaackstraße 97<br />
10435 <strong>Berlin</strong>-Prenzlauer Berg<br />
Tube<br />
Bei Hip Hop, R´n´B und Black Music gemischt<br />
mit dem richtigen Beat kann man bis<br />
in die Morgenstunden tanzen. Das edle Design<br />
des Clubs mit den gebogenen Wänden<br />
soll an die Londoner Tube-Stations erinnern.<br />
Die Getränkepreise sind Hauptstadtpreise,<br />
das heißt Longdrinks und Cocktails<br />
liegen bei 8,50 Euro und aufwärts. Der Eintritt<br />
kostet zehn Euro.<br />
www.tube-station.de<br />
Friedrichstraße 180<br />
10117 <strong>Berlin</strong>-Mitte<br />
(der Eingang liegt etwas versteckt hinten im Gebäude)<br />
Watergate<br />
Weiter die Spree entlang liegt am Wassertor<br />
der gleichnamige Club „Watergate“.<br />
Die Musikrichtung: Elektro, House, Minimal,<br />
Techno, Drum`n`Base, manchmal auch Soul<br />
& R`n`B. Der Eintritt entspricht mit 10 €<br />
und nicht gerade günstigen Getränkepreisen<br />
dem Hauptstadtstandard. Das Ambiente<br />
besticht durch Style und Moderne, was<br />
jedoch nicht bedeutet, dass auch der<br />
Dress-Code und die Leute „versnobt“ sind.<br />
Der „Water-Floor“ bietet einen herrlichen<br />
Ausblick auf die Spree. Zudem kann man<br />
draußen auf einem angehängten Floß mit<br />
Sitzmöglichkeiten entspannen.<br />
www.water-gate.de<br />
Falckensteinstr.49<br />
10997 <strong>Berlin</strong>-Prenzlauer Berg
Eindruck Seite 17<br />
Week End<br />
Im 12. Stock des ehemaligen „Haus des<br />
Reisens“ am Alexanderplatz kann man<br />
ebenfalls ausgiebig feiern. Zudem wird ein<br />
imposanter Blick über <strong>Berlin</strong> geboten. Die<br />
große Dachterrasse einige Stockwerke höher<br />
lädt vor allem im Sommer neben dem<br />
Tanzen zum Relaxen ein. Gespielt wird<br />
feinster House, Electro und Techno. Der<br />
Eintritt sowie die Getränkepreise liegen bei<br />
den üblichen Clubpreisen dieser Stadt.<br />
www.week-end-berlin.de<br />
Am Alexanderplatz 5<br />
10178 <strong>Berlin</strong>-Mitte<br />
Restaurants<br />
cha cha positive eating<br />
Thai Street Kitchen<br />
Die Küche verwendet frische, gesunde und<br />
leichte Zutaten. Gemüse, Obst, feinstes<br />
Fleisch und spezielle Gewürze sind ebenfalls<br />
Bestandteil der wohltuenden Gerichte:<br />
„Thai-Reis-Spaghetti mit Pfeffer-Bio-Hühnchen“<br />
oder „cha cha Gemüse-Frühlingsrollen-Salat“.<br />
Zu empfehlen ist die gelbe cha<br />
cha Limonade mit Aloe Vera Stückchen. „Bio“<br />
auf moderne Art im stylishen Ambiente.<br />
www.eatchacha.com<br />
Friedrichstraße 63<br />
10117 <strong>Berlin</strong>-Mitte<br />
Mirchi Restaurant<br />
Das Restaurant bietet indische Küche an.<br />
Empfehlenswert sind nicht nur die Gerichte,<br />
sondern auch die Cocktails, von denen<br />
ausgewählte den gesamten Abend zum<br />
Happy-Hour-Preis von 4,90 Euro angeboten<br />
werden.<br />
www.amrit.de<br />
Oranienburger Straße 50<br />
10117 <strong>Berlin</strong>-Mitte<br />
(Nähe U-Bhf. Oranienburger Tor)<br />
Oranienstraße 204<br />
10999 <strong>Berlin</strong>-Kreuzberg<br />
Sagano<br />
Wer lecker und preiswert im Westteil der<br />
Stadt Sushi und Cocktails trinken möchte,<br />
ist hier genau richtig. Das Sushi schmeckt<br />
lecker und ist qualitativ hochwertig. Junges<br />
Interior für junges Publikum.<br />
www.sagano.de<br />
Kurfürstendamm 182<br />
10707 <strong>Berlin</strong>-Charlottenburg<br />
(Nähe Olivaer Platz)<br />
Vapiano<br />
Auch die <strong>Berlin</strong>er Vapianos halten, was sie<br />
versprechen: Italienische Küche, preiswert,<br />
modernes Ambiente und zentral in der<br />
City gelegen.<br />
www.vapiano.com<br />
Vapiano <strong>Berlin</strong> 1<br />
Augsburger Straße 43<br />
(Nähe U-Bhf. Kurfürstendamm)<br />
Vapiano <strong>Berlin</strong> 2<br />
Potsdamer Platz 5<br />
Vapiano <strong>Berlin</strong> 3<br />
Mittelstraße 51-52<br />
(Nähe S+U-Bhf. Friedrichstraße)<br />
White Trash Fast Food<br />
Restaurant, Club und Tattoo Studio in einer<br />
Lo<strong>ca</strong>tion vereint. Das buntgemischte Design<br />
des Restaurants ist was fürs Auge – unbeschreiblich,<br />
davon muss man sich selbst<br />
überzeugen. Neben Steaks, werden auch<br />
Ceasar Salads, Burger und „Chilli Fries“ angeboten.<br />
Abwechselnd legen DJs ihre Musik<br />
auf: Underground, Indie, Mainstream, Country.<br />
www.whitetrashfastfood.com<br />
Schönhauser Allee 6/7<br />
10119 <strong>Berlin</strong>-Mitte<br />
(Nähe U-Bhf. Rosa-Luxemburg-Platz)<br />
Shopping & Sightseeing<br />
In <strong>Berlin</strong> gibt es vieles zu entdecken. Empfehlenswert<br />
ist es daher, sich ab S+U-Bhf.<br />
Zoologischer Garten in die Buslinie 100<br />
zu setzen. Der Bus fährt in Richtung Alexanderplatz<br />
und hält an Stationen, die direkt<br />
an <strong>Berlin</strong>s schönen Sehenswürdigkeiten<br />
anknüpfen. Von West nach Ost zum<br />
BVG-Regeltarif. Eine teure Sightseeingtour<br />
kann man sich so sparen.<br />
Eine Station der Buslinie 100 ist Unter den<br />
Linden. Von dort aus geht es schnell in Richtung<br />
Brandenburger Tor oder Friedrichstraße,<br />
die einen in Großstadtfeeling<br />
versetzt und zum Shoppen verleitet, wie<br />
zum Beispiel in den Galeries Lafayette.<br />
Bleibt man im Bus sitzen und fährt weiter<br />
in Richtung Alexanderplatz, kann man<br />
den Fernsehturm, eines der Wahrzeichen in<br />
<strong>Berlin</strong>, besichtigen und sich im Alexa, dem<br />
großen Shoppingcenter, vergnügen.<br />
Vom Alexanderplatz aus ist es nicht weit<br />
zum Hackeschen Markt, in dessen<br />
Umgebung es viele Cafés und Läden gibt,<br />
die zum Shoppen einladen. Im Ostteil, vor<br />
allem in den Bezirken Mitte, Prenzlauer<br />
Berg und Friedrichshain, kann man sehr viel<br />
entdecken. Hier lohnt es sich spazieren zu<br />
gehen und die Augen nach kleinen Second-<br />
Hand-Läden und Cafés offen zu halten.<br />
Die Bergmannstraße (Nähe U-Bahnhof<br />
Mehringdamm) im Stadtteil Kreuzberg<br />
lädt mit ihren vielen Cafés und Restaurants<br />
ein zu verweilen. Die meisten Lokale bieten<br />
die Möglichkeit draußen auf der Straße zu<br />
sitzen und die Sonne zu genießen sowie die<br />
Passanten zu beobachten.<br />
Im Westen liegt der Kurfürstendamm,<br />
der bei einem <strong>Berlin</strong>-Trip immer einen<br />
Stopp wert ist. Zahlreiche Geschäfte, Cafés<br />
und Restaurant warten auf ihre Besucher.<br />
An schönen Tagen ist es sehr zu empfehlen,<br />
den gesamten Kurfürstendamm vom Ka-<br />
DeWe bis hin zum Halensee zu laufen:<br />
Großstadtfeeling, umgeben von schönen<br />
Altbauten.<br />
Annalena Jung<br />
Tip: In der City werden vor allem zum Wochenende<br />
hin Flyer verteilt, die bei Abgabe<br />
des Flyers in den Clubs eine Eintrittsermäßigung<br />
ermöglichen. Also: Augen auf!<br />
Die Stiftung Warentest gibt Neu-Studierenden<br />
wichtige Tipps zu den Themen „Geld“,<br />
„Jobs“, „Banken und Versicherungen“ etc.<br />
Zu finden auf www.test.de/studienbeginn.<br />
Auf der Homepage www.rabatte.unicum.<br />
de gibt es hilfreiche Informationen zum<br />
Thema „Gut und günstig im Studium“. Dort<br />
kann man sogar Hotels finden, bei denen<br />
man sich für einen Euro am Frühstücksbuffet<br />
satt essen kann.
Seite 18 Eindruck<br />
Hooters <strong>Berlin</strong><br />
Das Auge isst mit<br />
D<br />
as Auge isst mit, wie es schon<br />
auf der Speisekarte des 2009<br />
eröffneten Hooters Restaurants<br />
am <strong>Berlin</strong>er Tiergarten heißt. Damit<br />
ist gewiss nicht die ästhetische<br />
Aufbereitung der Speisen gemeint,<br />
sondern vielmehr das Umfeld,<br />
in dem das typisch amerikanische<br />
Essen genossen wird.<br />
Das erste in Deutschland eröffnete Restaurant<br />
der US amerikanischen Kette Hooters<br />
wurde in Neunkirchen im Saarland angelegt,<br />
passenderweise nahe der amerikanischen<br />
Air Base. Das <strong>Berlin</strong>er Hooters hat<br />
sich hingegen mit einem angehängten Biergarten<br />
„eingedeutscht“.<br />
Foto: Maximilian Fritz<br />
Unschwer zu erkennen: Unsere Bedienung hieß Caro.<br />
Beim Betreten der Sports-Bar werden wir<br />
auf Englisch begrüßt, was ich in einem<br />
amerikanischen Restaurant sehr schätze.<br />
Die Begrüßung ist zudem dem internationalen<br />
Publikum angepasst. Das Ambiente ist<br />
ohne Veränderung aus den USA übernommen<br />
worden. An der Wand: Große amerikanische<br />
Verkehrsschilder, Neon-Werbe-<br />
Leuchten, Bilder von Stars und den<br />
Hooters-Girls und Fernseher auf denen<br />
Sport übertragen wird. Es wird laut Chart-<br />
Musik gespielt und auf den Tischen stehen<br />
sogenannte Bier-Pints (0,568 Liter). Dazwischen<br />
wuseln die immer gut gelaunten Bedienungen<br />
im einheitlichen knappen<br />
Hooters-Dress mit weißen Tank Tops und<br />
Hot Pants in dem bekannten Hooters-<br />
Orange.<br />
„Hi, ich bin Caro, euer Hooters-Girl für heute.“<br />
Sie schreibt ihren Namen auf den<br />
Bestellungs-Block und legt uns den Zettel<br />
auf den Tisch. Das Prinzip ist simpel aber<br />
effektiv. Der klischeehafte Männerwunsch<br />
nach Bier, Baseball und Busen bewegte sechs<br />
Amerikaner 1983 in Florida zur Gründung<br />
von Hooters, das bis heute mit 460 Restaurants<br />
in 27 Ländern vertreten ist. Weltweit<br />
wird dieselbe Erfolgsstrategie verfolgt: Mit<br />
dem Gast auf Tuchfühlung gehen. Der Restaurantname<br />
bedeutet umgangssprachlich<br />
einerseits Eule, die auch das Logo ziert, und<br />
andererseits ist Hooters ein Begriff für die<br />
Oberweite der Frauen. Die weiblichen<br />
Reize der Hooters-Girls sind unter anderem<br />
in unternehmensinternen Magazinen,<br />
Kalendern und Miss-Wahlen zu betrachten.<br />
Als Vorspeise wähle ich Sellerie-Karotten-<br />
Sticks mit Dip, die für ein gutes Gewissen<br />
vor den reichhaltigen Hauptspeisen sorgen.<br />
Vorsichtig bestelle ich die Chicken Wings<br />
mit dem Schärfegrad „Medium“. Wer einmal<br />
hier gegessen hat, weiß, dass der<br />
höchste der fünf Schärfestufen „911 Hot“<br />
eindeutig unter „Mutprobe“ einzuordnen<br />
ist. Die Chicken Wings sind etwas trocken,<br />
aber auf angenehme Weise knusprig. Leider<br />
habe ich vergessen den extra Wing-Dip zu<br />
bestellen, ohne den das Gericht etwas fade<br />
ist. Hierauf hätte mich jedoch auch die Bedienung<br />
aufmerksam machen können, die<br />
allgemein zwar sehr freundlich, aber auch<br />
unaufmerksam war. Die Spare Ribs hingegen<br />
sind mit einer saftigen Barbecue-Soße<br />
und Curley Fries zu empfehlen. Curley<br />
Fries sind zu einem Wirbel gedrehte<br />
Pommes Frittes, eine in Deutschland noch<br />
nicht sehr verbreitete Pommes-Variation,<br />
was definitiv nachzuholen ist. Die Portionen<br />
sind groß und nicht überteuert. Die<br />
billig wirkenden Küchenrollen, welche auf<br />
jedem Tisch als Serviertenersatz stehen,<br />
sind dringend notwendig, denn selbst Knigge<br />
sagt: Hähnchen isst man mit den Händen.<br />
Während des Essens wechselt die Beschallung<br />
zwischen unterhaltender Musik zu<br />
Sport-Reportern, die ein aktuell übertragenes<br />
Spiel kommentieren. Hin und wieder<br />
wird die Musik laut aufgedreht, wozu die<br />
wie Cheerleader gekleideten Bedienungen<br />
einen einstudierten „Klatsch-Hüpf-Tanz“<br />
aufführen um die Stimmung zu heben. Dabei<br />
wird klar, dass das Corporate Image der<br />
Hooters Filialen auf eine vorwiegend jüngere<br />
männliche Zielgruppe abgestimmt<br />
scheint, wohingegen in den US-Ketten auch<br />
viele Frauen und Familien anzutreffen sind.<br />
Die etwas irritierende Toiletten-Beschilderung<br />
„Most Men“ und „All Women“ kann<br />
scherzweise so interpretiert werden, dass<br />
das Lokal nichts dagegen hat, wenn auch<br />
mal Männer zusammen mit einer Frau auf<br />
der Damentoilette verschwinden. Dort, so<br />
habe ich es mir sagen lassen, finden sich im<br />
Waschbecken jedoch verloren gegangene<br />
Haare der Hooters-Girls wieder.<br />
Ein letztes Mal rumpelt die S-Bahn über<br />
unsere Köpfe hinweg und nachdem Caro<br />
fertig getanzt hat, lassen wir die Rechnung<br />
kommen. Diese wird mit Schnörkeln und<br />
einem Herzchen verziert überreicht in<br />
dem Wissen, dass das Trinkgeld entsprechend<br />
großzügig ausfallen wird. Alles in<br />
allem ist diese Art von Erlebnis-Gastronomie<br />
„Geschmacksache“, jedoch bin ich mir<br />
nach diesem Abend sicher, wo ich den<br />
nächsten Super Bowl verfolgen werde.<br />
Maximilian Fritz<br />
Hooters <strong>Berlin</strong><br />
S-Bahn Haltestelle Tiergarten<br />
Straße des 17. Juni 131<br />
Telefon (030) 310 17 011<br />
www.hooters-berlin.de
Eindruck<br />
Interessantes über den Alten St.-Matthäus-Kirchhof<br />
Ein Friedhof der<br />
besonderen Art<br />
D<br />
ass der Alte St.-Matthäus-<br />
Kirchhof im <strong>Berlin</strong>er Stadtteil<br />
Schöneberg Ungewöhnliches<br />
verbirgt, erkennt man auf den ersten<br />
Blick nicht. Stutzig wird man<br />
trotzdem, wenn einem bewusst<br />
wird, dass das Häuschen links neben<br />
dem Tor des Haupteingangs<br />
ein Café, das finovo, beherbergt.<br />
Bei Kaffee und Kuchen ist es hier<br />
möglich, gemütlich auf dem Friedhofsareal<br />
zusammen zu sitzen und<br />
über Gott, die Welt sowie den einen<br />
oder anderen verstorbenen<br />
Liebling zu reden.<br />
Dieser Kirchhof hat eine alte Geschichte:<br />
1856 gründete die evangelische St.-Matthäus<br />
Kirchengemeinde ihre Begräbnisstätte.<br />
Mit den Jahren ließen sich nicht nur Mitglieder<br />
der Gemeinde hier beerdigen, sondern<br />
auch „Außenstehende“, wodurch er<br />
erweitert werden musste. Zudem konnte<br />
die Kirchengemeinde Anfang des 20. Jahrhunderts<br />
eine neue Kirche im italienischen<br />
Renaissance- und Barockstil errichten lassen,<br />
die sich auch heute noch in der Nähe<br />
des Haupteingangs befindet.<br />
Auch die Auswirkungen des Dritten Reiches<br />
machten vor dem Kirchhof nicht Halt.<br />
Ein Drittel der Ruhestätten wurden<br />
1938/39 zerstört und sollten Albert Speers<br />
Visionen weichen, da er für die Welthauptstadt<br />
Germania eine überdimensionale Autobahn<br />
plante. Das Ende des Krieges vereitelte<br />
diesen Plan. Trotzdem wurden<br />
aufgrund des Vorhabens zahlreiche Gräber<br />
versetzt.<br />
Foto: Maximilian Fritz<br />
Die Skulptur für die „Sternenkinder“ hat Thekla Furch gestaltet.<br />
Auf dem Friedhof befindet sich auch ein<br />
Gedenkstein für die verstorbenen Widerstandskämpfer<br />
in der NS-Zeit. Der Name<br />
Claus Schenk Graf von Stauffenberg fällt<br />
einem sofort ins Auge. Ihm wird ein besonderes<br />
Schicksal, verbunden mit dem St.-<br />
Matthäus-Kirchhof, zuteil: Nach seiner Exekution<br />
wurde er auf dem Firedhof begraben,<br />
aber kurz nach der Beerdigung von Nationalsozialisten<br />
wieder ausgegraben und an<br />
einen unbekannten Ort versetzt.<br />
Gräber bekannter Persönlichkeiten kann<br />
man auch auf dem Friedhof entdecken. Bei<br />
näherem Betrachten liest man Namen von<br />
Dichtern vorangegangener Jahrhunderte,<br />
aber auch von bekannten Künstlern. Die<br />
wohl prominentesten Literaten, die auf<br />
dem Alten St. Matthäus Kirchhof ihre letzte<br />
Rufe fanden, sind die Gebrüder Grimm, Jacob<br />
(1785-1863) und Wilhelm (1786-1859).<br />
Aber auch Friedrich Adolf Wilhelm Diesterweg<br />
(1790-1866), dessen Nachname auf<br />
vielen Grundschullehrbüchern erscheint,<br />
wurde auf dem Kirchhof beerdigt, genau so<br />
wie Friedrich Drake (1805-1882), ein Bildhauer,<br />
der die Viktoria auf der <strong>Berlin</strong>er Siegessäule<br />
erschuf, und Prof. Dr. Rudolf<br />
Virchow (1821-1902), der als Begründer<br />
der modernen Pathologie gilt.<br />
Ungewöhnlich mutet auch an, dass der<br />
„Denk mal positHIV“-Verein eine Grabpatenschaft<br />
übernommen hat und somit die<br />
Möglichkeit schuf, dass Schwule gemeinsam<br />
in einer Grabstelle ihre letzte Ruhe finden.<br />
Hier wurden schon einige, zum Teil auch<br />
sehr junge Homosexuelle beerdigt.<br />
Aufmerksamkeit muss man auch einer<br />
Seite 19<br />
Skulptur von Thekla Furch widmen. Das<br />
Kunstwerk ist Teil des Projekts „Sternenkinder“<br />
und befindet sich auf der Begräbnisanlage<br />
für Totgeburten und Föten. Hier<br />
haben Eltern die Möglichkeit, ihren verstorbenen<br />
Kindern eine Ruhestätte zu geben,<br />
da Totgeburten oder Föten nach deutschen<br />
Richtlinien grundsätzlich nicht beerdigt<br />
werden müssen.<br />
Möglich wird dies durch den EFEU e.V. Der<br />
gemeinnützige Verein kümmert sich um die<br />
Erhaltung und Pflege des Friedhofs, bietet<br />
u. a. Führungen an und schafft durch die<br />
Zusammenarbeit mit dem Café finovo einen<br />
Ort der Zusammenkunft, da die oberen<br />
Räume des Cafés für Beisetzungsfeiern,<br />
Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt<br />
werden können. Eine weitere Aufgabe vom<br />
EFEU e.V. ist die Vermittlung von Grabpatenschaften.<br />
Der Verein sucht Paten, die<br />
sich um den Erhalt einer Ruhestätte kümmern.<br />
Dafür können sie diese beim Todesfall<br />
als eigene Grabstelle nutzen. Auf dem<br />
Kirchhof lassen sich einige verfallene Grabanlagen<br />
entdecken. Mausoleen säumen die<br />
Wege durch die Grabmäler, die heute<br />
durch ihre Größe und kunstvolle Verzierungen<br />
auf ein einst prächtiges Aussehen<br />
verweisen. Viele haben jedoch einen hohen<br />
Restaurierungsbedarf, sodass mit etwa<br />
100.000 Euro Aufwand gerechnet werden<br />
muss. Auf dem Kirchhof gibt es imposante<br />
Wandgräber, die durch kunstvolle Gitter<br />
voneinander abgegrenzt werden, aber auch<br />
kleinere, nicht minder künstlerische Grabstätten,<br />
die zeigen, wie schöpferisch und<br />
kreativ Ruhestätten aussehen können.<br />
Nicht nur diese originellen Grabmäler lassen<br />
den Alten St.-Matthäus-Kirchhof als ungewöhnlichen<br />
Friedhof erscheinen.<br />
Wenn man nach einem Rundgang über den<br />
Friedhof zum Haupteingang wieder zurückkehrt,<br />
passiert man unweigerlich das Café<br />
finovo. Ein Friedhofs<strong>ca</strong>fé. Es ist untypisch,<br />
ungewöhnlich, aber eins ist es nicht: unpassend.<br />
Annalena Jung
Seite 20<br />
Schwule im Profifußball<br />
„Randgruppe“ im<br />
Mainstream<br />
E<br />
s ist eine der meist diskutierten<br />
Fragen im deutschen<br />
Fußball: Hat man als Homosexueller<br />
eine Chance, im<br />
Profifußball zu existieren und<br />
kann man es wagen sich zu outen?<br />
Der Deutsche Fußball Bund<br />
(DFB) und allen voran dessen<br />
Präsident Dr. Theo Zwanziger<br />
setzen sich für Toleranz gegenüber<br />
Homosexuellen ein. Jedoch<br />
gibt es auch Bedenken und verschiedene<br />
Meinungen auf Seiten<br />
der Trainer und Verantwortlichen.<br />
Zwanziger beschäftigt sich immer wieder<br />
mit dem Thema der sexuellen Orientierung<br />
im Fußball. Er stellte in seiner Rede vor<br />
dem Völklinger Kreis klar, dass die Würde<br />
eines jeden Menschen unantastbar sei. Es<br />
sei die Aufgabe der Zivilgesellschaft, zu der<br />
Fußball zweifellos gehöre, das deutlich zu<br />
machen. Fußball sei in Deutschland und der<br />
ganzen Welt sehr populär. Zwanziger führte<br />
weiter aus, dass neben dem sportlichen<br />
Vergnügen auch gesellschaftliche Beiträge<br />
geleistet werden müssten. Er nannte Beispiele,<br />
wie die Weltmeisterschaften 1954<br />
und 2006, die große gesellschaftliche Fortschritte<br />
in Deutschland gebracht hätten.<br />
Der Sieg der Weltmeisterschaft 1954 hätte<br />
ein neues Wir-Gefühl gebracht und ein<br />
neues Vertrauen in der schweren Nachkriegszeit<br />
herbeigeführt. Die Weltmeisterschaft<br />
2006 hätte in Deutschland ein neues<br />
Klima geschaffen und ein positives Bild im<br />
Ausland erzeugt. Wenn man als Fußballer<br />
solch eine Weltmeisterschaft im eigenen<br />
Land feiert, komme die Überlegung: Was<br />
kann für die Gesellschaft auch im Blick auf<br />
Toleranz und Akzeptanz getan werden?<br />
In den 1990er Jahren wäre man zur Einsicht<br />
gekommen: „Wenn man stark ist,<br />
muss man auch an die Schwächeren denken.“,<br />
so Zwanziger. Erste Projekte zur sozialen<br />
Verantwortung seien entstanden.<br />
1998 sei die Satzung des DFB erweitert<br />
worden. Der Verband trete entschieden jeder<br />
Art von Diskriminierung entgegen.<br />
Dies hätte nichts damit zu tun, dass man<br />
Politik machen wolle, aber der Sport müsse<br />
sich weiterentwickeln. Es ginge nicht darum,<br />
eine heile Welt auszurufen, sondern<br />
die Einstellung des DFB preiszugeben. Fußball<br />
sei sehr medienpräsent, es gebe also<br />
eine Chance einen Veränderungsprozess<br />
mitzugestalten. Jeder solle Fußball spielen<br />
können, Jungen und Mädchen egal welcher<br />
Religion, Hautfarbe oder sexueller Orientierung.<br />
Man könne durch Projekte, Kommunikation<br />
und klare Orientierung manche<br />
Tabus relativieren und mit der Zeit sogar<br />
verschwinden lassen, so Zwanziger. In den<br />
letzten Jahren habe man den Trainern und<br />
jedem der Verantwortlichen klar gemacht,<br />
dass sexuelle Orientierung nie ein Merkmal<br />
oder Kennzeichen für Ausgrenzung sein<br />
dürfe. Ein entsprechender Prozess würde<br />
auch allmählich voran schreiten, jedoch sei<br />
man noch nicht am Ende. Im Amateurbereich<br />
sei Homosexualität kein großes Thema<br />
mehr, im Profibereich aber sei die Situation<br />
äußerst schwierig.<br />
Zudem meldete Zwanziger Bedenken an,<br />
die er an zwei Überlegungen fest mache.<br />
Die erste stimme ihn sehr nachdenklich,<br />
Foto: David Koch<br />
Stolz vor Gleichberechtigung?<br />
Eindruck<br />
wenn sie richtig sei, denn nach mehreren<br />
Gesprächen halte er es für möglich, dass es<br />
im Profifußball mit Sicherheit nicht viele<br />
schwule Spieler geben würde, da diese gar<br />
nicht soweit kommen würden. Denn neben<br />
außergewöhnlichem Talent brauche man in<br />
der Regel einen freien Kopf. Er könne sich<br />
vorstellen, dass, wenn man ein junger, hoch<br />
talentierter, aber schwuler Fußballspieler<br />
sei, die Jahre des Versteckspiels viel Kraft<br />
kosten würden. Diese Kraft könnte fehlen<br />
um die erste Geige im Profisport zu spielen.<br />
Dadurch wiederum würde Talent verloren<br />
gehen, das man gut gebrauchen könne.<br />
Zweitens: Wenn es wirklich homosexuelle<br />
Profis gibt, so führte Zwanziger weiter aus,<br />
befinden die sich auch in einem Team aus<br />
den unterschiedlichsten Kulturen. Bei manchen<br />
dieser Kulturen sehe man Homosexualität<br />
allerdings eher kritisch. Außerdem<br />
könne der Trainer noch so tolerant sein<br />
und bei einem Coming-Out helfen, am<br />
Ende zähle nur der Erfolg der Mannschaft.<br />
Wer möchte schon seine Karriere aufs<br />
Spiel setzen oder verantwortlich sein, wenn<br />
das Team nach dem Outing nicht mehr<br />
funktioniere? Das alles sei mit einzukalkulieren.<br />
Doch der Verband stehe zu dem, was er<br />
formuliert habe. Man orientiere sich in die<br />
richtige Richtung, brauche aber Zeit, um<br />
alle Beteiligten nicht zu überfordern. Ein<br />
DFB-Präsident könne kein Coming-Out<br />
herbeiführen, sondern nur das Signal senden,<br />
dass Homosexuelle nicht aussortiert<br />
würden. Es sei auch eine Aufgabe für spätere<br />
Generationen, weil aufzeigt werden<br />
müsse, dass das menschliche Miteinander<br />
nicht von der sexuellen Orientierung abhängig<br />
sei.<br />
Bekannte Trainer wie Felix Magath oder<br />
Jürgen Klopp sagen zu der Frage, ob denn<br />
die Bundesliga reif für Outings sei, folgendes:<br />
Magath: „In unserer Gesellschaft hat man<br />
es schwer, wenn man anders ist. Wir neigen<br />
dazu, Dinge aufzubauschen. Es gehört sehr<br />
viel Mut dazu, sich zu etwas zu bekennen.“
Eindruck Seite 21<br />
Klopp: „Unsere Gesellschaft ist schon lange<br />
bereit für Outings. Nur unser Fußball nicht!<br />
Was für Geschichten würden auch in den<br />
Medien entstehen, wenn sich der erste<br />
Spieler zu seiner Homosexualität bekennen<br />
würde. So etwas im Fußball sozialvertäglich<br />
zu äußern, das geht meiner Meinung<br />
noch nicht.“<br />
Aber vor nicht allzu langer Zeit gab es noch<br />
ganz andere Meinungen zum Thema Homosexualität<br />
im Profifußball. Im Jahr 2008<br />
sagte Christoph Daum, damals noch Trainer<br />
des 1. FC Köln, er hätte wirklich Bedenken,<br />
wenn von Theo Zwanziger irgendwelche<br />
Liberalisierungsgedanken einfließen<br />
sollen. Er würde den Schutz der Kinder<br />
über jegliche Liberalisierung stellen. Damit<br />
brachte er Homosexuelle in Verbindung<br />
mit Kindesmissbrauch. Beispiele für Homophobie<br />
gab es schon früher. Der ehemalige<br />
Libero des 1. FC Köln, Paul Steiner (von<br />
1981 bis 1991), fasste den verbreiteten Tenor<br />
in den achtziger Jahren so zusammen:<br />
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schwule<br />
Fußball spielen können.“ 1982 wurde in<br />
England Justin Fashanu von seinem Coach<br />
bei Nottingham Forrest beschimpft und<br />
vom Platz gestellt, nachdem er erfahren<br />
hatte, dass er schwul ist. Als erster und bislang<br />
einziger homosexueller Fußballprofi<br />
outete sich Fashanu 1990, und verkaufte<br />
seine Geschichte für 80.000 Britische Pfund<br />
an eine englische Boulevardzeitung. Acht<br />
Jahre später erhängte er sich in einer Londoner<br />
Garage. Er ertrug die Beleidigungen<br />
nicht mehr.<br />
Nur langsam setzte in den folgenden Jahren<br />
ein Umdenken ein. Der kroatische Fußballtrainer<br />
Otto Baric wurde als Erster wegen<br />
Homophobie vom europäischen Fußballverband<br />
Uefa verurteilt. „Ich sage das, was<br />
viele denken: Ich werde niemals einen<br />
Schwulen in meinem Team spielen lassen”,<br />
so äußerte sich Baric 2007 und musste<br />
3000 Schweizer Franken Strafe zahlen.<br />
Nach Meinung des FC St. Pauli- Präsidenten<br />
Corny Littmann wird Homosexualität weiter<br />
ein Tabu-Thema bleiben. Er könne verstehen,<br />
dass sich schwule Fußball-Profis<br />
nicht outen wollen. Die Gefahr, dass sie an<br />
den Pranger gestellt werden, sei hoch. Littmann,<br />
selber schwul, meint, wenn sich<br />
plötzlich einer oute, werde ihm ewig anhängen,<br />
der erste schwule Fußballer der<br />
Bundesliga gewesen zu sein. Ob ein junger<br />
Mensch mit diesem Prädikat wohl rumlaufen<br />
wolle?<br />
David Koch<br />
Foto: Maximilian Fritz<br />
Beschimpfungen gehören im Stadion zum guten Ton
Seite 22<br />
Redaktionsbesuch bei der TAZ<br />
Eine etwas<br />
andere Zeitung<br />
E<br />
s ist Montag, 9:25 Uhr. Im tazpresso<br />
ist gerade nicht viel los.<br />
Es ist das hauseigene Café der taz,<br />
das von der Rudi-Dutschke-Straße<br />
aus einsehbar ist. Von dort aus<br />
kann die belebte Straße mit Menschen<br />
auf dem Weg zu ihrer Arbeit<br />
und Touristen, die vom nahen<br />
Checkpoint Charlie herüberkommen,<br />
beobachtet werden. Das tazpresso<br />
ist Sinnbild für enge Bindung<br />
zwischen Zeitung und<br />
Lesern, Schreibenden und zu Beschreibendem.<br />
Warum noch nicht soviel los ist, lässt sich<br />
vielleicht damit erklären, dass in wenigen<br />
Momenten die Redaktionssitzung der taz<br />
stattfindet. Ein Stockwerk über dem tazpresso<br />
befindet sich die Zeitung selbst. Es<br />
herrscht viel Bewegung. Die meisten machen<br />
sich in den Raum auf. Es dauert nicht<br />
lange, dann ist jeder Stuhl besetzt. Es ist erkennbar,<br />
dass hier kein Meeting von Bankern<br />
oder Managern vonstatten geht. Hier<br />
gibt es keinen Dresscode, die bunte Palette<br />
der Textilindustrie ist hier vertreten. Nachdem<br />
es einigermaßen still geworden ist, beginnt<br />
die Redaktionssitzung mit der Blattkritik<br />
der Zeitung vom Wochenende. Der<br />
Mitarbeiter, der für die heutige Blattkritik<br />
zuständig ist, geht die Zeitung von vorne<br />
nach hinten durch. Dabei scheint wichtig zu<br />
sein, dass die Artikel verständlich sind. Der<br />
Mitarbeiter macht keinen Hehl daraus,<br />
wenn er einen Artikel nicht verstanden hat<br />
und wenn ihm etwas nicht gefällt, doch er<br />
lobt auch das Positive, das Gelungene. Es<br />
wird die gesamte Zeitung bewertet und<br />
nicht nur der Teil, für den der Mitarbeiter<br />
selbst zuständig ist. Das verhindert einen<br />
„Tunnelblick“ und sorgt für eine objektivere<br />
Bewertung. Bei der Blattkritik wird<br />
nicht nur auf Inhalte geachtet, sondern<br />
auch auf Aufmacher, Überschriften, Bild,<br />
Unterzeilen und die Zuordnung von Fotos.<br />
Der Blattkritik folgt eine Diskussionsrunde,<br />
die anderen Redaktionsmitglieder kommentieren<br />
Teile der Zeitung vom Vortag<br />
aus ihrer Sicht. So entsteht eine Mischung<br />
aus Komplimenten, Kritik und Verbesse-<br />
rungsvorschlägen. Jeder darf seine Meinung<br />
sagen, keiner hält sich zurück. Der Chef<br />
vom Dienst erteilt jeweils das Wort, damit<br />
nicht alles durcheinander läuft. Es kristallisieren<br />
sich zwei größere Diskussionen heraus:<br />
Zum einen, ob die taz denn zu regional<br />
agiert. Was denken die Leser aus<br />
anderen Regionen über die Zeitung? Kommen<br />
die Inhalte auch außerhalb <strong>Berlin</strong>s an?<br />
Es wird gesagt, dass genauer darauf zu achten<br />
ist, um auch außerhalb der Region interessierte<br />
Leser zu erreichen und diese<br />
nicht mit zu vielen regionalen Artikeln zu<br />
konfrontieren. Die größte Diskussion jedoch<br />
gibt es zum Thema Onlineauftritt. Es<br />
wird kritisiert, dass nicht alle Artikel aus<br />
dem Printbereich online zu Verfügung stehen.<br />
Auch wird kritisiert, dass einige Beiträge<br />
zu wenig angeklickt werden. Es geht hin<br />
und her, es werden viele verschiedene<br />
Argumente gesammelt. Eine Redakteurin<br />
führt aus, die taz solle sich doch ein Beispiel<br />
an der New York Times nehmen, die nach einer<br />
Studie herausgefunden hat, dass man<br />
nicht nur nach den Klicks gehen kann, da<br />
interessierte Leser Artikel per mail weiter<br />
senden würden, um auch andere darauf<br />
aufmerksam zu machen. Außerdem wolle,<br />
so die Journalistin weiter, die taz doch gerade<br />
auch Minderheiten ansprechen. Wäh-<br />
Foto: Maximilian Fritz<br />
In der TAZ ist selbst das Chaos im Archiv Programm.<br />
Eindruck<br />
rend der Diskussion steht einer wütend auf<br />
und verlässt den Raum, um sich vor der Tür<br />
etwas lauter aufzuregen. Aus zeitlichen<br />
Gründen wird festgelegt, dass man eine extra<br />
Sitzung zum Onlineauftritt veranstalten<br />
will und man sich mit diesem Thema weiter<br />
beschäftigen muss.<br />
Am Ende werden die voraussichtlichen<br />
Themen der morgigen Zeitung von den<br />
verschiedenen Abteilungen vorgestellt. Es<br />
wird diskutiert was unbedingt rein muss,<br />
dazu in welcher Form oder ob man doch<br />
lieber etwas anderes nimmt. Dabei spielen<br />
schon konkrete Seitenzahlen eine Rolle<br />
und was kommentiert werden soll. Nachdem<br />
die Zeitung des kommenden Tages<br />
eine Inhaltsstruktur bekommen hat, wird<br />
die Sitzung beendet.<br />
Manche Sitzungsteilnehmer sieht man danach<br />
in dem jetzt immer voller werdenden,<br />
tazpresso. Es wird erst mal etwas getrunken<br />
oder gegessen und wohl noch ein wenig<br />
weiter diskutiert, bevor sie sich auf den<br />
Weg zum Arbeitsplatz machen, um ihren<br />
Teil der neuen taz mitzugestalten.<br />
David Koch
Eindruck Seite 23<br />
Prof. Dr. Bernhard Vogel im Gespräch<br />
Politisches<br />
Urgestein<br />
Prof. Dr. Bernhard Vogel<br />
Der Christdemokrat und promovierte Politikwissenschaftler<br />
Dr. phil. Bernhard Vogel<br />
(*19. Dezember 1932 in Göttingen) ist der<br />
einzige deutsche Politiker, der in zwei Bundesländern<br />
- Rheinland-Pfalz und Thüringen<br />
- Ministerpräsident war.<br />
Wie sein älterer Bruder Hans-Jochen, der<br />
bereits mit 34 Jahren sozialdemokratischer<br />
Oberbürgermeister von München wurde,<br />
und später gar zum SPD-Bundesvorsitzenden<br />
aufstieg, war auch Bernhard Vogel, der<br />
1960 in die CDU eingetreten war, ein politischer<br />
Frühstarter: mit 32 zog er in den<br />
Deutschen Bundestag ein, 1967 saß er mit<br />
gerade einmal 35 Jahren als Kultusminister<br />
im Landeskabinett von Rheinland-Pfalz. Da<br />
erst, so sagte er es der „Märkischen Oderzeitung“,<br />
habe er gewusst, „dass ich wohl<br />
dauerhaft in der Politik bleiben werde.“<br />
1976 beerbte Vogel, der bei Feind wie<br />
Freund als charmant, belesen, integer und<br />
glaubwürdig, dabei bisweilen aber auch als<br />
ungeduldig gilt, Helmut Kohl als Ministerpräsident.<br />
Als ihm seine Parteifreunde 1988<br />
bei einem Parteitag in Koblenz die Wiederwahl<br />
als CDU-Landeschef verweigerten,<br />
trat der Speyerer gedemütigt auch als Ministerpräsident<br />
von Rheinland-Pfalz zurück.<br />
Vier Monate nach seinem Sturz, im März<br />
1989, wurde er Chef der Konrad-Adenauer-<br />
Stiftung, 1992, die Anführer der innerparteilichen<br />
Revolte von Koblenz waren da<br />
schon längst vergessen, wurde Vogel Thüringer<br />
Landeschef. Ein Amt, mit dem er<br />
dann absolute Mehrheiten gewann, und das<br />
er 2004 an seinen Ziehsohn Dieter Althaus<br />
weitergab. Vogel gilt als „Arbeitstier“. Die,<br />
die ihn kennen, bescheinigen ihm Pflichtbewusstsein<br />
und Selbstdisziplin.<br />
Heute ist der passionierte Wanderer und<br />
Bergsteiger, Weinkenner und Zigarrenliebhaber<br />
Ehrenvorsitzender der Konrad-<br />
Adenauer-Stiftung, viel gefragter Zeitzeuge<br />
und er verfasst regelmässig Kolumnen für<br />
Zeitungen. Sein Motto lautet: „Was du tust,<br />
das tue klug und bedenke das Ende.“<br />
Holger Doetsch<br />
Foto: Maximilian Fritz<br />
Interview Bernhard Vogel<br />
Wenn sie jemandem begegnen würde,<br />
der keinerlei Ahnung von Politik<br />
hat, wie würden Sie ihm „Politik“<br />
erläutern?<br />
Politik ist, das Zusammenleben einer größeren<br />
Zahl von Menschen so zu ordnen,<br />
dass jeder seine Chance hat.<br />
Was sind für Sie Parteifreunde? Sind<br />
das richtige Freunde? Oder braucht<br />
man diese nur zur Umsetzung von<br />
Plänen?<br />
Parteifreunde sollen Menschen sein, die der<br />
gleichen Partei, wie man selber, angehören<br />
und mit denen man befreundet ist. Natürlich<br />
unterscheiden sich die Parteifreunde<br />
von Freundschaften außerhalb der Partei.<br />
Aber leider vor allem dadurch, dass der Begriff<br />
Parteifreund oft verwendet wird, wenn<br />
gar nicht Parteifreunde gemeint sind.<br />
Das heißt, man muss zwischen Parteifreunden<br />
und Freunden differenzieren?<br />
Man muss sich fragen, ob jeder, der sich als<br />
Parteifreund bezeichnet, auch tatsächlich<br />
ein Freund ist.<br />
Kann es auch parteiübergreifende<br />
Freundschaften geben?<br />
Ja, selbstverständlich. Es kann konfessionsübergreifend,<br />
staatenübergreifend, parteiübergreifend,<br />
geschlechterübergreifend und<br />
generationsübergreifend Freunde geben.<br />
Können Sie uns einen Namen nennen<br />
für eine parteiübergreifende<br />
Freundschaft die sie pflegen oder<br />
gepflegt haben?<br />
Beispielsweise hat mich über Jahrzehnte<br />
eine herzliche Freundschaft mit Johannes<br />
Rau verbunden. Obwohl Johannes Rau nun<br />
wirklich ein eingefleischter und überzeugter<br />
Sozialdemokrat war und ich mich<br />
von früher Jugend an den Zielen der CDU<br />
verbunden gefühlt habe.<br />
Warum sind Sie in die Politik gegangen<br />
– was waren Ihre Ziele und Wünsche?<br />
Ich habe zu keinem Tag beschlossen in die<br />
Politik zu gehen. Sondern der erste Schritt<br />
war, dass ein mit mir befreundeter KFZ-<br />
Meister in Heidelberg mich gewonnen hat,<br />
für den Heidelberger Stadtrat zu kandidieren.<br />
Nach der Zusage hat das bedeutet,<br />
dass ich der Partei, für die ich kandidiert<br />
habe, der CDU, auch beigetreten bin. Kein<br />
Mensch, am wenigstens ich selber, hat mit<br />
der Bereitschaft zur Stadtratskandidatur<br />
den Beschluss, ganz in die Politik zu gehen,<br />
vermutet. Ein paar Jahre später kamen Leute<br />
die mich von einem sozialen Seminar her<br />
kannten und sagten: „Wir suchen einen<br />
Bundestagskandidaten, wären sie nicht bereit?<br />
Sie halten immer so gute Reden über<br />
soziale Marktwirtschaft und christliche Soziallehre,<br />
haben sie nicht Lust zu kandidieren?“<br />
Nach einigem Überlegen habe ich<br />
gesagt: „Ach ja, vier Jahre könnte man praktische<br />
Erfahrung sammeln, bevor man wieder<br />
zurückkehrt zu der Absicht in der<br />
politischen Wissenschaft eine Habilitationsschrift<br />
zu schreiben.“ Auch da habe ich<br />
nicht entschieden in die Politik zu gehen.<br />
Dann bin ich nach ein paar Jahren aufgefordert<br />
worden Kultusminister in Rheinland-<br />
Pfalz zu werden. Das hat mich natürlich<br />
gereizt, damals mit 34 Jahren. Das war eine
Seite 24 Eindruck<br />
Chance die man nicht ohne weiteres wieder<br />
bekommt und ich habe zugesagt. Da<br />
hat mir dann langsam gedämmert, dass die<br />
Politik mein Beruf werden würde. Aber um<br />
es noch mal zu sagen, ich habe nie den Entschluss<br />
gefasst, Politiker zu werden.<br />
Hat Sie damals Helmut Kohl gefragt,<br />
ob sie für den Bundestag kandidieren<br />
wollen?<br />
Nein. Das wird immer wieder gerne erzählt.<br />
Weil es einmal irgendwer erzählt hat,<br />
schreiben es alle ab. Ich kannte Helmut<br />
Kohl aus der Studentenzeit. Er hatte etwas<br />
andere Schwerpunkte in den Studienfächern<br />
als ich. Aber wir waren gemeinsam,<br />
über mehrerer Semester, in einem Seminar<br />
von Dolf Sternberger. Da haben wir uns näher<br />
kennengelernt. Es ist richtig, dass, als<br />
die Speyerer und Neustädter, der pfälzische<br />
Teil von Rheinland-Pfalz, kamen und mich<br />
nach der Bereitschaft zur Bundestagskandidatur<br />
gefragt haben, sagten: „Wir müssen<br />
allerdings auch noch Helmut Kohl fragen.“<br />
Aber die Idee zu dieser Kandidatur ging damals<br />
von anderen aus.<br />
Warum haben sie sich für die CDU<br />
als ihre Partei entschieden und ihr<br />
Bruder Hans-Jochen für die SPD?<br />
Eine ebenso häufig gestellte, wie relativ einfach<br />
zu beantwortende Frage. Die Erklärung<br />
liegt nicht in unserem Elternhaus begründet,<br />
sondern in der Zeitgeschichte.<br />
Mein Bruder, der sieben Jahre älter ist als<br />
ich, war noch gezwungen in den letzten beiden<br />
Jahren des zweiten Weltkriegs teilzunehmen.<br />
Er kam aus dem Zweiten Weltkrieg<br />
1945 mit 19 Jahren zurück. Er war<br />
damals beeindruckt von dem, in der Tat beeindruckenden,<br />
Kurt Schumacher, dem Vorsitzenden<br />
der Sozialdemokratischen Partei<br />
in Deutschland, der im Krieg und im KZ<br />
ungeheuer gelitten hatte, und eine beispielgebende<br />
Figur gewesen ist, in der Situation<br />
des totalen Zusammenbruches des Deutschen<br />
Reiches. Ich bin zum Nachdenken<br />
über Politik und Geschichte Jahre später<br />
gekommen, nämlich in der Schule, als Konrad<br />
Adenauer bereits deutscher Bundeskanzler<br />
war. Sein Weg der Westintegration<br />
und der Sozialen Marktwirtschaft hat mich<br />
beeindruckt, seine Persönlichkeit hat mich<br />
begeistert. Außerdem bin ich in einer katholischen<br />
Schülergemeinschaft aufgewachsen,<br />
bei der die katholische Soziallehre eine<br />
große Rolle gespielt hat. Diese war auch bei<br />
der Gründung der CDU von Bedeutung.<br />
Deshalb war mir klar, dass, wenn ich einer<br />
Partei beitreten würde, für mich nur die<br />
CDU in Frage käme.<br />
Streiten Sie sich mit Ihrem Bruder<br />
über politische Fragen? Und stimmt<br />
es, dass Ihre Mutter Ihnen beiden<br />
verboten hat, zu Hause über Politik<br />
zu streiten?<br />
Zunächst hat die Tatsache, dass mein Bruder<br />
in die SPD eintrat und ich in die CDU,<br />
niemanden sonderlich aufgeregt. Man hat<br />
gedacht, der eine wird mal Rechtsanwalt,<br />
warum soll der nicht in der SPD sein, und<br />
der andere wird, wenn er es schafft, vielleicht<br />
mal Professor, warum soll der nicht<br />
in der CDU sein? Bedeutsam ist das erst<br />
geworden, als mein Bruder in sehr jungen<br />
Jahren Oberbürgermeister von München<br />
wurde, dies mit der Unterstützung der<br />
SPD, und ich ein paar Jahre später, als CDU<br />
Mitglied, Kultusminister von Rheinland-<br />
Pfalz. Da hat die Öffentlichkeit erstmals von<br />
dieser Tatsache Notiz genommen. Vorher<br />
hat das weder die Familie noch sonst wen<br />
sonderlich beschäftigt und aufgeregt. Wir<br />
haben dann, über Jahrzehnte, beide außerordentlich<br />
fordernde Aufgaben gehabt.<br />
Mein Bruder: Oberbürgermeister von<br />
München und <strong>Berlin</strong>, Bundesminister, Bundesvorsitzender<br />
der SPD, Kanzlerkandidat.<br />
Ich: Kultusminister und Ministerpräsident<br />
in Rheinland-Pfalz und Thüringen. Wir haben<br />
nicht wahnsinnig viel Zeit gehabt uns<br />
zu streiten und wenn wir uns bei Familienfeiern<br />
gesehen haben, dann haben wir uns,<br />
nicht weil unsere Mutter das angeordnet<br />
hätte, sondern mit Rücksicht auf unsere Eltern,<br />
vor allzu heftigem Streit zurückgehalten.<br />
Über Jahrzehnte haben wir wohl beide<br />
gemeint, der jeweils andere wird einsehen,<br />
dass er in der falschen Partei sei. Später hat<br />
sich diese Vorstellung gelegt, und wir haben<br />
begonnen zu respektieren, dass wir beide<br />
meinen, der jeweilige Bruder sei in der<br />
falschen Partei.<br />
In Rheinland-Pfalz haben Sie am 11.<br />
November 1988 nach dem Verlust<br />
der Parteiführung an Hans Otto<br />
Wilhelm Ihren Ministerpräsidentenposten<br />
abgegeben. Warum haben<br />
Sie das getan?<br />
Ich habe schon vor der entscheidenden<br />
Wahl auf dem Landesparteitag im November<br />
1988 erklärt, wenn ich nicht mehr das<br />
Vertrauen meiner Partei als Vorsitzender<br />
habe, dann kann ich auch nicht mehr Ministerpräsident<br />
des Landes sein. Man kann<br />
nicht mit zwei abgeschlagenen Armen führen<br />
und den Karren weiter ziehen. Dieser<br />
Überzeugung, der ich frühzeitig Ausdruck<br />
gegeben habe, bin ich auch danach treu geblieben.<br />
Man muss nicht Ministerpräsident<br />
und Parteivorsitzender sein. Wenn man<br />
aber, wie das bei mir der Fall war, beides<br />
war, muss zu Kenntnis genommen werden:<br />
Wenn die eigene Partei einen nicht mehr<br />
trägt kann dem Land nicht mehr gedient<br />
werden.<br />
Sie haben nach der Rücktrittsankündigung<br />
die Koblenzer Rhein-<br />
Mosel-Halle nach diesem Satz<br />
verlassen: „Gott schütze Rheinland-<br />
Pfalz!“. Dieser Ausruf ist oft interpretiert<br />
und auch fehlinterpretiert<br />
worden. Sagen Sie uns, was Sie damit<br />
genau gemeint haben?<br />
Zunächst ist es überraschenderweise in<br />
der Tat der Satz aus meinem politischen Leben,<br />
der am häufigsten zitiert wird. Dem<br />
entspricht nicht etwa eine grundsätzliche,<br />
lange Überlegung, so zu formulieren. Nach<br />
dem Bekanntwerden des Wahlergebnisses<br />
habe ich um das Wort gebeten und habe<br />
eine kurze Stellungnahme abgegeben. Ich<br />
habe noch einmal betont, dass ich vom Amt<br />
des Ministerpräsidenten, wie angekündigt,<br />
zurücktreten werde, und habe dann mit<br />
diesem Satz diese kurze Rede beschlossen.<br />
Dies geschah aus dem Stegreif. Interpretieren<br />
muss man den Satz, wenn man ihn richtig<br />
interpretieren möchte, so, dass ich<br />
immerhin fast 22 Jahre dem Rheinland-Pfälzischen<br />
Kabinett angehört habe, fast zehn<br />
Jahre als Minister und zwölf Jahre als Ministerpräsident,<br />
das heißt mich mit Haut und<br />
Haar, bei Tag und Nacht, für das Land engagiert<br />
habe und das dieses jähe, von mir so<br />
nicht erwartete, Ende in mir große Sorgen<br />
hinterlassen hat, wie es weiter gehen wird?<br />
Es war kein geplanter Abschied, es war ein<br />
mutwillig herbeigeführter und spontaner<br />
Abschied. Daraus ist diese Formulierung<br />
entstanden.<br />
Haben sie nach dem Rücktritt gedacht,<br />
dass ihre politische Karriere<br />
da vorbei ist?<br />
Selbstverständlich. Ich war damals 57 Jahre<br />
alt und dachte, dass es vorbei ist. Ich habe<br />
mich schließlich überzeugen lassen und für<br />
das Amt des Vorsitzenden der Konrad-<br />
Adenauer-Stiftung kandidiert, zudem ich<br />
auch gewählt worden bin. Ich habe natürlich<br />
auch mein Landtagsmandat mit dem<br />
Ministerpräsidentenposten niedergelegt.<br />
Wie ist man an sie heran getreten,<br />
um sie als Ministerpräsident von<br />
Thüringen zu gewinnen? Und hat es<br />
sie verwundert?<br />
Im Januar 1992 ist Thüringens Ministerpräsident<br />
Josef Duchac zurückgetreten. Die<br />
Thüringer CDU und Thüringen haben nach
Eindruck Seite 25<br />
einem neuen Ministerpräsidenten Ausschau<br />
gehalten. Es fielen eine ganze Menge von<br />
Namen, jeden Tag neue, darunter auch meiner,<br />
weil davon auszugehen war, dass ich<br />
eine gewisse Regierungserfahrung hatte<br />
und wusste, wie es geht, Ministerpräsident<br />
zu sein. Diese Erfahrung hatte Herr Duchac<br />
nicht in diesem Maße mitgebracht. Auf<br />
Grund dessen kamen Thüringer Christdemokraten,<br />
insbesondere der damalige Parteivorsitzende<br />
Willibald Böck, auf die Idee,<br />
mich zu fragen, ob ich bereit sei. Ich habe<br />
die Angelegenheit selbstverständlich mit<br />
dem Bundesvorsitzenden und Bundeskanzler<br />
Helmut Kohl besprochen, und bin an<br />
einem späten Sonntagabend in einem Telefonat<br />
zu dem Ergebnis gekommen, Nein, zu<br />
sagen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung stand<br />
vor völlig neuen Aufgaben, es schien plötzlich<br />
möglich, nicht nur in den neuen Bundesländern<br />
Bildungswerke einzurichten,<br />
sondern in ganz Osteuropa. Eine Vorstellung,<br />
die uns wenige Monate zuvor völlig<br />
utopisch erschienen war. Wir sind also zu<br />
dem Ergebnis gekommen, dass ich nicht<br />
nach Thüringen gehe. Am nächsten Morgen<br />
bin ich dann zu einer Besprechung mit der<br />
Leitung der Hanns-Seidel-Stiftung nach<br />
München gefahren, und bin dort sehr überrascht<br />
von den Gesprächspartnern empfangen<br />
worden. Diese sagten: „Im Radio<br />
hört man Sie gehen nach Thüringen und<br />
jetzt kommen sie hier her?“ Daraufhin<br />
sagte ich: „Nein, das hat sich erledigt, wir<br />
können unser Gespräch machen.“ Nachdem<br />
die Besprechung beendet war, sind wir<br />
in ein Wirtshaus gegangen. Dort hat mich<br />
dann ein Anruf erreicht aus dem Bundeskanzleramt.<br />
Die Führung der Thüringer<br />
CDU hatte sich bei dem Parteivorsitzenden<br />
eingefunden und sie seien zu dem Entschluss<br />
gekommen, dass man sich auf keine<br />
Foto: Holger Doetsch<br />
Lösung einigen könne, außer ich sei doch<br />
bereit mich zur Verfügung zustellen. Ich<br />
habe noch schnell die Suppe aufgegessen<br />
und bin dann nach Erfurt gefahren. In der<br />
Nacht hat die Parteiführung und die Fraktion<br />
beschlossen mich als Nachfolger vorzuschlagen.<br />
Dann musste noch der Koalitionspartner<br />
gewonnen werden, wir hatten<br />
damals eine Koalition mit der FDP. Das ist<br />
dann am nächsten Morgen gelungen, und<br />
am 5. Februar bin ich zum Ministerpräsidenten<br />
gewählt worden.<br />
Wie lange, haben sie gedacht, wird<br />
die DDR noch existieren, im Mai<br />
1989?<br />
Ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht,<br />
jedes Jahr einmal für ein paar Tage in die<br />
DDR zu fahren. Ich war der Meinung, ein<br />
deutscher Ministerpräsident, der natürlich<br />
alle westdeutschen Länder kannte, müsste<br />
auch die ostdeutschen Länder kennen. In<br />
den elf Besuchen, die ich gemacht habe,<br />
zwischen 1976 und 1988 hat sich schon<br />
eine deutliche Veränderung vollzogen. Am<br />
Anfang haben die Leute es nicht gewagt,<br />
mich zu grüßen. Sie kannten mich ja aus<br />
dem Fernsehen, insbesondere durch die<br />
Mainzer Fastnacht, was sie alle gesehen hatten.<br />
Beim letzten Besuch 1988 in Halle sind<br />
Leute gekommen und haben Autogramme<br />
erbeten. Man hat gemerkt es ändert sich<br />
was, aber dass ein paar Monate später die<br />
Mauer fallen würde, habe ich mir nicht vorstellen<br />
können.<br />
Nun ein paar persönliche Fragen zu<br />
ihrer Person. Haben sie sich manchmal<br />
mehr Privatleben gewünscht?<br />
Ich hätte mir das sehr gewünscht, aber sie<br />
müssen sehen, es gibt Situationen, bei denen<br />
heißt es: Ganz oder gar nicht! Sie kön-<br />
Interview in der Konrad Adenauer Stiftung. Prof. Dr. Vogel (hinten rechts) ist dort inzwischen Ehrenvorsitzender.<br />
nen nicht Privatleben haben wollen, und<br />
Ministerpräsident sein. Als Ministerpräsident<br />
haben sie ein minimales Privatleben,<br />
und wenn sie das nicht haben wollen, dann<br />
dürfen sie auch nicht Ministerpräsident<br />
werden.<br />
Was machen sie in ihrer Freizeit?<br />
Ich bin auch als Ministerpräsident jeden<br />
Sommer ins Hochgebirge gefahren zum<br />
Bergsteigen. Ich habe versucht, so oft es<br />
geht zu schwimmen, habe mitunter Skat gespielt<br />
und versucht, über Geschichte, Politik<br />
und deutsche Literatur einen Überblick<br />
zu behalten und einiges auch gelesen.<br />
Was erwarten Sie heute von jungen<br />
Menschen, die ihren Weg in die Politik<br />
gehen wollen?<br />
Zunächst möchte ich die junge Generation<br />
dazu aufrufen: Es lohnt sich, sich zu engagieren!<br />
Es lohnt, sich für andere zu engagieren! Das<br />
kann auf vielfältigster Weise geschehen, und<br />
ist auch in der Politik möglich. Sollte sich<br />
jemand dazu entscheiden, sich in der Politik<br />
zu engagieren, dann rate ich ihm oder ihr,<br />
einen Beruf zu erlernen, in den er oder sie<br />
jeder Zeit zurückkehren kann. Politik-machen<br />
darf nicht zur Abhängigkeit führen.<br />
Wer also in die Politik geht, sollte seine Unabhängigkeit<br />
bewahren, und nicht vor der<br />
Partei betteln müssen, ein weiteres Mal nominiert<br />
zu werden.<br />
2012 werden sie 80 Jahre alt. Was<br />
wünschen sie sich?<br />
Zwei Jahre vor meinem 80. Geburtstag<br />
wünsche ich mir, dass ich ihn erlebe.<br />
Und dann?<br />
Das wird man sehen.<br />
David Koch
Seite 26 Eindruck<br />
Blogs und Modetrends<br />
Das neue Sprachrohr<br />
der Mode<br />
I<br />
mmer mehr junge Menschen<br />
aus der gesamten Welt entdecken<br />
ihren inneren Drang Persönliches<br />
auf der eigenen Website<br />
preiszugeben. Unterstützt durch<br />
Fotos entsteht so ein modernes<br />
elektronisches Tagebuch: Ein Blog.<br />
Modeblogs sind eine spezielle Form und<br />
sehr beliebt bei jungen Modeinteressierten.<br />
Die Mode steht als Passion im Vordergrund.<br />
Dabei ist es dem Blogger selbst überlassen,<br />
in welcher Art und Weise er seine Leidenschaft<br />
für dieses Genre präsentiert. Es gibt<br />
viele Modeblogs, in denen die Blogger<br />
selbst im Rampenlicht stehen und tagtäglich<br />
über ihren eigenen Style, über ihre neuesten<br />
Shoppingerrungenschaften und über<br />
das berichten, was in der Modewelt gerade<br />
so Weltbewegendes passiert. Andere widmen<br />
sich nur dem Geschehen im weltweiten<br />
Modebusiness und lassen sich selbst<br />
außen vor, auch wenn ab und an ein Stylingpost<br />
dazwischen rutscht. Ansonsten wird<br />
über die internationalen Fashion Weeks<br />
vor und hinter den Kulissen berichtet, die<br />
neuen Kollektionen der Designer kritisiert<br />
und Modetrends ausführlich beschrieben.<br />
Streetstyle-Blogs, so heißt das Phänomen,<br />
wurden eigenmächtig dafür angelegt, dass<br />
Blogger auf der gesamten Welt Modeinteressierte<br />
und kleidungstechnische Paradiesvögel<br />
auf der Straße ablichten.<br />
Aber: Entstehen die Trends nun auf der<br />
Straße oder sind Stars die Urheber der<br />
Trends wie es uns die Modemagazine nach<br />
wie vor kundtun? Sind es nicht die Designer,<br />
die die Modetrends mit ihren saisonalen<br />
Entwürfen herauf beschwören? Wir<br />
blättern durch bekannte <strong>Zeitschrift</strong>en und<br />
bekommen so einen Eindruck, was die VIPs<br />
gerade in ihrem begehbaren Kleiderschrank<br />
hängen haben. Bei vielen Fashionistas,<br />
wie die weiblichen, konsumfreudigen<br />
Modebegeisterten auch genannt werden,<br />
setzt sofort ein „Haben-wollen-Gefühl“<br />
ein. Und so sind es letztendlich die Modemagazine,<br />
die aus Kate Moss eine Modeikone<br />
und aus Sienna Miller ein It-Girl<br />
machten. Wobei nicht vergessen werden<br />
darf, dass sich hinter dem Style der Stars<br />
ihre Stylisten verbergen. Diese wiederum<br />
sind mit den bekanntesten Designer per<br />
Du und kleiden ihre Stylingschützlinge mit<br />
deren Entwürfen ein. Das System aus Stars-<br />
Stylisten-Designer kann einen verwirren.<br />
Foto: Annalena Jung<br />
Eine Modebloggerin bei der Arbeit.<br />
Fakt bleibt, dass die Blogger nun die ersten<br />
Reihen der Fashion Shows besetzen. So sah<br />
man im September 2009 bei der<br />
Dolce&Gabbana-Show die beiden Blogger<br />
Bryanboy und Tommy Ton neben Anna Wintour<br />
sitzen. Die Redakteurin der deutschen<br />
Madame und der Chef von Saks Fifth Avenue<br />
mussten mit der zweiten Reihe vorlieb<br />
nehmen. Ungewohnt, denn diese sitzen eigentlich<br />
in der front row. Die Kritiker sind<br />
zunehmend keine ausgebildeten Modespezialisten<br />
mehr, sondern Blogger. Direkt in<br />
der ersten Reihe twittern und bloggen sie<br />
direkt, was sie gerade auf den Catwalks gesehen<br />
haben: es werden Farben beschrieben<br />
und Schnitte analysiert. Die Designer<br />
haben begriffen, wie wichtig die Blogger für<br />
ihr Unternehmen sein können. Sehr gute<br />
Werbung ohne Kosten: Es wird über die<br />
jeweiligen Shows gebloggt, die neuen Kollektionen<br />
online gestellt und weltweit können<br />
alle Modeinteressierten das Neueste<br />
von den Catwalks sehen. Und später in den<br />
Geschäften kaufen.<br />
Mary Scherpe von dem Streetstyle-Blog Stil<br />
in <strong>Berlin</strong> geht es um „Mut zur Auffälligkeit“<br />
wie sie in einem Interview mit der Süddeutschen<br />
Zeitung sagte. Sie sucht Leute auf der<br />
Straße, die kleidungstechnisch nicht der<br />
Norm entsprechen. Trends zu zeigen oder<br />
gar zu setzen, spielt keine Rolle, denn die<br />
Kreativität des Kombinierens von Kleidungsstücken<br />
steht im Vordergrund. Es<br />
wird Individualität und kein Modetrend gesucht.<br />
Die Streetstyleblogger präsentieren den<br />
Style auf den Straßen dieser Welt und die<br />
Hochglanzmagazine den Style der Stars.<br />
Die Modeinteressierten verfügen so über<br />
ein großes Kontingent, aus dem sie die Modetrends<br />
schöpfen können. Inspiriert von<br />
jungen Menschen aus der gesamten Welt,<br />
abgelichtet auf der Straße, können sie<br />
durch die Modemagazine blättern und sich<br />
wiederum von Stars abgucken, was ihnen<br />
gefällt.<br />
Und die Designer der großen Modehäuser?<br />
Die stehen nach wie vor ganz oben an der<br />
Modeernährungskette. Ihre Kollektionen,<br />
ihre Schnitte und Farben inspirieren die gesamte<br />
Modeindustrie. Ihre Kollektionen<br />
lassen die Modetrends heranwachsen, denn<br />
die Designer waren es schließlich, die die<br />
70er und 80er, die Röhrenjeans und Leggins<br />
revolutionierten. Und wer trägt sie? Alle<br />
Modeinteressierten, egal, ob Star oder<br />
„Streetstyler“.<br />
Annalena Jung<br />
Interessante Mode-Blogs:<br />
www.thesartorialist.blogspot.com<br />
www.lesmads.de<br />
www.stilinberlin.blogspot.com<br />
www.fashionpuppe.com<br />
www.zeitgeschmack.blogspot.com
Eindruck Seite 27<br />
Jungdesigner und Blogger Konstantin Siegel<br />
Blogs sind<br />
kein Ersatz<br />
D<br />
er 26-Jährige studiert Modedesign<br />
an der Hochschule<br />
für Technik und Wirtschaft <strong>Berlin</strong><br />
(HTW). Momentan vertreibt er<br />
erfolgreich selbst gestaltete T-<br />
Shirts und Leinwände.<br />
Konstantin, handelt es sich bei deinem<br />
Blog „fashion illustration“ um<br />
einen Modeblog – ich frage das deshalb,<br />
weil du doch nur deine gemalten<br />
Werke hochlädst?<br />
Ja, ich bezeichne ihn als Modeblog, obwohl<br />
ich keine Stylings oder ähnliches zeige. Meine<br />
Illustrationen, die ich hochlade, können<br />
z.B. Designern als Inspiration dienen.<br />
Warum stellst du sie online?<br />
Mein Blog ist ein neues Projekt von mir. Ich<br />
habe ihn seit Anfang des Jahres und er steht<br />
im Gegensatz zu meiner Homepage mit<br />
meinem kleinen T-Shirt-Label. Ich nutze<br />
meinen Blog als Übung und möchte zeigen<br />
was ich kann.<br />
„one illustration a day“ – wie kamst<br />
Du auf diesen Claim?<br />
Einer von meinen Kollegen hatte einen<br />
Blog, für den er täglich neue Stylinginspirationen<br />
hochgeladen hat. Und das war auch<br />
eine Idee von mir. Jeden Tag neue Illustrationen<br />
erschaffen, etwas Neues zeigen. Sie<br />
unterscheiden sich, weil ich jeden Tag anders<br />
gelaunt bin. Mal sind die Illustrationen<br />
bunt, manchmal eher eintönig.<br />
Du hast auf deinem Blog zwei Illustrationen<br />
von Alexander McQueen<br />
gestellt. Hat er dir als Designer etwas<br />
bedeutet?<br />
Oh ja, natürlich. Sein Selbstmord war ein<br />
Schock für die ganze Modewelt. Ich war<br />
traurig, hab es zuerst nicht geglaubt, aber<br />
überall stand: „McQueen ist tot!“. Durch<br />
die Bilder habe ich meine Trauer verarbeitet,<br />
es ist eine Widmung für ihn. Die beste<br />
Show, die er in meinen Augen gemacht hat,<br />
war, als ein Model in einem weißen Tüllkleid<br />
auf den Runway ging und zwei Roboter es<br />
mit Farbe besprühten. Das war etwas Besonderes<br />
für mich, weil in diesem Moment<br />
all meine Leidenschaften vereint waren: ich<br />
als Airbrusher, Graffitikünstler und die<br />
Mode. Ein Kunstwerk wird vor den eigenen<br />
Augen erschaffen. Toll.<br />
Was inspiriert dich?<br />
Ich nehme meine Inspirationen von überall<br />
her. Es sind meistens Kleinigkeiten, die man<br />
tagtäglich sieht, in der U-Bahn zum Beispiel…<br />
Wie sieht es aus mit der Unabhängigkeit<br />
der Blogger?<br />
Ich persönlich bin unabhängig, aber ich<br />
denke, man kann nicht unabhängig arbeiten,<br />
wenn man z.B. von Designern zu den Fashionshows<br />
eingeladen wird. Meinen Blog mache<br />
ich nicht aus kommerziellen Gründen.<br />
Die Leute klicken aus Eigeninitiative meinen<br />
Blog an, aber um tausende Klicks zu<br />
bekommen, braucht man viel Promotion.<br />
Nimm z.B. den Blog Les Mads - die werden<br />
durch einen Verlag unterstützt, und da<br />
denke ich nicht, dass sie tun können, was<br />
sie wollen.<br />
Foto: Maximilian Fritz<br />
Konstantin Siegel im Interview in der <strong>EMBA</strong>-Akademie.<br />
Sterben Modemagazine aus?<br />
Modemagazine wird es immer geben. Vielleicht<br />
wird die Auflage geringer, aber ich<br />
denke, dass ein Modemagazin wie die Vogue<br />
in ein paar Jahren sogar selbst einen Blog<br />
führen wird. Heute kann jeder überall online<br />
sein und ich denke, die Magazine werden<br />
darauf reagieren. Ich persönlich habe<br />
lieber ein Magazin in der Hand und halte<br />
nicht viel von Modeblogs. Vor allem nicht,<br />
wenn eine Dreizehnjährige meint, (Konstantin<br />
Siegel bezieht sich auf Tavi Gevinson – die<br />
Red.) sie muss die Fashionshows kommentieren.<br />
Sie ist einfach noch ein Kind und<br />
deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass<br />
sie so ein enormes Wissen hat. Sie müsste<br />
ein Ausnahmetalent sein, um so über Mode<br />
entscheiden zu können. Ich musste sieben<br />
Semester studieren, um urteilen zu können.<br />
Ist Tavi denn ein Ausnahmetalent?<br />
Ich weiß es nicht. Ihr Blog ist nichts besonderes,<br />
finde ich, sie wird einfach von allen<br />
Seiten gepusht. Ich halte nicht viel davon,<br />
wenn man aus Schnipseln von der Wendy<br />
und Vogue Collagen bastelt. Vielleicht<br />
schreibt sie es auch gar nicht selbst. Ich hätte<br />
mit 13 eine ganz andere Wortwahl verwendet;<br />
wundert mich überhaupt, warum<br />
Blogger so hoch gejubelt werden. Auch<br />
wenn Blogs preiswerter sind, sie sind kein<br />
Ersatz für Magazine.<br />
Wo siehst du dich in zehn Jahren?<br />
Was sind deine Ziele und Wünsche?<br />
Ich habe mich für diesen Weg aus reiner<br />
Überzeugung entschieden, und wie viel<br />
Geld ich dabei verdiene spielt keine große<br />
Rolle. Ob ich jetzt der Überflieger der<br />
deutschen Kunstszene werde oder ob ich<br />
weiterhin einen Undergroundblog führe, ist<br />
mir egal. Ich möchte davon leben und meine<br />
Familie ernähren können. Außerdem<br />
möchte ich freiberuflich arbeiten. So soll es<br />
sein.<br />
Annalena Jung<br />
Zu finden ist Konstantin im Internet unter den Adressen:<br />
www.kasdesign.de<br />
www.daily-illustration.blogspot.com
Seite 28 Eindruck<br />
Ein Blick hinter die Kulissen von Ulrich Meyers Akte<br />
Investigativer<br />
Journalismus<br />
D<br />
as Sendeformat Akte existiert<br />
bereits seit 16 Jahren,<br />
ein Urgestein also in der schnelllebigen<br />
Fernsehlandschaft. „Akte<br />
20.10 – Reporter kämpfen für Sie!“<br />
behandelt persönliche Schicksalsfälle<br />
und deckt Gesetzeswidrigkeiten<br />
auf, die ohne die Recherche<br />
der Akte-Redaktion wohl nie enthüllt<br />
worden wären.<br />
Foto: Holger Doetsch<br />
Dirk Klapperich (l.) erklärt einen Arbeitsplatz in der Redaktion.<br />
In <strong>Berlin</strong> Charlottenburg am beschaulichen<br />
Lietzensee befindet sich META-Productions,<br />
das von Akte-Moderator Ulrich Meyer gegründete<br />
Medien-Unternehmen. Unter<br />
dem Dach des Hauses der Kuno-Fischer-<br />
Straße 6 befinden sich die Redaktion,<br />
Schnitträume, Tonstudio, Regie und Archive<br />
mit 60.000 Bändern, hauptsächlich von der<br />
SAT.1-TV-Sendung Akte. Neben Akte werden<br />
dort auch andere Formate für das<br />
deutsche Fernsehen produziert, die ähnliche<br />
Themen behandeln. Es geht um Missstände,<br />
um Rat in kritischen Lebenssituationen,<br />
um Täter und Opfer und darum, die<br />
Verantwortlichen zur Rede zu stellen.<br />
Der stellvertretende Redaktionsleiter und<br />
Chef vom Dienst der Akte Redaktion Dr.<br />
Dirk Klapperich nahm sich persönlich die<br />
Zeit, uns über den Alltag in einer Redaktion<br />
aufzuklären. Die Produktion einer jeden<br />
Sendung beginnt mit der Themenfindung.<br />
Ulrich Meyer und sein Team diskutieren anfänglich<br />
in den Redaktionssitzungen darüber,<br />
was die Menschen in Deutschland bewegen<br />
könnte. Heute tragen die Zuschauer<br />
ihr Anliegen direkt an Akte. Täglich erhält<br />
die Redaktion mittlerweile bis zu 300 e-<br />
Mails, sowie unzählige Anrufe und Faxe von<br />
Anfragen mit der Bitte über ihre Problematik<br />
zu berichten. Zudem gibt es einen Not-<br />
ruf-Button auf der Akte-Website von SAT.1,<br />
bei der jeder der Redaktion sein Problem<br />
schildern kann.<br />
Die Masse an Anfragen wird einem kritischen<br />
Filter unterzogen, um letztlich drei<br />
bis vier interessante Themen heraus zu kristallisieren.<br />
Dabei kommen Themen in Frage,<br />
welche persönliche Schicksale behandeln<br />
wie „Meine Versicherung zahlt nicht“<br />
oder „Ich wurde durch Internet-Portale<br />
abgezockt“. Sehenswert sind hier vor allem<br />
die Ungerechtigkeiten, welche sich in Grauzonen<br />
bewegen und die vom Gesetzgeber<br />
nicht immer klar definiert sind. Des Weiteren<br />
sollte die Person, deren Schicksal<br />
dann verfilmt wird, medientauglich auftreten<br />
können. Die Sachlage muss zudem im<br />
Vorfeld so recherchiert sein, dass alle Fakten<br />
abgeklärt und Unterlagen vorhanden<br />
sind. Themen, die eine mehrwöchige Recherche<br />
benötigen, kann man sich in der<br />
Fernsehe-Branche schlichtweg nicht leisten,<br />
abgesehen davon, dass das Format jede<br />
Woche am Dienstag erscheint und für Recherchen<br />
daher weniger als sieben Tage<br />
Zeit bleibt. Ein arbeitsintensives Unterfangen<br />
bei drei festangestellten Redakteuren,<br />
einem Kameramann und wenigen Praktikanten<br />
zur Unterstützung der Recherche.<br />
Mehrmals konnten durch Akte-Reportagen<br />
essenzielle Hinweise zur Aufklärung von<br />
Straftaten geliefert werden, was zum Beispiel<br />
zur Aufklärung eines Falls über Kin-<br />
Foto: Holger Doetsch<br />
Wo im Fernsehen die Geschichten entstehen.<br />
derpornografie führte. Daher wird die Akte-Redaktion<br />
öfter von polizeilichen<br />
Behörden kontaktiert, wenn diese Entsprechendes<br />
aus Sendungen erfuhren. Eine direkte<br />
Zusammenarbeit lehnt die Polizei jedoch<br />
ab. Auch sei es äußerst schwierig, so<br />
die Akte-Redaktion, polizeiliche Informationen<br />
zu bestimmten Fällen zu erhalten,<br />
dies besonders bei der <strong>Berlin</strong>er Polizei.<br />
Da das Sende-Format Akte 20.10 stark auf<br />
das Umfeld von rechtlichen Streitereien<br />
ausgelegt ist, müssen die Reporter bei heiklen<br />
Themen mit Bodyguards und versteckten<br />
Kameras arbeiten. Auch Medienrecht<br />
wird bei META-Productions groß<br />
geschrieben. Ein heikles Thema, das schnell<br />
zu Klagen seitens derer führt, die vor der<br />
Kamera von Akte zu Rede gestellt werden.<br />
Deren Gesichter müssen daher unkenntlich<br />
gemacht und ihre Stimmen nachgesprochen<br />
werden. Die rechtliche Vorgehensweise<br />
und die ausgewählten Sende-<br />
Themen werden stets mit Hilfe von jährlichen<br />
internen Medienrechts-Schulungen,<br />
sowie einer Münchner Anwaltskanzlei<br />
überprüft.<br />
Denn wo der „normale“ Bürger seinen gesetzlichen<br />
Rahmen nicht kennt, helfen –<br />
dem Akte-Claim entsprechend – die Reporter<br />
weiter und kämpfen für Sie!<br />
Maximilian Fritz
Eindruck Seite 29<br />
Interview mit einem Schriftsteller<br />
Ein Buch entsteht<br />
E<br />
s gibt unendlich viele Bücher<br />
auf dieser Welt. Doch welche<br />
Arbeit steckt eigentlich hinter<br />
einem fertigen Buch? Wie geht ein<br />
Schriftsteller vor? Um diese Fragen<br />
klären zu können, haben wir<br />
mit Holger Doetsch, der bereits<br />
sein zweites Buch geschrieben<br />
hat, gesprochen.<br />
Es ist morgens kurz vor zehn Uhr, als wir<br />
die <strong>Berlin</strong>er Wohnung von Holger Doetsch<br />
betreten. Er hat uns auf eine Tasse Tee eingeladen,<br />
um unsere Fragen zu beantworten.<br />
Er führt uns in sein Arbeitszimmer und das<br />
erste, was in diesem Raum unsere Aufmerksamkeit<br />
auf sich zieht, ist das riesengroße<br />
Bücherregal. Es erstreckt sich fast<br />
von einem Ende des Raumes bis zum anderen.<br />
Alle Regalreihen sind lückenlos gefüllt<br />
mit Weltliteratur, Biografien, Büchern über<br />
Kunst und Kultur und vieles mehr. Krimis<br />
oder Thriller dagegen findet man dazwischen<br />
kaum. Kleine eingerahmte Fotos und<br />
Bilder hängen an den Regalbrettern oder<br />
stehen vor den Büchern. Aus fast jedem der<br />
Bücher ragen Zeitungsartikel, die etwas mit<br />
dem Inhalt oder dem Autor zu tun haben<br />
und zum Teil auch von Doetsch selber verfasst<br />
worden sind. Es ist also nicht nur eine<br />
Bibliothek, sondern auch ein Archiv. Am<br />
Ende des Raumes befindet sich ein großer<br />
Holzschreibtisch, sein Arbeitstisch, die<br />
Wände sind mit Kunstwerken, Fotos und<br />
anderen Erinnerungsstücken verziert, unter<br />
dem Fenster steht eine Couch. Wir<br />
nehmen jeder auf einen der vier im Raum<br />
verteilten Sessel Platz, Holger, nachdem er<br />
uns mit Roibusch-Vanille-Tee versorgt hat,<br />
auf einem Stuhl vor seiner Bücherwand.<br />
Auf unsere erste Frage, welche Gedanken<br />
ihm durch den Kopf gehen, wenn er beginnt<br />
zu schreiben, antwortet er: „Zuerst entsteht<br />
die Idee. Die Idee, worüber man etwas<br />
schreiben und was einem selbst und<br />
anderen Freude und auch Sinn bereiten<br />
könnte.“ Seiner Meinung nach muss sich<br />
jeder Schriftsteller darüber im Klaren sein,<br />
was er seinen Lesern mitteilen möchte und<br />
welche Botschaft dahinter stecken soll.<br />
„Wenn ich diese Idee im Kopf habe mache<br />
ich mir permanent Notizen und baue sie<br />
später in meinem Buch ein.“ Nach der Ideenfindung,<br />
werden die Charaktere festgelegt<br />
und zum Schluss die Handlungsstränge<br />
in eine Reihenfolge gebracht. „Was ich<br />
überhaupt nicht weiß, ist das Ende.“<br />
Die Ideen für seine Bücher entstehen<br />
spontan. Man benötige dazu eine gewisse<br />
Intuition, die nicht jeder Mensch habe und<br />
auch nicht brauche. „Ich glaube ein guter<br />
Erzähler ist manchmal ein Spinner und auch<br />
umgekehrt, ein Spinner ist ein guter Erzähler.“<br />
Holger findet, dass ein guter Schriftsteller<br />
Bilder in Worte fassen können muss.<br />
Eine Authentizität könne nur entstehen,<br />
wenn der Leser spürt, dass die beschriebenen<br />
Dinge vom Autor selbst oder bei<br />
anderen erlebt wurden und nicht am<br />
Schreibtisch konstruiert worden sind. Nur<br />
dann weiß der Schriftsteller, welche Gefühle<br />
in bestimmten Situationen dahinter<br />
stecken und nur so könne ein gutes Buch<br />
entstehen. Da nicht jedem dieses Feingefühl<br />
zueigen ist, könne auch nicht jeder ein<br />
Buch schreiben, oder zumindest kein gutes.<br />
Was aber sind schlechte Bücher? „Bücher<br />
mit wirrer Handlung. Man kann sich überhaupt<br />
nicht in die Charaktere hinein versetzen.<br />
Es gibt eine unschlüssige Handlung<br />
oder es ist schlichtweg uninteressant“, ur-<br />
Foto: Maximilian Fritz<br />
Des Schriftstellers antikes „Google“: Holger Doetsch vor seiner Bibliothek.<br />
teilt Doetsch. Nicht selten brauche man<br />
„eine gewisse Melancholie. Melancholie ist<br />
ein wichtiger Teil einer jeden Kunst.“<br />
Wenn er ein Buch zu schreiben beginnt, ist<br />
es für ihn sehr wichtig einen festen Tagesablauf<br />
zu haben, um nicht zu bequem zu<br />
werden und die Fertigstellung über einen<br />
langen Zeitraum hinauszuschieben. Es mögen<br />
ihm andere Schriftsteller widersprechen,<br />
aber er selbst geht davon aus: „Wenn<br />
du dir selber keinen positiven Druck<br />
machst, wird das nichts.“ Und: „Jeder<br />
schöpferische Akt ist auch eine Plage.“ Daher<br />
steht er morgens spätestens halb sechs<br />
Uhr auf und setzt sich nach einer Dusche<br />
und einem Kaffee an seinen besagten<br />
Schreibtisch im Arbeitszimmer und beginnt<br />
zu arbeiten. Meistens hält er das bis Mittag<br />
durch, denn nach 14 Uhr ist er, wie er selbst<br />
sagt „nicht mehr zu gebrauchen“ und beschäftigt<br />
sich mit anderen Dingen. Natürlich<br />
könne das nicht für jeden gelten, da<br />
nicht jeder ein Morgenmensch sei. Der<br />
eine könne morgens, der andere nachmittags<br />
oder abends besser arbeiten. Wichtig<br />
sei nur, dass man sich seinen Tag mit Rücksicht<br />
auf seinen Rhythmus einteilt.<br />
Eine Regel, die seiner Meinung nach während<br />
des Schreibens unbedingt eingehalten<br />
werden sollte: kein Alkohol oder andere
Seite 30 Eindruck<br />
Drogen. „Alkohol vernebelt die Sinne. Es<br />
mögen zwar manchmal tolle Sachen dabei<br />
zustande kommen – auch bei Verwendung<br />
anderer Drogen. Die Dinge werden vielleicht<br />
blumiger, aber sie werden dann eben<br />
auch verfälschter.“<br />
Viele Schriftsteller lassen sich von ihren<br />
Vorbildern inspirieren. So auch Holger Doetsch.<br />
Sein Vorbild heißt Hervé Guibert:<br />
„Ich beginne sogar mein Buch Ein lebendiger<br />
Tag mit seinem Lebensmotto: „Tout dire!“<br />
– alles sagen. Doetsch wurde bereits mit<br />
diesem und mit Charles Bukowski verglichen.<br />
Dieser verwendet sehr derbe Worte<br />
und beschreibt sehr hart die Dinge so, wie<br />
sie sind. „Also wenn man mit Leuten verglichen<br />
wird, ist es auf der einen Seite eine<br />
Pest, auf der anderen Seite bin ich so einer,<br />
der sich darüber freut,“ merkt er an.<br />
Eine weitere Sache bei der Entstehung<br />
eines Buches ist die Verlagswahl. Wir<br />
wollten wissen, ob man sich während des<br />
Schreibvorgangs bereits einen Verlag sucht<br />
oder erst, wenn man sein Buch bereits vollendet<br />
hat. Doetschs Antwort darauf: „Das<br />
ist unterschiedlich. Ich zum Beispiel habe<br />
nebenbei noch Vorlesungen und muss auch<br />
Geld verdienen – während das Buch entsteht<br />
verdient man ja nichts. Deswegen bin<br />
ich jemand, der die Verlagssuche und die<br />
Vertragsverhandlungen neben dem Entstehungsprozesses<br />
macht. Der Verlag gibt dann<br />
auch eine Deadline, d.h. einen Zeitpunkt, an<br />
dem das Buch spätestens fertig sein muss,<br />
vor. Bei der Berechnung dieser Deadline<br />
gilt die alte Regel: 20 Tage für das erste Lektorat<br />
und 20 weitere Tage für das zweite<br />
Lektorat und den Druck.“<br />
Wer sich also, so Doetschs Ratschlag, in<br />
seiner Inspiration nicht durch Einschrän-<br />
Foto: Maximilian Fritz<br />
Ein Autor bei der Arbeit.<br />
kungen beschneiden lassen will oder sich<br />
nicht in der Lage fühlt administrative Angelegenheiten<br />
nebenher zu erledigen, der<br />
sollte sich erst nach Vollendigung seines<br />
Buches einen Verlag suchen.<br />
Daraus entwickelte sich unsere nächste<br />
Frage: Wie ein Schriftsteller das Vertrauen<br />
eines Verlages erlangt, obwohl sein Buch<br />
noch in der Entstehung ist. „Man gibt dem<br />
Verlag Leseproben und erzählt natürlich,<br />
was der Inhalt des Buches sein soll. Der<br />
Verlag entscheidet dann, ob er mit dem<br />
vom Autor gewählten Thema gut werben<br />
kann – die Verleger denken natürlich auch<br />
betriebswirtschaftlich. Und im Zeitalter des<br />
Internets wird die Person gegoogelt um<br />
zum Beispiel feststellen zu können, ob bereits<br />
Schriftstücke vorhanden sind und ob<br />
derjenige wirklich etwas zu erzählen hat.“<br />
So gehen zumindest die seriösen Verlage<br />
vor. Es gibt aber auch Verlage, bei denen jeder,<br />
der ein Buch veröffentlichen möchte,<br />
für einen bestimmten Geldbetrag sein<br />
Werk drucken lassen kann. Dabei wird<br />
aber selten auf die Qualität des Geschriebenen<br />
geachtet.<br />
Hat man einen Verlag gefunden, werden die<br />
Vertragsverhandlungen geführt. Dabei wird<br />
festgelegt, welchen prozentualen Anteil der<br />
Autor beim Verkauf des Buches erhält. Doetsch<br />
erklärt: „Man bekommt zwischen<br />
zehn und höchstens vierzig Prozent. Dafür<br />
übernimmt der Verlag die Kosten für das<br />
Papier, den Druck oder auch die Präsentation<br />
eines Buches etwa auf einer Messe.“<br />
Von den Preisen im Geschäft erhält der<br />
Schriftsteller also nur einen Bruchteil. Daraus<br />
folgert er: „Reich wird man mit Büchern<br />
nicht, außer man heißt vielleicht Dan<br />
Brown oder so. Allerdings wird man innerlich<br />
reich. Und es ist wirklich ein geiles Gefühl,<br />
wenn man sagen kann, das hier ist<br />
mein neues Buch!“<br />
Bei den Verhandlungen mit dem Verlag geht<br />
es auch um Dinge wie das Cover sowie die<br />
Beschaffenheit des Buchs. Da gibt es einmal<br />
das sogenannte Hardcover, ein fester und<br />
robuster Umschlag, und zum anderen das<br />
Broschur, eine günstigere Alternative, aber<br />
auch wesentlich dünner und leichter zerstörbar.<br />
Meistens veröffentlichen die Verlage<br />
ihre Bücher erst im Hardcover und<br />
geben es dann als Taschenbuch heraus, um<br />
eine breitere Masse zu erreichen: „Mit Broschur<br />
verdient man weniger als mit Hardcover.<br />
Das sind harte Verhandlungen, die man<br />
mit dem Verlag führt. Und es gibt zum Beispiel<br />
Verlage, deren Philosophie ist es, keine<br />
Billigproduktionen herzustellen, sondern<br />
nur kunstvolle Dinge. Daher wird dort<br />
auch jede Neuauflage eines Buches wieder<br />
als Hardcover produziert. Dies ist der Fall<br />
bei meinem ersten Buch Elysander – deswegen<br />
arbeiten wir mit Studentenrabatten.“<br />
Als Holger Doetsch uns alle unsere Fragen<br />
beantwortet hat, zeigt er uns noch sein<br />
zweites Arbeitszimmer. Hier befinden sich<br />
sämtliche politische Bücher, die wieder zusammen<br />
mit Zeitungsausschnitten archiviert<br />
worden sind.<br />
Wir sehen uns gerade die Fotos an den<br />
Wänden an, während er dem Klingeln an<br />
seiner Haustür nachgeht. Kurze Zeit später<br />
kommt er mit einem Päckchen in den Händen<br />
zurück und sagt: „Wenn ihr Glück habt<br />
werdet ihr gleich die ersten sein, die mein<br />
neues Buch zu sehen bekommen.“ So richtig<br />
daran zu glauben scheint er dabei selber<br />
nicht. Er macht das Paket auf und tatsächlich:<br />
Es ist das erste gedruckte Exemplar<br />
seines neuen Buches Ein lebendiger Tag, das<br />
er in seinen Händen hält. Mit einem strahlenden<br />
Gesicht bewundert er zunächst den<br />
Einband von vorne und hinten bevor er die<br />
Plastikfolie entfernt. Zum ersten Mal hält er<br />
nun sein druckfrisches „Baby“ in den Händen.<br />
Mit vor Freude leicht zittrigen Fingern<br />
blättert er zum ersten Mal durch die Seiten<br />
und riecht sogar daran. All die Arbeit und<br />
der Stress bis zur Fertigstellung sind in diesem<br />
Moment vergessen.<br />
Wir wollen ihn die ersten Minuten mit seinem<br />
neuen Buch alleine genießen lassen<br />
und verabschieden uns schnell.<br />
Franziska Seilkopf