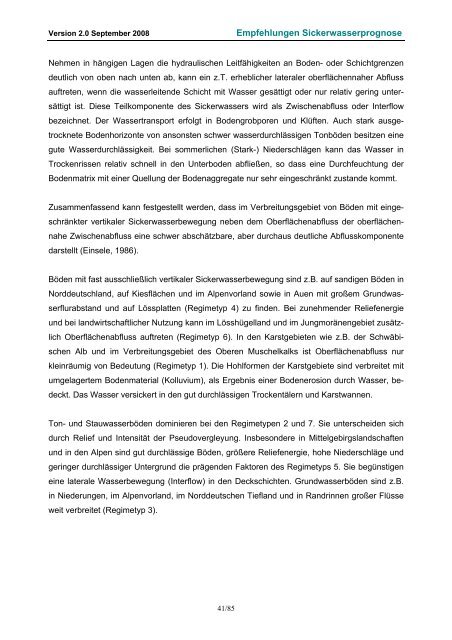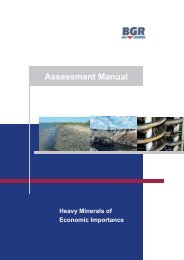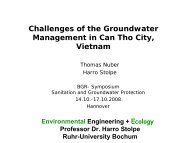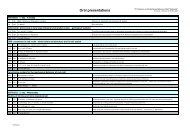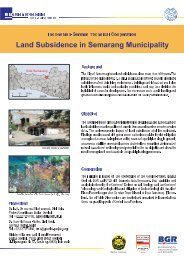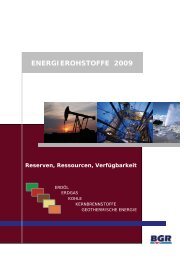Empfehlungen für die Charakterisierung und ... - BGR
Empfehlungen für die Charakterisierung und ... - BGR
Empfehlungen für die Charakterisierung und ... - BGR
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Version 2.0 September 2008 <strong>Empfehlungen</strong> Sickerwasserprognose<br />
Nehmen in hängigen Lagen <strong>die</strong> hydraulischen Leitfähigkeiten an Boden- oder Schichtgrenzen<br />
deutlich von oben nach unten ab, kann ein z.T. erheblicher lateraler oberflächennaher Abfluss<br />
auftreten, wenn <strong>die</strong> wasserleitende Schicht mit Wasser gesättigt oder nur relativ gering untersättigt<br />
ist. Diese Teilkomponente des Sickerwassers wird als Zwischenabfluss oder Interflow<br />
bezeichnet. Der Wassertransport erfolgt in Bodengrobporen <strong>und</strong> Klüften. Auch stark ausgetrocknete<br />
Bodenhorizonte von ansonsten schwer wasserdurchlässigen Tonböden besitzen eine<br />
gute Wasserdurchlässigkeit. Bei sommerlichen (Stark-) Niederschlägen kann das Wasser in<br />
Trockenrissen relativ schnell in den Unterboden abfließen, so dass eine Durchfeuchtung der<br />
Bodenmatrix mit einer Quellung der Bodenaggregate nur sehr eingeschränkt zustande kommt.<br />
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im Verbreitungsgebiet von Böden mit eingeschränkter<br />
vertikaler Sickerwasserbewegung neben dem Oberflächenabfluss der oberflächennahe<br />
Zwischenabfluss eine schwer abschätzbare, aber durchaus deutliche Abflusskomponente<br />
darstellt (Einsele, 1986).<br />
Böden mit fast ausschließlich vertikaler Sickerwasserbewegung sind z.B. auf sandigen Böden in<br />
Norddeutschland, auf Kiesflächen <strong>und</strong> im Alpenvorland sowie in Auen mit großem Gr<strong>und</strong>wasserflurabstand<br />
<strong>und</strong> auf Lössplatten (Regimetyp 4) zu finden. Bei zunehmender Reliefenergie<br />
<strong>und</strong> bei landwirtschaftlicher Nutzung kann im Lösshügelland <strong>und</strong> im Jungmoränengebiet zusätzlich<br />
Oberflächenabfluss auftreten (Regimetyp 6). In den Karstgebieten wie z.B. der Schwäbischen<br />
Alb <strong>und</strong> im Verbreitungsgebiet des Oberen Muschelkalks ist Oberflächenabfluss nur<br />
kleinräumig von Bedeutung (Regimetyp 1). Die Hohlformen der Karstgebiete sind verbreitet mit<br />
umgelagertem Bodenmaterial (Kolluvium), als Ergebnis einer Bodenerosion durch Wasser, bedeckt.<br />
Das Wasser versickert in den gut durchlässigen Trockentälern <strong>und</strong> Karstwannen.<br />
Ton- <strong>und</strong> Stauwasserböden dominieren bei den Regimetypen 2 <strong>und</strong> 7. Sie unterscheiden sich<br />
durch Relief <strong>und</strong> Intensität der Pseudovergleyung. Insbesondere in Mittelgebirgslandschaften<br />
<strong>und</strong> in den Alpen sind gut durchlässige Böden, größere Reliefenergie, hohe Niederschläge <strong>und</strong><br />
geringer durchlässiger Untergr<strong>und</strong> <strong>die</strong> prägenden Faktoren des Regimetyps 5. Sie begünstigen<br />
eine laterale Wasserbewegung (Interflow) in den Deckschichten. Gr<strong>und</strong>wasserböden sind z.B.<br />
in Niederungen, im Alpenvorland, im Norddeutschen Tiefland <strong>und</strong> in Randrinnen großer Flüsse<br />
weit verbreitet (Regimetyp 3).<br />
41/85