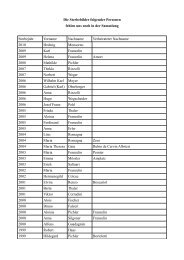FÄCKL A. & CO. Ohg - Montaner Dorfblatt
FÄCKL A. & CO. Ohg - Montaner Dorfblatt
FÄCKL A. & CO. Ohg - Montaner Dorfblatt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
16<br />
Einwanderung in Südtirol<br />
Kürzlich organisierten die Schützen einen Informations- und<br />
Diskussionsabend in Montan. Als Referent/innen für diese löbliche<br />
Initiative wurden Paula Maria Ladstätter (Juristin und zuständig<br />
für die Flüchtlingshilfe der Caritas) und der Arbeiterpriester<br />
und Gewerkschafter sowie geistlicher Assistent des KVW,<br />
Josef Stricker gewonnen. Mit guter Beteiligung vieler junger<br />
<strong>Montaner</strong>Innen und auch einiger dem Jugendalter auch schon<br />
Entwachsener konnten sich die Anwesenden ein umfassendes<br />
Bild von der Einwanderung in Südtirol, von der rechtlichen Lage<br />
der EinwandererInnen und ihrer sozialen und existentiellen Situation<br />
machen – und offene Fragen und Ungewissheiten klären.<br />
„Arbeitskräfte wurden geholt – Menschen sind gekommen“, mit<br />
diesem Motto von Max Frisch begann der Abend. Das Einwanderungsszenario<br />
hat in Südtirol, das ja eigentlich viele Jahre lang<br />
(bis in die 70er Jahre herauf) selbst ein Auswanderungsland war,<br />
in den 90er Jahren begonnen, als zunehmend Arbeitskräfte aus<br />
dem Ausland geholt wurden. Heute wären Wirtschaftszweige wie<br />
der Tourismus (laut HGV sind zwei Drittel der in diesem Sektor<br />
Erwerbstätigen AusländerInnen), die Landwirtschaft (man denke<br />
an die ErntehelferInnen), die Krankenpflege (Betriebe wie das<br />
Krankenhaus Bozen fußen auf der ausländischen Arbeitskraft)<br />
und Hauspflege (vor allem im Hinblick auf die „Badanti“) ohne<br />
ausländische Arbeitskräfte nicht lebensfähig.<br />
Paula Maria Ladstätter erklärte, dass die italienische Regierung<br />
mit den so genannten Decreti Flussi das Kontingent festsetzt und<br />
somit bestimmt, wie viele Arbeitskräfte pro Sektor und auch pro<br />
Herkunftsland, sich jährlich regulär in Italien aufhalten können.<br />
In Südtirol beträgt die Zahl der anwesenden AusländerInnen laut<br />
Josef Stricker derzeit etwa 33.000, davon sind der Großteil BürgerInnen<br />
der Europäischen Union. Insgesamt sind 121 Nationalitäten<br />
mit über 100 verschiedenen Sprachen in Südtirol vertreten,<br />
unter den Religionen ist der Islam in der Minderheit. Waren es früher<br />
vor allem saisonale Arbeitskräfte, die nach Saisonsende wieder<br />
ins Heimatland zurückkehrten, so sind es heutzutage immer öfter<br />
Menschen, die das ganze Jahr über bei uns arbeiten. Damit steigt<br />
natürlich der Wunsch nach Familienzusammenführung. Dieser<br />
Begriff wird oft missverständlich gebraucht und es ist darauf hinzuweisen,<br />
dass das italienische Gesetz diese nur erlaubt, falls es<br />
sich um den Ehepartner/die Ehepartnerin, die Kinder oder die<br />
Eltern handelt. Letztere dürfen nur geholt werden, falls es im Ursprungsland<br />
oder in einem anderen Land nicht andere Geschwister<br />
gibt, welche die Eltern betreuen können. Die Möglichkeit der<br />
Zusammenführung gilt außerdem nur, wenn eine Wohnung einer<br />
gewissen Mindestgröße, ein gewisses Mindesteinkommen und ein<br />
mindestens ein Jahr gültiger Arbeitsvertrag nachgewiesen werden<br />
können. Somit muss man sagen, dass das in der Vorwahlzeit oftmals<br />
angeprangerte Gesetz zur Familienzusammenführung sehr<br />
restriktiv ist und keineswegs Horden von ausländischen Clans ins<br />
Land holt (wie es indessen oft an die Wand gemalt wurde).<br />
Josef Stricker plädierte für das einzig mögliche Modell des Zusammenlebens:<br />
Nachdem das Distanzmodell (in dem man die<br />
ausländischen Bevölkerungsanteile möglichst separat hält und<br />
Kontakt verhindert) ebenso wie das Assimilierungsmodell (in<br />
montaner dorfblatt<br />
Ein Abend über ethische und praktische Aspekte<br />
der Einwanderung<br />
Paula Maria Ladstätter (Juristin und zuständig für die Flüchtlingshilfe<br />
der Caritas) und der Arbeiterpriester und Gewerkschafter sowie<br />
geistlicher Assistent des KVW, Josef Stricker zusammen mit dem Jungschützenbetreuer<br />
Lukas Wegscheider<br />
dem man davon ausgeht, dass sich die EinwandererInnen anpassen<br />
sollen) immer zu Konflikten und sozialem Druck führt, kann<br />
einzig das Integrationsmodell angewendet werden. Das bedeutet,<br />
dass wir bereit sein müssen, die eingewanderten Menschen zu akzeptieren<br />
und sie ihre Eigenart leben zu lassen. Von ihnen können<br />
wir aber auch etwas erwarten, nämlich dass sie das gleiche tun<br />
und außerdem respektieren, dass wir in einem Rechtsstaat und in<br />
einer demokratisch geregelten Gesellschaft leben. Gegenseitiger<br />
Respekt ist die Grundlage für das Integrationsmodell.<br />
In der anschließenden Diskussion ging es dann um den Rechtsrutsch<br />
und die Ausländerparolen, die den Wahlkampf bestimmt<br />
hatten. Die Referenten führen dies unter anderem auf die Wirtschaftskrise<br />
und die zunehmenden Ängste zurück, ebenso auf die<br />
mangelnde Möglichkeit der Begegnung mit den zugewanderten<br />
Familien. So bleiben Vorurteile aufrecht und können politisch<br />
missbraucht werden. Wenn man nämlich die Realität kennt, so<br />
sieht man, dass etwa das Vorurteil der „privilegierten“ AusländerInnen<br />
nicht haltbar ist: Zum Beispiel dürfen Asylbewerber (also<br />
politische Flüchtlinge – sie stellen allerdings nur einen geringeren<br />
Teil der AusländerInnen) gar nicht arbeiten, während sie darauf<br />
warten, dass das Asylgesuch bearbeitet wird. Wer also Leute<br />
sieht, die am „helllichten Tag“ herumsitzen, kann nicht immer<br />
von Faulheit ausgehen, sondern sollte vor Augen haben, dass es<br />
sich auch um solche Flüchtlinge handeln könnte. Ebenso heißt<br />
es immer, dass Ausländer bei der Vergabe von Sozialwohnungen<br />
im Vorteil seien, weil ihnen ein unverhältnismäßig großer Anteil<br />
zugewiesen wird. Pfarrer Stricker erklärte hierzu, dass zwei Drittel<br />
der Südtiroler Familien selbst ein Eigenheim besitzen und somit<br />
in der Liste der Ansucher proportional weniger oft aufscheinen.<br />
Außerdem sind kinderreiche Familien (wie bei Ausländern oft<br />
vorkommend) bei der Vergabe der Sozialwohnungen letztlich<br />
benachteiligt, weil die Wohnungen, die in Südtirol normalerweise<br />
gebaut werden, nur für Familien mit 1-2 Kindern die nötige