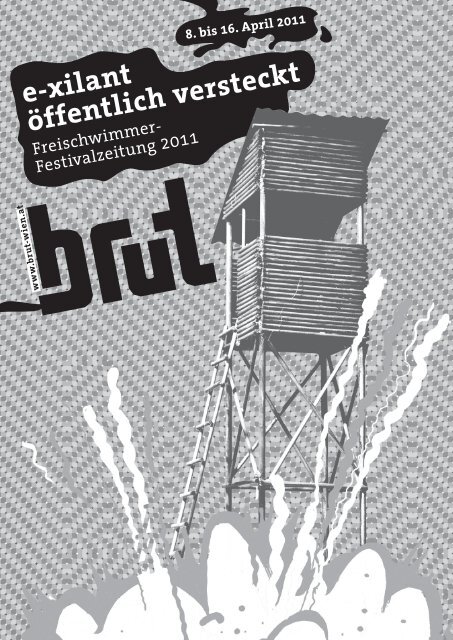e-xilant öffentlich versteckt - brut Wien
e-xilant öffentlich versteckt - brut Wien
e-xilant öffentlich versteckt - brut Wien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.<strong>brut</strong>-wien.at<br />
e-<strong>xilant</strong><br />
<strong>öffentlich</strong> <strong>versteckt</strong><br />
Freischwimmer-<br />
Festivalzeitung 2011<br />
8. bis 16. April 2011
Impressum<br />
Medieninhaber und für den Inhalt verantwortlich:<br />
Koproduktionshaus <strong>Wien</strong> GmbH<br />
Karlsplatz 5 • 1010 <strong>Wien</strong><br />
Tel: +43 (0) 1 587 87 74 • Fax: +43 (0) 1 587 87 74 31<br />
zentrale@<strong>brut</strong>-wien.at<br />
www.<strong>brut</strong>-wien.at<br />
Redaktion Christopher Bader, Eliška Cikán,<br />
Alisa Findling, Tanja Füreder, Birte Gemperlein,<br />
Petra Gschwendtner, Theresa Naomi Hund,<br />
Kristina Kirova, Eva-Maria Kleinschwärzer,<br />
Nathalie Knoll, Olivia Lefford, Ada Mumajesi,<br />
Luca Lidia Pályi, Florian Peter Pesel,<br />
Katja Poloubotko, Maria Rauch, Annamaria Rohner,<br />
Raimund Rosarius, Tea Sahačić, Vanessa Scharrer,<br />
Daniela Scheidbach, Sebastian Schley,<br />
Victoria Schopf, Lisa Schöttel, Katharina Sindelar,<br />
Frederique Trautmann, Jennifer Vogtmann,<br />
Simon Weyer, Christoph Wingelmayr,<br />
Anna Katharina Wuzella<br />
Koordination Hannah Egenolf, Eva Geißler,<br />
Haiko Pfost Grafik Atzgerei<br />
02<br />
Freischwimmer-Blogs<br />
http://glasfront.wordpress.com<br />
Christopher Bader, Ada Mumajesi,<br />
Annamaria Rohner, Simon Weyer<br />
http://freischwimmerwien.wordpress.com/<br />
Petra Gschwendtner, Maria Rauch,<br />
Frederique Trautmann, Anna Katharina Wuzella<br />
http://krisfreischwimmer.wordpress.com/<br />
Kristina Kirova<br />
Wir danken Hannah Egenolf vom Institut für Theater-,<br />
Film- und Medienwissenschaft der Universität <strong>Wien</strong><br />
herzlich für Ihre Unterstützung.<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
e-<strong>xilant</strong> 04<br />
von Hannah Egenolf und <strong>brut</strong>-Team<br />
Mit dem Strom ins <strong>öffentlich</strong>e Exil schwimmen! 05<br />
von Lisa Schöttel<br />
Junges Theater im Exil! 06<br />
von Katharina Sindelar<br />
fant. Virt. Reisen: Die Anatomie des Freskos<br />
verlangt nach Schmiererei 07<br />
von Raimund Rosarius<br />
Vom Seepferdchen zum Freischwimmer 09<br />
von Vanessa Scharrer und Daniela Scheidbach<br />
Barbara Ungepflegt: NOTSTAND<br />
Not macht erfinderisch? 12<br />
von Florian Peter Pesel<br />
<strong>Wien</strong> im Notstand 13<br />
von Olivia Lefford<br />
„So schön kann Notstand sein“ 14<br />
von Theresa Naomi Hund<br />
„Angenehm, Ungepflegt.“ 15<br />
von Nathalie Knoll und Kristina Kirova
Institut für Hybridforschung: Furry Species<br />
Back to Basics 17<br />
von Christoph Wingelmayr und Birte Gemperlein<br />
„Menschliche Mittelmäßigkeit“ 18<br />
von Sebastian Schley<br />
You never howl alone! 20<br />
von Christoph Wingelmayr<br />
Pelz auf den Augen 21<br />
von Vanessa Scharrer<br />
Bericht einer Bühnengeburt 22<br />
von Raimund Rosarius<br />
mariamagdalena und Gäste: Bis dass der Tod<br />
uns scheidet<br />
(K)Ein Bund fürs Leben ... 23<br />
von Alisa Findling<br />
Disco-Polo-Utopie 24<br />
von Eva-Maria Kleinschwärzer<br />
Wir drehen uns, bis wir alle sterben 25<br />
von Eva-Maria Kleinschwärzer<br />
Die Freuden und Leiden 26<br />
von Tanja Füreder<br />
Alex Deutinger & Marta Navaridas: Your Majesties<br />
„Der nackte Obama“ 27<br />
von Victoria Schopf und Katja Poloubotko<br />
Let us reach for the world 28<br />
von Victoria Schopf<br />
Obama als Marionettenfigur 30<br />
von Katja Poloubotko<br />
Martin Schick und Laura Kalauz: CMMN SNS PRJCT<br />
Who wants that? 31<br />
von Lisa Schöttel<br />
Can we stop participating? 32<br />
von Alisa Findling<br />
Does common make sense? 33<br />
von Katharina Sindelar<br />
Das große Spiel mit der Spielregel 34<br />
von Luca Lidia Pályi<br />
TH D BHND 35<br />
von Alisa Findling und Katja Poloubotko<br />
Verena Billinger und Sebastian Schulz:<br />
Romantic Afternoon<br />
Romantic Afternoon 36<br />
von Eliška Cikán<br />
Mit Kuss und Gruß 37<br />
von Victoria Schopf<br />
Ein Kuss für Blickfänger 38<br />
von Eliška Cikán<br />
Niemand bleibt ungeküsst 38<br />
von Jennifer Vogtmann<br />
Auf der anderen Seite 39<br />
von Theresa Naomi Hund<br />
Liebeszombies küssen besser! 40<br />
von Eliška Cikán, Ada Mumajesi und Olivia Lefford<br />
Publikumsstimmen 42<br />
von Victoria Schopf und Theresa Naomi Hund<br />
Chuck Morris: souvereines<br />
Macht und Märchen 43<br />
von Kristina Kirova<br />
Die gläserne Königin 44<br />
von Eva-Maria Kleinschwärzer<br />
Verbeugt euch - die Königin kommt 44<br />
von Christoph Wingelmayr<br />
Behind the crown 45<br />
von Tanja Füreder<br />
Skandal bei den Royals 46<br />
von Eva-Maria Kleinschwärzer und Nathalie Knoll<br />
„Ob die Ballett machen?“ 47<br />
von Sebastian Schley<br />
Lovefuckers: King of the Kings<br />
Gaddafi Superstar 48<br />
von Tea Sahačić<br />
Handpuppen im Kugelhagel 49<br />
von Jennifer Vogtmann<br />
„Let‘s fetz“ sprach MC G 50<br />
von Lisa Schöttel<br />
King of the Kings 51<br />
von Daniela Scheidbach und Birte Gemperlein<br />
MC G, der Hanswurst des Orients 53<br />
von Birte Gemperlein<br />
„The weird world of Gaddafi on stage“ 53<br />
von Birte Gemperlein und Daniela Scheidbach<br />
Was Künstler und ihr Publikum ... 54<br />
von Katja Poloubotko<br />
Das Oeuvre zum Schluss 54<br />
von Theresa Naomi Hund<br />
Gegen den Strom freigeschwommen 55<br />
von Florian Peter Pesel<br />
Raus aus dem Wasser 57<br />
von Luca Lidia Pályi<br />
Mehr als nur die Summe seiner Einzelteile 58<br />
von Kristina Kirova<br />
Land in Sicht 59<br />
von Tea Sahačić<br />
033
Bereits zum dritten Mal hatten StudentInnen des Instituts<br />
für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität<br />
<strong>Wien</strong> die Möglichkeit, im Rahmen des Freischwimmer-Festivals<br />
journalistische Beiträge zu den einzelnen Produktionen<br />
des Festivals zu schreiben. Sie führten Interviews mit den<br />
eingeladenen Künstlern und Teams, verfassten Vorberichte<br />
und Kritiken, setzten sich mit dem diesjährigen Thema<br />
„Rückzug ins Öffentliche“ auseinander und führten Publikumsbefragungen<br />
durch.<br />
Überdies bot sich ihnen die Möglichkeit, die Produktionsabläufe<br />
eines Festivals kennenzulernen, sich mit den Künstlern<br />
auszutauschen und hinter die Kulissen des <strong>brut</strong> zu blicken.<br />
Sämtliche Beiträge der StudentInnen waren während der<br />
Dauer des Festivals bereits als Wandzeitung in den Spielstätten<br />
des <strong>brut</strong> nachzulesen. Die gesammelten Beiträge werden<br />
überdies auf der <strong>brut</strong>-Homepage zum Download zur<br />
Verfügung gestellt. Zudem nahmen einige StudentInnen am<br />
diesjährigen – vom Freischwimmer-Festival ausgeschriebenen<br />
– Blog-Battle teil und bloggten tagesaktuell über das<br />
Festival, gestalteten eigene Beiträge, Videoclips und Liveticker<br />
und formulierten Kritiken und assoziative Gedanken zu den<br />
einzelnen Produktionen.<br />
Die Festivalzeitung entstand in Kooperation mit dem Institut<br />
für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität<br />
<strong>Wien</strong> und der Lehrveranstaltung<br />
„Schreiben für die Freischwimmer-Festivalzeitung 2011 im<br />
<strong>brut</strong>“ unter der Leitung von Hannah Egenolf.<br />
Sämtliche Beiträge wurden von den StudentInnen in eigener<br />
Organisation und inhaltlicher Verantwortung verfasst, das<br />
<strong>brut</strong>-Team stand als Gesprächspartner unterstützend zur Seite.<br />
Wir wünschen allen LeserInnen eine gute Leküre und bedanken<br />
uns bei den StudentInnen für das große Engagement und<br />
beim Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft für<br />
die Kooperation.<br />
Mit herzlichen Grüßen<br />
Das <strong>brut</strong>-team & Hannah Egenolf<br />
04<br />
e-<strong>xilant</strong> – <strong>öffentlich</strong> <strong>versteckt</strong> im <strong>brut</strong><br />
Freischwimmer-Festivalzeitung 2011<br />
Bildrechte: Theresa Naomi Hund
Mit dem Strom ins <strong>öffentlich</strong>e Exil schwimmen!<br />
von Lisa Schöttel<br />
freischwimmen. Wir schwimmen mit dem Strom oder<br />
machen uns frei? Wahrscheinlich benötigen wir auch ein<br />
Abzeichen, um uns endlich freischwimmen zu können, oder<br />
müssen uns einfach vom Leben freischwimmen. Die Kunst,<br />
das Theater, die Performance sind anerkannte Freischwimmer-Abzeichen,<br />
in einem gewissen Rahmen, das begeistert.<br />
Man zwängt sich aus einer Form und hält anderen einen<br />
Spiegel vor die Augen. Oder man schwimmt weiter in Bahnen<br />
und taucht nur manchmal unter Wasser, um Luft zu holen.<br />
Dafür gibt’s sogar manchmal Abzeichen, in Form von Ruhm<br />
und Ehre, oder man fällt einfach durch und geht unter.<br />
Auch dieses Jahr haben sich wieder tapfere Freischwimmer<br />
den kritischen Augen und Ohren der Studierenden der<br />
Theater-, Film- und Medienwissenschaften gestellt und dabei<br />
auf voller Linie begeistert. Daraus ist nun unsere Zeitung<br />
entstanden, eine Sammlung der interessantesten Artikel,<br />
Interviews und Berichte über das Freischwimmer-Festival<br />
2011 im <strong>brut</strong>.<br />
e-<strong>xilant</strong>. <strong>öffentlich</strong> <strong>versteckt</strong>. Jeden Tag bewegen wir uns in<br />
der Öffentlichkeit. Gehen auf die Straße, besuchen <strong>öffentlich</strong>es<br />
Eigentum, fahren mit <strong>öffentlich</strong>en Verkehrsmitteln. Und<br />
wir kommen nach Hause, drehen den Fernseher an, sehen<br />
Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, drehen den Fernseher<br />
ab, um uns ein bisschen zurückzuziehen. Und finden<br />
uns im World Wide Web wieder. Die virtuelle Öffentlichkeit.<br />
Wir schreiben darin, wie es uns geht, was wir machen, wo<br />
wir uns befinden. Die Grenzen zwischen Privatem und Öffentlichem<br />
verschwimmen, wir werden in die Öffentlichkeit<br />
getrieben und zu E<strong>xilant</strong>en.<br />
Auch mit unserer Zeitung haben wir uns ein Exil in der<br />
Öffentlichkeit geschaffen und können uns hinter unseren<br />
Worten noch ein bisschen <strong>öffentlich</strong> verstecken.<br />
Eine Woche voller Eindrücke, Gedankenspiele und manchmal<br />
Verwirrungen haben zur Entstehung der Zeitung geführt, die<br />
uns auch die Möglichkeit gab, im Schreibprozess Eindrücke<br />
und Gedanken verarbeiten zu können. Eine intensive Woche<br />
mit viel Kunst und Unterhaltung hat uns zu diesem Ergebnis<br />
gebracht, auf das wir alle sehr stolz sind.<br />
Zum Schluss. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei unseren<br />
beiden Betreuerinnen Eva Geißler und Hannah Egenolf<br />
bedanken, die mit viel Elan und Engagement einen großen<br />
Anteil zur Entstehung dieser Zeitschrift beigetragen haben.<br />
Ich glaube, ich kann im Namen der ganzen Gruppe sprechen,<br />
wenn ich sage, dass es uns eine große Freude war, mit euch<br />
zusammenzuarbeiten. Weiters möchte ich darauf hinweisen,<br />
dass wir uns im Vorfeld dazu entschieden haben, in der Gender-Frage<br />
einen pluralistischen Ansatz zu verfolgen, sodass<br />
es jedem Redakteur und jeder Redakteurin selbst überlassen<br />
war, ob er oder sie auch die weibliche Formulierung mit in<br />
den Artikel nimmt oder nicht.<br />
Et voilà. e-<strong>xilant</strong> – <strong>öffentlich</strong> <strong>versteckt</strong>. Gedanken, Kritiken,<br />
Essays und Stimmen zum Freischwimmer-Festival 2011. Viel<br />
Spaß beim Lesen.<br />
05
Junges Theater im Exil!<br />
Gedanken zum Festival und zur Festivalzeitung<br />
von Katharina Sindelar, 06.04.2011<br />
Das Freischwimmer-Festival kommt nach <strong>Wien</strong>, und alle<br />
schwimmen mit beim „Rückzug ins Öffentliche“. Junges<br />
neues Theater erkundet Exile in der Öffentlichkeit.<br />
Das Freischwimmer-Festival kommt auch 2011 wieder nach<br />
<strong>Wien</strong> ins <strong>brut</strong>, diesmal unter dem Motto „Rückzug ins<br />
Öffentliche“. Nach den Sophiensaelen in Berlin und Kampnagel<br />
in Hamburg macht das Festival on tour nun halt im <strong>brut</strong> in<br />
<strong>Wien</strong>, um danach auch noch das Theaterhaus Gessnerallee in<br />
Zürich und das FFT in Düsseldorf zu erkunden. Sieben neue<br />
Theaterperfomances von jungen Künstlern haben auch dieses<br />
Jahr wieder die Chance, dem Publikum zu zeigen, was sie<br />
können. Alle Stücke sind Uraufführungen, die mit den Förderungen<br />
des Festivals realisiert werden konnten. Nur die achte<br />
Show, Your Majesties, war schon fertig bei der Bewerbung, bekommt<br />
jedoch im <strong>brut</strong> die Gelegenheit aufgeführt zu werden,<br />
passt sie doch so gut zum Thema des Festivals.<br />
Ob Barbara Ungepflegt mit dem Notstand oder das Institut für<br />
Hybridforschung mit Furry Species, Laura Kalauz und Martin<br />
Schick mit dem CMMN SNS PRJCT oder die Lovefuckers mit<br />
King of the Kings, mariamagdalena und Gäste mit Bis dass<br />
der Tod uns scheidet, Verena Billinger und Sebastian Schulz<br />
mit Romantic Afternoon oder Chuck Morris mit souvereines,<br />
sie alle haben sich mit dem Thema „Rückzug ins Öffentliche“<br />
beschäftigt und einige außergewöhnliche Stücke kreiert. Diese<br />
werden nun im Rahmen des Festivals aufgeführt und erstmals<br />
der Öffentlichkeit gezeigt.<br />
Doch was ist ein Rückzug ins Öffentliche? Ist es nicht eigentlich<br />
ein selbst gemachtes Exil, dass man dann doch mit der<br />
Öffentlichkeit teilt, mit den Menschen, die man eigentlich<br />
aus seinem Leben ausgesperrt hat? Immer öfter sieht man,<br />
dass Menschen lieber zu Hause sind und vor dem Computer<br />
mit den Menschen in ihrer Umgebung interagieren, als vor<br />
die Haustür zu gehen und diese im realen Leben zu treffen. So<br />
baut sich der Mensch seine Wohnung zu einem eigenen kleinen<br />
Exil um, bezieht dieses freiwillig und verlässt es nur für die<br />
notwendigen Dinge wie Arbeit, Uni oder Einkaufen. Das wirkliche<br />
Leben spielt sich im Cyberspace ab. Auf Facebook, Twitter,<br />
My Space und diversen anderen Social-Media-Plattformen.<br />
Diese Exile begleiten einen immer mehr auf seinem Lebensweg,<br />
unbemerkt davon, dass man sich selbst in die Verban-<br />
06<br />
nung seiner eigenen vier Wände schickt. Früher wurde diese<br />
Maßnahme als Strafe vollzogen, um sich unliebsamer Gegner<br />
zu entledigen, heute ist es für viele ein Glück, alleine, vor dem<br />
PC zu sitzen. Aber warum werden dann Statusmeldungen geschrieben<br />
und somit jedwede Gemütslage und unnütze Tätigkeit<br />
einer breiten Masse berichtet? Niemand würde sich freiwillig<br />
auf einen großen Platz stellen und seinen momentanen<br />
emotionalen Zustand aller Welt preisgeben, aber in unseren<br />
selbst geschaffenen Exilen fühlen wir uns sicher genug, um<br />
dies zu tun. Somit bringen uns diese Exile, die kleinen privaten<br />
Räume, die nur wir betreten dürfen, mehr in die Öffentlichkeit,<br />
als wir es jemals wagen würden, wären wir nicht gerade im<br />
Internet unterwegs.<br />
Aus diesem Grund sind unsere Exile schon so weit in der<br />
Öffentlichkeit, dass unser eigener kleiner Rückzugsraum mehr<br />
von uns preisgibt als ein Face-to-Face-Gespräch in der Bar um<br />
die Ecke.<br />
Mit diesen Gedanken hat sich eine Gruppe von Theater-, Film-<br />
und Medienwissenschaftsstudenten der Universität <strong>Wien</strong> zusammengefunden,<br />
die das Festival besuchen, kritisch betrachten<br />
und vielleicht auch daraus lernen wollen. So entsteht auch<br />
diese Zeitung. Sie will mehr über die Künstler schreiben, die<br />
hinter den Stücken stehen, dem Publikum Informationen über<br />
die Stücke mitteilen und eine kritische Reflektion nicht nur der<br />
Darbietungen, sondern des ganzen Festivals an die Öffentlichkeit<br />
bringen. Hier soll allerdings kein Exil geschaffen werden,<br />
sondern eine Möglichkeit, sich genauer zu informieren. Das<br />
Theater, das eher im geschlossenen Rahmen stattfindet, wird<br />
so in die Öffentlichkeit gebracht, um die Masse zu unterhalten.<br />
Nicht der Rückzug ist hier das Ziel, sondern das Hinaustreten<br />
in die Öffentlichkeit, um Menschen für junges Theater zu begeistern<br />
und noch nicht etablierten Künstlern den Weg nach<br />
oben einfacher zu gestalten.
fant. Virt. Reisen: Die Anatomie des Freskos verlangt<br />
nach Schmiererei • Gedanken zu Freischwimmer 2011<br />
von Raimund Rosarius, 06.04.2011<br />
Dem Körper ist Zeit gestohlen, den Augen Ruhe.<br />
Das genaue Wort verliert seinen Ort. Der Schwindel<br />
Fliegt auf mit dem Tausch von Jenseits und Hier<br />
In verschiedenen Religionen, mehreren Sprachen.<br />
Überall sind die Rollfelder gleich grau und gleich<br />
Hell die Krankenzimmer. Dort im Transitraum,<br />
Wo Leerzeit umsonst bei Bewusstsein hält,<br />
Wird ein Sprichwort wahr aus den Bars von Atlantis.<br />
Reisen ist ein Vorgeschmack auf die Hölle.<br />
Durs Grünbein<br />
Mit dem Reisen hat es also angefangen, eine sich zusammenziehende<br />
Welt, die bald an ihrer geballten globalen Dörflichkeit<br />
erlahmte; die Entfremdungsprozesse¹ setzten ein.<br />
Der nächste Schritt, Couch, Bett und Hundekorb gar nicht erst<br />
zu verlassen, ist ein konsequenter. Wozu den Körper ermüden,<br />
für nichts und wieder nichts; Phantomvibrationsklingelei ist<br />
Muskelkontraktion genug und Entnervung ohnehin die Königsdisziplin<br />
der Ermüdung.<br />
Ohne den Tränenfilm, vom Bildschirmflackern evaporiert, kein<br />
Funkeln in den Augen; der Körper ist unendlich humorlos. Der<br />
Reiz der Ferne aus den Augen geklaubt, die Fantasie hat sich<br />
verzogen angesichts der evidenten Alltäglichkeit der großen,<br />
weiten Welt.<br />
Wieso nicht gleich und gleich zwingend das Grau in Grau über<br />
die Tasten schicken? Und schwärmen von der toten Fremde<br />
aus der nun wüsten Fantasie, hinein in die bewusste, in die<br />
tätliche Fiktion.<br />
Und dann doch ein letztes Aufbäumen, Packen der verbliebenen<br />
sieben Sachen zur Flucht. Der Körper versucht eine<br />
Flucht nach vorn, einen Rückzug ins Öffentliche, eine Flucht ins<br />
Exponat. Aus Feigheit vor der nur folgerichtigen Maschinenwerdung<br />
Mensch: Flucht in die Körperlichkeit, Flucht in den<br />
Pelz, Flucht in Säfte.<br />
Bei Freischwimmer 2011 haben wir ja alles, wofür es sich zu<br />
fliehen lohnt.<br />
Das Reisen: Wie überflüssig, als Freischwimmer durch die<br />
Lande zu tingeln und dabei die selbsterklärten Kulturmetropolen<br />
des deutschsprachigen Europas mit körperlichen Ertüchtigungen<br />
zu beglücken, lässt sich doch alles von der Couch aus<br />
streamen, was sich von der Couch aus futtern lässt. Und eben<br />
das Virtuelle, doch das ist – gebannt durch die Zügel und<br />
Ketten der Bühne zum Anschauungsobjekt – eine gefährliche<br />
Harmlosigkeit. Rückzug auf Bühnen oder bühnenähnliches<br />
Territorium, also Welt – wie man Alles nannte, bevor auch das<br />
virtuell wurde.<br />
Doch was begegnet uns dort? Tiere und Puppen. Verstreut<br />
aus Riten, allesamt Fetische. Die, die wir anschicken, die Welt<br />
für uns zu erfahren, sind Halbwesen, humanoide Avatare: ein<br />
wenig noch wir und doch schon ganz anders.<br />
Vor einigen Wochen wurde „Das blinde Geschehen“ von Botho<br />
Strauß in <strong>Wien</strong> uraufgeführt. Held John Porto tippt sich dort,<br />
natürlich liegend, seine ganz eigenen Parallelwelten zusammen,<br />
die sich vom Gros der Parallelwelten selbstredend wenig<br />
unterscheiden. In diesen sterilen Kammern versucht er dann<br />
die alltäglichen Problemchen des Zwischenmenschlichen zu<br />
lösen oder doch wenigstens zu verdrängen, was ihm so kläglich<br />
misslingt wie dem Autisten der Zungenkuss.<br />
Eilverfahren zur Welterklärung: dort Freya Genetrix (auf ein<br />
opulentes Weibchen verzichtet John Porto in seinem künstlichen<br />
Paradies naturgemäß nicht, wenn er schon ihren Namen<br />
nach antiker Dekadenz schreien lässt) und hier nun die teuren<br />
Pelzviecher, Furry Species, des Instituts für Hybridforschung.<br />
Die, die wir anschicken –<br />
Fantasy metastasiert zum ganzheitlichen Mythos.<br />
Zum guten Ton gehört ja heute, sich nicht ernst zu nehmen.<br />
Der kokett-coole Unernst wird dabei mit größter Ernsthaftigkeit<br />
nach außen getragen. Die Betäubung liegt im Spiel ohne<br />
Einsatz, in der ironischen Risikovermeidungsmaschinerie der<br />
Popkultur. Ein Spiel als Spiel, nichts weiter, auch hier kläglich.<br />
Lovefuckers impliziert eine Konventionalität des Gegenteils.<br />
Getaucht in ein Becken von Körperlichkeit um der Körperlichkeit<br />
willen ist der Lovefuck groteskes Alleinstellungsmerkmal.<br />
Was sollen da die Nachbarn sagen? Die Lovefuckers seismografieren<br />
sich mit einer putzigen Muammar al-Gaddafi-Puppe<br />
durch die scheinbar asexulle Weltpolitik. Kann der Gaddafi<br />
geliebt werden? Taugt er doch ganz offensichtlich als King of<br />
the Kings, als ultimative Popikone.<br />
Auch jetzt noch? Die Anteilnahme beziffert sich wohl numerisch:<br />
die Zahl der Toten. Das Kampfgewicht der Bunga-Bunga-<br />
Objekte. Am Ende gar die Zahl der Wangen? Überhaupt Liebe,<br />
dieses insektoide Zeugs; fühlen sich Internetbekanntschaften<br />
doch per se schäbig an. Dann lieber gleich offen praktizierte<br />
Lust statt Lüsternheit im Fiktiven.<br />
Abhilfe sollte Romantic Afternoon von Verena Billinger und<br />
07
Sebastian Schulz schaffen. Mit echtem Zungenzeugs, Gruppenzungenküssen,<br />
allerdings, das sei erwähnt, durchchoreografiert.<br />
Die vierte Wand bleibt – schade, wenngleich gesund.<br />
Billinger und Schulz operieren am Reiz der Grenze, stimulieren<br />
die Ambivalenz zwischen Jenseits und Hier und pieksen in<br />
flimmernd hoher Frequenz in die Unentschiedenheit.<br />
Das Zuschauen ist eine halbe Körperübung, findet sich genau<br />
zwischen Partizipation und Voyeurismus ein und steht permanent<br />
in Spannung zwischen beiden Polen. Das stumme<br />
Zuschauen als einzige große Kontraktion.<br />
Auch das Dargebotene lebt im Graubereich zwischen Inszenierung<br />
und Regung. Ist da nur körperliche Ertüchtigung und<br />
Choreografie? Ergibt sich aus dem Vorgang allein nicht schon<br />
zumindest ab und an Gefühl? Was ist wahr und was ist Spiel?<br />
Öffentlichkeit scheint bei Freischwimmer 2011 restauriert<br />
aus einer Anatomie der Liebe, separiert in mehr oder minder<br />
saubere Fleischfetzen vor den Spots.<br />
Es wird geliebäugelt, gezüngelt, bedient und (schließlich<br />
doch?) geheiratet, und zwar auf Polnisch: Hochzeitsgeschenke<br />
erwünscht, ein Anlegen von Abendgarderoben, Bis dass der Tod<br />
uns scheidet. Als wäre da nicht schon genug Fraktionierung,<br />
Partition.<br />
Man flieht aus dem elektronischen Gewebe und nimmt dessen<br />
Gepflogenheiten mit – es gibt kein Entkommen: Real heißt<br />
nunmehr nicht virtuell. Außerdem: „Ich weiß ja, dass du weißt,<br />
dass das nicht so ernst gemeint ist.“<br />
Das bühnenähnliche Territorium expandiert durch Ablasshandel,<br />
Befriedung von Aufrichtigkeiten; an den Territorialgrenzen<br />
kalauert es heftig.<br />
Aus der Not geboren, ein Gestell: Der Notstand von Barbara<br />
Ungepflegt macht aus der Not eine Tugend und ruft schließlich,<br />
endlich, den Notstand aus, bedient so lange, bis alle<br />
bedient sind. Wann ist der Reiz ausgereizt? Steigert er sich bis<br />
zur fulminanten Kulmination mit punktgenauem Finish, bleibt<br />
die Masse non-finito stehen oder plätschert das Ganze bis zur<br />
Apathie nach?<br />
Hinzu kommt: Die Wirklichkeit ist doch sowieso schon witzig.<br />
In Zeiten, in denen ein Gaddafi ohnehin witziger ist als alle<br />
auch nur denkbaren Hofnarren, wird es Zeit, auch einmal etwas<br />
Neues auszuprobieren, eine echte Kunstfigur in den Weltenlenkerstand<br />
zu erheben. Endlich die Jonathan Meesianische<br />
„Diktatur der Kunst“, fleischgeworden in Chuck Morris, von<br />
und mit und über und durch Chuck Morris, das schweizerischdänische<br />
Künstlerinnenduo. Ausgebildet in der hessischen<br />
08<br />
Semiprovinz und zugleich einmal mehr in Chuck Morris – im<br />
Herbst zur Königin gekrönt, von den Pressediensten weitgehend<br />
unbemerkt. Der Beiträge tollster Etikettenschwindel:<br />
souvereines.<br />
Dieses Festival ist ein einziges Wagnis.<br />
Es begegnet dem Zeitgeist mit dessen ureigenen Mitteln. Man<br />
möchte den Künstlern gar „Modernität“ vor die Füße speien.<br />
Vielleicht weil Ersterer der Kunst die Klauen geklaut hat:<br />
Verfremdung und das gänsefüßige Als-ob sind im Dunstkreis<br />
der Freischwimmer-Stationen längst mehrheitsfähig. Und was<br />
die Leute sowieso schon machen, hat a priori einen schalen<br />
Eigengeschmack. Am deutlichsten vielleicht wenn es um einen<br />
Austausch der ganz anderen Art geht, so einen Austausch<br />
ohne Saft, wie er im CMMN SNS PRJCT von Laura Kalauz und<br />
Martin Schick praktiziert wird. Schnöde Waren und Juristereien,<br />
eingespielte und wohlgeformte Vorgänge aus anständigen<br />
Berufen. Eben solchen, in denen Entscheidungen neuerdings<br />
aus Alternativlosigkeit gefällt werden.<br />
Auf wessen Seite wird sich das Festival Freischwimmer 2011<br />
schlagen? Wird es den Zeitgeist mit seinen eigenen Waffen<br />
über den Löffel barbieren oder begnügt es sich mit schmarotzerhafter<br />
Koexistenz bis schrankenloser Anbiederung?<br />
¹ Und wir lauschen dicken Männern mit Bärten, die Männer<br />
mit dicken Bärten zitieren, die das alles immer schon<br />
gewusst haben.
Vom Seepferdchen zum Freischwimmer<br />
Interview mit Haiko Pfost von Vanessa Scharrer und<br />
Daniela Scheidbach, 05.04.2011<br />
<strong>brut</strong> Künstlerhaus. Haiko Pfost. Wasser und Zigaretten. Unser<br />
Aufnahmegerät und jede Menge Fragen zum diesjährigen<br />
Freischwimmer-Festival. „Rückzug ins Öffentliche“ ist das politisch<br />
angehauchte Thema des Festivals 2011. Entsprechend<br />
brisant sind auch einige Produktionen, die in diesem Jahr<br />
aufgeführt werden und sich im künstlerisch-ästhetischen Feld<br />
an die Thematik heranwagen. Haiko Pfost hat uns Rede und<br />
Antwort gestanden.<br />
e-<strong>xilant</strong>: Seit wann und warum arbeitet das <strong>brut</strong> mit dem<br />
Freischwimmer-Festival zusammen?<br />
Haiko Pfost: Seit 2007, eigentlich seitdem wir hier das <strong>brut</strong><br />
übernommen haben. Im Herbst haben wir eröffnet, und schon<br />
im Vorfeld haben wir uns mit den Partnern getroffen und<br />
unser Interesse bekundet, in das Freischwimmer-Festival einzusteigen.<br />
Das waren vorher vier Partner, die Sophiensaele in<br />
Berlin, Kampnagel Hamburg, Forum Freies Theater Düsseldorf<br />
und das Theaterhaus Gessnerallee in Zürich. Es hat aber in Österreich<br />
ein Partner gefehlt, das lag einfach daran, dass es kein<br />
Koproduktionshaus gab in dem Sinne, wie es die anderen sind.<br />
Und eine unserer Aufgaben besteht auch darin, eine internationale<br />
Vernetzung voranzutreiben.<br />
e: Wie koordiniert man ein Festival, das in fünf verschiedenen<br />
Städten und drei verschiedenen Ländern stattfindet?<br />
HP: Dafür gibt es eine Produktionsleitung und eine Produktionsassistenz,<br />
die sitzen in Berlin, die koordinieren das ganze<br />
Festival-Touring. Das heißt, die Dinge werden zwar vor Ort<br />
produziert, gehen dann aber als Paket zur Premiere nach<br />
Berlin, und das muss auch organisiert werden. Es gibt auch<br />
einen Freischwimmer-Coach, Markus Droß, der die Gruppen<br />
auch inhaltlich noch mal begleitet, und es gibt auch jemanden<br />
für die organisatorische Abwicklung, der die Organisation der<br />
Fracht und der Unterbringung organisiert.<br />
e: Wer trifft die Entscheidungen über die Reihenfolge der<br />
Städte? Beginnt das Festival immer in Berlin?<br />
HP: Ja, es beginnt immer in Berlin. Das liegt zum einen an<br />
der Tradition und zum anderen auch am Landeshauptstadt-<br />
Kulturfond, der durch die Finanzierung den Anspruch auf die<br />
Uraufführung hat. Und dann tourt es durch die Städte, und es<br />
kommt auf die Spielpläne der Häuser an, da spricht man sich<br />
ab, wann es am besten passt.<br />
e: Wie kam es zum Thema „Rückzug ins Öffentliche“? Es unterscheidet<br />
sich durch seine genaue Definition deutlich von den<br />
Themen „Rausch“ (2008) und „Schock“ (2009/10). Wurde es<br />
von den freien Produktionshäusern gemeinsam beschlossen?<br />
HP: Wir arbeiten zusammen bei der Entwicklung des Festivals.<br />
Es gibt fünf Kuratoren, von jedem Haus einer, der dafür<br />
zuständig ist und das Festival auch betreut. Nachdem wir<br />
zwei eher ästhetische Begriffe hatten, also eben „Rausch“<br />
und „Schock“, wollten wir dieses Jahr politisch etwas konkreter<br />
werden. Die Ausschreibung lief aber noch sehr allgemein<br />
unter dem Begriff „Öffentlich“. Und wir haben uns dann erst<br />
nachdem wir die Projekte kannten entschieden, den Titel noch<br />
mal zu verschärfen. „Rückzug ins Öffentliche“ als Kontrapunkt<br />
zu „Rückzug ins Private“, was ja mal ein politischer Slogan war,<br />
der aber heute so nicht mehr gilt, weil eigentlich alles privat<br />
ist und die Frage ist: Was für eine Öffentlichkeit kann man<br />
eigentlich noch schaffen? Muss man sich nicht auch eine andere<br />
Form von Öffentlichkeit generieren, und was ist das dann,<br />
was könnte das für ein Rückzug sein? Das hat für uns dann<br />
auch als Slogan funktioniert, um auch das Festival noch mal<br />
präziser zu transportieren.<br />
e: Was muss eine Künstlergruppe tun, um bei dem Festival<br />
mitwirken zu können?<br />
HP: Es gibt eine Ausschreibung im Internet, dort findet maneinen<br />
kleinen formalen Text, also was für Bedingungen es gibt<br />
(Uraufführung, Konzept), und dann gibt es ein Bewerbungsformular<br />
mit einer kurzen Zusammenfassung und der Vita<br />
der Künstler. Dabei ist es sehr unterschiedlich, wie konkret<br />
die Künstler sein wollen. Wir versuchen deshalb auch bei den<br />
Stücken, die wir in die nähere Auswahl nehmen, uns mit den<br />
Leuten zu treffen und mit ihnen vorab ein Gespräch zu führen,<br />
um das Projekt besser einschätzen zu können.<br />
e: Wie groß war der Bewerbungspool? Haben sich die Bewerbungen<br />
in den letzten Jahren in einer besonderen Weise<br />
verändert, dadurch, dass das Festival bekannter wird?<br />
HP: Es pendelt immer so zwischen 120 und 160 Bewerbungen,<br />
allein in <strong>Wien</strong> haben wir zwischen 30 und 40 Bewerbungen.<br />
Und in den letzten Jahren, also seitdem wir dabei sind, hat sich<br />
die Anzahl erhöht.<br />
e: Lässt sich qualitativ auch ein Unterschied feststellen?<br />
HP: Jein, es ist immer unterschiedlich. Es gibt stärkere und<br />
09
schwächere Jahrgänge, aber es ist oft so, dass es herausragende<br />
Positionen gibt, aber auch Sachen, die überhaupt nicht<br />
funktionieren. Es gibt aber auch Jahrgänge, in denen das<br />
Niveau gleich gut ist. Nachdem es sich um ein Nachwuchsfestival<br />
handelt, geht es eher darum, die Entwicklung zu begleiten,<br />
um zu sehen, wo geht jemand hin. Es geht nicht darum,<br />
dass man die Highlights erwarten kann oder soll. Es ist eine<br />
Art Spielwiese.<br />
e: Nach welchen Kriterien wurden dann die Vorschläge der<br />
Künstler ausgesucht, um produziert zu werden?<br />
HP: Es ist ja eine Ausschreibung und man kann sich bei einem<br />
der Häuser bewerben. Wir machen eine Liste und tauschen<br />
die Projekte dann auch aus. Das heißt, jeder kann die Projekte<br />
der anderen auch einsehen. Und dann diskutieren wir eine<br />
nähere Auswahl an Künstlern in der ersten Runde, so eine Art<br />
Shortlist, wo wir uns dann auch Videomaterial anschauen und<br />
Erfahrungsberichte austauschen. Schließlich geht es darum<br />
ein breites Spektrum an ästhetischen Ansätzen abzudecken,<br />
zum andern auch darum die einzelnen Koproduktionshäuser<br />
abzudecken. Das heißt, jedes der Häuser produziert mindestens<br />
eine Position. In der Regel gibt es dann noch eine sechste<br />
Position, die noch offen ist, um auch eine Flexibilität zu haben.<br />
Die kann dann mal aus <strong>Wien</strong> oder aus Zürich kommen. Dieses<br />
Jahr haben wir einen Spezialfall, dass wir uns sogar für sieben<br />
Produktionen entschieden haben. Es war uns auch wichtig,<br />
dass die Stücke unterschiedlich sind, also Performance und<br />
Live Art und Puppenspiel, dass ein breites Spektrum an ästhetischen<br />
Positionen zustande kommt.<br />
e: Handelt es sich also dabei um schon aufgeführte Stücke?<br />
HP: Nein überhaupt nicht, das sind nur Konzepte, das ist ein<br />
Produktionsfestival, und das ist auch ganz wichtig.<br />
e: Wie kann man sich dann schon Videomaterial ansehen?<br />
HP: Von den schon aufgeführten Stücken – nicht von den<br />
vorgestellten Projekten. Dieses Jahr haben wir den Sonderfall<br />
in der <strong>Wien</strong>er Ausgabe: Your Majesties. Das ist so eine Spezialsache<br />
von Alexander Deutinger und Marta Navaridas. Die<br />
haben sich auch für das Festival beworben, und wir fanden<br />
die Produktion sehr interessant, sie war aber schon fertig,<br />
deswegen ist sie auch aus formalen Gründen ausgeschieden,<br />
andererseits hat sie inhaltlich sehr gut gepasst, deswegen präsentieren<br />
wir sie als Spezialprogramm nur in <strong>Wien</strong>. Aber fast<br />
jedes Haus macht so eine Art Rahmenprogramm, ob das jetzt<br />
eine spezielle Installation ist oder eine Diskussionsrunde oder<br />
wie wir, die eine Festivalzeitung anbieten. Und wir machen<br />
meistens noch ein Gastspiel dazu.<br />
10<br />
e: Von wem werden die Kosten übernommen?<br />
HP: Es handelt sich um eine Mischfinanzierung, das heißt, die<br />
Häuser sind mit einem Beitrag von 7500 € beteiligt. Aber die<br />
Gruppen versuchen dann noch, durch zusätzliche Anträge<br />
Geld zu bekommen. Das Festival hat nämlich noch die zusätzliche<br />
Finanzierung vom Hauptstadtkulturfonds in Berlin. Und<br />
aus diesem ganzen Pott werden sowohl die Produktionskosten<br />
anteilig übernommen als auch das komplette Touring bezahlt.<br />
e: Was hört man noch von den ausgewählten Künstlern?<br />
Macht sich die Förderung direkt bemerkbar?<br />
HP: Für das Haus ist es immer gut gelaufen. God's Entertainment<br />
haben sich beispielsweise schon sehr stark durchgesetzt.<br />
Sie zeigen sehr viel auch im Ausland, sie sind viel unterwegs<br />
und machen auch Koproduktionen mit Kampnagel Hamburg<br />
oder mit dem Hebbel am Ufer in Berlin. So auch die Rabtaldirndln.<br />
Das ist genau das, was erreicht werden soll, eben eine<br />
Anbindung an andere Produzenten zu finden.<br />
e: Gab es bei den Lovefuckers mit King of the Kings keine<br />
Angst vor dem heiklen politischen Thema?<br />
HP: Die Angst kam erst später. Denn die politische Lage war<br />
eine andere, als das Stück ausgewählt wurde. Die Gruppe<br />
wurde von den Ereignissen überrollt. Es handelt sich um eine<br />
musicalhafte Inszenierung über Muammar al-Gaddafi, er<br />
sollte auf der einen Seite karikiert werden, aber einige seiner<br />
Thesen sollten auch beleuchtet werden, die durchaus relevant<br />
sein können. Es hätte ein Spiel ohne größere politische Belastung<br />
werden können. Einerseits sagt man dann, dass man den<br />
richtigen Riecher hatte, andererseits ist es schwierig für die<br />
Produktion in einem Klima, in dem Menschen sterben. Wenn<br />
man davon gewusst hätte, wäre man anders an die Produktion<br />
herangegangen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass das Publikum<br />
weiß, dass es sich hier um ein Problem handelt, und es<br />
auf dieser Folie lesen kann.<br />
e: Nur Barbara Ungepflegt geht mit Notstand auf die Straße,<br />
in die echte Öffentlichkeit. Gingen die Überlegungen nicht in<br />
die Richtung, das Thema auch auf die Räume zu übertragen?<br />
HP: Wir waren voll aufgeschlossen, wir dachten, es gibt mehr<br />
Bewerbungen, die in den <strong>öffentlich</strong>en Raum wollen, das ist<br />
aber nicht geschehen und deswegen war es uns auch sehr<br />
wichtig, dass die Produktion von Barbara Ungepflegt mit dabei<br />
ist, weil sie auch eine andere Wirkung hat. Eine Inszenierung<br />
im <strong>öffentlich</strong>en Raum ist immer eine andere, und ich finde,<br />
es ist wichtig, dass es gerade bei diesem Thema diesen<br />
Beitrag gibt.
e: Wie sehr unterscheiden sich die Produktionen in den einzelnen<br />
Städten voneinander?<br />
HP: Also die Produktion Notstand wird in Zürich oder Berlin<br />
ganz anders aussehen als in <strong>Wien</strong>, da die Orte bzw. die<br />
Aufführungsmöglichkeiten unterschiedlich sind.<br />
Ich kann das gerade für Barbara Ungepflegt nicht einschätzen,<br />
ich habe sie nur in Berlin gesehen. Aber es unterscheidet sich<br />
grundsätzlich immer sehr, weil die Räume andere sind, weil die<br />
Institutionen mit ihrem Programm auch immer ein anderes<br />
Publikum haben, andere Sehgewohnheiten und eine andere<br />
Mentalität in der Zuschauerschaft. Ich denke aber, das ist das<br />
Interessanteund das, was das Freischwimmer-Festival bieten<br />
kann. Dass die Künstler die Erfahrung machen können, dass<br />
etwas in Hamburg super funktioniert und in Zürich überhaupt<br />
nicht. Dass der Raum in Berlin zu groß ist und in <strong>Wien</strong> zu klein.<br />
Es handelt sich also um fünf unterschiedliche Erfahrungen und<br />
das schätzt man am Anfang gar nicht so ein, aber es ist wichtig,<br />
diesen Weg als Künstler zu gehen und diese Erfahrung zu<br />
machen. Das ist, wie ich finde, einer der wesentlichen Punkte,<br />
warum wir beim Freischwimmer-Festival mitmachen.<br />
Von daher ist es nicht nur für Barbara Ungepflegt wichtig,<br />
sondern für alle anderen ebenso.<br />
Bildrechte: Nathalie Knoll<br />
e: Was wäre der Wunsch für die Zukunft? Sollen noch mehr<br />
Städte oder Länder dazukommen?<br />
HP: Es gibt immer Anfragen von Leuten, die mitmachen wollen,<br />
aber das bedeutet immer auch einen größeren Aufwand.<br />
Und um alles zusammenhalten zu können, braucht es eine<br />
Überschaubarkeit und man müsste vielleicht alles neu denken.<br />
Es hat sich aber auch in dieser Form etabliert, von daher sehe<br />
ich jetzt keinen großen Drang danach, etwas zu verändern. Die<br />
Frage wäre eher, wie man die Gruppen besser unterstützen<br />
kann. Auch was die finanziellen Möglichkeiten und die Betreuung<br />
angeht. Man sollte darauf achten, dass man den Leuten<br />
Raum und Möglichkeiten einräumt, damit sie ihre Chance<br />
nutzen können.<br />
11
Not ist eine Tugend? – Moment, das war doch die Geduld.<br />
Aber, da der Bauer in der Not die Wurst auch ohne Brot frisst,<br />
macht diese dann erfinderisch!? Oder war's am Ende doch<br />
etwas ganz Anderes? Das, oder so etwas in der Art, muss sich<br />
wohl Barbara Ungepflegt gedacht haben, als sie die ersten<br />
Ideen zu ihrem Projekt Notstand geboren hatte, mit dem sie<br />
an dem diesjährigen Freischwimmer-Festival teilnimmt und<br />
bereits erste Erfolge in Berlin und Hamburg verzeichnen kann.<br />
Hinter dem Projekt steht eine Dame, die sich selbst als Bedienerin<br />
bezeichnet und laut ihrer Homepage für einen Escortservice<br />
arbeitet – alles was der Kunde wünscht, nur zu gewissen<br />
Konditionen, versteht sich. Wer jetzt glaubt, Frau Ungepflegt<br />
würde eher horizontal als genial arbeiten, der täuscht sich.<br />
Denn das Einzige, womit sie sich und andere bedient, ist das<br />
Spiel mit Worten und deren Doppeldeutigkeit. Ergebnis daraus<br />
ist die entstehende Inhaltsveränderung, die am Ende manchmal<br />
verstörender wirken kann als so manch anderes Spiel.<br />
Unbekannt dürfte die österreichische Künstlerin für den Szenegänger<br />
in <strong>Wien</strong> jedoch nicht mehr sein, da sie schon in den<br />
vergangenen Jahren durch eigene Projekte wie die Misswahl<br />
2010 im Rathauspark oder als Mitwirkende in Julius Deutschbauers<br />
Werken in den medialen Vordergrund rückte.<br />
Notstand ist eine Mischung aus Installation und kleinen Minidramen.<br />
Die Entourage um diese doch eher geheimnisvolle<br />
Person Ungepflegt besticht durch konzeptionelles Chaos. Ein<br />
Hochstand, der als Notstand dienen muss, jedoch nicht um<br />
einen entspannten Ausblick auf die Welt zu erhaschen, sondern<br />
um den Eindruck zu vermitteln, dass der erste Blick auch<br />
trügerisch sein kann, wenn man genauer hinsieht. So heißt es,<br />
dass man beim Besteigen des Notstands notwendigerweise<br />
gesichert wird, damit das rustikale Flair genossen werden<br />
kann, das notgedrungen entsteht, sobald die Lebkuchenherzen<br />
und die restlichen selbstgebastelten Wanddekorationen auf<br />
die Netzhaut gelangen. Wer bei dieser Beschreibung an eine<br />
spießbürgerliche Wohnstube denken muss, wird leider (oder<br />
doch zum Glück?) enttäuscht werden, denn die Schriftzüge auf<br />
den kalorienreichen Kitschherzchen lassen deutlich die Thematik<br />
des Notstands erkennen, ohne aber jedoch den „I mog<br />
di“-Charme zu verlieren. Doch nicht nur Süßes hängt dort an<br />
den Wänden. Der Mutige wie auch beschämende ÖVP-Notnagel-Spruch<br />
„Mut zu Eliten“ ziert das Interieur – passend nicht<br />
in Stein gemeißelt, sondern fein gestickt,rot auf weiß. Doch<br />
12<br />
Not macht erfinderisch? – oder: Not, erfinderisch gemacht!<br />
Vorbericht von Florian Peter Pesel, 06.04.2011<br />
genau nach dem Motto: Wo das herkommt, gibt’s noch viel<br />
mehr, kann jede(r) BesucherIn sich selbst auf die Entdeckungsreise<br />
zu den von Barbara Ungepflegt aufgezeigten Nöten machen.<br />
Erwarten muss und darf man viel Kitschiges, Spießiges,<br />
Belustigendes, Erschreckendes, Kreatives und Beschämendes.<br />
Zu entdecken gibt es jedenfalls genug, und nicht nur weil die<br />
Stadt <strong>Wien</strong> ihren Teil dazu beigetragen hat, dass das ganze<br />
Vorhaben der ungepflegten Frau ein Erfolg werden kann.<br />
Denn auch die Vielfalt der Ideen wird nicht aus der Not heraus<br />
auf das Essenziellste beschränkt, das heißt platt gesagt: alles<br />
für alle, oder mit den Worten der Künstlerin: Kunst für alle!<br />
Letztendlich heißt es dann wohl Überfluss im Notstand, oder<br />
aus der Not eine Tugend machen. Die Tatsache, dass Frau Barbara<br />
Ungepflegt an jedem Festivaltag eine Vorstellung ihres<br />
Notstands gibt, die täglich variiert, zeugt allerdings auch von<br />
enormem Mitteilungsbedürfnis und Spaß an der Freude.<br />
Wem diese Beschreibung jedoch zu undurchsichtig ist und wer<br />
noch nicht ganz begriffen hat, worum es Frau Ungepflegt eigentlich<br />
geht, dem ist es wärmstens empfohlen, der notleidenden<br />
Welt der Barbara Ungepflegt einen Besuch abzustatten<br />
und sich davon einen eigenen Eindruck zu schaffen – natürlich<br />
ganz nötigungsfrei!
<strong>Wien</strong> im Notstand – Now or never?<br />
Kritik von Olivia Lefford, 08.04.2011<br />
Verwunderung. Verwirrung. Staunen. Das sind einige jener<br />
Attribute, die den Zustand beschreiben, in den einen das „Bühnenbild“<br />
des Stückes unmittelbar versetzt. Die Regisseurin Barbara<br />
Ungepflegt stößt uns damit noch vor dem eigentlichen<br />
Beginn des Stückes ins Thema. Indem sie den Theaterraum ins<br />
Öffentliche verlegt, schafft sie einen performativen Raum an<br />
der Schnittstelle zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, der<br />
uns unmittelbar die Verschränkung dieser beiden dissonanten<br />
Räumlichkeiten erfahren lässt. Durch die Schaffung eines in<br />
solcher Art gestalteten Zeitraumes wird der Zuseher in die unklare<br />
Position hinsichtlich der räumlichen als auch zeitlichen<br />
Struktur des Stückes versetzt. Ganz nach dem Motto gemeinsam<br />
einsam zu sein – in einer Welt der „Social Media“, in der<br />
Verbindlichkeit und Nähe weniger Platz zu haben scheinen als<br />
die ewige Selbstdarstellung von Individuen.<br />
Barbara Ungepflegt nennt sich die Akteurin, die eine Bedienerin<br />
darstellt. Als solche bedient sie laut eigenen Aussagen andere<br />
und bedient sich jedoch selbst auch von anderen. In einer<br />
One-Woman-Show eröffnet sie die Aktion mit feierlicher und<br />
dennoch einsamer Blasmusik. Sie marschiert in rhythmischen<br />
Schritten gezielt auf ihren nicht übersehbaren Hochstand zu.<br />
Was der Hochstand nicht zu sein scheint, und zwar stabil, das<br />
gleicht Barbara Ungepflegt gekonnt aus, indem sie ihre eigene<br />
Standhaftigkeit im Gefüge des wackeligen Notstandes unter<br />
Beweis stellt.<br />
Noch immer weht ein leichter Wind der Verwirrung durch das<br />
Publikum. Liegt dies vielleicht an Barbaras rosa Turnschuhen<br />
oder ihrem Trachtenkostüm mit dazu passendem Hut? Ratlos<br />
steht das Publikum um Frau Ungepflegt und ihrem Notstand<br />
herum und grübelt: Wozu das Ganze? Statt Klärung fordert<br />
sie das Publikum auf, mit ihr gemeinsam die Teilnahmebedingungen<br />
für den Notstand im Chor zu lesen, was nicht nur zum<br />
dramaturgischen Teil des Stückes gehört, sondern auch zur<br />
rechtlichen Absicherung dient.<br />
Die Künstlerin fordert einen Notstand, der für alle leistbar ist.<br />
Mit spontanen Pointen und einem nicht identifizierbaren Lied,<br />
das sie dann zu singen beginnt, schöpft man als Zuschauer<br />
langsam Vertrauen in das, was sie tut.<br />
Es folgt traditionsgemäß die Taufe des Notstands, in dem sie<br />
eine Flasche Sekt mit Schwung auf dem Gerüst zum Platzen<br />
bringen möchte. Der Flasche zum Trotze, die sich nicht und<br />
nicht zerstören lassen will, sind laut Frau Ungepflegt aller<br />
guten Dinge nicht drei, sondern hundert, und so lässt sie den<br />
Sekt großzügig ans Publikum verteilen, was definitiv guten<br />
Anklang fand. Prost!<br />
Nach dem „spontanen“ Umtrunk lädt Frau Ungepflegt dann<br />
jeden Einzelnen ein, ihren wackeligen Notstand zu besteigen.<br />
Somit löst sie die Unterscheidung zwischen Akteur und Publikum<br />
auf und lässt den Zuseher so wiederholt die Dialektik<br />
von Freiheit und Sicherheit erfahren. Schnell findet sich ein<br />
tapferer Freiwilliger aus dem Publikum, der den Thron des<br />
Notstands als Erster besteigen will. Getreu dem Prinzip „safety<br />
first“ wird der Sicherheitsgurt umgeschnallt, und schon startet<br />
der Mann in Richtung Glück. Raus aus dem Alltag. Rein in<br />
den Notstand. In der Folge finden sich noch weitere Mutige,<br />
die sich auf den Gipfel des Notstands wagen, sei es aus Neugierde<br />
oder aus Verzweiflung.<br />
Obwohl Realität und Performance permanent vermischt<br />
werden und dies mit Sicherheit für Verunsicherung gesorgt<br />
hat, war es auf jeden Fall ein gelungener Auftakt zum<br />
Freischwimmer-Festival!<br />
Eine nicht nur wetterbedingte Erfrischung scheint diese<br />
Produktion ohnehin zu werden. Wer zur Premiere nicht<br />
anwesend sein konnte, der hat bis zum Festivalende noch<br />
jeden Tag die Gelegenheit, seinen persönlichen Notstand<br />
zu erklimmen. Abwechslung ist dabei garantiert! Ein handschriftlich<br />
geschriebenes Gewinnspiel wird ans Publikum<br />
verteilt und bringt Schwung in die relativ banale Handlung.<br />
Mit ein bisschen Glück kann man nach Ausfüllen des Teilnahmescheins<br />
vielleicht ein romantisches Candle-Light-Dinner<br />
für eine Person gewinnen.<br />
13
„So schön kann Notstand sein“<br />
Die ersten drei Tage Notstand in <strong>Wien</strong><br />
von Theresa Naomi Hund, 11.04.2011<br />
Notstand. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung bezeichnet<br />
dieser allgemein „einen die Lebensbedingungen gefährdenden<br />
Zustand, der nur mit außergewöhnlichen Mitteln<br />
beseitigt werden kann (…)“ Barbara Ungepflegt hat da(zu) eine<br />
Idee. Schließlich macht Not erfinderisch. Tag 1: Ein Standort in<br />
Not? Ein Notstand auf dem Vorplatz des Künstlerhauses. Dessen<br />
Besitzerin ist Barbara Ungepflegt, welche am 08.04.2011<br />
gegen 19.10 offiziell den Notstand in <strong>Wien</strong> eröffnet hat. Der<br />
Notstand wird hier verkörpert durch einen Hochstand, welcher<br />
von Notbedürftigen täglich für eine Stunde bestiegen werden<br />
darf. Anstatt rauszugucken, schaut man hier rein. Steigt<br />
die Holztreppe hinauf und begibt sich in den Innenraum des<br />
Außenraumes, dann gibt es allerlei zu entdecken. Lebkuchen,<br />
Postkarten, ein Video von und mit Frau Ungepflegt, ein akustisches<br />
Klangerlebnis, welches durch Ziehschnüre aktiviert<br />
werden kann, eine Sitzbank, ein Gästebuch, welches anhand<br />
der Abnutzungsspuren bereits in vielerlei Händen gewesen<br />
zu sein scheint. Ein Notstand mit Geschichte. Erinnerungen<br />
an frühere Kindheitstage, an Wald und Wiesen, an heimliche<br />
Versteckspiele in Hochsitzen. Im Gegensatz zu früher kommt<br />
heute aber kein Jäger mehr, der einen verjagt – im Gegenteil.<br />
Die Gegenwart meint es gut mit uns und schickt uns Frau Ungepflegt,<br />
welche zwar in Jagdgewand gekleidet, jedoch nicht<br />
als Moralpredigerin, sondern als Bedienerin fungiert. Sie fragt<br />
nach unseren Notständen und versucht, ganz im Sinne ihrer<br />
Bedienerrolle, diese zu lindern. Bereits in den ersten Minuten<br />
ihrer Live-Art-Performance wird deutlich, dass im Notstand<br />
ein anderer Ton angeschlagen wird. Da ist tatsächlich jemand,<br />
der helfen will, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen –<br />
Irritation. Man ist ja eher skeptisch als beglückt. Wen wundert<br />
es? Wo gibt es denn heute noch was umsonst? Nichtsdestotrotz,<br />
der Notstand interessiert. Hier tritt er nun endlich für<br />
jeden sichtbar, fühlbar, sogar begehbar in Erscheinung. Aber<br />
das ist für die meisten dann doch zu viel, sie bleiben lieber in<br />
sicherer Distanz.<br />
Notstand bildet. Tag 2: Heute auf dem Programm? Notstandsjapanisch<br />
für Fortgeschrittene und die Ziehung des<br />
Gewinners des gestrigen Gewinnspiels. Bei diesem konnten<br />
alle Besucher des Eröffnungstages teilnehmen, der Sieg ist<br />
eine Übernachtung mit Candle-Light-Dinner im Notstand, das<br />
mögliche Notstandsessen: „Falscher Hase“. Der Glückliche ist<br />
Eduard, doch leider erfährt dieser aufgrund seiner Abwesenheit<br />
erst später von seinem Gewinn. Die Anwesenden haben<br />
14<br />
zuvor schon Glück, so lernen sie, dank Langenscheidt, ein paar<br />
japanische Wörter. Der Notstand ist aktuell, greift globale<br />
und gesellschaftspolitische Themen auf. Einzelne Besucher<br />
werden auch heute wieder nach ihren Notständen befragt.<br />
Frau Ungepflegt, ganz Menschenfreund, posaunt die Antwort<br />
ihrer Notleidenden nicht in die Runde, sondern versucht visà-vis<br />
zu helfen. Immer mal wieder traut sich ein Notdürftiger<br />
empor, und manchmal wird der Abstieg mit einem Hornblasen<br />
belohnt. Das Japanischüben geht weiter, das Wörterbuch wird<br />
zwischenzeitlich auch gerne aus der Hand gegeben. Integration<br />
statt Segregation. Man ist Teil der ganzen Szenerie, die<br />
Bühne ist dabei der ganze Vorplatz und die Protagonisten sind<br />
wir, die Besucher, die Interessierten, geführt und gelenkt von<br />
Barbara Ungepflegt.<br />
Not macht hungrig. Tag 3: Sonntag Ruhetag? Nicht im Notstand.<br />
Dieser öffnete wieder um 19 Uhr seine Pforten. Doch<br />
heute scheint alles anders. In Jeans und Pulli, ohne Blashorn<br />
und Hut bedient Frau Ungepflegt an ihrem Arbeitsplatz. Heute<br />
steht der Notstand ganz für sich, ohne viel Tamtam. Warten.<br />
Warten auf Godot? Nein, auf den Pizzaboten. Der gestrige<br />
Hunger mancher Notleidender ist wohl am Ort haften geblieben.<br />
Eine Notstandshelferin ruft beim Pizzataxi an: „Eine Pizza<br />
zum Notstand, bitte.“ Der Taxifahrer lässt sich sicherheitshalber<br />
die Handynummer geben. Denn wo bitte ist der Notstand?<br />
Warten. Immer mal wieder kommen Interessierte vorbei, einige<br />
wenige trauen sich. Kein Blasen, kein Applaus. Ist der Notstand<br />
heute im Ruhestand? Morgen ist Montag - vielleicht ist<br />
es auch die Ruhe vor dem Sturm. Der Notstand sollte entdeckt<br />
werden. Ob es acht Tage braucht, um die Mission Notstand zu<br />
erfüllen, ist zu hinterfragen. Doch warum die Hetze? Vielleicht<br />
ist es gerade das, was Frau Ungepflegt uns hier auf dem Notstand<br />
schenkt - Zeit. Sie ist die Antagonistin zu Momos grauen<br />
Männern, welche dem Kind in uns die Zeit stehlen wollen. Hier<br />
haben wir sie nun täglich von 19 bis 20 Uhr für uns und mit<br />
Barbara Ungepflegt. Zwischenbilanz: Ein Notstand ist nicht<br />
gleich ein Stand in Not. So stellte der erste Besucher des Notstandes<br />
folgerichtig fest: „So schön kann Notstand sein.“
„Angenehm, Ungepflegt.“<br />
Wildspezialitäten im Notstand<br />
Interview mit Barbara Ungepflegt von Nathalie Knoll<br />
und Kristina Kirova, 07.04.2011<br />
Am Tag vor dem Festivalbeginn machen wir uns auf den Weg<br />
ins <strong>brut</strong>. Wir sind in freudiger Erwartung des Interviews mit<br />
der Künstlerin Barbara Kremser alias Barbara Ungepflegt.<br />
Kaum biegen wir ums nächste Eck, sehen wir schon ihre<br />
Installation. Eine Jagdhütte mitten auf dem Vorplatz des <strong>brut</strong><br />
in sechseinhalb Meter Höhe. Neugierig nähern wir uns dem<br />
Objekt und versuchen hineinzuspähen, als uns von innen heraus<br />
jemand entgegenlacht. Es ist Barbara Ungepflegt höchstpersönlich.<br />
Barbara Ungepflegt versteht sich als Bedienerin<br />
jeder Art. Außerdem ist sie Schauspielerin, Künstlerin und<br />
Performerin. Sie studierte Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft<br />
und tourt nun mit ihrem Notstand im Rahmen des<br />
Freischwimmer-Festivals durch Deutschland, Österreich und<br />
die Schweiz.<br />
Bildrechte: Nathalie Knoll<br />
e-<strong>xilant</strong>: Was hat es mit dem Namen Barbara Ungepflegt auf<br />
sich?<br />
Barbara Ungepflegt: Barbara Ungepflegt hat den Namen<br />
Ungepflegt gewählt, weil sie sich als Bedienerin sieht. Das<br />
heißt, ich fühle mich als Frau oft als Bedienerin gebraucht,<br />
andererseits bediene ich mich auch ganz vieler anderer Dinge,<br />
und diese Wechselwirkung in unserer auch serviceorientierten<br />
Gesellschaft finde ich ganz spannend und damit setze ich<br />
mich auch sehr oft auseinander. Ich find es einfach auch<br />
schön, wenn man vorgestellt wird und man sagt dann:<br />
„Angenehm, Ungepflegt.“<br />
e: Du betreibst ja einen Escortservice, worum geht es dabei<br />
eigentlich genau?<br />
BU: Mein Escortservice ist in erster Linie ein Begleit- und Bedienungsservice,<br />
das heißt, dass ich sehr viele Lebensumstände<br />
sehr gerne begleite. Ich biete z. B. sämtliche Verhinderungen<br />
an, sämtliche Begleitservices bei Problemfällen, wie z. B. das<br />
Angebot, dass ich anstelle von Eltern zum Elternsprechtag<br />
gehe. Wenn jemand sein Steckenpferd verloren hat, dann<br />
stelle ich ihm ein Neues zur Verfügung. Also ganz praktische<br />
Tipps und Serviceleistungen. Ein nächstes größeres Projekt im<br />
Escortservice Ungepflegt wird sein, eine Plattform zu schaffen,<br />
die „Baby to Go“ heißt. Das ist für alle Eltern, die nicht Eltern<br />
werden konnten oder wollten.<br />
e: Wie ist die Verbindung zwischen dem Thema „Rückzug ins<br />
Öffentliche“ und dem Notstand?<br />
BU: „Rückzug ins Öffentliche“ hat ja großteils im Fokus, dass<br />
aufgrund der Globalisierung und der neuen Medien wie Internet<br />
Leute sich immer mehr zurückziehen. Sie gehen in ihrer<br />
Gestalt nicht nach außen in die Öffentlichkeit, sind aber in<br />
diesem Rückzug aufgrund von Facebook und diesen ganzen sozialen<br />
und nicht sozialen, asozialen Netzwerken sehr suchend<br />
nach einer Verbindung mit der Welt. Und Notstand ist für<br />
mich in jederlei Hinsicht da vorhanden, zum einen emotionaler<br />
Notstand, dass man mit allen möglichen Leuten befreundet<br />
ist, die man überhaupt nicht kennt, das finde ich auch immer<br />
ganz merkwürdig. Zum anderen aber auch der Notstand, dass<br />
wir alle mitverfolgen, wie es eine Wirtschaftskrise gibt, und<br />
dann werden den Leuten, die überhaupt nie gezockt haben<br />
oder ganz absurde Geldgeschäfte gemacht haben, die Beträge<br />
dann auf die Steuern raufdividiert. Das erleben wir ununterbrochen,<br />
Notstand. Das schreit zum Himmel.<br />
15
Aber ursprünglich war für mich der Anlass für den Notstand<br />
der ganze Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche, und<br />
ich wollte den Notstand auch so stellen, dass man den Blick<br />
auf eine Kirche hat. Das ist in diesem Fall auch ganz gut<br />
gelungen. Man hat innen jetzt eine notdürftige Aussicht<br />
auf die Karlskirche.<br />
e: In welcher Not muss man sein, um im Notstand Unterschlupf<br />
zu finden?<br />
BU: Also das obliegt natürlich jedem Besteiger selbst, und<br />
es ist ja ganz individuell, was man als Not empfindet oder<br />
ob man sich selbst als notdürftig erlebt oder im Notstand<br />
befindet. Es ist jeder herzlich willkommen im Notstand. Der<br />
Notstand ist jetzt hier insgesamt sechseinhalb Meter hoch,<br />
aber ich finde, er könnte ruhig noch höher sein, er kann gar<br />
nicht hoch genug sein, aber dann würden es die Behörden<br />
wahrscheinlich überhaupt nicht mehr genehmigen.<br />
e: Wie war die Entwicklung der Installation vom Konzept bis<br />
zur Umsetzung, also bis zum Endprodukt?<br />
BU: Ich habe zuerst an diesen Notstand innerhalb der Kirche<br />
gedacht und es ist dann immer weiter gegangen, in verschiedenste<br />
Notstandsgebiete, was man auch wirklich in den<br />
Medien hört und liest. Für mich haben auch immer so solitäre<br />
Gebäude oder Objekte eine große Faszination ausgeübt.<br />
Außerdem habe ich mit Jagen eigentlich überhaupt nichts zu<br />
tun und persönlich auch nie was miterlebt. Aber die Tatsache,<br />
dass man ein Haus auf Stelzen baut, um rauszuschauen und<br />
etwas zu erlegen, fand ich dann schon sehr faszinierend. Weil<br />
ich auch sehr mit Sprache arbeite, hat mich natürlich dieses<br />
Sprachwortspiel „Hochstand-Notstand“ schon einmal sehr gereizt.<br />
Daher kam es überhaupt zu dieser Idee einen Hochstand<br />
als Notstand zu deklarieren.<br />
e: Wie ist das gemeint: „etwas erlegen?“<br />
BU: Man erlegt ja in einem Hochstand das Wild. Da sitzen<br />
dann die Jäger und Jägerinnen und erschießen das Rehschnitzel.<br />
Deswegen gibt es im Notstand nur eine notdürftige<br />
Aussicht. Man kann also leider niemanden erlegen. Man hat<br />
dazu nicht die Macht, außer man schlägt die Scheiben ein. Es<br />
soll auch eine sehr einladende Hütte sein, da oben auf Stelzen,<br />
darum steht auch „Zimmer frei“und „Bus willkommen“ drauf.<br />
Es passt zwar leider keine Busladung hinein, aber man kann es<br />
ja mal anbieten. „Wildspezialitäten“.<br />
16<br />
e: Das Festival hat ja bereits in Berlin und Hamburg Station<br />
gemacht. Wie waren die Reaktionen?<br />
BU: Es kommt vollkommen darauf an, wo der Notstand steht.<br />
In Berlin stand er in einem Innenhof von den Sophiensaelen.<br />
Aber so, dass man erst in einen Innenhof ging und dann erst<br />
sah man den Notstand. Und das war eine vollkommen andere<br />
Situation, nicht auf einem offenen Platz wie hier mit traditionellen<br />
Gebäuden, wie in einer geschlossenen Atmosphäre.<br />
Da waren die Leute auch überrascht, aber etwas überrumpelt.<br />
Es gab nämlich keinen Platz zum Ausweichen. Da stand man<br />
im Hof und gleich vor dem Notstand. Ich lade die Leute ja zu<br />
einem Besuch in den Notstand ein, der auch kostenlos ist. Und<br />
dann waren viele natürlich irritiert, manche haben lächelnd<br />
gesagt: „Haha, ich bin ja schon im Notstand.“<br />
e: Wie lang braucht man, bis man den Notstand aufgebaut<br />
hat?<br />
BU: So vier Stunden. Beim ersten Mal aufbauen haben wir<br />
neun Stunden gebraucht. Es wird immer schneller. In Düsseldorf<br />
wird’s dann ganz schnell gehen. Fast aufblasbar.<br />
e: Wir haben gelesen, dass sich der Notstand immer verändert.<br />
BU: Es kommt immer wieder ein bisschen was dazu. Ab morgen<br />
wirds am Dach auch eine Neonaufschrift mit „Notstand“<br />
zu sehen sein, sodass man auch am Abend aufmerksam darauf<br />
wird. Es gibt auch innen ein notdürftiges Video zu sehen, Themen<br />
wie „Genuss im Notstand“ und „Anstand im Notstand“.<br />
e: Der Notstand ist ja vollgestopft mit allen möglichen Kuriositäten.<br />
Was haben die Lebkuchenherzen zu bedeuten?<br />
BU: Die sind zum Teil Zitate aus der Bibel, zum Teil auch aufgeschnappte<br />
Kommentare von Menschen. Die habe ich selbst<br />
beschriftet. Man kann sie auch essen, wenn man will. Sie sind<br />
aber schon dreimal nass geworden, weil es so viel geregnet<br />
hat. Ich habe es innen so gestaltet, dass es wie in so einer<br />
geschmacklosen Skihütte aussieht, auch diese ganze Spaßgesellschaft<br />
finde ich ganz spannend.<br />
e: Was wäre dein Wunsch, wie sollen die Besucher den Notstand<br />
verlassen?<br />
BU: Mit viel Not. Ich habe eigentlich keine Wünsche in dem<br />
Sinn. Manche Dinge muss man einfach tun.
Furry Species –<br />
Back to Basics, denn Isegrim war gestern!<br />
Interview mit Corinna Korth von Christoph Wingelmayr<br />
und Birte Gemperlein, 07.04.2011<br />
Furry Species, das erste Bühnenwerk der Hamburger Künstlerin<br />
Corinna Korth, ist anders als so manch anderes Theater. Und<br />
weil es so anders ist, hat e-<strong>xilant</strong> sie gleich mal zum ausführlichen<br />
Interview getroffen. Mit dabei: Wolfshund Kojote.<br />
e-<strong>xilant</strong>: Corinna, in Furry Species geht es um das Hybridwesen<br />
Menschwolf oder Wolfsmensch. Wann haben Sie sich erstmals<br />
mit dem Thema Wolf auseinandergesetzt und warum?<br />
Corinna Korth: Ich beschäftige mich mit der Hybridwerdung<br />
seit 1995. Was mich interessiert hat, war der Gegensatz von<br />
mythologischem und biologischem Wolf. Der mythologische<br />
Wolf ist negativ besetzt und wird in Fabeln und Märchen auch<br />
so dargestellt. Dort erscheint er als gefräßig, dumm und verliert<br />
gegen Reineke Fuchs. Der biologische Wolf hingegen ist<br />
sozial, hochintelligent und eher scheu. Dieser Gegensatz hat<br />
mich erst mal interessiert. Ich hab viele Bücher dazu gelesen,<br />
Filme geschaut und das mit Fabeln abgeglichen. Dann hab ich<br />
überlegt, was das mit mir zu tun hat, weil ich auch immer sehr<br />
viel mit Hunden zu tun hatte. Das Domestizierte beim Hund<br />
gefällt mir nicht, ich mag diesen Wildheitsaspekt beim Wolf.<br />
Er lässt sich nur bis zu einem gewissen Grad domestizieren, sobald<br />
es um die Ehre oder den Stolz geht, lehnt er sich auf. Das<br />
Verhalten des Wolfs ist also unberechenbar. Ich hab angefangen,<br />
verschiedene Verhaltensweisen beim Tier zu untersuchen<br />
und diese mit menschlichem Verhalten zu vergleichen. So<br />
hab ich beim Menschen z. B. Dachstypen, Hundetypen oder<br />
Katzentypen entdeckt. Es geht darum, wie man sich zueinander<br />
verhält: Bildet man Rudel, geht man auf Distanz, ist man<br />
der Jäger oder ist man die Beute?<br />
e: Was kann man sich unter dem Institut für Hybridforschung<br />
vorstellen?<br />
CK: Das Projekt umfasst meine Arbeit seit 1995. Dabei habe<br />
ich mit vielen Leuten zusammengearbeitet. Diesmal arbeite<br />
ich mit einem Schönheitschirurgen zusammen, bei anderen<br />
Arbeiten mit Aikido-Sportlern. Die Athleten sollten sich z. B.<br />
in Tiere hineinversetzen und passende Kampfstile entwickeln,<br />
wie Schlangen-, Kranich- oder Drachentechnik. Dann fand ein<br />
zweistündiger Kampf mit Tiermasken statt und die Kontrahenten<br />
haben sich allmählich mit ihren Rollen identifiziert. Sie haben<br />
angefangen zu knurren oder tierartige Abwehrhaltungen<br />
einzunehmen. Für mich macht das Institut aus, Projektpartner<br />
und tierisches Restverhalten im menschlichen Verhalten zu<br />
finden, daran zu arbeiten und das zu verbildlichen.<br />
e: Was sagen Sie zu der Aussage „Tier ist das neue queer“?<br />
CK: Das ist sowas wie „Pink is the new black“, ein Slogan,<br />
der besagt, dass es wieder „in“ ist, zu seinen tierischen<br />
Wurzeln zurückzufinden.<br />
e: Wie kamen Sie auf die Idee, Furry Species auf die Bühne zu<br />
bringen?<br />
CK: Die Hamburger Dramaturgin Nadine Jessen hat mich<br />
angesprochen und geeint: „Eigentlich machst du Theater.“<br />
Ich hab bisher aber einen anderen Zugang gehabt, da ich aus<br />
dem Bereich der bildenden Kunst komme. Hauptsächlich führe<br />
ich Inszenierungen und Performances auf, die einen hohen<br />
wissenschaftlichen Anteil haben. Wir haben dann erst mal<br />
drei Monate daran gearbeitet und überlegt, wie man mein<br />
künstlerisches Schaffen sinnvoll innerhalb einer Stunde auf die<br />
Bühne bringen kann. Das unterscheidet sich wirklich nicht so<br />
sehr von dem, was ich sonst mache, nur dass ich mich normalerweise<br />
nicht auf einen zeitlichen und räumlichen Rahmen<br />
festlegen lasse.<br />
e: Wir haben in einem Interview gelesen, dass Sie Furry Species<br />
nicht als Kunst ansehen. Als was würden Sie es denn bezeichnen?<br />
CK: Für mich ist das ein Vortrag, der natürlich eine gewisse<br />
Fiktion beinhaltet, aber auch nur erst mal. Weil ich denke,<br />
dass der Weg, sich zu wandeln, passieren muss und dass wir<br />
als Menschen nicht mehr ausreichend sind, gerade wenn man<br />
sich jetzt so das Weltgeschehen anschaut. Es gibt kein Tier, das<br />
so viel zerstört oder so viele komische Dinge erfindet, die nicht<br />
zu Ende gedacht sind und die man dann nicht mehr beherrschen<br />
kann. Also so was wie „die Geister, die ich rief, werd ich<br />
nicht mehr los“. Und ich glaube, dass irgendeine Veränderung<br />
passieren muss, dass man sich wieder auf Urinstinkte besinnen<br />
muss. Man muss ein bisschen gucken, was die tierischen<br />
Mitbewohner so treiben, und das wieder neu erlernen. Es gibt<br />
ja viel Urwissen und ein paar Generationen vor uns konnten<br />
die Leute Wetter- und Tierverhalten lesen und sind anders damit<br />
umgegangen. Ich glaube, dass kaum jemand von uns das<br />
noch beherrscht oder sich damit beschäftigt.<br />
e: Für Ihre Untersuchungen sind Sie regelmäßig mit Wolfspelz<br />
und Wolfsmaske gekleidet als Mensch-Wolf-Mischwesen unterwegs.<br />
Was haben Sie dabei für Erfahrungen gemacht?<br />
CK: Viele Menschen haben wirklich die Fabel im Kopf.<br />
17
Wenn ich als Wolf unterwegs bin, sagen die meisten Eltern<br />
ihren Kindern: „Guck mal, da ist der böse Wolf.“ Obwohl ich<br />
nichts tue. Oder wenn ich <strong>öffentlich</strong>e Verkehrsmittel benutze,<br />
dann will niemand neben mir sitzen. Das ist schon diskriminierend.<br />
Ich nutze zwar Masken oder ein anderes Verhalten,<br />
aber eigentlich geht es um Anderssein und wie das von<br />
außen aufgenommen wird.<br />
e: Zu guter Letzt haben wir uns noch ein paar Stichworte überlegt.<br />
Was fällt Ihnen spontan dazu ein?<br />
Gläserner Mensch.<br />
CK: Unheimlich.<br />
e: Zivilisation.<br />
CK: Domestiziert, Zwangsjacke, mehr Wildheit.<br />
e: Arielle, die kleine Meerjungfrau.<br />
CK: Nett für Kinder, sprechende Tiere, Comics und Zeichentrick.<br />
Für Kinder sicher der richtige Schritt, um dann später beim<br />
Institut für Hybridforschung zu landen.<br />
18<br />
e: Corinna, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Interview!<br />
„Menschliche Mittelmäßigkeit“<br />
Besuch bei Dr. Dr. Hohl<br />
Kritik von Sebastian Schley, 09.04.2011<br />
Gerade haben die Zuschauer ihre Plätze wieder eingenommen,<br />
Haiko Pfost vom <strong>brut</strong> und Corinna Korth vom Institut für Hybridforschung<br />
entschuldigen sich für die technische Panne und<br />
die dadurch bedingte kurze Unterbrechung der Vorstellung.<br />
Wenig später funktionieren Bild- und Tonebene der Videoinstallation<br />
endlich, wie sie es offenbar von Anfang an sollten.<br />
So war der Ausfall der Bildebene offenbar kein dramaturgisch<br />
geplantes Ereignis. Schade eigentlich. Denn was die kommenden<br />
sechzig Minuten folgen sollte, hätte so manch einen<br />
unvorhersehbaren überraschenden Moment – das, was in<br />
der Sprache der Dramaturgen unter dem Begriff „plot point“<br />
bekannt ist – gut vertragen.<br />
Das Stück beginnt mit einer kurzen Videocollage, in der die verschiedensten<br />
Mensch-Werwolf-Mutationsprozesse der Filmgeschichte<br />
gezeigt werden. Im Anschluss stellt sich Corinna Korth<br />
als Mitarbeiterin des Institut für Hybridforschung vor. Ihre<br />
These: Hybrid statt Hybris. Oder anders: Mensch und Tier sollten<br />
miteinander zu einem neuen und besseren Hybridwesen<br />
verschmelzen. Diese Mensch-Tier-Werdung könne zum einen<br />
durch Fortpflanzung, zum anderen operativ erreicht werden.<br />
Warum das Erreichen dieses Hybridzustandes überhaupt<br />
erstrebenswert ist, erklärt Korth anhand einer im Hintergrund<br />
ablaufenden Powerpoint-Präsentation, in der wissenschaftliche<br />
Standardkenntnisse, mystische Halbwahrheiten und schierer<br />
Unsinn fließend ineinander übergehen. Einige Fakten werden<br />
genannt, die offenbar zum tatsächlichen Nachdenken über<br />
die Vorteile eines Mensch-Tier-Hybridwesens anregen sollen.<br />
An und für sich wäre das eine gute Idee im Inszenierungskonzept<br />
– die voreingenommen schnell als Unsinn abgetane These<br />
plötzlich argumentativ gut zu belegen. Allerdings tut Korth<br />
dies nicht.<br />
Denn die wenigen wissenschaftlichen Fakten, die genannt<br />
werden, dürften niemanden mehr wirklich vom Hocker reißen.<br />
Fledermäuse hören besser als Menschen, Leoparden laufen<br />
schneller, im Vergleich der Föten sehen einige Tiere dem Menschen<br />
erstaunlich ähnlich. Ja. Stimmt.<br />
Zusätzlich werden einige Argumente auf abenteuerliche Weise<br />
ideologisch aufgeladen. Der Mensch sei ein Wesen, welches<br />
sich durch eine Mittelmäßigkeit auf allen Gebieten auszeichne,<br />
Tiere also die besseren Menschen. Wie sich ein solch<br />
nichtskönnendes, durchweg mittelmäßiges Wesen im Zuge<br />
der inzwischen als sehr wahrscheinlich geltenden Evolution<br />
gegenüber sämtlichen anderen Tierarten behaupten konnte,<br />
wird nicht erklärt.
Stattdessen kommen plötzlich ganz andere Kontexte hinzu:<br />
Der Mensch macht sich von der Technik abhängig und<br />
schwächt seine Position dadurch selbst. Tiere tun dies nicht, da<br />
sie nicht auf Technik angewiesen sind. Ja. Stimmt auch. Aber<br />
sind sie deshalb freier als Menschen? Besser als Menschen?<br />
Man bekommt allmählich den Eindruck, dem Vortrag einer<br />
ideologisierten Tierliebhaberin zu lauschen. Es sind Momente,<br />
in denen man befürchtet, dass Korth hier ihr tatsächliches<br />
Menschenbild preisgibt. Denn für eine groteske Klamauknummer<br />
ist das Gesprochene und Gezeigte einfach nicht lustig,<br />
nicht komisch genug. Für eine ernsthafte Auseinandersetzung<br />
allerdings zu oberflächlich. Somit bleibt die Frage, was Furry<br />
Species eigentlich will.<br />
Im weiteren Verlauf des Stücks verkündet Korth ihr Vorhaben,<br />
zu einem Mensch-Wolf-Hybriden zu werden. Operativ – ironischerweise<br />
von Dr. Dr. Hohl. Als Beleg hierzu wird ein viel zu<br />
langes Video gezeigt. Korth sitzt beim Kieferorthopäden und<br />
lässt sich einen Gebissabdruck machen. Unzählige Minuten<br />
vergehen, bis der Abdruck endlich fertig ist. Der Mehrwehrt<br />
dieser Information: gleich null. Stattdessen bekommt die Inszenierung,<br />
deren Konzept bisher „nur“ einfach nicht wirklich<br />
aufgegangen zu sein schien, nun zusätzlich einen sehr amateurhaften<br />
Charakter.<br />
Abschließend verschwindet Korth von der Bühne, um kurze<br />
Zeit später von zwei Ärzten auf einer Krankenliege wieder in<br />
den Raum geschoben zu werden. Die Wolfs-OP beginnt. Einige<br />
Milliliter Blut werden in die erste Reihe gespritzt, die zuvor mit<br />
einer Folie geschützt wurde. Es ist, als hätte Korth irgendwo<br />
gelesen, dass man im zeitgenössischen Theater auf alle Fälle<br />
noch das Publikum einbinden und im Optimalfall sogar gegen<br />
selbiges vorgehen müsse.<br />
Schließlich wird der Hybridwilligen ein Wolfschwanz an die<br />
Strumpfhose genäht. Ihr Hund betritt die Bühne, und beide<br />
heulen zu einer abgewandelten Version von David Bowies<br />
„Heroes“, die auf die Thematik des Werwolfs umgedichtet<br />
wurde. Den wenig glorreichen Text gibt’s zum Mitlesen auf der<br />
Projektionsfläche. Das war’s dann.<br />
Furry Species lässt einen mit einem Gefühl von Gleichgültigkeit<br />
zurück. Die grundthematische Idee ist gar nicht schlecht,<br />
wurde allerdings wenig kreativ und noch weniger mitreißend<br />
umgesetzt. Was schon zu Beginn, innerhalb der ersten fünf<br />
Minuten, thematisch eingeführt wurde, hat man auf sechzig<br />
Minuten ausgedehnt, ohne zu brechen, ohne zu hinterfragen,<br />
ohne zu überraschen.<br />
Zugleich stellt sich die Frage nach der Intention des Stücks.<br />
Was wollte uns Korth eigentlich sagen? Eine mögliche Message<br />
verschwimmt an der Oberfläche.<br />
Es war, als würde man ein Fragment, ein noch unausgereiftes<br />
Konzept auf einer Probebühne betrachten. Dabei hätte die<br />
Thematik Potenzial gehabt – und Corinna Korth, die ihre Rolle<br />
im Übrigen gut und recht überzeugend gespielt hat, hat die<br />
Fähigkeit, diese umzusetzen.<br />
Es ist schade, wenn man abschließend sagen muss, dass der<br />
dramaturgisch spannendste Part der Inszenierung die unvorhergesehe<br />
Technikpanne zu Beginn war.<br />
Bildrechte: Gerhard F. Ludwig<br />
19
You never howl alone!<br />
Heraus aus der „zivilisierten“ Welt – hin zu unseren Urinstinkten<br />
Kritik von Christoph Wingelmayr, 08.04.2011<br />
Mit diesen Appellen brachte Corinna Korth vom Institut<br />
für Hybridforschung das Publikum in Wallung. Begleite sie<br />
auf ihrer Transformation hin zum Tier. Beobachte sie dabei<br />
– live. Sie führt in ihrer aktuellen Produktion Furry Species<br />
eine neue Form der Menschwerdung vor. Wir brauchen<br />
keine Hybris mehr, die Überheblichkeit hat uns nicht weit<br />
gebracht, der Hybrid ist das neue Konzept. Stärker, besser,<br />
überlegen, ein paar Schlagworte. Treffender kann man diese<br />
neue Schöpfung nicht beschreiben. Im Gegensatz dazu der<br />
mittelmäßige Mensch, dem es an Vielem mangelt. Auf der<br />
Suche nach einer neuen Identität können wir die Protagonistin<br />
begleiten, wie sie sich schrittweise zum Wolf wandelt.<br />
Sie wählt für sich den operativen Weg: kurz und schmerzlos,<br />
um so die Vorteile beider Spezies nutzen zu können.<br />
Ein Traum könnte wahr werden.<br />
Tatkräftig wird sie dabei unterstützt von Dr. Dr. Hohl und<br />
Bildrechte: Christoph Wingelmayr<br />
20<br />
seinem Operationsteam. Auf einer Gratwanderung zwischen<br />
Traum und Realität erleben wir eine Operation, die uns näher<br />
an das Animalische heranbringt.<br />
Der Handlungsstrang kratzt teilweise jedoch leider nur an der<br />
Oberfläche. Mehr Tiefgang hätte der Story gut getan. Dieses<br />
Thema bietet sich geradezu an, um noch tiefer zu graben<br />
und dem Publikum zahlreichere Facetten unserer degenerierten<br />
Zivilisation darzubieten. Zu Beginn schwächelt das<br />
Inszenatorische, hinkt an seinem videolastigen Vortrag. Mit<br />
der fortschreitenden Darbietung putzt sich das Bühnenwerk<br />
allmählich heraus und wird zu einer schaurig, aber liebevoll<br />
umgesetzten Performance. In dieser ist die Künstlerin zu Hause,<br />
hier liegen ihre Stärken. Ein sehenswertes Stück, mit dem<br />
uns Corinna Korth zum Nach- und Umdenken anregt.<br />
Heulen wir gemeinsam mit den Wölfen!!!
Pelz auf den Augen –<br />
Wie Furry Species schockiert<br />
Kritik von Vanessa Scharrer, 08.04.2011<br />
In letzter Zeit fühle ich mich so unwohl in meiner Haut! Angefangen<br />
bei den körperlichen Defiziten der Spezies Mensch, ein<br />
ständiger Aufwand, sich bei Kälte durch Kleidung zu wärmen<br />
oder sich bei Hitze zu kühlen, und weiter über die soziale<br />
Verstümmelung unseres natürlichen Gruppenverhaltens durch<br />
Arbeits- und Lebensverhältnisse, die uns zu funktionierenden<br />
Maschinen machen wollen. Ich will das so nicht mehr! Wer<br />
kann mir helfen?<br />
Das Institut für Hybridforschung hat meine Sorgen und<br />
Probleme erkannt und bietet mir endlich eine Lösung an, so<br />
zumindest die Versprechung. Befinde ich mich nun also im<br />
Konzerthaus des <strong>brut</strong> <strong>Wien</strong> in einer Lehrveranstaltung oder in<br />
einer Performance? Worin liegt die Grenze zwischen künstlerischer<br />
Performance und praktischer Lebenshilfe? Corinna Korth<br />
zumindest spricht ganz ernst und hochprofessionell zu mir als<br />
Partizipant einer Lehrveranstaltung. Sie will mir theoretisch<br />
erklären und praktisch zeigen, wie sie zum Wolf werden wird<br />
und was Hybride für einen Fortschritt in unserer Gesellschaft<br />
bedeuten würden.<br />
Die Menschen sind im Vergleich zu Tieren oft nicht so gut<br />
entwickelt, deutlich wird das am Frequenztest, bei dem selbst<br />
Fledermäuse besser abschneiden als der Mensch – verkörpert<br />
durch das Publikum. Noch immer haben Tiere eine untergeordnete<br />
Stellung bei uns Menschen, und die Verwandlung<br />
zum Tier wird in der Horrorfilmgeschichte gänzlich unzureichend<br />
dargestellt. Es wird mir zur Demonstration ein Zusammenschnitt<br />
aus verschiedenen Horrorfilmen gezeigt und ich<br />
werde gewarnt, dass es eventuell später Blut zu sehen geben<br />
wird. Vor lauter Angst interpretiere ich in die Bilderfolge von<br />
„Mond“ und Closeup auf ein „Auge“ die Szene aus Luis Buñels<br />
Film Un Chien Andalou hinein und warte auf den Einschnitt in<br />
das Auge, aber bis zum Schluss bleibt jegliches „Shocking“ aus.<br />
Weiter geht es mit renommierten Mitarbeitern des Instituts,<br />
darunter auch Kojote, der Wolfshund, der als Berater der tierischen<br />
Seite zur Stelle ist. Er kommt auch als zweite Chorstimme<br />
zusammen mit Corinna Korth zum Finale auf die Bühne.<br />
Was für Möglichkeiten habe ich nun, wenn ich mich für den<br />
besseren Weg der Tierwerdung entschieden habe? Zum<br />
einen können die Hybridmerkmale vererbt werden, gemäß<br />
der Mendel'schen Regeln, aber das ist keine Möglichkeit für<br />
den Menschen, der ohne solche Merkmale geboren wurde.<br />
Zunächst muss ich mich entscheiden, welchem Tier ich mich<br />
annähern möchte. Für Corinna Korth kommt der Wolf infrage;<br />
als Kind wusste sie nicht, zu welchem Tier sie tendiert, und es<br />
bedarf dafür einer gewissen Reife (das erinnert an den Konflikt,<br />
den auch Transsexuelle empfinden).<br />
Und dann folgt ein langes Video, in dem gezeigt wird, wie<br />
Corinna Korth zum Kieferorthopäden geht, aber die Praxis<br />
wird als eine spezielle Tierwerdungspraxis verkauft. Hier wird<br />
der komische Moment deutlich, weil jeder die Täuschung<br />
erkennen kann, aber weiterhin davon gesprochen wird, dass<br />
Corinna Korth eine Schnauze aus ihrem Gesicht machen will.<br />
Es bleibt aber bei ein paar aufgeklebten Vampirzähnchen.<br />
Weitergeführt wird der unrealistische Moment dann im<br />
großen Finale, als Corinna Korth schließlich operiert werden<br />
soll. Es wird feierlich eine Plastikplane unter roter Beleuchtung<br />
auf die erste Reihe zugetragen, und zwei Ärztinnen im grünen<br />
Kittel sprühen mit Desinfektionsmittel herum. Jetzt zumindest<br />
angespannte Stille unter den Zuschauern, aber Entwarnung.<br />
Ihr wird nur ein kleines Schwänzchen an die Stoffhose genäht,<br />
und das Publikum wird mit Kunstblut bespritzt. Nach der Operation<br />
folgt das schon erwähnte gesangliche Duett mit Kollege<br />
Kojote mit der wichtigen Botschaft, dass Wildheit Freiheit<br />
bedeutet und wir als Hybride niemals allein heulen müssen.<br />
Nachdem die Ernsthaftigkeit ein wesentlicher Teil der Performance<br />
ist, liegt hier das gemeinsame Moment in einer<br />
praktischen Lebenshilfe. Aber wenn wir auf die Anwendbarkeit<br />
schauen, finden wir Täuschung. Dadurch liegt die Vermutung<br />
nahe, die Hybridwerdung mit anderen ernsten Themen zu vergleichen,<br />
ob auch sie uns etwas vorspielen. Denn die Theorie<br />
enttäuscht uns oft, wenn es darum geht, sie mit der Wirklichkeit<br />
in Verbindung zu bringen. Alternative Lebensmodelle wurden<br />
verfasst, um das Leben der Menschen zu verbessern, aber<br />
sie verbleiben oft in der grauen Theorie, so wie ein Leben ohne<br />
Konsumterror oder absolut umweltfreundlicher Lebensweisen.<br />
Nicht schlecht, wie mich das Institut fast veralbert hätte, beinahe<br />
hätte ich Corinna ernst genommen.<br />
21
Juroren an Schauspielschulen haben ein besonderes Interesse<br />
am Scheitern ihrer Bewerber. Genauer: am Zusammenbruch,<br />
am Platzen ihrer Konzepte, vorbeugend säuberlich über- und<br />
zurechtgelegt. Der Schauspieler trennt sich von der Spreu<br />
derer, die unbedingt Schauspieler sein wollen, von den onanistischen<br />
Selbstdompteuren also, wenn es gilt, mit Pannen<br />
umzugehen. Just in dem Moment, in dem er den Boden unter<br />
den Füßen verliert, muss er sich ungebrochen in einen alternativen<br />
Bereich der Bühnenwelt flüchten. Ein Schauspieler<br />
entschuldigt sich nicht, schon gar nicht für Pannen, er weiß sie<br />
wie selbstverständlich in seine Bühnenwelt aufzunehmen, gar<br />
zwingend erscheinen zu lassen.<br />
Der Fehler erschließt zwei Optionen: mit ihm umzugehen oder<br />
ihn zu umgehen. Konfrontation und Vermeidung eines Problems<br />
aus denselben Wortbausteinen: Die deutsche Sprache<br />
scheint schon veranlagt zur Risikovermeidung. Dabei setzt erst<br />
der GAU die Kreativitätspotenziale des Menschen frei, wie sich<br />
im Vergleich der beiden Vorstellungen des Instituts für Hybridforschung<br />
wieder erwiesen hat.<br />
Am 8. April wäre dies wohl ein Verriss geworden. Die Technik<br />
funktionierte fast reibungslos, ansonsten nichts. Zu sehen war<br />
das schamhafte Ablesen eines Konzepts ohne Entäußerung,<br />
eine hölzerne Dressur, kleinlichst einstudiert. Der Versuch, sich<br />
unangreifbar zu machen, endete wie immer in der Peinlichkeit.<br />
Pointen kamen, kaum mehr zu detektieren, in wie komponierter<br />
Regelmäßigkeit zu spät, der Schauder des schlecht<br />
gemachten Witzes, in erkennbarer Unfreiwilligkeit. Man nahm<br />
Corinna Korth nichts ab. Dabei lebt ihre Performance vom<br />
Spannungsverhältnis zwischen Ernsthaftigkeit, dem wohl<br />
möglich echten Glauben an die Überlegenheit von Mensch-<br />
Tier-Mischwesen und der unmöglichen praktischen Realisation<br />
des Transformationsprozesses auf der Bühne. Man hätte die<br />
Verwandlung, das Annähen eines Schwanzes an die fleischfarbene<br />
Nylonhose, durchaus als bloße Illustration empfinden<br />
können und hätte sich gefragt, wie es wohl um die geistige<br />
Gesundheit der guten Frau Korth bestellt ist.<br />
Die Art der Verwandlung ließ allerdings keinen Zweifel daran,<br />
dass es sich nur um Bühnenshow handelt. Wenn Realität<br />
reklamiert wird, wo keine Realität sein kann, fliegt die Tarnung<br />
auf und endet im Bewusstsein des Beiwohnens einer großen,<br />
dazu schlecht gemachten Schau. Leider ist unweigerlich festzustellen:<br />
Corinna Korth ist gesund.<br />
22<br />
Bericht einer Bühnengeburt<br />
Vergleich der beiden Vorstellungen von<br />
Furry Species von Raimund Rosarius, 10.04.2011<br />
Und bei der zweiten Sitzung? Am 9. April geht alles schief,<br />
was schiefgehen kann. Hier ist von Glück zu sprechen, denn<br />
sonst hätte es diese Ehrenrettung für Corinna Korth nie<br />
gegeben. Gleich zu Beginn fällt die Technik aus, kein Bild, kein<br />
Ton, das System hat sich heillos verrannt. Zunächst vorsichtige<br />
Täuschungsversuche, als sich aber so gar nichts tut, wird<br />
schließlich ein Techniker herbeigerufen – die zuckersüße<br />
Sichtbarwerdung der Abhängigkeit vom Gegenfüßler, der<br />
die Technik dem Tier allein schon vorzieht, weil sie ihm den<br />
Lebensunterhalt sichert. Dann wird das Publikum in eine<br />
neuerliche Vorbereitungspause entlassen, das Ganze ist als<br />
Ganzes nicht mehr zu retten.<br />
Doch nach der Unterbrechung, vorrangig genutzt zur Besänftigung<br />
tierischer Triebe, erlebt das Publikum eine völlig<br />
verwandelte Corinna Korth. Das Konzept kann nicht mehr<br />
aufgehen wie durchgeplant, sie hat ihren scheinbar so sicheren<br />
Halt verloren, und genau deswegen ist alle Nervosität,<br />
alle Hölzernheit wie weggewischt und nur ein leichtes Zittern<br />
in den Händen gibt noch Auskunft über die Qualität der früheren<br />
Aufführung. Wir erleben eine Bühnengeburt.<br />
Das Publikum reagiert beständig, zumal die Pointen dieses<br />
Mal sitzen. Der Applaus ist nicht vergleichbar mit dem des<br />
ersten Abends, an dem die heutigen Bravo-Rufe blanker Hohn<br />
gewesen wären.<br />
Die Versatzstücke aus Vortrag, Filmausschnitten und Demonstration<br />
an Modellen hatten ohnehin eine eigene Qualität. Es<br />
fehlte lediglich der verbindende Kitt, eine Rhythmik, die Prise<br />
Improvisation, die zu jeder Bühnendarbietung unbedingt<br />
notwendig ist.<br />
Ratsam wäre, die Versatzstücke weniger starr aneinanderzureihen<br />
und den Abend mit viel Improvisation aus dem<br />
lebendigen Vortrag heraus zu gestalten, mit Streichungen und<br />
Zugaben aus dem Forschungs- und Ideenrepertoire, über das<br />
Corinna Korth ganz offensichtlich verfügt. Das sture Abarbeiten<br />
des ersten Abends könnte sich so nicht wiederholen.
(K)ein Bund fürs Leben<br />
maria magdalena und Gäste: Bis dass der Tod uns scheidet<br />
Vorbericht von Alisa Findling, 06.04.2011<br />
Geschenke bereits gekauft? Nein? Dann sollte man sich<br />
beeilen, denn am Eröffnungsabend des Freischwimmer-<br />
Festivals im <strong>Wien</strong>er <strong>brut</strong> wird zu einer polnischen Hochzeitsfeier<br />
geladen. Die Gäste werden gebeten, entsprechend dem<br />
feierlichen Anlass in festlicher Abendkleidung zu erscheinen<br />
und gute Laune mitzubringen, denn mariamagdalena und<br />
Gäste entführen die Zuschauer auf eine traditionell polnische<br />
Hochzeit mit reichlich Wodka, deftigem polnischem Essen und<br />
landestypischer Musik im Polkastil.<br />
Hinter dem Künstlernamen mariamagdalena verbirgt sich die<br />
1983 in Polen geborene Künstlerin Magdalena Chowaniec.<br />
2003 emigrierte sie nach Österreich und besuchte in Linz<br />
die Anton Bruckner-Privatuniversität. Nun ist die talentierte<br />
Polin bereits seit 2004 als Tänzerin, Performerin, Sängerin<br />
und Choreografin in Österreich tätig. 2007 rief sie schließlich<br />
das Künstlerkollektiv mariamagdalena ins Leben und arbeitet<br />
seitdem unter diesem Namen immer wieder mit unterschiedlichen<br />
KünstlerInnen zusammen.<br />
Beim diesjährigen Freischwimmer-Festival präsentiert uns<br />
Magdalena Chowaniec mit der Unterstützung von Mirjam<br />
Klebel, Georg Hobmeier und Thomas Proksch ihr neues Projekt<br />
mit dem Titel Bis dass der Tod uns scheidet. Den Stoff für ihre<br />
aktuelle Arbeit schöpft die gebürtige Polin aus ihren Wurzeln,<br />
bringt dem westlichen Publikum einen Teil ihrer Heimat näher.<br />
Dies ist mittlerweile das vierte Projekt der jungen Künstlerin.<br />
Die Vorgänger Hold Your Horses, Empathy Project Vol. I und The<br />
MOb: Fixing Freedom Tour waren in Österreich (u. a. im <strong>brut</strong>),<br />
Polen, Deutschland und den Niederlanden zu sehen, und daher<br />
wird möglicherweise auch der eine oder andere <strong>brut</strong>-Besucher<br />
Magdalena Chowaniec wiedererkennen.<br />
Aber nicht nur auf der Theaterbühne ist Magdalena Chowaniec<br />
anzutreffen, sie kann auch häufig als Frontfrau des<br />
Punk-Duos VALYA an der Seite des russischen Performancekünstlers<br />
Oleg Soulimenko, aber auch mit The MOb auf<br />
Rockbühnen bewundert werden. beim Auftritt von The MOb<br />
bei der Freischwimmer-Abschlussparty am 16. April im <strong>brut</strong><br />
kann man sich vom musikalischen Können der polnischen<br />
Künstlerin live überzeugen.<br />
Zuerst wird aber auf einer polnischen Hochzeit mit mariamagdalena<br />
und Gästen gefeiert, getanzt und getrunken. Diese<br />
Gäste sind wir! Das unbekannte Publikum wird zum Teil der<br />
Performance. Magdalena Chowaniec, selbst ledig, feiert mit<br />
uns, also ihren Gästen, in der Rolle der Braut den bekanntlich<br />
schönsten Tag im Leben. Der Hochzeitsgesellschaft wird ein<br />
Einblick in eine fremde Kultur mit all ihren Klischees und Bräuchen<br />
gewährt. mariamagdalena inszeniert ein gewöhnlich<br />
privates Ereignis und überträgt es in einen <strong>öffentlich</strong>en Raum,<br />
in ein Theater, macht es einer unbekannten Masse zugänglich<br />
und lässt sie am ursprünglich Privaten teilhaben. Bis dass der<br />
Tod uns scheidet bzw. bis die Performance zu Ende geht, lautet<br />
das Motto des Abends. Also, Geschenke nicht vergessen! Der<br />
Wodka wartet bereits. Na zdrowie!<br />
Bildrechte: Eliška Cikán<br />
23
Alle, auch jene, die eine Hochzeit noch nicht am eigenen Leibe<br />
erfahren durften, haben doch eine gemeinsame Vorstellung<br />
von ihr: schicke Kleider, Musik, amüsante bis peinliche Spiele,<br />
natürlich reichlich Verpflegung und die Hoffnung, nicht neben<br />
dem langweiligen Onkel des Bräutigams sitzen zu müssen.<br />
Mit der Produktion Bis dass der Tod uns scheidet laden mariamagdalena<br />
und ihre Gäste Mirjam Klebel, Georg Hobmeier<br />
und Thomas Proksch zu einem rauschenden Fest.<br />
Eine Hochzeit: der schönste Tag im Leben, an dem man sein<br />
privates Glück in die Öffentlichkeit hinausträgt, es politisch<br />
und moralisch unantastbar macht und an dem man diesen<br />
Beschluss mit seinen „Liebsten“ in intimem Kreise feiert.<br />
Die Künstlerin Magdalena Chowaniec macht sich als mariamagdalena<br />
diesen Widerspruch zunutze und geht einen Schritt<br />
weiter: Sie feiert dieses Ritual der Öffentlichkeit denn auch<br />
mit selbiger. Und dabei gibt sie sich nicht etwa nur mit einem<br />
schönsten Tag im Leben zufrieden. Nein, an fünf Tagen, in fünf<br />
Städten soll Hochzeit gefeiert werden. Eine polnische Hochzeit.<br />
Eine „mythische Tradition“ mit Disco Polo, Wodka, Hochzeitsgeschenken<br />
und rührseligen Reden. Doch bei dieser Idylle<br />
allein soll es nicht bleiben. Denn der Gast erlebt nicht nur, wie<br />
sich zwei Menschen fürs Leben binden, sondern auch, wie es<br />
sein kann, wenn Menschen getrennt werden, weil der Mann<br />
ein polnischer Gastarbeiter ist, gezwungen, in seinem LKW zu<br />
leben. Die Party geht weiter. Aber für einige Augenblicke wird<br />
die Utopie der Realität weichen.<br />
Damit sich der geladene Gast auch auf solch unbekanntem<br />
Terrain zurechtfindet, gibt es Spielregeln:<br />
1. Tanze und singe deinen Weg zur Verkörperung einer ande<br />
ren Kultur.<br />
2. Schmecke das „Polnische“ und mach es zu einer kurzfristigen<br />
gemeinsamen Utopie, was mehr ist, als du mit deinen<br />
Sinnen wahrnehmen kannst.<br />
3. Reise durch die Momente der Freude, Verwirrung, Aufregung<br />
und der großen Emotionen.<br />
4. Begegne einer fremden Geschichte, vorhandenen Klischees,<br />
Schönheit der alten Zeiten und heutigem Kitsch.<br />
5. Sei betrunken – genieße es!<br />
6. Sieh dich um und finde die „echten“ Gesichter. Stelle einem<br />
Paar Fragen.<br />
7. Höre die Geschichten des polnischen Gastarbeiters.<br />
8. Fühle, denke, gleich dich an.<br />
9. Schmecke den Unterschied*.<br />
24<br />
Disco-Polo-Utopie<br />
Vorbericht von Eva-Maria Kleinschwärzer, 06.04.2011<br />
*zwischen: Utopie und Realität/verschiedenen Realitäten/unterschiedlichen<br />
Utopien<br />
Die Künstlerin Magdalena Chowaniec, 1983 in Polen geboren<br />
und seit 2006 in <strong>Wien</strong> tätig, arbeitet seit jeher mit Zwischenräumen,<br />
in denen man sich etwas verloren fühlt und<br />
nicht entscheiden kann, ob es sich nun um Theater, Fiktion,<br />
Dokumentation oder gar Realität handelt. So zeigt sie sich in<br />
ihrem Empathy Project Vol. 1 als drogenabhängiger Junkie am<br />
Karlsplatz oder inszeniert mit The MOb: Fixing Freedom Tour<br />
den Abschied einer Punkband vom Bühnenleben.<br />
Der Künstlername mariamagdalena lässt sich auf die biblische<br />
Figur zurückführen und ist eine Anspielung auf den starken<br />
Einfluss der katholischen Kirche in Polen. Durch die Wahl<br />
einer so provokanten Frau betont Magdalena Chowaniec die<br />
Möglichkeit einer kritischen Meinung im „heiligen Tempel der<br />
Kunst“. Und kritisch ist sie, denn sie versucht in ihrer Arbeit<br />
auch, das Theater wegzubringen von einem Bildungsbürgertum<br />
und zugänglich zu machen für alle. In ihrer aktuellen<br />
Performance lädt sie deshalb auch gezielt solche ein, die nicht<br />
zum Stammpublikum des <strong>brut</strong> gehören. Dabei spielt ihre Herkunft<br />
eine maßgebliche Rolle: Nicht nur polnische Partybands<br />
aus den jeweiligen Städten werden für die Hochzeit gebucht,<br />
sondern ebenso polnische Mitbürger eingeladen, mitzufeiern.<br />
Bleibt nur noch, das passende Hochzeitsgeschenk für das<br />
glückliche Paar zu finden, sich in Schale zu werfen und sich in<br />
die Öffentlichkeit zu stürzen. Oder sich ins <strong>brut</strong> zurückzuziehen?<br />
Auf eine Party zu gehen? Oder Theater zu sehen?
Wir drehen uns, bis wir alle sterben<br />
Kritik von Eva-Maria Kleinschwärzer, 08.04.2011<br />
Ein Herr mit Schnurrbart und schillernd rotem Anzug<br />
empfängt die knapp 150 Gäste und bedankt sich für die<br />
wunderbar gelungene Zeremonie in der Kirche gerade eben.<br />
Nun sei es aber Zeit, auch angemessen zu feiern. Und da<br />
kommt auch schon das Auto des glücklichen Paares, das wir<br />
am Vorplatz gebührend in Empfang nehmen. Im Festsaal<br />
dann erst mal Wodka. Und natürlich die mitgebrachten<br />
Geschenke abgeben. Doch lange bleibt man nicht an der<br />
Tafel sitzen … Bei einer polnischen Hochzeit lacht ein Auge,<br />
das andere weint. Und gemäß diesem Sinnspruch wurde<br />
am 8. April im <strong>brut</strong> gefeiert, mit Wodka, Essiggurken und<br />
polnischer Tanzmusik.<br />
Wenn man sich nach der Vorstellung nach dem Stimmungsbild<br />
erkundigte, bekam man ein Wort häufig zu hören:<br />
„Genial.“ In diesem Fall sogar grenzgenial, im wahrsten<br />
Sinne des Wortes. Denn polnische Kultur konnte man hier<br />
am eigenen Leibe spüren, sei es auf der Tanzfläche, sei es<br />
bei diversen Partyspielen oder wenn es wieder hieß: Na<br />
zdrowie! Und so feierten echte Polen mit solchen, die es für<br />
einen Abend waren, und dabei konnte man fast vergessen,<br />
dass man ja eigentlich im Theater war, was sich nicht zuletzt<br />
daran zeigte, dass einfach weiter gefeiert wurde. Innerhalb<br />
dieser zwei Stunden verschieben sich nicht nur Landesgrenzen.<br />
Man ist Zuschauer. Aber man interagiert auch, tanzt<br />
mit Braut und Bräutigam, fischt beim nächsten Trinkspiel<br />
einen Wikingerhelm aus einer Plastiktüte oder kann<br />
improvisieren. Dabei konnte man teilweise nicht mehr<br />
beurteilen, wer nun „echt“ ist und wer nicht. Aber das war<br />
dann auch irgendwie egal.<br />
Und das weinende Auge? Die wunderbare Idylle der Hochzeit<br />
erwies sich an manchen Stellen als brüchig. Wenn die Braut<br />
von einer weißen Möwe singt, die davonfliegt, oder wenn unter<br />
den Tischen Briefe vorgelesen werden von solchen, die ihr<br />
Glück in der weiten Welt suchten und nun doch nur arbeiten<br />
müssen und folglich nicht mit uns tanzen können.<br />
mariamagdalena und ihren Gästen gelingt hier die großartige<br />
Inszenierung einer fremden Kultur, in die man sofort aufgenommen<br />
wird, und so brüllt man nach einer Stunde schon<br />
„Gorzko!“ Ohne eigentlich recht zu wissen, was das heißt. Ah,<br />
das Brautpaar soll sich küssen und wir wieder Wodka trinken.<br />
Bildrechte: Eliška Cikán<br />
25
Offiziell, gesellschaftlich, <strong>öffentlich</strong> – Hochzeiten mitsamt<br />
Feierlichkeiten präsentieren nicht nur all das, gleichsam findet<br />
sich darin eine ordentliche Portion Theater. Die Künstlergruppe<br />
mariamagdalena und Gäste nahmen sich das zu Herzen und<br />
inszenierten in Bis dass der Tod uns scheidet eine Hochzeitsfeier<br />
mit Höhen und Tiefen. Mit dem zugrunde liegenden Thema<br />
„Polnisch“ wird Leichtsinn und Spass geboten, aber auch<br />
Denkwürdiges aufgegriffen. Die Gäste des Banketts dürfen<br />
natürlich nicht fehlen.<br />
Die aus Polen stammenden jungen Verliebten Maria Magdalena<br />
und Tomasz haben also soeben geheiratet und müssen<br />
<strong>öffentlich</strong> empfangen werden. „Nicht trödeln, das Brautpaar<br />
kommt jeden Moment aus der Kirche“, ruft ein in einen<br />
schillernd roten Anzug gekleideter Trauzeuge, Organisatoroder<br />
auch Animateur, und schon findet man sich selbst als Teil<br />
eines Menschentunnels wieder. Traditionelles Spalierstehen<br />
als Beginn einer Kette von klischeehaften Bräuchen, kitschigen<br />
Tänzen und hemmungslosen Partyspielen.<br />
Bereits in den ersten Minuten der inszenierten Hochzeitsfeier<br />
fühlt man sich mehr als Gast denn als Zuschauer. Das soll<br />
auch so sein, denn nicht nur die Künstlergruppe mariamagdalena,<br />
sondern auch ihr Publikum trägt zur Inszenierung<br />
bei, weshalb in der Aufführung, wie auch oft bei Hochzeiten,<br />
die Hauptaufgabe darin besteht, die Nebendarsteller bei<br />
Laune zu halten. In diesem Fall mit reichlich Wodka, polnischer<br />
Tanzmusik, Tanzeinlagen der Künstler und einem<br />
aufgeweckten Gastgeber.<br />
Eine Besonderheit findet sich in Bis dass der Tod uns scheidet<br />
folglich darin, dass jeder im Publikum selbst darüber entscheiden<br />
kann, auf welche Weise er an dieser Veranstaltung teilnehmen<br />
möchte. Manch einer sieht selbst bei dem Disco-Polo-<br />
Gruppentanz gerne nur zu, andere wiederum stürzen sich ins<br />
Geschehen und nehmen mutig an den doch etwas peinlichen<br />
Spielen teil, wie beispielsweise um die Wette Runden mit dem<br />
Miniscooter zu drehen oder auf eigentümliche Weise Luftballons<br />
zum Platzen zu bringen. Die Sieger allerdings gewinnen<br />
einen kurz kommentierten Steckbrief über sich selbst in der<br />
Rolle einer fiktiven polnischen Person, etwa eines Niedriglohnarbeiters<br />
in Deutschland oder einer Nachtclubbesitzerin. Nicht<br />
zuletzt erfahren wir so auch etwas über Magdalena Chowaniecs<br />
Werdegang. Diese kurzen Anekdoten zu verschiedenen<br />
26<br />
Die Freuden und Leiden einer zahlenden Hochzeitsgesellschaft<br />
Kritik von Tanja Füreder, 08.04.2011<br />
Menschen bilden einen roten Faden, der in einer abschließenden<br />
Darbietung mündet.<br />
In jenen letzten Minuten wird es schließlich etwas besinnlicher<br />
und auch ernüchternd. Die Lichter gehen aus, Ruhe kehrt<br />
ein und Maria Magdalena verliest Briefe verhinderter Freunde<br />
aus Polen, die über deren tragische Geschichte erzählen.<br />
Doch auch wenn am Ende Fremdenpolitik und gesellschaftliche<br />
Problematiken aufgegriffen werden und der Versuch stattfindet,<br />
dem feuchtfröhlichen Fest eine gewisse Ernsthaftigkeit<br />
und eine kritische Note zu verleihen, bleibt es letztendlich<br />
doch nur ein lebhaft inszeniertes polnisches Hochzeitsfest, auf<br />
das zusätzlich noch eine Abschlussfeier mit den versprochenen<br />
deftigen Speisen folgt.
„Der nackte Obama“<br />
Wenn ein globaler Hoffnungsträger choreografisch offengelegt wird<br />
Vorbericht von Victoria Schopf und Katja Poloubotko, 06.04.2011<br />
In <strong>Wien</strong> gesellt sich zu den bereits in Berlin und Hamburg<br />
gezeigten Aufführungen die Performance Your Majesties der<br />
Künstler Alexander Deutinger und Marta Navaridas, wobei diese<br />
sich nur auf eine Aufführung und den Aufführungsort <strong>Wien</strong><br />
beschränkt und somit gut und gern als Special des Festivals zu<br />
betrachten ist. Gewählt wurde diese Performance aufgrund<br />
ihrer augenscheinlichen Parallelität zur diesjährigen Thematik,<br />
die mit den Termini Öffentlichkeit und Privatheit agiert und die<br />
Unterschiede sowie Übereinstimmungen diskutiert.<br />
Parallelen finden sich auch bei dem Künstlerduo untereinander:<br />
Beide studierten Translationswissenschaften in Graz; sie, gebürtige<br />
Spanierin, Englisch und Deutsch, er, gebürtiger Salzburger,<br />
Spanisch und Englisch. Übereinstimmung in drei Sprachen,<br />
wobei jeweils der andere die Muttersprache studiert. So war<br />
der nächste logische Schritt, dass Marta Alexander eine andere<br />
Leidenschaft von ihr näherbrachte: Tanz und Performance.<br />
Bereits als Kind war sie bewegungsfreudig, wobei sie die Leidenschaft<br />
fürs Tanzen nach einer langen Pause als Studentin in<br />
Barcelona und Graz in diversen Tanzworkshops wiederaufflammen<br />
ließ. Nach ihrem Studium der Translationswissenschaften<br />
fand ihre Tanzbegeisterung den Höhepunkt in der Ausbildung<br />
als Tänzerin und Choreografin an der Kunstuniversität Arnheim<br />
und der Theaterschool in Amsterdam.<br />
Angesteckt von Marta probierte auch Alexander einige Tanzkurse<br />
aus, bis er am Institute for Dance Arts der Bruckner-Universität<br />
in Linz aufgenommen wurde und eine intensive dreijährige<br />
Ausbildung durchlief. Sie gründeten zusammen die Gruppe<br />
„Unicorn“ und wählten nach einigen internationalen Studienengagements<br />
Graz als Dreh- und Angelpunkt für ihr künstlerisches<br />
Schaffen aus.<br />
Ihre Werke sind vielfältig und in verschiedenen Tanzdisziplinen<br />
ausgeführt, die Konzepte meist ebenso einfach und klar wie<br />
genial. Zugleich arbeiten sie gerne und erfolgreich mit der choreografischen<br />
Interpretation von Texten. Dies findet sich auch<br />
in ihrer aktuellen Performance Your Majesties wieder, bei der die<br />
Übersetzungswissenschaft ein geglücktes Stelldichein mit der<br />
Performance- und Tanzkunst eingeht: Das Öffentliche und Heroische<br />
wird ins Private transzendiert. Dass diese Mischung erfolgreich<br />
ist und sein kann, beweist der Theaterpreis „bestOFFstyria<br />
2010“, den sie als erste Tanzproduktion erhalten haben.<br />
Nicht umsonst, denn Your Majesties ist etwas, das es so noch<br />
nicht gab: keine schnöde Parodie eines Politikers, sondern die exakte<br />
Wiedergabe seiner Worte, in Originalsprache, der Präsident<br />
nur durch den Tänzer Alexander Deutinger ersetzt, während<br />
Marta Navaridas als Teleprompterin im Hinterhalt ihm gestikulierend<br />
das Bewegungsmaterial zuspielt. Auch wenn es leicht<br />
lächerlich wirken kann, wenn ein Mann springend und sich am<br />
Boden fläzend Barack Obamas Nobelpreisrede wiedergibt: Wer<br />
könnte auch einen so sympathischem und charismatischem<br />
Mann wie Obama ernsthaft Böses wollen und eine Karikatur<br />
seinesgleichen zeichnen? Von ihm, der doch in seinen Reden mit<br />
großen Ideen, willensstarken Vorstellungen und idealistischen<br />
Träumen seine Zuhörer berührt und wieder Glauben schenkt,<br />
dass eine bessere Welt in Einklang und Frieden möglich ist.<br />
Als er ein halbes Jahr nach seiner Inauguration den Friedensnobelpreis<br />
überreicht bekam, war keine seiner Heldentaten<br />
schon erfüllt, aber sein Auftritt, seine Worte rührten alle zu<br />
Tränen und ließen die Proteststimmen vor dem Rathaus in Oslo<br />
verstummen. Er war damit der Erste, der den größten Preis,<br />
den die Menschheit zu vergeben hat, nur für Reden bekommen<br />
hat. Man könnte ihn glatt als einen der größten Performer der<br />
Weltpolitik bezeichnen, ihn in eine Reihe mit Martin Luther King<br />
Jr., Mahatma Gandhi und John F. Kennedy stellen, hätte nicht er<br />
selbst verboten.<br />
Doch was passiert, wenn man den großen Worten die noch viel<br />
größeren Gesten des zurzeit sympathischsten Staatsoberhauptes<br />
der Welt entzieht? Was geschieht mit all den Hoffnungen,<br />
Idealen und Träumen hinter den Worten, wenn der Commander-in-Chief<br />
des größten Heeres der Welt den Krieg seines<br />
Landes im Irak und in Afghanistan auf einmal sich am Boden<br />
wälzend verteidigt, wenn er daumenlutschend von „just peace“<br />
redet oder den Bürgerkrieg in Darfur thematisiert, während er<br />
wie vom wilden Affen gebissen auf und ab hüpft? Da stehen<br />
plötzlich keine Überzeugungen und Visionen einer besseren<br />
Welt vor uns, sondern lediglich ein paar leere Worthülsen,<br />
kontextlos, lächerlich, und bringen uns vielleicht trotzdem oder<br />
gerade deswegen zum Nachdenken. Denn ohne die charismatische<br />
und positive Präsenz Barack Obamas und seiner geradezu<br />
messianischen Gesten werden all seine Intentionen nur noch<br />
zu grammatikalisch (meist) richtigen Anordnungen, nicht mehr.<br />
Ein Konzept, das in Your Majesties seine Richtigkeit prüfen will.<br />
27
Man darf also gespannt erwarten, ob das Publikum bei denselben<br />
Stellen lacht, nachdenkt oder gar applaudiert wie die<br />
geladenen Gäste bei Obamas Vortrag im Dezember bei der<br />
Verleihung des Friedensnobelpreises. Wahrscheinlich nicht, am<br />
besten machen Sie sich selbst ein Bild davon. Aber seien Sie<br />
gewarnt: Es könnte ihren Glauben in die Politik und vielleicht<br />
sogar die Sympathie, welche Sie gegenüber dem hoffnungsgeladensten<br />
Politiker seit Martin Luther King Jr. hegen, trüben.<br />
28<br />
Bildrechte: A. Deutinger, M. Navaridas<br />
Let us reach for the world<br />
that ought to be<br />
Kritik von Victoria Schopf, 09.04.2011<br />
Man nehme die Friedensnobelpreisrede des amerikanischen<br />
Präsidenten, ersetze diesen durch einen Tänzer, stelle ihm eine<br />
wortwörtliche Fädenzieherin seiner Gesten gegenüber und<br />
schaue, was dabei herauskommt. Politik, Realität, Fiktion?<br />
Am Ende waren es nur noch weiße Zettel und ein paar Schuhe,<br />
die verloren im schwarzen Raum liegen blieben. Die ursprünglich<br />
30-minütige Friedensnobelpreisrede Barack Obamas hatte<br />
viel verloren, vor allem an Glaubwürdigkeit, ganz im Gegensatz<br />
zu den performenden Künstlern, aber dennoch blieb man<br />
schlussendlich hin- und hergerissen zwischen Faszination auf<br />
künstlerischer Ebene und dem inhärenten politischen Gehalt,<br />
der eigentlich zum Nachdenken anregen sollte.<br />
Am Anfang jedoch war der Stuhl. Außer diesem aber auch recht<br />
wenig. Inmitten einer ausnahmslos schwarzen Bühne stand er,<br />
alleine und wartete auf den Redner des Abends, welcher mit<br />
Alex Deutinger auch nur wenige Minuten verspätet seinen Weg<br />
auf die Bühne fand. Ihm gegenüber, in den Zuschauergefilden,<br />
seine Marionettenspielerin Marta Navaridas, welche scheinbar<br />
an unsichtbaren Fäden ziehend alle seine Bewegungen koordinierte.<br />
Als er die Bühne betrat, hatte man noch ein wenig das<br />
Gefühl einer gewissen Ähnlichkeit mit dem Originalredner,<br />
nicht nur optisch, denn Alex Deutinger kam in den ersten fünf<br />
Minuten mit der gemäßigten, immer wieder auf sein Publikum<br />
eingehenden Sprechweise Barack Obama schon sehr nahe.<br />
Da stand er nun, mit den Zetteln zur Unterstützung in der<br />
Hand, gab die Worte der Friedensnobelpreisrede des amerikanischen<br />
Präsidenten in bestem akzentfreiem Englisch wieder<br />
und bedankte sich auch noch in derselben bescheidenen Art<br />
und unterstrich mehrmals, dass diesen Preis viele andere doch<br />
wesentlich mehr verdienen würden. Doch spätestens als die<br />
Zettel fielen und es sich der Künstler auf dem Stuhl, die Beine in<br />
alle Himmelsrichtungen schlagend, bequem machte, während<br />
er über „just war“ philosophierte, wurde klar, dass dies nicht<br />
nur die simple Darbietung einer politischen Rede war. Und auch<br />
das Spiegelbild zwischen ihm und seiner Gegenspielerin auf<br />
der anderen Seite, wie es anfangs schien, begann nicht mehr<br />
durchgängig zu funktionieren, wurde mit der Zeit doch immer<br />
klarer, dass sie ihm immer einen Schritt voraus war, gerade so,<br />
als ob ihre Handlung den Gedanken dazu erst in seinen Kopf<br />
setzen würde. In Anbetracht der Tatsache, dass Barack Obama<br />
keine seiner Reden selbst schreibt, ist der Vergleich mit einem<br />
Marionettenspieler wohl in mehrerlei Hinsicht passend.
Doch der Sessel war in keinster Weise nur der Rückzugsort<br />
eines Orators, der in diesen Momenten immer wieder den<br />
Anschein erweckte, er würde sich die Worte vielmehr erst aus<br />
den Fingern saugen müssen und seiner Sekretärin diktieren,<br />
als sein Publikum ernst zu nehmen und die großen Worte<br />
Martin Luther Kings über „permanent peace“ auch nur im<br />
Geringsten so zu meinen, wie er sie mit den noch größeren<br />
Gesten unterstrichen darstellte. Am Boden sitzend, sich in aller<br />
Seelenruhe die Schuhe ausziehend und seine Zehen begutachtend<br />
wandte er sich schließlich den Themen der NATO sowie<br />
auch der UNO und den „failed states“ zu, wobei die Entdeckung<br />
eines Fussels auf seinem Fuß sicherlich nicht nur zufällig,<br />
sondern vielleicht auch mit Hintergedanken gespielt war.<br />
Denn vielleicht ist ja auch in dem in seiner Ansprache sonst<br />
so hochgepriesenen amerikanischen System, welches er mit<br />
stolzgeschwellter Brust immer wieder als Friedenskämpfer Nr.<br />
1 betonte, auch ein kleiner schwarzer Fleck, den er am liebsten<br />
verstecken möchte, und sei es nur durch seine anscheinende<br />
geografische Unkenntnis; denn Dakar links oben zu deuten ist<br />
bei jeder Spiegelverkehrtheitsentschuldigung unentschuldbar.<br />
Verstecken jedoch lässt sich in einer Welt wie der unseren<br />
heutzutage nichts mehr, Fehler werden grundsätzlich sanktioniert<br />
oder mit genügend Korruption ausradiert, was auch<br />
in Your Majesties Eingang findet, bekommt der Präsident, der<br />
eigentlich schon längst keiner mehr ist, im Laufe der Performance<br />
nicht nur die gelbe, rote, blaue und grüne Karte<br />
gezeigt, sondern ist auch jedes Mal darauf verwiesen, seinen<br />
Redefluss deswegen zu unterbrechen, ob durch Händeschütteln<br />
mit dem Publikum, Pfeifen oder aber sich zu weigern und<br />
stur weiterredend durch die Gänge des <strong>brut</strong> zu marschieren,<br />
hinter Vorhängen und Türen zu verschwinden und an unerwarteten<br />
Stellen wieder aufzutauchen, um seinen Auftritt<br />
fortzusetzen. Als Zuschauer ein kleines örtliches sowie auch<br />
politisches hide-and-seek-Spiel, fast so wie in der Realität.<br />
Doch da stellt sich die Frage: Was ist überhaupt die Realität?<br />
Die Originalrede, ein Mann, sein Publikum. Nur mit seiner<br />
Gestik, geleitet von der stummen Gegenspielerin, verzerrt<br />
er dann doch das Bild der Wirklichkeit. Denn so sportlich der<br />
amerikanische Präsident auch wirkt, Yogaübungen, Froschhüpfen<br />
sowie Beinahe-Brücken traut man ihm dann doch wieder<br />
nicht zu, vor allem nicht während er dabei über die drei Wege<br />
zur Erhaltung bzw. Herstellung von Frieden referiert.<br />
Schlussendlich ist der Mann mit Anzug und ohne Schuhe aber<br />
immer öfter ein Spiegelbild des Präsidenten, den wir vielleicht<br />
gerne sehen würden. Ratlos, verletzt, die Schultern hängen<br />
lassend oder sich an den Ärmeln verschämt zupfend steht er<br />
verloren in diesem schwarzen Raum und weiß nicht wohin,<br />
seine Marionettenspielerin auf der anderen Seite wirkt ihm<br />
trotz ihrer Stummheit überlegen, hat sie doch wenigstens<br />
eine Idee, was als Nächstes folgen wird. Er nicht, er folgt nur<br />
nach. Der Performer auf der Bühne wird zum Spiegelbild des<br />
vom Publikum imaginierten privaten Obama selbst, hofft man<br />
zumindest. Denn auch wenn zurzeit der wahrscheinlich sympathischste<br />
Politiker, möchte man doch versichert sein, dass<br />
auch er nur ein Mensch mit Fehlern und Schwächen ist.<br />
Als mit den Worten „Thank you very much“ die Performance<br />
endet, bleibt es still. Im Gegensatz zum laut applaudierenden<br />
Publikum, welches sich Sekunden nach diesem Satz bei der<br />
Nobelpreisverleihung in Oslo mit Begeisterung auf den so<br />
charismatischen Originalpräsidenten stürzte, bleibt in <strong>Wien</strong><br />
zunächst einmal die Verwunderung. Teils vielleicht, weil es<br />
schwierig fiel, der Rede und ihrem Inhalt bei der wesentlich<br />
interessanteren Komponente der Gestik zu folgen. Teils allerdings<br />
vielleicht auch, weil gerade diese irreale Wiedergabe einer<br />
stattgefundenen Realität den Blickwinkel auf die Redepolitik<br />
Obamas ein wenig verändert hat. Es bleiben viele Fragen<br />
offen, darunter nicht nur jene, ob der Krieg in Afghanistan<br />
wirklich so „just“ ist, wie der Präsident mit seinen Argumenten<br />
zu unterstreichen versucht, sondern auch ob Barack Obama<br />
nach einer solchen Rede genauso verschwitzt ist wie Alex<br />
Deutinger und Marta Navaridas, denn auch wenn die körperliche<br />
Anstrengung wegfällt, so steht für ihn vielleicht moralisch<br />
mehr auf dem Spiel. Hoffen wir doch zumindest, oder?<br />
29
Obama als Marionettenfigur –<br />
wenn ein Teleprompter zu viel Macht besitzt<br />
Kritik von Katja Poloubotko, 09.04.2011<br />
Das Special des diesjährigen Festivals beginnt und kommt<br />
sogar ohne Spektakel aus: Auf die Bühne tritt ein angenehm<br />
und seriös wirkender Mann mittleren Alters in einem gut sitzenden<br />
Anzug, durch ein dezentes Scheinwerferlicht beleuchtet.<br />
Er hält einen Stoß Blätter in seiner Hand und beginnt<br />
mit würdevoller Stimme eine Rede in englischer Sprache.<br />
Dabei handelt es sich um die Dankesrede des US-Präsidenten<br />
Barack Obama anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises<br />
im Jahre 2009.<br />
In den ersten Minuten erscheint die Gestik des Künstlers<br />
seinen Worten angemessen. Bedächtig und erhaben. Im weiteren<br />
Verlauf nehmen seine Gestik und Bewegungen immer<br />
groteskere Formen an. Zunächst werden seine Armbewegungen<br />
ausladender, danach entledigt er sich sogar seiner Notizen<br />
und schreitet die Bühne auf und ab. Die Bewegungen erhalten<br />
einen immer alltäglicheren Zug; er setzt sich auf einen Stuhl,<br />
noch ziemlich gesittet, und wird dann immer legerer. Er präsentiert<br />
uns seine nackten Füße, lässt uns an einer oberflächlichen<br />
und schnellen Pediküre teilhaben und rollt sich auf dem<br />
Boden. Die alltäglichen Bewegungen transformieren sich in<br />
showähnliche Einlagen, so hüpft er umher, macht Tanzbewegungen,<br />
formt mit seinen Fingern Teufelshörner, pfeift, geht<br />
von der Bühne und spricht weiter, geht auf die Zuschauer zu<br />
und winkt ihnen.<br />
Mitten im Publikum, etwas erhöht auf einem Podest, steht<br />
eine junge Frau in sportlicher Freizeitkleidung. Sie ist die Ursache<br />
für den Bewegungsausbruch des Mannes auf der Bühne,<br />
sie liefert ihm sein Bewegungsmaterial wie ein Teleprompter.<br />
Springt sie, springt er auch, zeigt sie ihm die rote Karte, so<br />
geht er von der Bühne ab. Er ist abhängig von ihr, er ist ihre<br />
Marionette. So wie auch Obama?<br />
Obama ist mehr als abhängig von der Wirkung seiner Ausstrahlung<br />
und seines Auftretens. Seine Worte wirken leer,<br />
solange sie nicht von adäquaten Bewegungen unterstrichen<br />
werden. Sie werden zu Phrasen und es wird deutlich, wie<br />
wenig Logik seine Rede über die Notwendigkeit eines Krieges<br />
beinhaltet. Das zeigt das Stück auf. Theoretisch.<br />
Sicherlich erschließt sich die Aussage des Stücks einigen<br />
geübten Theaterzuschauern, jedoch muss man anmerken,<br />
dass die weniger alltagstaugliche englische Sprache einige<br />
30<br />
Schwierigkeiten in dieser Hinsicht bereitet, wobei zu betonen<br />
ist, dass der Fokus ja weniger auf dem Inhalt der Rede lag als<br />
auf den Bewegungen. Trotzdem führte dieser Aspekt zu einem<br />
etwas eintönigen Empfinden der Performance. Diese Eintönigkeit<br />
wurde auch durch die Dauer des Stücks, welche etwa 45<br />
Minuten betrug, und durch das Fehlen anderer Elemente oder<br />
Instrumente wie Musik oder besonderes Lichtspiel verstärkt.<br />
Die Reaktionen des Publikums waren auch eher verhalten, es<br />
wurde selten einheitlich und weniger stark als wohl erhofft<br />
oder geplant auf eine gewisse Aktion reagiert. Es fehlten ein<br />
wenig die Wow- und Aha-Momente.<br />
Dennoch hat diese Performance ihren Reiz und ihre Berechtigung.<br />
Denn sie lebt eher von den feinen Details und den<br />
subtilen Tönen als von viel Spektakel und Effekthascherei. Der<br />
Fokus liegt auf den Körpern der beiden Protagonisten, die<br />
sehr gut damit umzugehen wissen, und es ist faszinierend,<br />
die beiden dabei zu betrachten. Ihre Bewegungen unterscheiden<br />
sich zudem voneinander, obwohl sie scheinbar dieselben<br />
ausführen. Die der Künstlerin Marta Navaridas wirken sehr<br />
artifiziell und stilisiert, fast leblos, wie von einer Maschine<br />
ausgeführt, da sie ihre Bewegungen ganz exakt verrichtet.<br />
Jene des Künstlers Alexander Deutinger dagegen wirken sehr<br />
authentisch, lebendig und fast auch schon zufällig ausgeführt,<br />
sie erscheinen auch passend zu seiner Mimik. Hier zeigt sich<br />
sehr gekonnt das Zusammenspiel von Teleprompter und dem<br />
Performer auf der Bühne. Auch der Teleprompter liefert nur<br />
lebloses Zeichenmaterial, welches vom Performer verwendet,<br />
interpretiert und somit auch belebt wird, wie es auch bei den<br />
beiden Protagonisten der Fall ist.<br />
Die körperliche Leistung der beiden ist somit mehr als<br />
bewundernswert, und auf jeden Fall sollte man sich dieses<br />
Stück als tanz- und performanceinteressierte Person nicht<br />
entgehen lassen. Bestaunen Sie die Harmonie des Zusammenspiels<br />
und lassen sie sich auf dieses amüsante Bewegungsexperiment<br />
ein!
Who wants that and what would you give me in return?<br />
Über den Common Sense der Tauschgeschäfte<br />
Kritik von Lisa Schöttel, 12.04.2011<br />
Schon lange habe ich auf meinen Erdäpfelschäler gewartet.<br />
Letzten Mittwoch war es dann so weit. Nachdem ich auf Martin<br />
Schicks Frage („Who wants that?“) mit einem kurzen Handzeichen<br />
geantwortet hatte, war ich stolze Besitzerin dieses<br />
nützlichen Küchenutensils. Ein Geschenk im Theater. Eher eine<br />
Seltenheit, weshalb das Publikum auch sofort Feuer und Flamme<br />
war und sogar der verschenkte Toaster, zum Leidwesen der<br />
beiden Künstler, wie wir beim Interview erfahren haben, am<br />
Ende mit nach Hause genommen wurde.<br />
Eigentum und Transfer von Besitz sind Themen, denen sich<br />
Laura Kalauz und Martin Schick auf humorvolle, aber auch<br />
nachdenkliche Art und Weise in ihrer einstündigen Performance<br />
widmen. Diese Fragen werden immer im Kontext des<br />
Common Sense betrachtet. Wirtschaftliche und gesellschaftliche<br />
Mechanismen werden auf der Bühne im Mikrokosmos neu<br />
erprobt und erfahren.<br />
Nach der Geschenksrunde war dann das Publikum an der Reihe,<br />
seinen Beitrag zu leisten. So mussten die Körper der beiden<br />
Künstler mit Kleidung bedeckt werden. Sehr zögerlich zog sich<br />
eine junge Dame ihre Hose aus und verpachtete diese für nur<br />
10 Euro an den Künstler. Österreich verschenkt wohl nichts.<br />
Dafür teilen diese beiden sehr gerne.<br />
„I would like to share something with you.“<br />
Mit dieser Aussage wird geistiges Eigentum transferiert. Anschließend<br />
auch das Blatt Papier, auf dem der Text geschrieben<br />
steht. Was ist mehr wert? Gehört es nun dem, der das Papier<br />
in den Händen hält? Wenn ich eine Kaffeemaschine zu Hause<br />
habe und damit zwei Wochen lang Kaffee koche, gehört sie<br />
dann automatisch mir? „It felt it was mine“, sagt Laura Kalauz<br />
im Zuge dieser Diskussion. „Property is not a feeling“, lautet<br />
Martin Schicks Antwort.<br />
Und weil beide einfach gerne geben und nehmen, wurden<br />
auch die Rechte des Stücks CMMN SNS PRJCT an den Mann<br />
gebracht. Um 50 Euro wurden das Skript, sowie eine exklusive<br />
CD der einschläfernden Fahrstuhlmusik an den netten Herrn in<br />
der ersten Reihe verkauft. War das im Vorhinein abgemacht?<br />
Oder hat der arme Mann gar nicht damit gerechnet, dass er<br />
wirklich fünf Scheine locker machen musste? Oder ist er gar<br />
wirklich interessiert an dieser Musik? Diese Fragen bleiben<br />
offen, niemand verzieht eine Miene. Geschäft ist Geschäft.<br />
Am Ende der Performance wurden die Einnahmen und Ausgaben<br />
des CMMN SNS PRJCTs dem Publikum vor Augen geführt<br />
mit dem für beide Künstler erstaunlichen Ergebnis, dass sie<br />
noch 75 Euro übrig hatten. Was tun mit so viel Geld? Sollte<br />
das Publikum eigentlich ergriffen sein von der eher nicht dem<br />
Common Sense entsprechenden Selbstlosigkeit mit der beide<br />
ihr Geld <strong>öffentlich</strong> zur Verfügung stellen, wollte eine junge<br />
Dame sofort 15 Euro für sich beanspruchen, da sie zuvor den<br />
Film Titanic richtig erraten hatte. Aber das Publikum entschied<br />
sich gegen ihren Vorschlag. Und so wurde das Geld auf den Boden<br />
gelegt. Just nachdem das Stück aus war, haben sich schon<br />
die richtigen Leute alles gekrallt. Von Ideen zum Spenden, wie<br />
es in Berlin der Fall war, keine Spur. Die Wirtschaftskrise hat<br />
wohl auch Österreich heftigst gebeutelt. Und der arme Mann<br />
hatte seine 50 Euro wohl endgültig verloren.<br />
Beide Künstler haben Fragen zum Common Sense im Hinblick<br />
auf Besitz und Eigentum auf sehr humorvolle und abwechslungsreiche<br />
Art und Weise aufgemacht. Anscheinend nahm<br />
aber im Publikum eher die Frage „Alles meins?“ am Ende des<br />
Stückes die Überhand. War wohl nicht die Intention der beiden.<br />
Leider schlich sich auch ein bisschen Langatmigkeit in ihre<br />
Performance. Nachdem die Szene aus einem Film von Pedro<br />
Almodovar auch nach dem dritten Anlauf nicht erraten wurde,<br />
konnte ich schon die versteinerte Miene meines Sitznachbarn<br />
erkennen, als sich Martin Schick schon wieder daran machte,<br />
mit der Bohrmaschine zu flirten. Auch ein wenig schauspielerisches<br />
Training hätte Laura Kalauz nicht geschadet, wirkte<br />
ihr Auftritt oft ein bisschen unsicher und konnte nicht wirklich<br />
überzeugen. Das Konzept ist großartig gestaltet, leider verliert<br />
die Umsetzung durch zu lange Umbauarbeiten oder unüberzeugende<br />
Performance oftmals die Spannung. Man hatte am<br />
Ende schon das Gefühl, dass viele Zusehende mit ihren Gedanken<br />
an der Bar verweilten.<br />
Aber beide Künstler wirkten auf der Bühne so sympathisch,<br />
dass man die kurzen Momente der Langeweile gerne auf sich<br />
nahm, um anschließend durch einen neuen Part des Stücks<br />
überrascht zu werden.<br />
31
Bereits vor Vorstellungsbeginn stellt man sich als Zuschauer<br />
die Frage nach dem Common Sense und was einen in der Performance<br />
von Laura Kalauz und Martin Schick wohl erwarten<br />
mag, denn viel kann ich mir im Vorhinein nicht vorstellen, also<br />
lautet mein Motto einfach überraschen lassen.<br />
Beim Betreten des Aufführungsortes wird man bereits von den<br />
zwei halbnackten Künstlern (nur in Unterwäsche und Socken)<br />
erwartet. Hinter den beiden ist ein Tisch mit zahlreichen<br />
Alltags- und Haushaltsgegenständen aufgestellt, die mit den<br />
Worten „Who wants that?“ an das Publikum verschenkt werden.<br />
Das <strong>Wien</strong>er Publikum erweist sich als gar nicht scheu und<br />
reißt sich vieles unter den Nagel. Vom Toaster, Wäscheständer<br />
über eine Klobürste, Luftschlangen bis hin zum Reisepass und<br />
sogar einem 5-Euro-Schein gab es so einiges abzustauben.<br />
Nach der Geschenkaktion wurden die Rollen getauscht, denn<br />
nun sollten die Zuschauer den beiden Künstlern etwas von<br />
sich geben. Und nicht nur irgendwas, sondern Kleidungsstücke<br />
für die Dauer der Performance. Nun kommt der materielle<br />
Aspekt ins Spiel. Den Zuschauern wird für den Verleih ihrer<br />
Sachen Geld angeboten, denn in unserer Gesellschaft ist<br />
nichts umsonst, eine Gegenleistung wird stets erwartet. Hier<br />
wird einem langsam auch der Common Sense bewusst, womit<br />
der gesunde Menschenverstand gemeint ist. Unser Leben<br />
beruht auf Konventionen, gesellschaftlichen Vereinbarungen<br />
und Übereinkünften. Wir handeln nach gewissen Prinzipien<br />
und Kriterien, ohne bewusst darüber nachzudenken, da es zur<br />
Gewohnheit geworden ist. In ihrer Performance konfrontieren<br />
uns Kalauz/Schick genau mit den Dingen, die als selbstverständlich<br />
erachtet und nicht mehr infrage gestellt werden.<br />
Does common make sense? Can we stop participation?<br />
Diese Fragen legen den Grundstein und stehen im Mittelpunkt<br />
der Performance. Das Künstlerduo liefert jedoch keine Antworten,<br />
sondern bietet dem Publikum reichlich Denkanstöße. Es<br />
wird einfachen Fragen Platz geboten und das Publikum wird<br />
beispielsweise interaktiv mit unserem kapitalistischen Gesellschaftssystem<br />
auf humorvolle Art und Weise konfrontiert.<br />
Trotz der interessanten Fragestellung und guten Denkansätzen<br />
schwächelt die Performance hier und da. Sie wirkt wie eine<br />
Aneinanderreihung von Fragmenten und Miniperformances.<br />
Es gibt zwar den Grundgedanken des Common Sense, aber<br />
dieser kommt nicht überall gleich zum Vorschein. Das Erraten<br />
berühmter Romane und Filme war ziemlich unterhaltsam,<br />
aber durch das mehrfache Wiederholen der einzelnen Szenen<br />
kam man sich vor allem bei der Darstellung eines Almodóvar-<br />
32<br />
Can we stop participating?<br />
Kritik von Alisa Findling, 12.04.2011<br />
Films wie in einer Dauerschleife gefangen vor und war am<br />
Ende froh darüber, als das Internet zur Hilfe herangezogen<br />
wurde. Einen Bruch in der Performance stellt die Tanzeinlage<br />
nach etwa der Hälfte dar. Die sinnlosen Verrenkungen auf der<br />
Bühne machten einen eher stutzig als nachdenklich. Nach<br />
dem Ausdruckstanz wurde die Darbietung immer schwächer<br />
und zog sich in die Länge. Die Debatte über Eigentum und<br />
Besitz bot zwar wiederum interessantes Gedankengut, wirkte<br />
aber im Endeffekt zu langatmig.<br />
Mit ihrem CMMN SNS PRJCT hat das Künstlerduo mit dem<br />
Ausrichten des Großteils ihrer Performance auf die Interaktion<br />
mit dem Publikum ein riskantes Unterfangen gewagt, denn<br />
der Schuss kann auch genauso gut nach hinten losgehen. In<br />
unserem Fall hatten die Performer mit dem <strong>Wien</strong>er Publikum<br />
jedoch viel Glück, denn der Großteil hat sich prächtig amüsiert,<br />
wie man an den Publikumsreaktionen sehen konnte.<br />
Dem Künstlerduo Kalauz/Schick ist trotz Schwächen ein unterhaltsamer<br />
Abend gelungen.<br />
Bildrechte: Gerhard F. Ludwig
Does common make sense?<br />
Vergleich von Katharina Sindelar, 13.04.2011<br />
Nach dem Besuch beider Vorstellungen des CMMN SNS PRJCTs<br />
stellt sich mir die Frage immer noch. Und danach auch was<br />
mir die Künstler mit dem Stück sagen wollten. Doch ich denke,<br />
dass dies auch beabsichtigt ist.<br />
Ging ich gestern noch mit merklicher Verwirrung aus der<br />
Vorstellung, war es diesmal so, dass die Verwirrung zwar nicht<br />
weniger war, ich diesmal aber wusste, dass man sich einfach<br />
auf das Stück einlassen muss.<br />
Die Aneinanderreihung verschiedener Quotes und Texte sowie<br />
die Auktion der Rechte an dem Stück wollten sich mir gestern<br />
einfach nicht ganz erschließen. Auch wurde ich etwas verwirrt,<br />
da das Zitat, welches eindeutig aus „Krieg und Frieden“ von<br />
Leo Tolstoi stammt und gestern auch noch als das erkannt<br />
wurde, heute als „The Importance of Being Earnest“ gewertet<br />
wurde. Doch der Satz „You can love a person dear to you with a<br />
human love, but an enemy can only be loved with divine love“<br />
stammt definitiv aus der Feder von Tolstoi.<br />
Allerdings lebt das Stück von der Publikumsbeteiligung. So<br />
konnte man sehr gut sehen, wie Menschen sich verhalten. Die<br />
Länge des Stückes hängt mehr von den Zuschauern als von<br />
Martin Schick und Laura Kalauz ab. Immerhin sind sie darauf<br />
angewiesen, wie schnell sie die Bekleidung am Anfang der<br />
Show bekommen und wie lange es dauert, bis man sich am<br />
Ende dafür entschieden hat, was mit dem Geld passieren soll,<br />
das von der Vorstellung übrig geblieben ist. Aber auch das<br />
Erraten der Szenen und die Versteigerung der Lizenz am Stück<br />
können mit unterschiedlichem Publikum ganz andere Wendungen<br />
nehmen. Mussten die beiden Schauspieler gestern<br />
noch alle Szenen zwei- bis sogar dreimal spielen und bei der<br />
Auktion ziemlich lange warten, bis jemand das Erstgebot von<br />
50 Euro zahlen wollte, ging dies heute sehr schnell vonstatten.<br />
Dafür musste man bei der zweiten Aufführung Durchhaltevermögen<br />
beweisen, als es darum ging, die beiden Darsteller mit<br />
Kleidung auszustatten. Hier konnte man gut sehen, wie unterschiedlich<br />
Menschen darauf reagieren, geht es darum, etwas<br />
von ihrem Eigentum fremden Menschen, teilweise gegen Geld,<br />
zu verleihen. Oder wie unterschiedlich Ideen verschiedener<br />
Menschen sein können, wenn es darum geht, das Geld, welches<br />
Martin und Laura innerhalb der Performance eingenommen<br />
haben, zu verteilen. Merkte man gestern noch, dass nur<br />
ein paar wenige das Geld wirklich haben wollten, war heute<br />
die Beteiligung an der Abstimmung schon um einiges reger.<br />
So fanden beide Vorstellungen einen ganz anderen Schluss;<br />
in der ersten wurde das Geld einfach auf den Boden gelegt,<br />
und letztendlich nahmen sich diejenigen, die Geld hergegeben<br />
hatten, ihres wieder, in der zweiten gab es ein Gratisgetränk<br />
für alle an der Bar. Der Schluss war dadurch heute ein offener,<br />
alle waren an der Bar, der Applaus fiel aus.<br />
Aber dadurch, dass so viel vom Publikum abhängt, ist man als<br />
Zuschauer eher dazu verleitet, seine Sitznachbarn zu beobachten,<br />
als sich wirklich mit dem Geschehen auf der Bühne zu<br />
beschäftigen, vor allem bei der zweiten oder dritten Wiederholung<br />
einer Szene aus einem spanischen Film. Diese Unterschiede<br />
in den Vorstellungen haben mich jedoch mehr zum<br />
Nachdenken angeregt als das Stück selbst. Warum reagieren<br />
Menschen so anders, wenn es darum geht, jemandem seine<br />
Hose zu borgen oder sich gratis einen Toaster oder einen Wäscheständer<br />
zu nehmen? Warum ist es manchen wichtiger ein<br />
Gratisgetränk zu bekommen, als zu sehen, wie andere ihr Geld<br />
wieder zurückerhalten? All diese Fragen hat das Stück für mich<br />
aufgeworfen, aber ob dies die Absicht hinter dieser Aufführung<br />
war, das ist mir nicht klar.<br />
Und die Frage, die mir die ganze Zeit durch den Kopf geht,<br />
ist: „Does common make sense?“ Denn das Bekannte und<br />
Alltägliche scheint bei näherer Betrachtung öfters nicht<br />
das Sinnvollste.<br />
33
Das große Spiel mit der Spielregel:<br />
„Gesunder Menschenverstand“<br />
Gedanken zu CMMN SNS PRJCT von Luca Lidia Pályi, 15.04.2011<br />
Im Grunde ist das Thema der Performance CMMN SNS PRJCT<br />
eines, das nichts Neues bietet. Es lüftet kein Geheimnis und öffnet<br />
auch nicht die Augen der Zuschauer. Der wahre Wert dieses<br />
Stückes liegt in der Sanftheit der Inszenierung. Es rüttelt nicht<br />
an der Tür, klopft nur ganz sanft und hält einem einen Spiegel<br />
vor das Gesicht. Jetzt, ein paar Tage danach, sehe ich die Welt<br />
nicht anders, sondern genau so, wie ich sie kenne. Und das ist<br />
nicht gut so.<br />
Laura Kalauz und Martin Schick haben sich dem gesunden Menschenverstand<br />
gewidmet. Zumindest lautet der Titel so. Aber<br />
schon während der Performance wird einem klar, dass das nicht<br />
so einfach ist. Weder es zu begreifen noch es aufzuarbeiten.<br />
Sie beginnen ihre Vorstellung mit dem Austeilen von Gegenständen.<br />
Keiner davon ist wirklich anziehend oder wertvoll, doch<br />
mit der Nachfrage steigt auch der Wert. Am Anfang sind es<br />
irgendwelche Dinge, die nicht viel Geld kosten und die sowieso<br />
schon jeder hat oder sich leisten kann. Langsam findet aber fast<br />
alles seinen Besitzer, und die paar Dinge, die noch übrig sind,<br />
erscheinen kostbar. Erstens, weil jeder sie haben will, und zweitens,<br />
weil sie umsonst sind.<br />
Jeder hat sich an den Kampf um die materiellen Werte gewöhnt.<br />
Die Regeln kennen auch alle und die Sprache des Geldes<br />
ebenfalls. Auf dieses Übereinkommen der Menschen wurde<br />
die Performance CMMN SNS PRJCT aufgebaut. Es kann gar<br />
nichts schiefgehen, denn bestimmte Aktionen lösen immer<br />
die entsprechenden Reaktionen aus. So verlässlich sind wir, die<br />
Konsumenten. Und während das Publikum mit den Performern<br />
das große Spiel spielt, wird einem klar, dass sich alles um dieses<br />
dreht. Hier im Theater und „da draußen“ auch. Mitmachen kann<br />
und muss jeder, die Spielregeln beruhen auf dem Hausverstand.<br />
Alles so schnell und einfach wie möglich zu bekommen, ohne<br />
viel Aufwand und ohne dabei allzu große Gefahren auf uns zu<br />
nehmen. Wir haben uns alle irgendwo in diesem materiellen<br />
Labyrinth verloren.<br />
Beobachtet man das Publikum, zeichnen sich die unterschiedlichsten<br />
„Geschäftstypen“ ab. Sie unterscheiden sich in der Taktik<br />
der Aneignung, nicht aber im Willen, Energie zu investieren,<br />
um an Besitz zu gelangen. Auch die, die nichts wirklich brauchen,<br />
wollen etwas von den Sachen, die dort stehen. Bis zum<br />
Schluss gibt es noch die Möglichkeit, den persönlichen Besitz zu<br />
vergrößern. Ob man mit einem Geschenk nach Hause ging, hing<br />
nur von der eigenen Initiative ab. Es war wirklich faszinierend<br />
zu sehen, wie unverschämt man werden kann, wenn es darum<br />
geht, sich gegenüber den anderen zu behaupten.<br />
34<br />
Niemand war zu extrem und niemand brauchte sich zu schämen.<br />
Schnell wurde einem klar, dass die Zeit, die man in das<br />
Nachdenken über die anderen investierte, eine verschwendete<br />
war. Schließlich ging die Auktion weiter, und niemand wartete<br />
auf einen. Der Rhythmus musste eingehalten werden, die<br />
Stimme sollte laut sein und Rücksicht brauchte man wirklich<br />
auf niemanden zu nehmen. Aber was passiert mit denen, die<br />
da nicht mitmachen wollen? Sie werden einfach leer ausgehen.<br />
Aber wie lange kann man sich gegen diesen materiellen<br />
Wahnsinn wehren?<br />
Das Überleben der Menschen ist auf den gesunden Menschenverstand<br />
angewiesen. Die Vereinbarungen zwischen Mensch<br />
und Mensch sind alles bestimmende Regeln, die niemand<br />
brechen darf, sonst ist man raus. Raus aus dem Spiel bedeutet<br />
raus aus dem Leben.<br />
Interessant war auch, wie die zwei Performer erreichten, dass<br />
sich die Zuschauer entspannten. Gleich von Anfang an konnten<br />
sie all ihre materiellen Wünsche in den Vordergrund positionieren.<br />
Kalauz und Schick waren nämlich nackt. In Unterwäsche<br />
erwarteten sie das Publikum. Das hatte nichts Sexuelles an<br />
sich, eher waren sie ausgeliefert und wehrlos. Durch diese gut<br />
durchdachte Selbstpositionierung fühlte sich das Publikum<br />
sicher. Aber auch die allseits bekannten „Verhandlungsmethoden“<br />
halfen dabei, schnell auf einen gemeinsamen Nenner zu<br />
kommen. Das Aneignen von materiellem und geistigem Gut<br />
kennt jeder. Manchmal ist es Kauf, manchmal Diebstahl, Tausch<br />
oder ein Geschenk. Irgendwie findet jeden Tag ein Transfer<br />
von Besitz statt. Und deshalb wusste auch jeder im Publikum,<br />
was er tun musste. Es konnte nicht nur mit Geschick gepunktet<br />
werden, auch eine gute Allgemeinbildung wurde belohnt.<br />
Allerdings nur mit den Worten: „Sie haben gewonnen!“ Aber<br />
was? Der eindeutige materielle Gewinn blieb aus.<br />
Kalauz hatte recht, als sie beim Interview sagte, das Stück<br />
passiert eigentlich danach. In den 45 Minuten wurde so viel angesprochen.<br />
Es war wie ein Stillstand, bei dem uns Zuschauern<br />
ein Blick in das System unserer Lebensweise gewährt wurde.<br />
Seitdem gebiert ein Gedanke den nächsten, und während die<br />
beiden Künstler vielleicht schon auf dem Nachhauseweg sind,<br />
zerbreche ich mir den Kopf darüber, wie die ganze Performance<br />
denn eigentlich zu interpretieren ist.<br />
Alles in allem konnte man ziemlich viel von dieser Performance<br />
mitnehmen. Nicht nur Geld oder eine Plastikblume, sondern<br />
auch vor allem die Frage: „Does Common make Sense?“
TH D BHND – The idea behind<br />
Auszug aus dem Interview mit Martin Schick und Laura Kalauz von<br />
Alisa Findling und Katja Poloubotko, 13.04.2011<br />
„Does common make sense?“ Eine Frage, die nicht nur in dem<br />
Stück CMMN SNS PRJCT gestellt wird, sondern die sich auch der<br />
Zuschauer letztendlich fragen wird. Generell hinterlässt das<br />
Stück meist einen verwirrten und nachdenklichen Zuschauer,<br />
weshalb wir es als hilfreich empfunden haben, uns mit den<br />
Künstlern Martin Schick und Laura Kalauz zusammenzusetzen,<br />
um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen und einige Fragen<br />
zu beantworten. Auch den Künstlern selbst erschien diese<br />
Möglichkeit zu reden als wichtig, da, um mit Martin Schicks<br />
Worten zu sprechen, „gerade Performancekünstler sich mit<br />
dem intensiv beschäftigen, was sie tun, und viel zu erzählen<br />
haben, aber sehr selten gefragt werden, während Filmschauspieler<br />
ständig interviewt werden, obwohl sie selbst weniger<br />
mit dem Entstehen des Werkes zu tun haben“.<br />
e-<strong>xilant</strong>: Sie arbeiten seit 2009 zusammen als Duo. Wie ist es<br />
zu dieser Zusammenarbeit gekommen?<br />
Laura Kalauz: Wir haben uns eigentlich 2006 kennengelernt. Es<br />
war diese praktische Beziehung zwischen Performer (Martin<br />
Schick) und Choreografin (Laura Kalauz). Wir haben in dieser<br />
Konstellation zwei Projekte realisiert. 2009 kam es zu dieser<br />
natürlichen Idee für eine Zusammenarbeit. Wir haben über<br />
unterschiedliche Ideen geredet und sind dann ganz natürlich<br />
zu einer Zusammenarbeit und diesem Projekt gekommen. Wir<br />
mussten dabei beide auf der Bühne performen, weil es sonst<br />
eigentlich keiner machen konnte.<br />
Martin Schick: Wir sind bisschen so eine Art Schrumpfteam.<br />
Wir versuchen auch immer wieder, Leute zu involvieren, aber<br />
landen schlussendlich immer in dieser Kleinformation. Also<br />
eigentlich hätten wir gerne jemanden, der uns nach außen<br />
vertritt oder der für uns gewisse Dinge auch erledigt, aber<br />
schlussendlich schaffen wir es gar nicht, was abzugeben, da wir<br />
an allem beteiligt sein, an allem dran sein wollen.<br />
LK: Unsere Projekte sind in Handarbeit entstanden, es ist nichts<br />
Industrielles. Wir machen vom Anfang bis zum Schluss alles<br />
selbst, Administration, Management usw., eigentlich alles.<br />
MS: Alles kommt am Schluss auch ein Stück mit auf die Bühne.<br />
Die ganzen Vorgänge, die bei der Administration passieren,<br />
wären sonst nicht in unsere Arbeit mit eingeflossen, weil wir<br />
gar nichts damit zu tun gehabt hätten – diese absurden Vorgänge,<br />
die wir erleben, dadurch, dass wir uns selbst verkaufen,<br />
uns selbst vermarkten und vertreiben. Es gibt Situationen, wo<br />
wir mehr mit Zahlen beschäftigt sind als z. B. mit dem Text.<br />
Diese Zahlen landen schlussendlich auf der Bühne, weil wir von<br />
Grund auf alles selbst machen und zwar nicht weil wir keine<br />
anderen Möglichkeiten hätten, sondern weil wir es gar nicht<br />
loslassen können. Es ist ein Teil der Arbeit.<br />
LK: Dies verleiht der Performance eine gewisse Qualität. Wir<br />
sind immer voll da. Deshalb habe ich es vorhin als Handarbeit<br />
bezeichnet. Wir werden in unserer Arbeit von niemandem<br />
manipuliert und sind sehr unabhängig. Der andere Grund für<br />
unsere Zusammenarbeit ist die Tatsache, dass wir Theater<br />
eigentlich nicht wirklich mögen. Wir versuchen aber trotzdem,<br />
Theater zu machen, jedoch ein untypisches. Wir überlegen uns<br />
immer, was man Neues im Theater machen könnte.<br />
e: Wie ist die Idee zum CMMN SNS PRJCT entstanden? Hatten<br />
sie diese schon vor der Ausschreibung des Freischwimmer-<br />
Festivals oder ist sie erst im Zuge dessen entstanden?<br />
MS: So eine Mischung eigentlich. Wir hatten schon ein Zwischenprojekt,<br />
das „Common Sense“ hieß. Das war eine<br />
Recherche in Japan, wo wir einen Monat auf der Suche nach<br />
Fragen und Antworten zum Thema Common Sense waren,<br />
die auch ziemlich kulturell bedingt sind. Ein Common Sense<br />
in Japan wird sicher anders interpretiert. Wir haben als Abschluss<br />
dieser Zwischenarbeit eine Installation gemacht und<br />
sind dann bei diesem Thema irgendwie hängen geblieben,<br />
wollten es aber nicht Common Sense nennen, weil es uns<br />
zu plakativ war. Wir haben dann versucht, irgendwie einen<br />
Schritt weiter zu gehen. Wir sind schnell darauf gekommen,<br />
dass es den Common Sense gar nicht so gibt, weder zwischen<br />
Publikum draußen im Alltag, noch zwischen Publikum und<br />
Performern oder zwischen uns Performern. Es gibt eigentlich<br />
nur individuelle Standpunkte, die kommen manchmal<br />
zusammen und manchmal eben auch nicht. Deshalb sind wir<br />
dann bei dieser Zwischenform, von CMMN SNS PRJCT gelandet,<br />
wo quasi das Performative, das auf der Bühne passiert,<br />
im Titel bereits vorhanden ist. Du als Leser des Titels musst<br />
gewisse Lücken selbst füllen. Da jeder die Lücken gleich füllt,<br />
gibt es doch einen gewissen Common Sense. Es gibt ein Gespür<br />
für ein Etwas, das schon da ist, welches einem gar nicht<br />
bewusst ist.<br />
LK: Aber ich meine schon, dass es einen Common Sense gibt.<br />
Ich glaube nicht, dass alles individuell zusammenkommt.<br />
Ich sehe den Common Sense in unserer „Tierlichkeit“. Wir<br />
haben uns schon weit weg von diesem animalischen Aspekt<br />
entfernt, wir sind nun voll individuell. Es gibt eine Reise zwischen<br />
dem Tier und dem Individuum. Ich habe den Common<br />
Sense in der tierischen Seite des Menschen gefunden. Wir<br />
bewegen uns in der westlichen Gesellschaft immer weiter<br />
35
weg von dieser tierischen Seite. Alle Menschen haben aber<br />
noch immer tierische Triebe, etwa in der Liebe.<br />
MS: Jeder hat einen unterschiedlichen Umgang mit diesen<br />
Sachen, die Common Needs sind. Man liebt, aber jeder hat eine<br />
andere Vorstellung von Liebe. Wir finden uns aber dabei nicht<br />
wirklich. Es ist immer ein Hauch von Common Sense vorhanden,<br />
da alle „CMMN SNS“ gleich ausfüllen. Aber es gibt auch<br />
Leute, für die es nur eine Auflistung von Buchstaben ist, die<br />
nicht dieses durchgehende Gemeinsame haben.<br />
LK: Unser Projekt hat einen Bezug zum ökonomischen Aspekt.<br />
Wir versuchen, den theatralen Raum in einen ökonomischen<br />
Zusammenhang zu rücken. Das war mein großes Anliegen bei<br />
diesem Projekt. Wir haben in diesem ökonomischen Handeln<br />
einen Raum für den Common Sense gefunden. Jeder kennt<br />
Geld und weiß, wie man damit umgeht. Niemand fühlt sich<br />
merkwürdig oder beschämt. Auf dieser gemeinsamen Basis<br />
können wir wieder eine Wende machen, mit Absurdität spielen.<br />
MS: Schlussendlich geht es eigentlich fast darum, was das Geld<br />
an Zwischenmenschlichem produziert, was es bei uns auslöst.<br />
Wir erzählen eigentlich nicht über das Geld an sich, sondern<br />
was durch diesen Geldwert oder durch den Geldtausch<br />
passiert, den Geldtausch zwischen dir persönlich oder den<br />
zwischen euch.<br />
LK: Wie fühlst du dich, wenn ich dir das Angebot mache, dir<br />
10 € für 5 € wiederzugeben? Du sagst natürlich ja, oder? Zum<br />
Schluss der Vorstellung haben wir zu viel Geld, aber es geht<br />
eigentlich nicht um Geld, sondern um das Handeln mit diesem.<br />
e: Was ist die eigentliche Intention Ihrer Performance?<br />
MS: Es geht um eine Verlagerung, eine Veränderung der Wahrnehmung<br />
von Dingen ohne vorzugeben, wie die Wahrnehmung<br />
nun sein soll. Es soll eher zu einem Antrieb bei den Leuten<br />
kommen, über die eigene Wahrnehmung oder das Verhältnis zu<br />
Wertvorstellungen von Dingen nachzudenken. Wir geben keine<br />
Lösungen vor, sondern wollen diesen Prozess nur ankurbeln. Das<br />
ist unsere Intention. Wir haben kein politisches Statement. Das<br />
Bild für die Produktion erklärt eigentlich die ganze Sache sehr<br />
gut, weil es zu diesem Moment kommt, wo es zum Selbstmord<br />
des eigenen Gedankenkonstrukts kommt. Man bringt alles um<br />
und macht etwas ganz Neues.<br />
LK: Es wirft ein neues Licht auf die Dinge, die uns nahestehen,<br />
die wir gar nicht mehr richtig sehen, z. B. die Art, wie wir im<br />
kapitalistischen Alltags leben und handeln. Die kapitalistischen<br />
Aspekte sind für uns sehr natürlich, aber ich möchte unsere<br />
Beziehung zum Kapitalismus aus einer Alltagssicht verfremden.<br />
Ich möchte nicht aus der Sicht ökonomischer Theorien darüber<br />
reflektieren, sondern vom Hier und Jetzt ausgehen.<br />
36<br />
Romantic Afternoon<br />
Vorbericht von Eliˇska Cikán, 06.04.2011<br />
Eine Stunde Dauerknutschen. Das bekommt man in der Choreografie<br />
Romantic Afternoon von Verena Billinger und Sebastian<br />
Schulz zu sehen. Das ist aber im Endeffekt spannender, als<br />
es sich anhört. Weil man von den Darstellern gänzlich ignoriert<br />
wird, ist man umso mehr mit sich selbst konfrontiert. Beim Beobachten<br />
dieses Zärtlichkeitenaustauschs entsteht ein Gefühl<br />
von Scham und Voyeurismus. Man fühlt sich wie beim Kauf<br />
von Liebesheften, wenn man dabei von der eigenen Mutter erwischt<br />
wurde. Eigentlich möchte man gar nicht hinsehen, was<br />
man im echten Leben und vor allem in der Öffentlichkeit auch<br />
nicht tun würde. Aber im Theater geht es eben nicht anders,<br />
denn dafür geht man ja hin.<br />
Eine Gruppe von sechs Menschen tauscht eine Stunde lang<br />
Zärtlichkeiten, Positionen und Partner ohne Rücksicht auf<br />
Gleich- oder Andersgeschlechtliche. Jeder knutscht mit jedem.<br />
Es ist ein Kuss, der auf der einen Seite Vertrautheit und auf<br />
der anderen wieder Befremdung hervorruft. Jeder kennt das<br />
Gefühl, die Bewegungen und die Art, sich anzufassen. Und<br />
genau damit spielen die Darsteller: Sie nähern sich an, bis sich<br />
die Nasenspitzen und dann die Lippen berühren, bis sie eng<br />
umschlungen da stehen und sich liebkosen- aber nur so lange,<br />
bis die Zeit zum Partnertausch gekommen ist. Sie tun das mit<br />
Gelassenheit, ohne wilde Leidenschaft, die einen das Schauspiel<br />
dahinter erahnen lässt. Als Zuschauer kann man über eine<br />
Intimität mutmaßen, fragt sich jedoch, wie sich die Darsteller<br />
dabei fühlen müssen. Ob sie nicht auch Gefühle dabei haben?<br />
Denn der Kuss ist ja bekanntlich einer der größten Liebesbeweise.<br />
Und genau das wollen Billinger und Schulz bezwecken: Die<br />
Art der Küsse und Umarmungen rufen im Zuschauer Gedanken<br />
und Gefühle hervor, die in Wahrheit nicht vorhanden sind.<br />
Man wird mit diesen Gedanken jedoch allein gelassen, denn<br />
die Darsteller sind mit sich selbst beschäftigt, und man wartet<br />
gespannt auf jeden Huster des Publikums, um die gespaltene<br />
und vielleicht doch etwas gespannte Stimmung ein wenig aufzulockern.<br />
Diese Gefühlsachterbahn ist aber auch angenehm,<br />
denn alles wirkt für uns irgendwie vertraut. In diesem Fall heißt<br />
es jedoch: Mund ist Mund.<br />
Verena Billinger und Sebastian Schulz studierten u. a. Choreografie<br />
und Performance in Gießen und Frankfurt. Sie nutzen als<br />
Ausgangpunkt für ihre Arbeiten gesellschaftliche und alltägliche<br />
Fragen der künstlichen Modellierung und Inszenierung. Im<br />
Fokus der Choreografie steht die Rolle des Körpers, mit dessen<br />
Bewegungen Bilder und Lebenszeichen vermittelt werden. Diese<br />
sollen die ZuschauerInnen berühren und zum Nachdenken<br />
anregen, was in dieser Choreografie wohl gelungen ist.
Mit Kuss und Gruß … und Nachdenklichkeit<br />
Kritik von Victoria Schopf, 12.04.11<br />
Die bohrendste Frage des Abends war wohl jene, wie viel<br />
Labello während der Probenzeit zu Romantic Afternoon verwendet<br />
wurde. Nun gut, vielleicht nicht die bohrendste, aber<br />
auf jeden Fall eine davon, denn nach einer Stunde Lippenkontakt<br />
ohne Unterbrechung waren nicht nur die Münder der<br />
Performer, sondern auch ein wenig die Nerven der Zuschauer<br />
wund geküsst. Nichtsdestotrotz ging die Performance nahe,<br />
sie sprach unsere voyeuristische Neugierde an und zog in<br />
ihren Bann, selbst wenn die vermutliche Aussage auch in zehn<br />
Minuten hätte vermittelt werden können.<br />
Sechs erwachsene Menschen, drei Männer und drei Frauen,<br />
die eine Stunde lang nichts anderes tun, als sich zu küssen.<br />
In allen möglichen Kombinationen, den wildesten Posen, mit<br />
mehr oder weniger Zärtlichkeit, authentisch, vor Aufregung<br />
mit geschlossenen Augen blinzelnd oder streng durchchoreografiert.<br />
In diesen 60 Minuten ist alles dabei. Von der anfänglichen<br />
schüchternen Befangenheit, sowohl die echte aufseiten<br />
des Publikums, als auch die gespielte aufseiten der Performer,<br />
wechselt man schnell zum Rausch des Kusses selbst über, die<br />
zwischenmenschlichen Interaktionen werden von der Vertikale<br />
in die Horizontale verlegt, und schon bald rollen mal Dreier-,<br />
mal Zweiergespanne auf dem Boden und küssen, als gäbe es<br />
kein Morgen. Anfangs zuerst ganz leise, geradezu beschämt,<br />
tippen sie einander auf die Schulter, um den jeweiligen Lippenakrobat<br />
abzulösen, doch immer eher wird auch die besitzergreifende<br />
Seite des Kusses selbst und dessen, der selbigen ausführt,<br />
deutlich, nicht nur wenn sich die Paare gegenseitig mit<br />
einer solchen Wucht gegen die schwarze Holzwand werfen,<br />
dass einen schon selbst die einzelnen Wirbel schmerzen. Die<br />
Performance der unermüdlichen Tänzer, welche sich trotz allzeitlicher<br />
Kussbeschäftigung auch immer im Raum fortbewegen,<br />
was vor allem ihn der Horizontalen etwas beschwerlich<br />
wird, wirkt immer anstrengender. Bis sich schließlich alle sechs<br />
zwischenzeitlich auch in einem großen Kussgelage wiederfinden,<br />
welches ein wenig an das Bild Grenouilles erinnert, der in<br />
Patrick Süskinds Roman Das Parfum von den Menschen aufgrund<br />
seines Duftes aufgefressen wird. Doch hier herrschen<br />
sehr egalitäre Kussverhältnisse: jeder mit jedem, gleichzeitig,<br />
nacheinander oder überhaupt alle zugleich, wobei alle küssbaren<br />
Körperteile zum Einsatz kommen.<br />
Das einzige Ermüdende daran ist vor allem die unendliche Stille,<br />
welche die gesamte Performance begleitet. Kein gesprochenes<br />
Wort, nur zwei kurze Musikeinspielungen und die immerwährenden<br />
Nebengeräusche küssender Menschen erreichen<br />
die leicht unterforderten Ohren des Publikums. Dafür werden<br />
die Augen durchgehend mit neuen Eindrücken versorgt, auch<br />
wenn man sich manchmal etwas mehr erwartet, wenn sich<br />
zwei der küssenden Parteien auf einmal ihrer Hosen zu entledigen<br />
beginnen. Schlussendlich werden Kleidungsstücke aber<br />
nur getauscht und so schnell wie möglich wieder angezogen.<br />
Nur die einmal ausgezogenen Schuhe bleiben bis zum Ende<br />
der Aufführung fein säuberlich in Reih und Glied aufgestellt<br />
am Rande der Bühne stehen. Vielleicht um uns zu erinnern,<br />
dass auch wir immer alles in Reihen und Spalten ordnen,<br />
selbst wenn wir dies nicht einmal intendieren.<br />
Neben der Frage, ob man nun selbst auch so aussieht, wenn<br />
man sich küsst (auch wenn die wenigstens währenddessen<br />
auch ernsthaft schon einen Rückwärtspurzelbaum gemacht<br />
haben), stellt sich vor allem auch jene, was am Kuss selbst so<br />
interessant ist. Natürlich ist da die voyeuristische Lust, aber<br />
dazu kommt auch noch das verzweifelte Suchen nach Halt,<br />
meist an jemandem, ob männlich oder weiblich (emanzipiert<br />
und tolerant sind wir doch alle), welches in fast jedem von uns<br />
tief verankert ist. Auch das greift die Performance auf, wenn<br />
die endlich kurz pausierenden Tänzer nach Minuten ohne<br />
sichtbares Luftholen während ihrer Kussmarathons selbst in<br />
den wenigen Sekunden, in welchen sie keinen zweiten in ihren<br />
Armen halten und trotzdem benebelt vom Kussrausch sind, in<br />
die leere Luft küssen, um nicht allein auf der kalten, schwarzen<br />
Bühne stehen zu müssen. Fast so wie wir, die wir doch immer<br />
auch ein wenig fürchten, allein auf der kalten, schwarzen<br />
Weltbühne unser Leben fristen zu müssen. Deshalb lieber<br />
jemanden küssen, denn da fühlt man sich doch gleich weniger<br />
allein und ein wenig mehr geliebt.<br />
Wobei Liebe in Küssen nicht inkludiert sein muss, genauso<br />
wenig wie gesprochene Worte in einer Sprache oder aber auch<br />
eine tiefsinnige Aussage in einer Performance. Nach 60 Minuten<br />
des Küssens gehen die sechs Künstler kurz zu einer Tanzperformance<br />
über, bevor sie sich, nach getaner Arbeit, brav<br />
verbeugen, vielleicht ein wenig schelmisch grinsend, und ihre<br />
Zuschauer wieder sich selbst und ihren unterschiedlichsten Interpretationen<br />
des Gesehenen überlassen. Natürlich sieht man<br />
Tag für Tag sich küssende Menschen in der Öffentlichkeit, es<br />
ist schon fast zu einer alltäglichen Erscheinung geworden, und<br />
trotzdem fühlt man sich nachher ein wenig, als hätte man zu<br />
viel gesehen. Zu viel als eigentlich erlaubt. Und trotz der rauen<br />
Lippen, welche man schon allein beim Zusehen bekam, oft<br />
auch eher des Gefühls eines zwischenmenschlichen Distanzbedürfnisses<br />
und der kurzzeitigen Konfusion den Inhalt sowie<br />
auch dessen Rezeption betreffend fiel das fast urtümlichste<br />
Ritual unserer Gesellschaft auch bei der Verabschiedung der<br />
einzelnen Zuschauer untereinander nicht aus. Raten sie einmal,<br />
was sie zum Abschied taten. Richtig, sich küssen.<br />
37
Ja, es wird wirklich richtig geküsst, und ja, es dauert auch<br />
wirklich eine Stunde, und noch mal: Ja, es wird nichts anderes<br />
gemacht außer eben küssen. Mal langsam, mit Leidenschaft,<br />
mal mit Akrobatik, und zum Schluss ein Abschiedstänzchen.<br />
Mit der Performance Romantic Afternoon haben Verena Billinger<br />
und Sebastian Schulz das Thema wie den Nagel auf den<br />
Kopf getroffen: Küssen=privat, Küssen+Öffentlichkeit=Rückzug<br />
ins Öffentliche.<br />
Man wird kurz von den Schauspielern durch einen Gedankengang<br />
geführt, der einen in eine sehr angenehme und<br />
verträumte Stimmung versinken lässt. Denn man kennt das<br />
Gefühl eines Kusses, der langsam, aber spannend, dann wieder<br />
intensiv und atemlos ist. Man fragt sich auch, ob die sechs<br />
Schauspieler nicht etwas beim Küssen fühlen. Vielleicht erregt<br />
werden. Durch die kleinen Lacher, die die Schauspieler ab<br />
und zu von sich geben, lässt sich doch eine Art Zufallsprinzip<br />
der Partnerwahl und Spontaneität des Stücks spüren. Diese<br />
Gedanken verfliegen aber schnell und man landet wieder<br />
im beleuchteten Zuschauerraum. Die akrobatischen Künste,<br />
die die Performer beim Küssen auf der Bühne hinlegen wie z.<br />
B. Purzelbäume, im sich abwechselnd tragend, beim Küssen<br />
auf den Schenkeln des Partners sitzend, lassen einen doch<br />
die Theatralität spüren. Von Intimität, die ein Kuss eigentlich<br />
vermitteln sollte, spürt man nach einiger Zeit wenig. Der Kuss<br />
wird zu einer Orgie, jeder küsst jeden, und es wird fast zu einer<br />
lächerlichen Angelegenheit.<br />
Von einer Art von Scham und Voyeurismus merkt man beim<br />
Beobachten wenig, wohl weil in der wirklichen Öffentlichkeit<br />
zu wenig geküsst wird oder aufgrund der Tatsache, dass man<br />
im Theater sitzt und man des Zusehens wegen hingeht. Oder<br />
vielleicht auch deswegen, weil man einfach von Erotik aus dem<br />
Alltag so überladen ist, dass man nach zwanzig Minuten genug<br />
gesehen hat – gegangen ist jedoch niemand, und der Applaus<br />
des Publikums spricht dafür, dass es einigen gefallen hat.<br />
Obwohl die Blicke während der Aufführung oft abwesend<br />
wirkten und man vielleicht durch das helle Licht öfter eingeladen<br />
war, die Reaktionen anderer zu beobachten, haben einige<br />
immerhin ihre Einkaufsliste in der Stunde fertiggedacht.<br />
38<br />
Ein Kuss für Blickfänger<br />
Kritik von Eliˇska Cikán, 12.04.2011<br />
Niemand bleibt ungeküsst<br />
Kritik von Jennifer Vogtmann, 13.04.2011<br />
Der Kuss gilt in vielen Kulturen als Ausdruck von Liebe und<br />
Zuneigung und wird je nach Dauer und Intensität auch als<br />
sexuelle Handlung verstanden. Durch das Berühren der Lippen<br />
(und Zungen) zweier Menschen wird die körperliche Distanz<br />
beinahe vollständig aufgehoben. Daher küssen sich meist Menschen,<br />
die in einem intimen Näheverhältnis zueinander stehen.<br />
In einigen Kulturen gilt es aufgrund der dem Kuss zugeschriebenen<br />
sexuellen Komponente als verpönt, sich in der Öffentlichkeit<br />
zu küssen. Mancherorts ist dies sogar verboten.<br />
Was passiert nun aber, wenn das Küssen aus dem ansonsten<br />
kulturell üblichen Kontext gerissen und auf der Bühne zur<br />
Schau gestellt wird?<br />
Romantic Afternoon. Sechs Menschen stehen am Bühnenrand.<br />
Der Raum ist hell erleuchtet. Langsam nähern sich die Darsteller<br />
wortlos und Schritt für Schritt einander an. Dann die<br />
ersten Küsse, die immer intensiver werden. Partnerwechsel. Es<br />
küssen sich Frauen und Männer, Frauen und Frauen, Männer<br />
und Männer, und siehe da, ein Raunen wird im Publikumsraum<br />
hörbar. Kuss-Staffellauf. Das Licht wird gedimmt. Die Darsteller<br />
räkeln sich miteinander am Boden. Sie küssen sich unentwegt.<br />
Sie küssen zu zweit, zu dritt, zu sechst. Berühren sich gegenseitig.<br />
Sexuelle Handlungen werden angedeutet. Zwei Darsteller<br />
tauschen ihre Hosen. Kein gesprochenes Wort. Kaum musikalische<br />
Untermalung. Nur Küsse, Schmatz- und Atemgeräusche.<br />
Und das Publikum? Einige verlassen den Raum. Andere blicken<br />
schmunzelnd und gebannt auf die Bühne. Wieder andere<br />
sehen sich unschlüssig um. Ein Paar lächelt sich an und schließt<br />
sich den küssenden Darstellern an. Das Paar zieht einige Blicke<br />
im Publikum auf sich. Sie werden angelächelt. Und auf der<br />
Bühne wird unterdessen unentwegt weitergeküsst. Jeder mit<br />
jedem und jeder für sich. Schattenküssen. Doch wo ist die Romantik<br />
in dieser einstudierten Performance? Vermutlich liegt<br />
sie in jedem von uns. Der Anblick dieser zur Schau gestellten<br />
Küsse löst wohl in jedem von uns etwas aus. Manche fühlen<br />
sich womöglich peinlich berührt, andere aber denken vielleicht<br />
an ihren oder ihre Liebste(n). Einige überkommt möglicherweise<br />
der Wunsch, sich auch wieder einmal einem Menschen<br />
auf diese intime Weise zu nähern, oder sie werden erinnert an<br />
eigene Kuss-Erfahrungen“.<br />
In Romantic Afternoon wird die intime zwischenmenschliche<br />
Handlung des Küssens, die meist in den eigenen vier Wänden<br />
oder zumindest abgeschieden von der Öffentlichkeit vollführt<br />
wird, nach außen gestülpt und als Choreografie auf die Bühne<br />
gebracht. Die Auflösung liegt wohl in jedem einzelnen Zuseher<br />
selbst. Welche Gefühle, Erinnerungen, Emotionen löst der<br />
Anblick der küssenden Darsteller in jedem von uns aus? Die<br />
Antworten mögen unterschiedlich sein, doch in jedem Fall<br />
haben Verena Billinger und Sebastian Schulz mit ihrer Performance<br />
Romantic Afternoon etwas in uns ausgelöst.
Auf der anderen Seite<br />
Die Macht des Publikums im Kusstaumel<br />
Kritik von Theresa Naomi Hund, 13.04.2011<br />
Die Küssenden Die Beobachtenden<br />
6 Künstler (3 Frauen, 3 Männer) küssen<br />
sich 60 Minuten lang, im<br />
Wechsel, in Zweierpaarungen, zu dritt oder auch<br />
allein. Ja, doch der Kuss allein ist tatsächlich<br />
möglich, pantomimengleich wird er<br />
vollzogen, der imaginäre Partner dient als<br />
Projektionsfläche. Sie küssen sich überwiegend<br />
mit geschlossenen Augen, es ist die reine<br />
Form des Kusses, ohne Speichelflüssigkeiten<br />
miteinander auszutauschen. Eine Kusschoreografie<br />
ist es, welche wir hier zu sehen bekommen.<br />
Geschlechtsauflösungen, Konventionsbrüche,<br />
aber schockieren tut das längst nicht mehr. Viele<br />
Schritte werden routiniert ausgeübt, manche<br />
wiederum sind improvisiert. Der ganze Bühnenraum<br />
wird durch und mit dem Küssen eingenommen, im<br />
Stehen, im Sitzen, im Liegen – jede Form der Kussakrobatik<br />
wird uns hier geboten. Zweierkonstellationen lösen sich<br />
immer wieder auf und werden neu formiert.<br />
Münder, Beine, Hände, Schultern,<br />
Knie, Waden, fast alle Gliedmaßen<br />
werden mit einem Kuss versehen. Es<br />
wird sich durch die Haare gefahren, das<br />
Gesicht mit Händen gestreichelt, ein Hauch von Zärtlichkeit<br />
kommt auf, jedoch wird diese wieder durch die<br />
routinierten, ja fast maschinellen Bewegungsabläufe<br />
unterbrochen. Viele Formen des Kusses werden<br />
ausprobiert, dominant, gefühlvoll, exzessiv. Es<br />
fällt auf, dass manche Kusspaarungen dabei besser<br />
harmonieren als andere. Gibt es verborgene<br />
Kusspräferenzen? Gibt es eine<br />
Kusshierarchie?<br />
Empfinden die Küssenden überhaupt noch etwas<br />
oder wird der Kuss zur Routine? Wenn ja, wie<br />
schade. Küssende Schlafwandler, die suchen, sich<br />
verlieren, einander spüren, sich dem anderen<br />
wieder entziehen, weil sie eben nicht finden.<br />
Sich (nicht) finden?<br />
Gebannte, gespannte, neugierige<br />
Blicke. Die ersten beginnen zu schmunzeln, zu flüstern, sich zu<br />
räuspern. Einige ziehen sich ihre Jacken aus,<br />
Handyspiele, manche lesen<br />
im Programmheft. Was ist hier los, was geschieht hier<br />
auf der heute deutlich spürbaren anderen Seite des<br />
Raumes?Unruhe, Unwohlsein, Unsinn? Was genau<br />
sehe ich denn da? Es ist zwar<br />
etwas scheinbar Intimes, aber eben<br />
nichts sexuelles, die Intimität wird durch die Blicke, die Nervosität<br />
des Zuschauers gar nicht zugelassen.<br />
Es ist kein romantischer Nachmittag,<br />
sondern ein mechanischer Abend. Der Blick vieler geht<br />
lieber in die Publikumsrunde, als auf das<br />
Spektakel auf der Bühne. Es liegt etwas in der Luft.<br />
Aggressivität, Genervtheit, Langeweile, Ratlosigkeit. Es<br />
kommt zu einem Rollenwechsel.<br />
Das Publikum ist heute der<br />
eigentliche Protagonist des<br />
Kusstaumels. Von uns<br />
aus wird das Stück regiert.<br />
Immer mal wieder kurze Blicke der Küssenden<br />
auf die andere Seite. Bekommen sie<br />
mit, was hier gerade passiert? Einige setzen<br />
eine persönliche Botschaft, indem sie den Raum verlassen.<br />
Fragende, aber auch verständliche Blicke. Ist<br />
es die Langeweile, die Ideenlosigkeit? Das <strong>öffentlich</strong>e<br />
Küssen schockiert nicht mehr, täglich sehen wir<br />
dort wie auch hier wird es inszeniert. Die Sehnsucht<br />
nach dem Ende wegen der Gewohnheit des Blickes? Es wird<br />
sich nicht auf das Geschehen eingelassen, dadurch kann es<br />
sich nicht entfalten.<br />
Der Kuss hatte von Anbeginn keine Chance. Zumindest heute.<br />
Selten habe ich die Rampe zwischen<br />
Publikum und Bühne so<br />
intensiv empfunden wie heute. Die triadische Kollusion ist<br />
gescheitert. Wir haben ein Kussspiel auf der einen<br />
und Spielverderber auf der anderen Seite.<br />
39
Kunst und Küsse. Performance und Intimität. Ein großes<br />
imaginäres Fragezeichen schwebt über unseren Köpfen. Ist das<br />
möglich? Absolut! Das finden zumindest Verena Billinger und<br />
Sebastian Schulz, die sich in die tiefen Abgründe des Kusses<br />
und der menschlichen Berührung gewagt haben, um ihre<br />
gemachten Erfahrungen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Die<br />
beiden Theaterwissenschafts-Studenten haben sich nicht erst<br />
während des Studiums, sondern schon viel früher kennengelernt.<br />
Im selben Ort aufgewachsen, paaren sie ihre Interessen<br />
und Ideen. Es entsteht etwas Sonderbares. Romantic Afternoon<br />
heißt die Frucht, eines ihrer größten Projekte bisher. Aber warum<br />
das ganze Spektakel? Vor welchem Hintergrund? Sind die<br />
Küsse echt? Kann man jemanden küssen und ihn gleichzeitig<br />
betrügen? Fragen über Fragen, die alle hemmungslos beantwortet<br />
wurden.<br />
e-<strong>xilant</strong>: Wo seht ihr den Schnittpunkt zwischen eurem<br />
Stück und dem diesjährigen Thema des Festivals<br />
„Rückzug ins Öffentliche“?<br />
Verena Billinger: Es ist eigentlich ein schneller Link. Küssen ist<br />
ein intimer Akt, dem man nie so zusieht, außer man befindet<br />
sich im <strong>öffentlich</strong>en Raum. Dadurch fanden wir es interessant,<br />
das in diesem Rahmen auf die Bühne zu bringen.<br />
Sebastian Schulz: Idee war erst mal das Thema, dann was<br />
uns an dem interessiert. Wir sind dann eben auf das Küssen<br />
gekommen, da das sehr körperbezogen ist. Wir fragten uns:<br />
Kann ein <strong>öffentlich</strong>er Kuss überhaupt klappen? Denn der<br />
private und <strong>öffentlich</strong>e Raum wird in so einer Situation durchkreuzt,<br />
wenn das in der Öffentlichkeit stattfindet. So gesagt,<br />
dass der <strong>öffentlich</strong>e Moment nicht stattfinden kann, solange<br />
der private nicht eingeschrieben wird, und umgekehrt.<br />
Wir denken, dass jede Intimität durch eine Art von Öffentlichkeit<br />
durchkreuzt ist, und glauben nicht an die Entgegensetzung<br />
von <strong>öffentlich</strong>em und privatem Raum.<br />
VB: Wenn wir mit Darstellern arbeiten und auf der Bühne<br />
stehen, repräsentieren wir auch etwas – wir wollen jedoch<br />
nicht schauspielern. Das ist für uns immer diese<br />
Gratwanderung zwischen privat und <strong>öffentlich</strong>.<br />
e: Ist das Stück zum Festival entstanden?<br />
SS: Ja.<br />
e: Sind die Küsse echt?<br />
VB: Ja!<br />
40<br />
Liebeszombies küssen besser!<br />
Interview mit Verena Billinger und Sebastian Schulz von Eliˇska Cikán,<br />
Olivia Lefford und Ada Mumajesi, 14.04.2011<br />
e: Welche Gefühlslage wollt ihr im besten Fall beim<br />
Publikum erreichen?<br />
SS: Das ist bei uns die ganze Zeit die Knackpunktfrage, wie<br />
das die Performer eben machen, welche Haltungen sie<br />
einnehmen. Denn je fragiler sie das machen, umso eher<br />
kann das Publikum mehrere verschiedene Assoziationen und<br />
Gefühle haben. Es gibt auch manchmal fast zu viel Intimität,<br />
dass man sich diverse Fragen stellt: Möchte man eigentlich<br />
hinsehen? Könnte zwischen den Darstellern etwas laufen?<br />
Mögen die sich eigentlich? Ist ihnen das unangenehm? Uns<br />
war wichtig, dass es sich nicht nur in eine Richtung entwickelt.<br />
Es soll weder nur emotional und psychologisch sein<br />
noch banal oder gespielt.<br />
e: Glaubt ihr wirklich, dass man von Scham betroffen wird?<br />
Es besteht doch ein Unterschied, ob man Leute in der U-Bahn<br />
oder im Theater beobachtet.<br />
SS: Klar gibt es einen Unterschied. Das kann auch eines der<br />
Gefühle sein, die der Zuschauer während der Aufführung hat.<br />
VB: Es gibt viele Zuschauerkommentare, die dahin gehen,<br />
dass sie eine gespaltene Aufmerksamkeit haben. Also dass<br />
sie zusehen, weil sie eben im Theater zusehen sollen, es aber<br />
irgendwie komisch finden. Es gibt auch manche Aktivitäten im<br />
Publikum, bei denen man anfängt, die anderen zu beobachten.<br />
Es muss nicht unbedingt Scham sein, aber wichtig ist, zu beobachten,<br />
wie man sich zu unterschiedlichen Handlungen und<br />
Situationen verhält. Wichtig war uns, dass man auch versteht,<br />
was auf der Bühne passiert, denn der Kuss an sich ist simpel,<br />
dass man aber in der Zeit Durchblicke bekommt und Vermutungen<br />
aufstellt. So wird dieser selbstverständliche Vorgang<br />
immer undurchsichtiger.<br />
e: Man bemerkt auch mehrere Abstufungen. Von romantisch<br />
und zärtlich, dann wieder eine Orgie, im Sinne von jeder mit<br />
jedem. Hat mich ein wenig an Gang-Bang erinnert, wo man<br />
versucht hat, eine Orgie romantisch zu inszenieren. Hat sich<br />
das während der Proben so entwickelt?<br />
SS: Klar ist es in eine bestimme Richtung choreografiert. Wir<br />
geben aber nicht vor, was der Zuschauer in dem Geschehen<br />
sehen soll. Jeder sieht anders.<br />
VB: Wir spielen schon in eine Richtung, indem wir ein Bild<br />
vorgeben, z. B. eben die Orgie auf eine groteske Art. Es kommt<br />
auch schon in der Literatur vor, wo genau so was beschrieben<br />
wird und wo Arme und Beine ihren Träger verloren haben.
Das ist bei uns natürlich nicht der Fall, aber man kann das in<br />
die Szene hinein assoziieren. Im Prinzip versuchen wir, eben<br />
solche Bilder anzubieten.<br />
e: Glaubt ihr nicht, dass man schon etwas übersättigt ist von<br />
Liebe, Leidenschaft und Erotik im Alltag? Dass man vielleicht<br />
schon als Zuschauer abgestumpft ist und diese Denkstufen<br />
nicht mehr durchmacht?<br />
SS: Wir bieten auf jeden Fall was anderes an, als es die<br />
Werbung tut.<br />
e: Aber Erotik ist es schon. Nur verkauft wird damit nicht.<br />
SS: Es fängt ja mit offenen, fragilen Küssen an, die sehr<br />
langsam und nicht erotisch sind, die man auch so nicht in der<br />
Werbung sieht.<br />
e: Das steigert sich doch immerhin bis zu Orgie und Ausziehen.<br />
SS: Es gibt auf jeden Fall eine Körperlichkeit, die wir versuchen<br />
zu zeigen und auch nicht zu zeigen. Aber dieser Imperativ, sexy<br />
zu sein, wie in der Werbung - das ist nicht unser Ziel. Natürlich<br />
spielen wir auch die Themen an, die mit Erotik verbunden sind.<br />
Uns interessiert eher, dass das Material für potenzielle<br />
Kontexte geöffnet und nicht auf Pornografie oder Erotik<br />
reduziert wird.<br />
VB: Es geht für uns vor allem um den Vorgang, bei dem die<br />
Handlung in verschiedene Richtungen geöffnet wird.<br />
e: In alle Richtungen. Ist das nicht zu willkürlich? Habt ihr<br />
Grundpfeiler in eure Choreografie gesetzt? Oder: Was waren<br />
die Aspekte des Kusses, die euch interessiert haben im Gegensatz<br />
zu einer absolut pornografischen Darstellung?<br />
SS: Wir haben am Anfang sehr viel über den Kuss und sein<br />
Bedeutungspotenzial recherchiert, z. B. woher Menschen das<br />
Küssen überhaupt haben oder über den Judaskuss. Denn ein<br />
Kuss, das haben wir herausgefunden, bedeutet nicht immer,<br />
dass alles in Ordnung ist, wie wir das aus den Filmen kennen.<br />
Was uns letztlich interessiert hat, war, dass diese Form für eine<br />
Emotion benutzt wird, ohne gerechtfertigt zu sein, und dass<br />
das für die Leute, die das tun und für das Publikum nicht ohne<br />
Folgen ist. Also, dass man den Kuss wiederholt, wobei hierbei<br />
ohne Grund Reaktionen produziert werden. Diese ganzen<br />
minimalen Halluzinationen, die man hat, sind genau das, was<br />
uns im Endeffekt interessiert.<br />
e: Eine Frage zum letzten Lied: Fred vom Jupiter von Die Doraus<br />
& Die Marinas (Anmerkung: Die Choreografie zum Lied<br />
wurde aus dem Originalvideo übernommen). Bezweckt das<br />
einen Bruch oder weist es auf die Flüchtigkeit des Kusses hin?<br />
SS: Das Stück ist an sich in zwei Teile geteilt, die in Dysbalance<br />
zueinander stehen. Der erste Teil ist vom Küssen aus entwickelt<br />
und geht dann in Bewegung bis zur Entleerung über und<br />
wird als Inszenierung sichtbar. Beim zweiten Teil steht die Choreografie<br />
an erster Stelle. Es geht uns beim Lied auch darum,<br />
die Situation zu beenden und zu brechen.<br />
e: Hattet ihr am Anfang der Proben Hemmungen? Ich meine,<br />
im normalen Leben küsst man ja nicht willkürlich jemanden.<br />
SS: Ehrlich gesagt fanden wir es am Anfang ein bisschen<br />
„krass“, dafür verantwortlich zu sein, dass sich fremde Leute<br />
jetzt küssen. Es war von unserer Seite eine ganz neue Erfahrung.<br />
Angefangen haben wir harmlos mit Flaschendrehen, um die<br />
Spannung aufzubauen. Lacht.<br />
e: Wart ihr mit den Aufführungen in Berlin und Hamburg<br />
zufrieden? Wie ist Romantic Afternoon beim Publikum angekommen?<br />
VB: Ja, wir waren zufrieden und es ist sehr gut gelaufen. Das<br />
ist eigentlich ganz schön bei dem Stück, weil relativ viele Leute<br />
auf uns zukommen und uns Sachen erzählen, die sie gesehen<br />
haben. Das ist oft unterschiedlich, welche Eindrücke und Assozia<br />
tionen sie uns schildern.<br />
e: Also Unklarheiten klären?<br />
SS: Es ist für uns interessant zu hören, da es meistens ein<br />
Grundverständnis für solche Dinge gibt. Dann herrscht<br />
Irritation, jeder weicht bestimmten Dingen aus und fokussiert<br />
auf andere Dinge. Interessant, die vielen Eindrücke zu hören<br />
und wie sich Leute dazu verhalten. Diese Eindrücke sind sehr<br />
unterschiedlich.<br />
e: Was gibt es bisher für Stimmen?<br />
SS: Eine Meinung war, dass es um das Thema Jugend geht<br />
und man sich alt fühlt, wenn man das sieht. Man merkt auch,<br />
dass Leute bestimmten Sachen ausweichen und in anderen<br />
Momenten wieder vertraut sind.<br />
VB: Es kamen auch Vorschläge, dass man das mit Senioren<br />
oder mit anderen Darstellern machen könnte. Vielleicht wird<br />
das ja unser nächstes Stück. Die Menschen verhandeln ständig<br />
mit sich selbst, ob das jetzt okay ist, was auf der Bühne passiert,<br />
oder nicht. Man hat auch gemerkt, wo die Leute ihren<br />
Schwerpunkt gesetzt haben, ob sie auf die Küsse achteten<br />
oder das ganze „Drumherum“ total interessant fanden.<br />
e: Ist es Zufall oder Absicht, dass die Schauspieler ins Publikum<br />
geschaut haben?<br />
SS: Nein, das ist Absicht! Lacht. Es sind verschiedene Szenen,<br />
wo eben auch mit der Zuschauersituation gespielt wird, z. B.<br />
gibt es den einen Kuss, wo der Blick ganz bewusst ins Publikum<br />
gerichtet wird, und das ist für uns so eine Art Ausformulierung<br />
von Betrug. Es ist eine Szene, um den Judaskuss<br />
umzusetzen. Ab dem Moment ist es möglich, jemanden zu<br />
küssen und gleichzeitig zu betrügen.<br />
e: Herzlichen Dank an Sebastian Schulz und Verena Billinger<br />
für das aufschlussreiche Interview.<br />
41
Es hat mich nicht mitgerissen, etwas dafür zu tun.<br />
Hat mich leider nicht berührt. Es hat Potenzial gehabt,<br />
aber es hat sich verloren. Mein Fazit: Nee. Viele Ansätze,<br />
aber nicht zu Ende gedacht.<br />
Die auditive Seite, also die Musik, war ganz angenehm.<br />
Als es ruppiger wurde, war es spannender.<br />
Ist es eine Performance?<br />
Ekstase braucht einen Rhythmus –<br />
es war ein bisschen wenig rhythmisch.<br />
42<br />
Publikumsstimmen zu Romantic Afternoon<br />
aufgezeichnet von Theresa Naomi Hund und Victoria Schopf, 12.04.2011<br />
Provozierend, ganz klar.<br />
Bildrechte: Eliška Cikán
Macht und Märchen<br />
Ein Künstlerduo zum Thema hoheitliche Souveränität<br />
Vorbericht von Kristina Kirova, 06.04.2011<br />
souvereines heißt die Performance des schweizerisch-dänischen<br />
Künstlerinnenduos Chuck Morris. 2008 haben sich Lucie<br />
Tuma und Cecilie Ullerup Schmidt am Institut für Angewandte<br />
Theaterwissenschaft in Gießen zusammengeschlossen. In<br />
souvereines beschäftigen sie sich konzentriert mit Fragen,<br />
Attributen und Darstellungen von Macht. Dabei untersuchen<br />
sie die Attribute und Strategien vergangener, heutiger und<br />
kommender Herrscherinnen und verbinden in ihrem Projekt<br />
märchenhafte Fiktion mit tatsächlichen Machtstrukturen.<br />
Souveränität(en)<br />
Am europäischen Hof wird eine Königin gekrönt. Ihr Name<br />
lautet Chuck Morris. Sie steht über allem und hat absolute<br />
Macht. Sie versinnbildlicht ein Ideal und einen Hoffnungsträger,<br />
zu dem alle emporblicken. Sie dirigiert Gesetz, Religion<br />
und Finanzen. Chuck Morris ist ein Souverän und besitzt<br />
per definitionem das Monopol über die Staatsgewalt. Wenn<br />
man darüber nachdenkt, scheint Chuck Morris kein normaler<br />
Mensch, sondern eine Gottheit zu sein. Man wird neugierig.<br />
Was bedeutet die kommende Königin? Wie verführt Chuck<br />
Morris das Volk? Was bedeutet Arbeit? Für wen arbeitet Chuck<br />
Morris? Ihr Status und die Erwartungen an ihre Position nähren<br />
das Bild einer unfehlbaren Kreatur und einer ikonenhaften<br />
Diva. Erwartungen muss man erfüllen, wie man Ansprüchen<br />
gerecht werden muss. Auf diese Weise bleibt einem das Bild<br />
einer makellosen Exzellenz im Gedächtnis. So wie man eine<br />
Königin sehen will, taucht sie am Horizont der Wirklichkeit auf<br />
und ihr Porträt brennt sich auf ewig in die Netzhaut und alle<br />
Erinnerungen ein.<br />
Der Freud’sche Versprecher<br />
Ließe man den sich aufdrängenden Freud'schen Versprecher<br />
zu, würde man doch glatt das „M“ in seinen Nebenbuhler verwandeln<br />
und hätte auf einmal „Chuck Norris“ herausposaunt<br />
und müsste über dessen unterbewusste Bedeutung grübeln.<br />
Seltsamerweise scheint ebenjener Chuck Norris die Inkarnation<br />
einer Actiongestalt mit übernatürlichen Kräften zu sein.<br />
„Chuck Norris hat nicht Angst vor der Dunkelheit. Die Dunkelheit<br />
hat Angst vor Chuck Norris“, lautet eine der kursierenden<br />
Floskeln, derer es tausende gibt. Ein Mensch wird in ein völlig<br />
neues Bild gerückt. Er wird zu einer neuen Person gekrönt und<br />
mit einem völlig anderen Status bemessen. Doch manipuliert<br />
das staunende Publikum die Person oder bestimmt die Person<br />
über Denkstrukturen? Wer übt hier Macht auf wen aus? Es<br />
kommt einem verzwickten Teufelskreis gleich, ähnlich der<br />
Frage, ob denn zuerst das Huhn oder das Ei da war.<br />
Publikumsbefragung<br />
Chuck Morris bat bereits das Publikum in Berlin und in Hamburg<br />
zur Sitzung. Die Konfrontation schien unterschiedliche<br />
Eindrücke und Meinungen zutage zu bringen. Die Besucher der<br />
Souveränitäten schienen der Vorstellung einerseits hinterherzu<br />
hinken, sie andererseits als entspannt zu empfinden. „So<br />
gleitet diese schöne und ruhige Kontemplation an einem vorbei<br />
und es bleibt leider ein ‚Was soll’s?, das der Rezensent auch<br />
am Morgen danach nicht aufklären kann und auch keinen<br />
Ansatz findet“, lautet ein kritisches Urteil. „Es sind sehr schöne<br />
Bilder entstanden, aber es war zeitweise sehr langatmig“, tönt<br />
andernorts aus einer Publikumsbefragung. Scheinbar schweben<br />
einige Fragezeichen über den Köpfen der Besucher.<br />
Der Blickwinkel macht’s<br />
Um was geht es hier eigentlich? Was ist die Verbindung<br />
dieser souveränen Machtdemonstration mit dem Rückzug in<br />
die Öffentlichkeit? Über Kunst lässt sich bekanntlich streiten,<br />
weil sie im Auge des Betrachters liegt. Der Blickwinkel, aus<br />
dem heraus das Objekt betrachtet wird, fördert erst die Interpretation<br />
zutage. Deshalb bleiben wir gespannt und mischen<br />
uns unter das Volk, um baldigst den Souveränitäten höchstpersönlich<br />
zu frönen.<br />
43
Die gläserne Königin<br />
Bericht über die Porträtmalaktion<br />
Das Künstlerduo Chuck Morris zeigt sich nicht nur als bereits<br />
gekrönte Monarchin der Öffentlichkeit, sondern auch ihr Werdegang<br />
wird offen dargelegt. Und zu einer Königin gehört das<br />
Symbol der Unsterblichkeit schlechthin: das Porträt. Jenseits<br />
von Schnelllebigkeit und Photoshop nimmt sich die neue Herrscherin<br />
auch die Zeit, sich in jeder der angestrebten Städte mit<br />
Farbe und Pinsel verewigen zu lassen und so ihre Macht zu<br />
demonstrieren. In diesem Fall war es die Galerie Rauminhalt<br />
in der Schleifmühlgasse, die den hohen Besuch beherbergen<br />
durfte. Doch Chuck Morris ist eine zeitlose Königin, die sich<br />
in jedes Zeitalter fügt, und so war nicht nur der Maler selbst<br />
anwesend, sondern auch eine Vielzahl von Fotografen, die ihr<br />
Bild in die Welt hinaustragen.<br />
Gemäß dem Motto des diesjährigen Festivals verweilten<br />
Chuck Morris zurückgezogen in einem geschlossenen Raum,<br />
der für einige Passanten doch genug Barriere darstellte.<br />
Gleichzeitig befanden sie sich jedoch in einem goldenen (oder:<br />
gläsernen) Käfig, nämlich in einem Schaufenster, und waren so<br />
für alle, auch solche, die nur zufällig mit der Einkaufstüte ihrer<br />
Wege gingen, gut sichtbar. Dabei stellt sich Chuck Morris auch<br />
immer die Frage: Für wen arbeitet die Königin? Wem gehört<br />
sie? Dem Publikum? Will das Publikum Chuck Morris? Oder<br />
nimmt sich Chuck Morris diese Aufmerksamkeit einfach? Ist<br />
das Luxus? Macht? Oder Aufopferung in unangenehmen Posen?<br />
Und obwohl alles offen dargelegt wird: Kann man jemals<br />
einen privaten Blick auf die Königin erhaschen? Oder agiert sie<br />
konsequent in ihrer <strong>öffentlich</strong>en Rolle?<br />
Chuck Morris wird in die Geschichte eingehen. Oder zumindest<br />
vielfach in die Ahnengalerie.<br />
44<br />
von Eva-Maria Kleinschwärzer, 13.04.2011<br />
Verbeugt euch –<br />
die Königin kommt!<br />
Kritik von Christoph Wingelmayr, 15.04.2011<br />
Im Foyer kommt die Vorhut an. Hofdamen ihrer Majestät<br />
erscheinen und kündigen ihr baldiges Eintreffen an. Benimmregeln<br />
werden mit auf den Weg gegeben. Das Theatrale und<br />
der reale Raum wagen eine erstmalige Verschmelzung. Kurzes<br />
Warten. Wir erhalten Einlass in diese wundersame Welt.<br />
Streng geregelt, der Ablauf. Nach Protokoll, versteht sich.<br />
Chuck Morris empfängt uns. Wortstakkato, Gestammel,<br />
Adjektive prasseln auf das Publikum hernieder. Die Königin<br />
steht auf.<br />
Ihre Herkunft wird bekanntgegeben, Österreich, Spanien,<br />
überall. Lange ist sie schon Königin. Einzigartig, verstört,<br />
siegessicher, ruhig, cholerisch. Attribute einer Herrscherin,<br />
gefangen in ihrer Zwiespältigkeit. Schon bildhaft zerrissen in<br />
zwei Personen. Ihr höchstes Gut: die Abbildung. Im Internet,<br />
Fernsehen, in den Bildern, Symbole ihrer Macht.<br />
Kriegerisch, im Marschschritt, stolziert sie über die Bühne.<br />
Gleichzeitig unsicher und verlegen. Diese Herrscherin kann<br />
nicht glücklich sein. Das Öffentliche und das Private in einer<br />
Person. Schizophren, gefangen in diesem Dualismus des<br />
Seins. Ihr Tanz, ein Sinnbild ihrer puppenhaften, inszenierten,<br />
zuckenden Zweiteilung.<br />
Doch der Zuschauer wird phasenweise auf eine harte Probe<br />
gestellt. Zu wenig erschließt sich die Bedeutung der Darbietung.<br />
Stumm verfolgt man das Werk und versucht, ihm einen<br />
Sinn zu entlocken. Ohne Aufklärung wird man entlassen. Erst<br />
nach und nach bahnen sich erste Ansätze des Verstehens<br />
ihren Weg.<br />
Ein eigener Dramaturg hätte der Aufführung gutgetan. Zusammenhangslos<br />
und unstrukturiert plätschert sie dahin. Die<br />
Idee hätte Potenzial, die Umsetzung hinkt jedoch hinterher. Es<br />
fehlen Spannungsbögen und Höhepunkte. Dennoch lohnt die<br />
Rezeption. Ein wohlüberlegtes Stück Theater.
Behind the crown –<br />
Die Beleuchtung „zweier Königin“<br />
Kritik von Tanja Füreder, 15.04.2011<br />
Die kommende Königin kommt. Ihre Audienz wird noch im<br />
Foyer von den beiden Künstlerinnen Chuck Morris selbst angekündigt.<br />
Belehrungen, wie man sich gegenüber Ihrer Majestät<br />
zu verhalten hat, folgen, und dem Publikum wird ein Vorgeschmack<br />
auf die in der Performance wesentlichen Elemente<br />
wie königliche Artikulation und Wortschatz sowie strenger<br />
Disziplin gegeben.<br />
Die Vorinformationen über die Produktion souvereines von<br />
Chuck Morris werfen schon im Voraus einige Fragen auf, das<br />
aufliegende Protokoll über den Ablauf der Vorstellung ist dabei<br />
nicht besonders hilfreich. Die Erwartungshaltung des Publikums<br />
ist von einer gewissen Unsicherheit, jedoch auch von<br />
Neugier geprägt – was wird passieren?<br />
Was schließlich passiert, ist eine Performance, die durch eine<br />
permanente Aneinanderreihung von Charakterbeschreibungen,<br />
fragmentarischen Tanzschritten, regelmäßiger Kommentierung<br />
und unterstützenden Details durch Ton und Beleuchtung<br />
bestimmt ist. Eine Performance, die es sich zur Aufgabe<br />
macht, auf abstrakte und sehr beherrschte Weise die totale<br />
Durchleuchtung einer gespaltenen, tragenden Persönlichkeit<br />
darzustellen. Die Königin Chuck Morris, verkörpert durch<br />
die zwei am Rücken aneinandergebundenen Künstlerinnen<br />
Chuck Morris, steht auf, stellt sich vor, kommt, erscheint, wird<br />
angezogen, tanzt und spricht, denkt sogar vor dem Publikum,<br />
dem Volk, in der Öffentlichkeit, bis sie sich schließlich zurückzieht<br />
und das Stück ein offenes Ende findet. Die gesamte<br />
Vorstellung steht ganz im Zeichen der Hervorbringung der<br />
Gespaltenheit einer Königin als einerseits <strong>öffentlich</strong>e, repräsentierende<br />
und andererseits private Person. Beschreibungen<br />
ihres Charakters in Form einer Aufeinanderfolge sich teilweise<br />
widersprechender Adjektive, hörbar gemachte Gedanken der<br />
divenhaften Herrscherin und das Spiel mit Licht und Schatten,<br />
Beleuchtung und Verdunkelung, verdoppeln diese Aussage.<br />
Obwohl die künstlerischen Elemente, der fragmentarische<br />
Tanz- und Sprechstil wie auch die beiden Künstlerinnen in sich<br />
absolut stimmig und stilvoll sind, mangelt es an einer ausreichenden<br />
Sinnhaftigkeit des Inhalts. Die endlos erscheinende<br />
Folge von Beschreibungen, Kommentaren, Phrasen wirkt nach<br />
einiger Zeit wie ein Kreisen um nichts. Schließlich ist man hin<br />
und her gerissen zwischen Ratlosigkeit, möglicherweise auch<br />
Resignation, aber auch noch einem Funken Spannung, denn<br />
neugierig ist man immer noch und wartet auf einen Bruch,<br />
eine Auflösung, ohne zu wissen, wie diese eigentlich aussehen<br />
könnte. Nach einer Gesangseinlage am Schluss zieht sich die<br />
Königin Chuck Morris jedoch zurück, die Vorstellung endet und<br />
hinterlässt verstörende Eindrücke.<br />
souvereines beeindruckt zwar durch die ausgefeilte Performance,<br />
enthält viele ansprechende Details und Stilmittel, doch<br />
die im Mittelpunkt stehende Thematik der zweigeteilten Person<br />
Königin scheint inhaltlich in dieser Form zu wenig zu sein,<br />
um dem Stück die notwendige Bedeutung und Sinnhaftigkeit<br />
zusprechen zu können.<br />
45
e-<strong>xilant</strong>: Wie verlief eure bisherige Zusammenarbeit?<br />
Chuck Morris: Wir haben zum ersten Mal 2008 zusammengearbeitet<br />
und in „Siebenschönchen“ das Medium Film ins<br />
Theater übersetzt. Als Vorbild diente der tschechische Film<br />
„Tausendschönchen“, der uns sehr viel Spielraum geboten hat,<br />
weil ja die Nouvelle Vague auf allen Ebenen auch sehr viel<br />
experimentiert, etwa mit Schnitt oder Farbe. Wir haben uns<br />
in dieser Produktion mit der postrevolutionären Frage „und<br />
was nun?“ auseinandergesetzt und damit, wie man überhaupt<br />
noch politisch sein kann.<br />
e: Wie kommt ihr zu eurem Namen?<br />
C: Wir wollten bewusst einen gemeinsamen männlichen<br />
Namen, es handelt sich dabei um ein Wort- und Klangspiel.<br />
Von Boris zu Moris und eben auch Morris. Auch Philosophen,<br />
die wir mögen, waren Vorbilder, daher Jacques, später dann<br />
Chuck. Erst beim Googeln ist uns dann die Verbindung zu<br />
Chuck Norris aufgefallen. So kommt es, dass wir oft Kommentare<br />
zu hören bekommen wie: Ah ja, Chuck Morris, davon hab<br />
ich schon gehört.<br />
e: Entwickelt hat sich die Produktion souvereines ja mit eurem<br />
Rechercheprojekt „souvereines Undressed”<br />
C: Ja, das war im April letzten Jahres. Wir wollten auch den<br />
Weg zu unserer Arbeit <strong>öffentlich</strong> machen, wir haben nämlich<br />
im Schaufenster gearbeitet und so auch gezeigt, was man normalerweise<br />
nicht sieht. Im Theater versteckst du dich ja bis zur<br />
Premiere in deinem Proberaum. Dabei gab es jeden Tag einen<br />
anderen Schwerpunkt wie etwa nackt arbeiten, und am Ende<br />
der Woche kam dann das Krönungszeremoniell. Der Schwerpunkt<br />
der Woche war: Für wen arbeitet Chuck Morris? Und<br />
wem gehört Chuck Morris? Dem Publikum? Gleichzeitig diese<br />
Geste von Souveränität: Wir nehmen uns Aufmerksamkeit, wie<br />
ja z. B. bei der Porträtaktion. Hier findet auch ein Drehmoment<br />
in der Zeit statt.<br />
e: Und warum das Motiv der Königin?<br />
C: Ein wichtiger Punkt war die gesellschaftliche Aussage, dass<br />
alle gleich sind. Wir untersuchen, wie sich die Darstellung<br />
von Macht, die ja heute durchaus noch vorhanden ist, verschoben<br />
hat, denn es ist ja kein Zufall, welche Bilder in der<br />
Öffentlichkeit auftauchen. Dabei waren ältere Inszenierungsformen<br />
interessanter für uns, denn mit der Angleichung an<br />
das Bürgertum beginnen diese sich sehr zu ähneln. Früher gab<br />
es unterschiedlichste Darstellungen von Körpern, etwa die<br />
volksnahe Mutter, die unantastbare Erscheinung oder aber die<br />
starke, erotische Frau.<br />
46<br />
Skandal bei den Royals: Chuck Morris packt aus!<br />
Audienz bei Chuck Morris von Eva Kleinschwärzer und Nathalie Knoll, 14.04.2011<br />
e: Was ist für euch Macht, mit welchen Symbolen spielt ihr?<br />
C: Wir haben uns ja auch wissenschaftlich mit Machtattributen<br />
beschäftigt. Das war früher vor allem Bildung, z. B. wenn<br />
man sich vor einem Bücherregal malen ließ. Oder wenn man<br />
seine Verbindung zur Nation körperlich darstellte. Elisabeth<br />
I. ließ sich auf einer Weltkarte stehend porträtieren. Heute<br />
demonstriert man Macht, indem man sich mit moderner und<br />
abstrakter Kunst in Verbindung bringen lässt oder indem man<br />
sich gelassen gibt, z. B. mit Jogginganzug und Baby. Dabei spielen<br />
auch immer die aktuellen Wertvorstellungen der Gesellschaft<br />
eine Rolle. Was bleibt, ist eine Struktur von Einschüchterung<br />
und Schau-ich-hab-das-deshalb-bin-ich-mächtiger. Wir<br />
beziehen uns also generell auf solche Körpertechniken. Heute<br />
sieht man sich ja eher „released“. Durch diese Natürlichkeit<br />
könnte man auch meinen, dass der Zuschauer ebenso gut auf<br />
der Bühne stehen kann. Tut er aber nicht, und deshalb sind wir<br />
im Endeffekt doch nicht alle gleich.<br />
e: Warum identifiziert sich Chuck Morris über zwei Königinnen<br />
in einer Person?<br />
C: Inspiriert hat uns dabei die Aussage, dass Königinnen einen<br />
natürlichen und einen politischen Körper haben. Das kann man<br />
auf zwei Ebenen verstehen, nämlich so, dass der Körper der<br />
Frau sowohl privat als auch <strong>öffentlich</strong> existiert, oder so, dass der<br />
natürliche Körper vergänglich ist, während der politische Körper<br />
von Herrscher zu Herrscher weitergereicht wird. So entsteht<br />
auch das moderne Bürgersubjekt, wo jeder seinen Status, seine<br />
Rechte und Pflichten hat, und so entstehen auch hier ein privater<br />
und ein <strong>öffentlich</strong>er Körper, diese beiden sind quasi untrennbar.<br />
Auch bei Königinnen verschmelzen diese Körper, denn um<br />
politisch wirksam zu sein, muss der private Körper immer noch<br />
gebären können. Wer in unserem Fall was repräsentiert, bleibt<br />
der Überlegung des Zuschauers überlassen.<br />
e: Wie waren die Reaktionen in Hamburg und Berlin bisher?<br />
C: Wir erzeugen ja im Vorhinein schon eine Erwartungshaltung<br />
von Perfektion, weil wir sehr systematisch und formell arbeiten.<br />
So erziehen wir unser Publikum zu einem strengen Blick.<br />
Und das ruft durchaus starke Reaktionen hervor, auch deshalb,<br />
weil wir den Zuschauer am Ende mit seiner Meinung allein<br />
lassen und wir dessen Erwartungen an zeitgenössische Kunst<br />
im Allgemeinen vielleicht nicht erfüllt haben.<br />
e: Habt ihr eine Lieblingskönigin?<br />
C: Elisabeth I. !
„I hob’s net gechecked“ – „Ob die Ballett machen?“<br />
Stimmungsbild von Sebastian Schley, 15.04.2011<br />
Gerade hat sich die „kommende Königin“ hinter die kleine<br />
Bühne des <strong>brut</strong> im Konzerthaus zurückgezogen. Die Audienz<br />
ihrer Majestät scheint beendet. Langsam erlöschen die<br />
Scheinwerfer, die Boxen verstummen und es wird dunkel und<br />
still. Nur eine Handvoll Zuschauer begreift diesen inzwischen<br />
ritualisierten, beinahe standardisierten Vorgang der theatralen<br />
Dramaturgie und beginnt nun zögerlich damit, ihre<br />
Handflächen aneinanderzuklatschen. Der mehrheitliche Rest<br />
– darunter ich – verharrt in der Stille und reagiert erst, als das<br />
große Saallicht zum kollektiven Mitmachen einlädt.<br />
Was zurückbleibt, ist allumgreifende Ratlosigkeit. Floskeln machen<br />
die Runde. „I glaub, I hob’s net gechecked“, „Aha“, „Was<br />
war das denn?“.<br />
Ich gehe in den Vorraum, schaue mich um und blicke ausschließlich<br />
in irritierte und nachdenkliche Gesichter. „Ich<br />
brauch wohl noch ein bisschen Zeit, bis sich mir der Sinn des<br />
Ganzen erschließt“, erklärt ein e-<strong>xilant</strong>-Kollege, „vielleicht weiß<br />
ich’s in drei Stunden.”<br />
Bildrechte: Christoph Wingelmayr<br />
Vielen scheint es da nicht anders zu gehen. Ein paar<br />
Meter weiter treffe ich auf eine Kulturreferentin des Landes<br />
Niederösterreich. „Mal was anderes, irgendwie passend zu<br />
Österreich, das Monarchie-Thema“, erzählt sie. Ihre Freundin<br />
fügt hinzu, dass vor allem die tänzerische Choreografie eine<br />
Wahnsinnsleistung sei. „Ich arbeite im Bereich Theater und<br />
Performancekunst und hab so was selber mal einstudiert –<br />
das ist unglaublich anstrengend.”<br />
Ich frage, was ihnen das Stück inhaltlich gesagt habe, und<br />
ernte zunächst langes Schweigen. Die Kulturreferentin<br />
versucht sich an der Interpretation der doppelmenschlichen<br />
Beschaffenheit der „kommenden Königin“, was ihr allerdings<br />
nicht so recht zu gelingen scheint. Anschließend ergänzt sie:<br />
„Man hat sich aber wirklich wie das Volk gefühlt“, und ihre<br />
Freundin bemerkt: „Die eine hatte so einen ganz durchdringenden<br />
Blick, das hat wirklich funktioniert.”<br />
Inzwischen hat sich der Vorraum fast vollständig geleert. Ich<br />
beschließe zu gehen, um die Lovefuckers-Inszenierung im<br />
Künstlerhaus nicht zu verpassen. Um mich herum scheint sich<br />
die Irritation allmählich in verblüffte Anerkennung gewandelt<br />
zu haben. Auch die Wortfetzen, die ich hier und da noch auf<br />
der Stiege aufschnappe, sind jetzt andere:<br />
„Große Leistung“, „Sich so zu bewegen, muss schwer sein“,<br />
„Ob die Ballett machen?“.<br />
47
„Die Zeit ist reif für einen Politthriller über Muammar al-<br />
Gaddafi“, erkannten die Lovefuckers aus Berlin lange vor den<br />
aktuellen Ereignissen in Libyen. Die Gruppe um Ivana Sajevic,<br />
Theaterwissenschaftlerin und Absolventin der Schauspielkunst<br />
an der Ernst Busch-Hochschule, Abteilung Puppenspielkunst,<br />
und Anna Menzel, ebenfalls Absolventin der Puppenspielkunst,<br />
setzten sich mit dem nordafrikanischen Herrscher auseinander,<br />
lange bevor er die Medien einnahm. Eben aufgrund der<br />
fehlenden medialen Beschäftigung mit den haarsträubenden<br />
Allüren des „Königs aller Könige“ hatte sich Regisseurin Sajevic<br />
dieser Thematik angenommen und damit offensichtlich ins<br />
Schwarze getroffen.<br />
Am Anfang der Idee und auch zu Beginn der Proben waren<br />
die Ereignisse im Wüstenstaat nicht einmal zu erahnen – im<br />
Gegenteil: Sajevic war noch beim Ausbruch der Revolten in<br />
Tunesien skeptisch gegenüber der Möglichkeit einer solchen<br />
Entwicklung in Libyen; zu festgefahren, zu verschlossen sei das<br />
System, Gaddafi habe „sein Volk unter eiserner Hand“. Seine<br />
starke autoritäre Führung werde einen möglichen Aufstand<br />
wohl schon im Vorfeld verhindern. Denn die Lovefuckers hatten<br />
bereits die dramaturgische Setzung, zum Ende des Stücks<br />
hin eine Revolution ausbrechen zu lassen, ohne eine solche als<br />
realistisch anzusehen – doch dann geschah ebendies, und die<br />
Truppe änderte ihr Vorhaben ein wenig ab; nicht etwa zum<br />
aktuellen Geschehen hin, nein, von den Ereignissen weg.<br />
Schließlich wäre es hinfällig, zu zeigen, was täglich ohnehin in<br />
den Medien verfolgt werden könnte. Wer mit dem Bedürfnis<br />
zu politischer Aufklärung das Stück besucht, wird nicht fündig<br />
werden - davon zeugen auch Stimmen aus Berlin: „Stand das<br />
Konzept schon vor den aktuellen Ereignissen?“ – „Vor einem<br />
halben Jahr hätte ich es recht lustig und witzig gefunden“. Insgesamt<br />
aber wurde das Konzept rund um Puppentheater, Videosequenzen,<br />
Schauspiel und Musik, abgerundet durch einen<br />
deutsch-englisch-italienisch-arabischen Akzentmix, bislang<br />
äußerst lobend aufgenommen: Gaddafi als halbmetergroße<br />
Puppe, mit schwarzer Lockenperücke, Las-Vegas-Sonnenbrille<br />
und den für ihn so typischen pompösen Kaftanen; laut gegen<br />
Amerika wetternd („Fuck USA!“), und sich als großer Revolutionsführer,<br />
überzeugter islamischer Sozialist und Gegner aller<br />
parlamentarischen Demokratien präsentierend.<br />
48<br />
Gaddafi Superstar – Politthriller, Puppenporno, Popsensation<br />
Vorbericht von Tea Sahǎcić, 06.04.2011<br />
„Ich bin der König aller Könige!“<br />
Warum Gaddafi als Puppe? Eine überzeugende Darstellung<br />
durch einen Schauspieler hätte sich als schwierig erwiesen;<br />
schließlich bleiben immer die eigene Präsentation und die Inszenierungsfreiheit<br />
des Darstellers. Bei einer widersprüchlich<br />
schillernden Figur wie Muammar al-Gaddafi wäre das aber ein<br />
zu starker Kontrast gewesen – sind sein Auftreten, seine Reden,<br />
Gesten und Handlungen, doch bereits diskrepant genug;<br />
einerseits messiasgleich Weltfrieden, Gleichberechtigung und<br />
Volksbestimmung aus seinem „Grünen Buch“ – einer möchtegern-utopiesozialistischen<br />
Schrift – predigend; andererseits<br />
mit despotischer Hand seine Untertanen führend, politische<br />
Positionen und Milliarden von Dollar freimütig an Verwandte<br />
verteilend. So unberechenbar wie Gaddafi selbst kann nur sein<br />
Puppenabbild sein: eine leere Hülle, mal von einer Seite, mal<br />
von der anderen geführt, die die Identität Gaddafis unreflektiert<br />
annehmen kann, ihn in allen seinen Facetten zeigt. Dank<br />
der Puppe ist Gaddafi nonexistent; es lässt sich leichter auf<br />
den Inhalt konzentrieren, erlaubt einem das unbefangene<br />
Lachen über diese widersprüchliche Figur.<br />
Weiß Gaddafi eigentlich, dass er sich ständig selbst widerspricht?<br />
Diese Frage tritt neben seinem spektakulären Lebens-<br />
und Regierungsstil wohl oder übel in den Hintergrund. Denn<br />
Superstar Gaddafi ist ein Meister der Selbstdarstellung; allein<br />
durch diesen Umstand sprang er Ivana Sajević erst einmal ins<br />
Auge: ein Mann, der sich eine Leibgarde, bestehend aus vierzig<br />
weiblichen Jungfrauen, allesamt in einem eigens hierfür eingerichteten<br />
Trainingslager in Tripolis ausgebildet, hält; der sich<br />
strikt weigert, bei Staatsbesuchen in Hotels zu nächtigen, und<br />
stattdessen vehement darauf besteht, sein Zelt – in guter alter<br />
Beduinenmanier – mitten im Central Park aufzuschlagen um<br />
angemessen logieren zu können; einer, der die UN Charta verbrennt<br />
um seinen Standpunkt auszudrücken – das ist Muammar<br />
al-Gaddafi, der 1969 durch einen Staatsstreich gegen den<br />
vormaligen libyschen König Idris zu absoluter Macht gelangte,<br />
und der von über zweihundert afrikanischen Königen und<br />
Stammesherrschern zum „König aller Könige“ ausgerufene<br />
dienstälteste Diktator der Welt.
Lachen erlaubt<br />
Despotischer Herrscher, beherzter Idealist, träumerischer<br />
Dichter und gewandter Monopolist in einer Person, ist ihm die<br />
King of the Kings-Aufführung wie auf den Leib geschneidert:<br />
bunt, laut, wild durcheinandergewirbelt, trashig; hier lassen<br />
die Lovefuckers die Puppen wortwörtlich tanzen, und nicht<br />
nur das; sie springen, fliegen, singen. Im Vordergrund steht<br />
das unbegreifliche Leben und Wirken des libyschen Diktators,<br />
der es wie kaum ein anderer versteht, sich zu inszenieren.<br />
Jeder Auftritt ist eine große Show, die den von ihm initiierten<br />
„Mythos Gaddafi“ unterstützen soll. Ein wahrer Performancekünstler,<br />
der die Aufmerksamkeit sucht, sie liebt. So gesehen<br />
ist King of the Kings lediglich eine Überspitzung des wahren<br />
Lebens Gaddafis; eines Mannes, der den Unterschied zwischen<br />
Öffentlichkeit und Privatheit, ganz dem Freischwimmer-Thema<br />
„Rückzug ins Öffentliche“ gemäß, nicht mehr zu erkennen<br />
vermag: Persönliche Wünsche und Vorstellungen werden auf<br />
ein gesamtes Volk projiziert, unhaltbaren Handlungen wird<br />
eine politische Ideologie zugrunde gelegt, das eigene private<br />
Denken wird im Gesetz festgeschrieben. All dies wirft die<br />
Fragen auf: Wie kann so jemand beinahe ein halbes Jahrhundert<br />
an der Macht geblieben sein? Warum ließen ihn alle so<br />
lange gewähren? Und was ihm da alles gewährt wurde, das<br />
ist in der Vorstellung zu bestaunen: Gaddafi mit „best friend“<br />
Berlusconi, der ihm im Falle des Falles vorsorglich schon das<br />
Exil in Italien zugesichert hat, bei Sexspielchen mit Fesseln und<br />
Peitschen; Gaddafi auf der Toilette, natürlich samt weiblicher<br />
Leibgarde; Gaddafi beim alltäglichen Waffeneinkauf.<br />
King of the Kings ist ein Stück mit großer Gestik, ein Stück<br />
für die Massen, auch für solche, die nicht über das libysche<br />
Geschehen informiert sind; eine krachende Komödie, die die<br />
Zuschauer womöglich noch weiter von der ohnehin fernen<br />
politischen Realität entfernt und sie, getragen durch offene,<br />
wenngleich auch kritische Pointen, der persönlichen Verantwortung<br />
entbindet. Ein Stück zum Lachen. Also: Lachen ist<br />
erlaubt. Und erwünscht.<br />
Handpuppen im Kugelhagel<br />
Kritik von Jennifer Vogtmann, 15.04.2011<br />
Der 2008 zum König der Könige von Afrika ausgerufene und<br />
selbsternannte Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi<br />
stattete <strong>Wien</strong> im Rahmen einer Produktion der Lovefuckers<br />
einen Besuch ab. Als Handpuppe inszenierte er sich selbst<br />
als „King of the King“ im gleichnamigen Stück und residierte<br />
natürlich wie üblich im Beduinenzelt. Seine persönliche Garde<br />
hatte er selbstverständlich auch mitgebracht. Noch vor dem<br />
ersten Auftritt des Revolutionsführers bekamen die Zuseher<br />
via Videoprojektion eine Umfrage zur Person Muammar al-<br />
Gaddafi zu sehen. Anschließend begann das rasante Stück.<br />
Immer wieder fielen Schüsse. Immer wieder Entwarnung<br />
durch die angespannte Leibgarde. Was braucht ein Mann wie<br />
Gaddafi also, nachdem er seine Geschenke entgegengenommen<br />
hat? Waffen. Also traf er sich erst einmal mit den Waffenexperten<br />
und ließ sich vom Social Business, drei Handpuppen,<br />
die neuesten Waffen vorführen. Nicht aber ohne sich vorher<br />
frisch zu machen, und so bekamen die Zuseher, wie in jedem<br />
Szenenwechsel, via Videoprojektion Einblicke in das Leben<br />
des selbsternannten Revolutionsführers hinter den Kulissen.<br />
Freund wie Feind hatten in King of the Kings ihren Auftritt.<br />
Von Berlusconi ließ sich Gaddafi lustvoll den Hintern versohlen,<br />
Jörg Haider bat er um sein Geld. In Reagans Grab wollte<br />
Gaddafi sich verstecken und mit den Schweizern (Fingerpuppen),<br />
die aus dem Vogelkäfig auf Gaddafis fliegendem Teppich<br />
geflohen waren, gab es eine hitzige Verfolgungsjagd. Aber<br />
auch die lyrische Seite Gaddafis fand mit dem Buch „Das Dorf,<br />
das Dorf, die Erde, die Erde (...)“ Erwähnung. Das „Grüne Buch“<br />
wurde den Zusehern während der Vorstellung von zwei um<br />
die Wette feilschenden Darstellern zum Verkauf angeboten.<br />
Und immer wieder hatte Muammar al-Gaddafi ein ihm selbst<br />
huldigendes Lied auf den Lippen. Beinahe schon hätte ich mit<br />
der exzentrischen Handpuppe sympathisiert, doch als ihm ein<br />
Anhänger (ebenfalls eine Handpuppe) den neuesten Gaddafi-<br />
Witz erzählte, zeigte sich die grausame Seite des „King of the<br />
King“. Er beschloss: „Wer den Witz erzählt, wird erschossen,<br />
und machte bei seinem Informanten den Anfang. Ganz ohne<br />
Scham und mit viel überzeichnetem Humor brachten Lovefuckers<br />
ihr fulminantes Stück auf die Bühne. Wer traut sich den<br />
nächsten Witz zu erzählen?<br />
49
„Let‘s fetz” sprach MC G …<br />
und flog mit dem goldenen Teppich davon<br />
Kritik von Lisa Schöttel, 16.04.2011<br />
Egal ob beim entspannten „Bunga Bunga“ mit Silvio Berlusconi<br />
oder beim Kamelritt durch die Wüste: Gaddafi rockt, und jeder<br />
schweigt, wenn er befiehlt.<br />
Mit der Inszenierung des Wüstendiktators haben sich die Lovefuckers<br />
an ein sehr brisantes Thema gewagt, das durch die aktuellen<br />
Ereignisse entweder zum Top oder aber auch zum Flop<br />
werden konnte. Sie wandern eine Stunde lang auf der Grenze,<br />
treten ab und zu einen Schritt zu weit in den Klamauktopf und<br />
überzeugen doch auf voller Linie.<br />
Würde man nicht wissen, dass das Stück bereits vor den Kämpfen<br />
der Rebellen mit Gaddafi entstanden ist, so würde man<br />
sehr wohl an der Moral der Darsteller zweifeln.<br />
Aber warum nicht das ganze Thema mal völlig in die Lächerlichkeit<br />
ziehen, oftmals werden der Klamauk und die<br />
Groteske politischer Prinzipien erst durch ihre Übertreibung<br />
beim Zuseher wahrgenommen. Die vielen Skandale, die in der<br />
Politik passieren, die vielen Menschen, die in der Öffentlichkeit<br />
stehen, werden durch den Kakao gezogen und dabei nicht mal<br />
mehr abgetrocknet.<br />
Die Inszenierung des libyschen Diktators ist perfekt getimed<br />
und choreografiert, es entstehen keine Lücken oder Unsicherheiten.<br />
Und auch die Bewegungen und die Stimme der Puppe<br />
Gaddafis wirken von Anfang an sehr authentisch. Zuerst noch<br />
in unverständlichem Arabisch, erklärt uns Gaddafi schon bald<br />
die Freuden des Diktatorendaseins auf Englisch. Egal ob er<br />
über die Vormachtstellung des Mannes gegenüber der Frau<br />
spricht, da diese ja durch Schwangerschaft und Stillen ständig<br />
geschwächt ist, oder seine Untertanen zu Tänzen und Liedern<br />
zwingt. Er ist sich seiner Macht bewusst und verfällt dadurch<br />
in die Rolle eines kleinen Kindes, das sich über neue Waffen so<br />
freut wie andere Kinder über einen neuen Bauklotz.<br />
Und hinter ihm versammeln sich neben den internationalen<br />
Business-People und Schweizer Bergtouristen auch bekannte<br />
korrupte europäische Politiker, die uns einen Einblick in ihre<br />
scheinbar wichtigen Aufgaben in der Weltpolitik gewähren.<br />
Berlusconi schaut z. B. auf einen Sprung in Libyen vorbei, um<br />
Gaddafi den Hintern zu versohlen. Oder Jörg Haider, der von<br />
Gaddafi aus der Gruft geholt wird, um ihm geheime Kontodaten<br />
zu entlocken, und der jedoch nur am Oberkörper Gaddafis<br />
interessiert ist. Kärnten wäre empört!<br />
Natürlich kann diese große Übertreibung auch als Witzvorstellung<br />
abgetan werden, die à la Villacher Fasching die Politiker<br />
auf die Schaufel nimmt. Aber King of the Kings fällt nicht in<br />
diesen Topf, da trotz der humorvollen und grotesken Art und<br />
50<br />
Weise auch ein leiser kritischer Ton mitklingt. Gespräche<br />
werden alle zwei Minuten von wildem Schießen unterbrochen.<br />
Eine Realität, die sich zurzeit auch in Libyen abzeichnet. Schon<br />
durch die Lautstärke der Pistolen überkam den Zuseher ein<br />
mulmiges, wenn nicht sogar ängstliches Gefühl.<br />
Auch in der Inszenierung der Figur Gaddafis zeigen die<br />
Lovefuckers viele Facetten, die vielleicht auch in der Realität<br />
helfen, das Schaffen dieses Mannes zu verstehen oder zumindest<br />
nachvollziehbar zu machen. Was Gaddafi fehlt, ist<br />
Menschlichkeit. Am Ende kann er sogar nur noch als Kopf ohne<br />
Körper existieren. Wie ein Regenwurm, den man auszulöschen<br />
versucht, der aber immer weiterleben kann.<br />
Die Atmosphäre, die die Lovefuckers auf der Bühne schaffen,<br />
ist sehr dicht und spannend. Von Puppenspielen, Tanzeinlagen<br />
bis hin zu abenteuerlichen Verfolgungsjagden bleibt<br />
kein Genre ausgespart. Trotzdem bleibt das Stück sehr an der<br />
Oberfläche hängen. Kritik wird geübt, aber schon im nächsten<br />
Satz wird einfach ein neuer Politiker aufs Korn genommen. Die<br />
Lovefuckers wollten sich austoben und begeistern, Tiefgründigkeit<br />
wird der Zuseher eher nicht finden. Aber vielleicht ist<br />
das Stück genauso banal, wie es auch die Politik ist.<br />
Und am Ende entlarvt sich Gaddafi eben nur als ruhmgeiler<br />
Popstar, der die Aufmerksamkeit der Menschen braucht und<br />
heilfroh darüber ist, dass die Lovefuckers nun endlich auch ein<br />
Stück über ihn geschrieben haben. „Let's fetz” lautet seine Devise,<br />
und wir hoffen mal alle, dass er bald wirklich auf seinem<br />
Teppich über alle Berge fliegt.
„What is the question?”<br />
Auszug aus dem Interview mit Lovefuckers von<br />
Birte Gemperlein und Daniela Scheidbach, 15.04.2011<br />
„I don’t like to be on television and give interviews“, so einmal<br />
Gaddafis Worte während eines Fernsehinterviews. Gut,<br />
dass die Lovefuckers um die Puppenspielerinnen Anna Menzel<br />
und Ivana Sajevićc nicht so „scheu“ drauf sind wie der<br />
selbsternannte „King of the King“. e-<strong>xilant</strong> wurde fleißig Rede<br />
und Antwort gestanden, ganz ohne Gaddafi'sches „What is<br />
the question?”<br />
e-<strong>xilant</strong>: Wie ist die Idee aufgekommen, ein Theaterstück über<br />
Gaddafi zu machen?<br />
Ivana Sajevic: Die Idee liegt sehr lange zurück. Es hatte damit<br />
zu tun, dass ich verschiedene politische Figuren herausgepickt<br />
habe und eigentlich ein Stück machen wollte über viele<br />
Politiker, und dann habe ich bei Gaddafi gemerkt, der gibt<br />
ziemlich viel Stoff her für einen eigenen Abend. Und dann hat<br />
sich im Rahmen des Freischwimmer-Festivals im letzten Jahr<br />
die Möglichkeit ergeben, da ein Konzept einzureichen. Dann<br />
hab ich das gemacht mit den Grundsäulen der Konzeption und<br />
dann das Team zusammengestellt, und Anfang Januar gab's<br />
die Proben.<br />
e: Wie muss man sich das vorstellen? Wie hast du das Stück<br />
zusammengebastelt?<br />
IS: Gaddafi hat ja zwei Bücher geschrieben. Das war eine<br />
wichtige Grundlage. Es gab so einen groben Szenenplot. Es<br />
gab auch mal die Überlegung, ein Stück zu schreiben, also<br />
ein Gerüst davor festzulegen. Aber dann hab ich immer mehr<br />
gemerkt, das ist irgendwie Quatsch, weil ich schon wusste,<br />
wer da so mitspielt, und die meisten auch kannte, und ich<br />
habe mich dann entschlossen, anhand dieses groben Plots zu<br />
improvisieren. Und die ersten vier, fünf Wochen haben wir entlang<br />
der Szenen permanent improvisiert. Alle wurden gebrieft.<br />
Die wurden irgendwann so gut wie möglich auf denselben<br />
Stand gebracht, wie ich selber war. Wir haben in den Proben<br />
die beiden Bücher gelesen, wir haben sehr viele Artikel über<br />
ihn gelesen, wir haben sehr viel diskutiert, weil es immer viele<br />
verschiedene Meinungen dazu gab. Und dann kam natürlich<br />
auch sehr viel von den Spielern mit rein. Weil jeder hat selber<br />
angefangen, mitzudenken, und da ja improvisiert wurde, hatten<br />
sie immer die Möglichkeit, Sachen einzubringen. Und so<br />
hat sich dann im Laufe der Probenzeit alles zusammengesetzt.<br />
e: Hattet ihr keine Angst vor diesem doch eher<br />
heiklen politischen Thema? Gab es nicht auch etwas<br />
Beklemmung deswegen?<br />
Annemie Twardawa: Angst auf keinen Fall. Aber ich hab auf<br />
jeden Fall damit gerechnet, dass es mehr negative Reaktionen<br />
gibt und auch eine Abwehrhaltung und Leute, die halt eher<br />
sagen, man kann nicht so leichtfertig mit einem Diktator<br />
umgehen, mit einer Person, die die Macht hat, Menschen umzubringen.<br />
Die meisten haben das eher so gesehen, dass man<br />
so gut mit dem Thema umgehen kann. Dadurch, dass die Lage<br />
dann aber so ernst wurde, hat das immer mehr Sinn gemacht,<br />
jetzt was über ihn zu machen. Und auch auf die Art. Weil man<br />
auf die Art Sachen darstellen kann, die man anders einfach<br />
nicht darstellen könnte. Wir haben das ja eigentlich alles nur<br />
so nachgespielt.<br />
Anna Menzel: Bei mir eigentlich gar nicht am Anfang. Wenn<br />
du improvisierst, dann nimmst du dir erst mal den Raum und<br />
musst auch alles machen dürfen, dafür ist die Probe ja auch da<br />
– um alles auszuprobieren. Später hab ich schon mal überlegt,<br />
wie finde ich das selber jetzt grade? Darf man das machen?<br />
Ich hab mir dann gedacht, das ist nicht meine Aufgabe. Ich<br />
mach es gerne und mir macht es Spaß und ich kann auch über<br />
solche Sachen lachen – ich hab eh an schwarzen Humor.<br />
Nils Zapfe: Ich fand's interessant, dass sich die Gegner im<br />
Publikum für mich beim Entwickeln irgendwann geändert<br />
haben. Als wir angefangen haben, im Januar gab es noch keine<br />
arabische Revolution in irgendeiner Form, war immer meine<br />
ängstliche Sorge: Wie weit reichen eigentlich die Arme von<br />
Gaddafi? Was heißt denn das, wenn wir das in Berlin machen<br />
und Aufmerksamkeit erregen? Was heißt das für mich? Was<br />
heißt das für meine Familie? Und dann hat sich das aber total<br />
geändert, durch die Revolution und die Überinformiertheit des<br />
Publikums, mir war dann klar: Ok, die Leute, die es wirklich kacke<br />
finden, werden die überinformierten Bildungsbürger sein,<br />
und um die kümmere ich mich nicht.<br />
e: Wie sehr hat sich denn das Stück verändert, dadurch dass<br />
sich die Situation in Libyen zugespitzt hat?<br />
IS: Also an der eigentlichen dramaturgischen Uridee - wir<br />
benutzen seine Inszenierungskunst, die er selber mitbringt<br />
real, und transportieren das auf die Bühne – hat sich eigentlich<br />
gar nichts geändert. Es gab ursprünglich noch eine dramaturgische<br />
Idee fürs Ende, die Revolution zu zeigen, zu einem<br />
Zeitpunkt, zu dem keiner davon ausgegangen ist, dass sie<br />
jemals möglich wäre in Libyen. Und dann ist die passiert, und<br />
dann war die Entscheidung, es ist jetzt hinfällig das zu zeigen.<br />
Aber an der Uridee hat das nichts verändert.<br />
e: Sind die Änderungen zum Stück während der Proben entstanden<br />
oder schon davor?<br />
51
AM: Die sind während der Arbeit entstanden. Es war ja so,<br />
dass wir den ganzen Januar am Plot gearbeitet haben, und<br />
Mitte Februar, als es losging, haben wir erst mal verfolgt,<br />
schwappt es jetzt von Ägypten über? Wahrscheinlich nicht.<br />
Und dann plötzlich ist es passiert. Dann war eine Woche, die<br />
ganz extrem war, und gerade zur Premiere war die ganze<br />
Situation auf dem Höhepunkt. Es war schon heftig. Es waren<br />
wirklich die letzten zwei Wochen, da haben wir ganz viel verändert.<br />
Wir haben auch noch am letzten Tag noch unglaublich<br />
viel verändert.<br />
e: Wieso eigentlich eine Puppe als Diktator?<br />
AM: Diese Puppe hat sehr viel Kraft. Wenn das einfach ein<br />
Mensch wäre oder ein Schauspieler, dann hätte es glaube ich,<br />
nicht so eine Kraft, dass er uns, den vier Bodyguards, Befehle<br />
gibt. So ist das halt ganz stark, weil er ohne uns eigentlich<br />
nichts tun kann, wir aber voll für ihn da sind und auch verantwortlich<br />
sind. Das ist so ein Machtspiel, das hin und her<br />
geht. Er braucht ja Menschen, die für ihn da sind, aber er hat ja<br />
trotzdem eine ganz wichtige Position.<br />
e: Heute habt ihr ja auch den Jörg Haider mit reingenommen<br />
ins Stück. Variiert das von Stück zu Stück?<br />
AM: Nein, der ist immer dabei. Das passt halt einfach sehr gut.<br />
e: Waren die Rollenwechsel schwer? Weil ja praktisch jeder<br />
mal den Gaddafi gespielt hat und auch sonst jeder von euch<br />
ziemlich viele verschiedene Rollen im Stück hat.<br />
AM: Es war von Anfang an so angelegt, dass wir alle Charaktere<br />
zusammen entwickelt haben. Viele von den Szenen hat<br />
irgendjemand improvisiert. Und dann hat jemand anderer<br />
diese Erfahrung übernommen. Wir haben einfach geguckt, wie<br />
es gerade gut passt.<br />
AM: Ne, weil wir sind Puppenspieler. Wir haben das gelernt<br />
sozusagen, sich da so ranzutasten an verschiedene Figuren.<br />
Das ist unser täglich Brot, also war das nicht so schwer. Aber<br />
Nils ist Schauspieler und nicht Puppenspieler.<br />
NZ: Für mich war es das erste Mal mit Puppen, ich hab auch<br />
nach fünf Wochen meinen Kollegen gestanden, dass ich auch<br />
noch nie Puppentheater gesehen habe – das hab ich lange für<br />
mich behalten. Also ich hab halt ganz oft Punkte gehabt, da<br />
war das so dilettantisch, da schäm ich mich eigentlich, aber<br />
Ivana hat da eine super Form gefunden, das alles zu führen,<br />
uns Sicherheit zu geben und das anzuführen, dass man immer<br />
52<br />
in einem sicheren Raum war. Jeder kann etwas anderes besser,<br />
der eine kann besser singen, der andere besser tanzen,<br />
andere können besser Puppen führen. Dadurch verliert man<br />
auch die Scham.<br />
e: Wie waren bis jetzt die Publikumsreaktionen?<br />
AM: Also ich kann das nur sagen von Gesprächen, die ich danach<br />
geführt habe mit Leuten, die ich kenne. Es gab Leute, die<br />
waren sehr begeistert, und es gab Leute, die fanden es furchtbar.<br />
Was ich auch verstehen kann, weil wir machen ja auch<br />
kein politisches Theater in dem Sinne, wenn man das erwartet,<br />
kann ich mir gut vorstellen, dass die sagen: Was machen die da<br />
für nen Scheiß? Ich hatte beim Spielen aber das Gefühl, dass<br />
die Leute auch Lachen konnten.<br />
AM: Es war schon sehr offen, das Publikum in <strong>Wien</strong>.<br />
e: Ivana, hast du schon Pläne für den nächsten Politiker, den<br />
du gerne als Hauptdarsteller inszenieren würdest?<br />
IS: Möglicherweise. Vielleicht mache ich aber auch erst mal<br />
auch was ganz anderes. Es gibt gerade Ideen, die in eine völlig<br />
andere Richtung gehen, aber es gibt durchaus auch Überlegungen,<br />
sich einzelne Figuren zu greifen und da noch mal was<br />
draus zu machen. Es ist nur die Frage, macht man das wirklich<br />
in demselben Format? Ich find's immer ganz interessant für<br />
mich, zu schauen, was gibt so ein Inhalt her, und danach die<br />
Form zu entscheiden, zu schauen, was bietet sich an, bei Gaddafi<br />
hat sich das halt angeboten – das war für mich/uns der<br />
einzige richtige Weg.<br />
e: Lovefuckers, vielen Dank für's Interview!
MC G, der Hanswurst des Orients<br />
King of the Kings in 200 Worten<br />
von Birte Gemperlein, 17.04.2011<br />
Aram sam sam, aram sam sam, guli guli guli guli, aaaaram<br />
sam sam. Araaaavi, Araaavi. Guli guli guli guli aaaram sam<br />
sam. Ein marokkanischer Nonsense-Kinderhit, präsentiert<br />
in King of the Kings. Da allerdings nicht als Hit, sondern als<br />
Zauberschwur. Für den fliegenden Teppich, versteht sich.<br />
Wunderwaffe von „Sooocial Business!“, kurz SB, gefertigt für<br />
den großen Muammar al-Gaddafi, kurz MC G, Shootingstar<br />
Libyens, Afrikas, des Orients, der Welt! Neben Musiker auch<br />
noch der Verfasser vom Bestseller „Das Dorf, das Dorf, die<br />
Erde, die Erde und der Selbstmord eines Astronauten“ und<br />
jetzt auch noch (Verzeihung: „endlich“) Schauspieler im<br />
eigens kreierten „theatre piece“. Kennt sie alle: „Bella“sconi,<br />
Ronald Reagan und Jörg Haider. Doch helfen kann ihm keiner.<br />
Will ihm keiner. Sind ja auch schon halb tot. MC G auf der<br />
Flucht. Nur wohin? Das Problem: die Bevölkerung macht<br />
Stress. Aber Entertainment geht halt vor. Lasset die Puppen<br />
tanzen! Mit Musik vom DJ. Plötzlich Maschinengewehre,<br />
Durcheinander, Krawall. Die Bodyguards spielen verrückt.<br />
Die Schweizer Käfiggarde auch, ist einfach entflogen. Es wird<br />
gerannt, gehetzt, geschossen, gebissen, gestürzt, getötet,<br />
gemordet – „Stopp! Ich hab jetzt kein Bock mehr!“, so MC G.<br />
Und was MC G sagt, ist halt Gesetz, egal ob albern unglaublich<br />
oder leider bizarr real …<br />
„The weird world of Gaddafi<br />
on stage“ • Was halten Sie davon?<br />
von Birte Gemperlein und<br />
Daniela Scheidbach, 15.04.2011<br />
„Es hat sehr viel Spaß gemacht, zuzuschauen. Denen ist<br />
irrsinnig viel eingefallen dazu. Es gab ja fast keine Minute<br />
Stillstand. Ich find’s auch witzig, dass man sich auf diese<br />
Weise einem ernsthaften Thema widmet. Denn Gaddafi war<br />
ja vor der Revolution auch schon Sinnbild für Terrorismus und<br />
Unterdrückung. Ähnlich wie Charlie Chaplin mit dem Diktator<br />
geht man jetzt daher und verulkt diese Figur auf eine solche<br />
Weise. Wirklich sehr, sehr gelungen!“<br />
„Ich hab kurz überlegt, ob’s eigentlich ok ist, dass man solche<br />
Scherze darüber macht. Dass man so eine ernste Sache so<br />
behandelt, aber eigentlich ja, weil das Kunst ist, und Kunst ist<br />
dazu da. Es war wirklich lustig.“<br />
Bildrechte: Gerhard F. Ludwig<br />
53
Die obligatorische Abschiedsfeier eines jeden Theaterfestivals<br />
wurde dieses Mal begleitet von einem Konzert der Band The<br />
MOb mit der Frontfrau Magdalena Chowaniec, die uns bereits<br />
aus der Performance Bis dass der Tod uns scheidet bekannt ist.<br />
Sie war kaum wiederzuerkennen, diese zierliche junge Frau,<br />
die wir als strahlende Braut in einem unschuldigen weißen<br />
Kleid kennengelernt haben und die nun auf der Bühne stand,<br />
sehr modern und lässig gekleidet, in diverse Lichteffekte getaucht<br />
(am Eingangsbereich warnte ein Schild davor, dass bei<br />
dem Konzert ein Stroboskop eingesetzt wird), Musik, die dem<br />
Genre Punk zugeschrieben werden kann, grölend.<br />
Doch bevor es zu dieser Szene kam, gab es zugunsten des<br />
Aufbaus der Instrumente im Saal, noch eine Pre-Konzert-Party<br />
in der <strong>brut</strong>-Bar. Man sah dort bekannte Gesichter wie Künstler<br />
des Festivals sowie auch Leute aus dem Publikum der vorangegangenen<br />
Performance King of the Kings, aber auch viele,<br />
die sich nur aufgrund des angekündigten Konzerts dazugesellt<br />
haben. Dementsprechend voll war die <strong>brut</strong>-Bar, es war<br />
schwierig, einen Sitzplatz zu ergattern. Was eine angenehme<br />
Unterhaltung zusätzlich erschwerte, war die laute und düstere<br />
Musik, die einen dazu zwang, sich den Inhalt des Gespräches<br />
ins Ohr schreien zu müssen. Ein positiver und großzügiger<br />
Aspekt seitens der Festivalveranstaltungsleitung war, dass es<br />
kostenlosen Sekt und Verpflegung in Form von Wraps für die<br />
Festivalmitarbeiter wie u. a. die Autoren der Festivalzeitung<br />
und die Künstler gab.<br />
Jedoch bin ich nicht aufgrund des Sekts gekommen, sondern<br />
zum Konzert, und war auch kurz nach 23 Uhr im Veranstaltungsort<br />
anwesend, so wie einige wenige auch. Da viel Platz<br />
vorhanden war, setzten sich die meisten Zuschauer auf die Zuschauerränge,<br />
was eine eher ungewohnte Konzertatmosphäre<br />
generierte. Der Künstlerin sowie Frontfrau fiel dieser Umstand<br />
auch auf, weshalb sie die Leute immer wieder zum Aufstehen<br />
und Näherkommen aufforderte, dem vereinzelte Zuschauer<br />
Folge leisteten. Es kamen immer mal wieder Zuschauer dazu,<br />
jedoch änderte sich nichts an der ungelösten und gehemmten<br />
Stimmung. Das Konzert dauerte auch nur etwa eine Stunde,<br />
und trotz des Bemühens und guter Leistung der Band war es<br />
aufgrund der passiven Zuschauer eine Enttäuschung.<br />
Nach und während des Konzertes gab das DJ-Team TT Bretterbodendisko<br />
sein Können in der <strong>brut</strong>-Bar zum Besten. Jedoch<br />
hatten es eher wenige Zuhörer, was vielleicht daran lag, dass die<br />
Party von den meisten an andere Orte verlegt worden ist, denn<br />
kurz nach Konzertende strömten die meisten wieder hinaus ins<br />
kalte <strong>Wien</strong> und damit vielleicht in ein heißeres Nachtleben.<br />
54<br />
Was Künstler und ihr Publikum<br />
noch so glücklich macht<br />
Partybericht von Katja Poloubotko, 17.04.2011<br />
Das Oeuvre zum Schluss<br />
Endblick auf den Notstand<br />
Partybericht von Theresa Naomi Hund, 17.04.2011<br />
Der Notstand endet, wie er angefangen hat. Mit Barbara<br />
Ungepflegt als Bedienerin, Clemens Stecher als glücklichem<br />
Gewinner des Candle-Light-Dinners, vielen Schaulustigen,<br />
Wagemutigen und Hungrigen. Auf der Speisekarte stehen<br />
Armer Ritter, Strammer Max, Barbusige Kopflose, Falscher<br />
Hase, Liebesknochen und, wie es sich gehört, ein Gruß aus<br />
der Küche. Gang für Gang serviert Barbara ganz klassisch mit<br />
Serviertuch und Haube auf einem mit einer Kerze angerichteten<br />
Tablett Clemens die einzelnen Speisen. Immer wieder<br />
bekommt er Besuch von anderen Notleidenden. „Heute<br />
ausnahmsweise zu zweit im Notstand“, hallt es durch das<br />
Megafon. Bevor Clemens mit seinem Mahl beginnt, fotografiert<br />
er dieses, er kann sein Glück scheinbar nicht fassen. Mit<br />
Plastikbesteck verspeist er den Strammen Max. Auch am<br />
heutigen Abend geht Frau Ungepflegt wieder ganz in ihrer<br />
Rolle als Bedienerin auf. „Wie schmeckt‘s?“ Beide Daumen<br />
hoch. Frau Ungepflegt ist zufrieden. Neugierige Passanten<br />
besuchen ihn in seinem Reich. Schließlich is(s)t Mensch lieber<br />
zusammen als allein. Beim nächsten Gang, „Falscher Hase“<br />
meint es Frau Ungepflegt besonders gut mit uns. „Diesen<br />
Gang dürfen auch sie mitessen.“ Schließlich will sie die Not<br />
aller Notleidenden stillen. Das Gewinnspiel des ersten Tages<br />
bildet mit dessen Einlösung am letzten das Ende des Notstandes<br />
in <strong>Wien</strong>. Resümierend stellt man fest, das Ganze<br />
hat Konzept. Und passt mit diesem ausgezeichnet zum<br />
Freischwimmer-Festival. So wundert es nicht, dass es ein<br />
Hochstand ist, welcher auf dem Plakat des Festivals abgebildet<br />
ist. Der Hochstand dient folglich als Versinnbildlichung,<br />
als Sujet für das diesjährige Festivalmotto. Wir ziehen uns<br />
von den anderen Blicken in den Hochstand zurück, um bei<br />
unserem eigenen Beobachten nicht entdeckt zu werden. Der<br />
Hochstand ist privat und <strong>öffentlich</strong> zugleich. Er steht frei in der<br />
Natur, dient dabei als Deckungs- und Witterungsschutz bzw.<br />
als Beobachtungspunkt, um Tiere zum Erliegen zu bringen.<br />
Im Übertragenen Sinne lässt sich sagen, dass sich der Mensch<br />
aus dem Öffentlichen ins Private zurückzieht und anhand von<br />
sozialen Netzwerken aus der Defensive heraus wieder aus dem<br />
privaten Raum in den <strong>öffentlich</strong>en eintritt. Ab nach Zürich und<br />
Düsseldorf, um weiteren Notleidenden zu helfen, denn dass<br />
es viele von ihnen gibt, ist mehr als eine Feststellung. In Zeiten<br />
von Social Network und den Massen an virtuellen Freunden<br />
wäre ein Nachahmungseffekt à la Barbara Ungepflegt in<br />
diesem Falle ausnahmsweise wünschenswert.
Gegen den Strom freigeschwommen<br />
Gedanken zum Festivalgeschehen von Florian Peter Pesel, 14.04.2011<br />
„<strong>Wien</strong> ist anders“ – so lautet der Slogan, mit dem sich die<br />
Stadt <strong>Wien</strong> stolz der Öffentlichkeit präsentiert. Doch ob dieser<br />
Spruch nun eher als Anerkennung der positiven Andersartigkeit<br />
dieses Ortes oder doch mehr als eine undurchsichtige<br />
Warnung davor zu verstehen ist, sei einmal dahingestellt.<br />
Würde man nun die verschiedenen Theaterhäuser <strong>Wien</strong>s<br />
mit einigen europäischen Städten gleichsetzen, so wäre das<br />
Pendant zu <strong>Wien</strong>, passend zu dem oben schon erwähnten<br />
Werbespruch, eine Produktionsstätte, die sich darauf versteht,<br />
anders zu sein – das <strong>brut</strong>.<br />
„<strong>brut</strong> ist anders“. Dieses Haus besticht durch seine Andersartigkeit,<br />
im Vergleich zu den restlichen Kunststätten der österreichischen<br />
Hauptstadt. Daher verwundert es auch nicht, dass<br />
das <strong>brut</strong> als eines der wichtigsten freien Produktionshäuser<br />
des deutschsprachigen Raums einer der Veranstaltungsorte<br />
der Theaterfestivalreihe Freischwimmer darstellt. Das Festival<br />
tourt von Berlin nach Hamburg, um einen kurzen Zwischenstopp<br />
in <strong>Wien</strong> einzulegen, bevor es weiter nach Düsseldorf<br />
und Zürich zieht.<br />
Den Auftakt zur Veranstaltungsreihe in <strong>Wien</strong> macht dieses<br />
Jahr am Freitag, den 8. April, Barbara Ungepflegt mit ihrer<br />
Eröffnung des Notstandes. Da die Flasche Sekt, die eigentlich<br />
dafür gedacht war, das hölzerne Projekt von Frau Ungepflegt<br />
auch offiziell auf den Namen „Notstand <strong>Wien</strong>“ zu taufen, sich<br />
leider zu schade ist, ihren Inhalt sinnfrei zu vergießen, können<br />
sich die Besucher an der prickelnden Flüssigkeit erheitern, um<br />
sich währenddessen über ihre Freude auf die zu erwartenden<br />
Darbietungen im Laufe der nächsten Woche mit den Umstehenden<br />
auszutauschen. Gespannt sind sie alle.<br />
Nach der erfolgreichen Einstimmung auf das Kommende geht<br />
es dann auch schon gleich weiter zur ersten „Hybrid“-Performance<br />
im Konzerthaus. Eine Stunde später macht man sich<br />
mit der nicht so überraschenden Erkenntnis, dass Menschen<br />
nicht perfekt sind, zurück auf den Weg ins Künstlerhaus, um<br />
pünktlich zur nächsten Vorstellung zu sein. Immer noch in<br />
Gedanken über die gerade gehörte Idee der Hybridwesen, ist<br />
man plötzlich Teil eines menschlichen Spaliers für ein unbekanntes<br />
polnisches Hochzeitspaar, und ehe man sich's versieht<br />
steht man mit einem Gläschen Wodka an einer hundertköpfigen<br />
Tafel und prostet sich gegenseitig auf Polnisch zu. Die<br />
folgenden Stunden verbringen wir mit Partyspielen und Tanz,<br />
doch gegen Ende des Abends ist es dann auch genug und das<br />
Angebot des Bräutigams, der sich auch als DJ entpuppt, weiter<br />
Party zu machen, wird meist nur angenommen, um sich den<br />
Wanst mit köstlichem polnischem Essen vollzustopfen und<br />
dann so leise und schnell wie möglich zu verschwinden,<br />
passend zum Abend, eben „einen Polnischen machen“.<br />
Der nächste Abend beginnt sehr politisch, denn die Worte<br />
Barack Obamas anlässlich der Verleihung des Nobelpreises<br />
werden akkustisch sowie visuell dargestellt. Eine Mischung<br />
aus Bewunderung und Verwunderung lässt sich nach dieser<br />
Vorstellung bei vielen Besuchern verzeichnen, die sich<br />
anschließend zu einem kleinen Plausch zusammenfinden oder<br />
aber eilig zum Konzerthaus laufen, um sich Corinna Korths<br />
Ideen zum Hybridwesen anzuhören – manche zum ersten<br />
Mal, andere aus Interesse zum zweiten Mal, andere gar nicht.<br />
Als echter Festivalgänger nutzt man jedes Angebot und<br />
lässt somit auch die an die letzte Vorstellung des Abends<br />
anschließende Party nicht aus. Da sich aber anscheinend die<br />
Einstellung eines Musikfestivalgängers völlig von der eines<br />
Theaterfestivalgängers unterscheidet, ist die Hybrid-Party<br />
eher ein gemütliches Zusammensitzen. Nachdem viele der<br />
Besucher sich über die eben dargebotene Kunst ausgetauscht<br />
haben und zu einer, mehrerer, oder keiner Erkenntnis gekommen<br />
sind, verbringen die meisten den restlichen Abend wohl<br />
doch eher mit einem Alternativplan. Die sehr bemühte DJane<br />
versucht das Publikum zum Tanzen zu animieren, doch das<br />
lässt sich lieber gemütlich auf den bereitgestellten Betten<br />
nieder und philosophiert bei einem Bier oder einem Weißen<br />
Spritzer über Gott, die Welt und natürlich die Kunst. Somit<br />
klingt der Abend in geruhsamer Weise, und in kleiner Runde<br />
ganz entspannt aus.<br />
Die nächsten zwei Tage werden als kurze Verschnaufpause<br />
genutzt, um sich von den vorhergehenden Festivaltagen zu<br />
erholen – nur Frau Ungepflegt bemüht sich unermüdlich,<br />
ihren Notstand der <strong>Wien</strong>er Bevölkerung näherzubringen.<br />
Dienstag ist es dann endlich wieder so weit – das <strong>brut</strong> öffnet<br />
erneut seine Tore, um seinem Publikum die neuesten Ideen<br />
aus der bildenden und performativen Kunst zu offenbaren.<br />
So zeigen uns Laura Kalauz und Martin Schick ein innovatives<br />
Konzept, die Konsumgesellschaft <strong>öffentlich</strong> anzukreiden,<br />
wohingegen Verena Billinger und Sebastian Schulz mit ihrem<br />
Romantic Afternoon bei vielen wohl ein großes Fragezeichen<br />
auf der Stirn hinterlassen haben.<br />
55
Die anschließende Party, bei der sich einige Freischwimmer an<br />
den Plattentellern versuchen, erweist sich als sehr gelungen.<br />
Obwohl das Festivalpublikum nach ein oder zwei Stunden<br />
vorzeitig aufgibt, was darauf zurückzuführen sein könnte, dass<br />
sie ein wenig erschöpft von dem sehr abwechslungsreichen<br />
Programm des Abends sind, tanzen sich aber die Künstler zu<br />
„Wannabe“ von den Spice Girls in Fahrt, um die eigene Agilität<br />
für die folgenden Songs zu steigern.<br />
Bildrechte: Theresa Naomi Hund<br />
56<br />
Die Stimmung ist ausgelassen, die Musik lässt die Herzen<br />
höherschlagen und die Kaltgetränke tun den Rest.<br />
Somit geht man nach einigen Stunden beschwingt und mit<br />
guter Laune nach Hause und muss sich jetzt schon ein kleines<br />
Tränchen der Trauer verdrücken bei dem Gedanken, dass die<br />
Hälfte des Festivals schon vorüber ist.
Raus aus dem Wasser …<br />
und die Schwimmflügel bitte mit nach Hause nehmen!<br />
Abschließendes von Luca Lidia Pályi, 17.04.2011<br />
Spätestens heute sind alle aus dem Wasser gestiegen, haben<br />
sich abgetrocknet und sind wieder nach Hause gegangen.<br />
Das Freischwimmer-Festival ist zu Ende und im <strong>brut</strong> kehrt<br />
allmählich wieder Ruhe ein.<br />
Am ersten Tag rief Barbara Ungepflegt gegen 19 Uhr den<br />
Notstand aus und versuchte, den Hochstand mit dem<br />
Zerbrechen einer Sektflasche einzuweihen. Ging nicht, macht<br />
nix. Spätestens am letzten Abend wurde der dann feierlich<br />
mit den Künstlern, dem Publikum und allen Mitarbeitern<br />
des Festivals getrunken. Einen schönen Rahmen gaben dem<br />
Festival auch mariamagdalenas Performances. Am ersten<br />
Tag verheiratete sie uns noch mit dem Festival, am letzten<br />
Abend wurden wir gemeinsam mit dem Gitarristen der Band<br />
The MOb verabschiedet. Die polnische Art des Feierns und die<br />
Achterbahnfahrt der Gefühle in einer Partnerschaft wurden<br />
genauso ehrlich dem Publikum dargeboten wie Corinna Korths<br />
Wunsch, ein Wolf zu werden. Sie zeigte uns, welche unglaubliche<br />
Wirkung ein lebendiges Tier auf der Bühne haben kann,<br />
und stimmte die Zuschauer schon mal aufs Freidenken ein.<br />
Bei CMMN SNS PRJCT widmeten sich die Künstler dem<br />
„gesunden“ Menschenverstand und fragten uns: „Does<br />
common make sense?“. In Romantic Afternoon wurde auf<br />
der Bühne herumgeknutscht und anschließend im Publikum<br />
stark kritisiert. Mit der <strong>öffentlich</strong>en Präsenz der Macht<br />
beschäftigten sich die Performances Your Majesties, King of the<br />
Kings und souvereines. Allerdings beleuchteten alle drei<br />
Produktionen das Thema auf unterschiedlichste Art und<br />
Weise. Bei Your Majesties wurde Barack Obamas Nobelpreisrede<br />
ein neuer Sinn gegeben. souvereines stellte mit Ästhetik<br />
und Choreografie die Grazilität einer Königin dar, und die<br />
Lovefuckers fegten uns mit hemmungsloser Gewalt und<br />
professionellem Puppenspiel von den Sesseln.<br />
Sowohl die Künstler als auch die Zuschauer gingen zusammen<br />
zurück ins Öffentliche. Für- und miteinander schmissen sie<br />
sich nackt und ohne Scham ins kalte Wasser. Die häusliche<br />
Atmosphäre des Theaters ermöglichte den Austausch<br />
zwischen dem Publikum und den Darstellern, die Stücke<br />
verlangten einen hohen Grad an Partizipation, und der<br />
Wunsch, Themen die einen beschäftigen, einfach in die Welt<br />
hinausschreien zu können, machte sich stark bemerkbar.<br />
Die Performances bauten sich zwar um das Thema „Rückzug<br />
ins Öffentliche“, waren aber trotzdem sehr unterschiedlich.<br />
Jeder fand etwas nach seinem persönlichen Geschmack und<br />
konnte lachen, weinen, denken oder sich einfach ärgern.<br />
Und all dem dann in der <strong>brut</strong>-Bar auch eine Stimme geben.<br />
Das Freischwimmer-Team tat genau dies. Wir kritisierten,<br />
schrieben und fotografierten, versuchten, uns an Abgabetermine<br />
zu halten, und nutzten die Freiheit, die uns beim<br />
Schreiben gegeben wurde. Wir bedanken uns bei Hannah<br />
Egenolf, Haiko Pfost und Eva Geißler, verabschieden uns<br />
schweren Herzens vom Festival, von manchen Künstlern, von<br />
allen Festivalmitarbeitern, vom Balkon des <strong>brut</strong> und vom<br />
Sekt-aus-Sektflöten-Trinken. Wir sahen, wie die Kunst Persönliches<br />
im <strong>öffentlich</strong>en Raum besprach und wie Zuschauer im<br />
Theatersaal privates fanden. Die befreiende Stimme der Kunst<br />
hält sich nicht zurück, sie macht sich die Hände schmutzig<br />
und spricht die verschwundene Grenze zwischen Geschlossenem<br />
und Öffentlichem an. Ganz laut macht sie das. So wie<br />
The MOb am letzten Abend des Festivals. Aus voller Kehle und<br />
mit schnellem Rhythmus rüttelten sie das Publikum wach.<br />
Und gerade als schon fast alle tanzten und sich auf die Wellen<br />
des Festivals einließen, war es schon wieder aus. Aber keine<br />
Angst, nächstes Jahr gibt es das Festival wieder! Und bis dahin<br />
kann man sich ja die Wartezeit mit Schwimmunterricht und<br />
Theaterbesuchen verkürzen.<br />
57
Das Freischwimmer-Festival –<br />
Mehr als nur die Summe seiner Einzelteile<br />
von Kristina Kirova, 16.04.2011<br />
Das Freischwimmer-Festival 2011 tourt durch die Weltgeschichte.<br />
Berlin, Hamburg, <strong>Wien</strong>, Düsseldorf, Zürich. Das<br />
Festival ist immer ein anderes Erlebnis. Denn nicht nur die<br />
Vorstellungen und die Künstler machen das Programm aus.<br />
Wir wollten wissen, was im Hintergrund abläuft, und fragten<br />
die Künstlerische Leitung gleich persönlich. Haiko Pfost über<br />
Spannungsbögen, Dramaturgie, und das Konzept hinter dem<br />
Freischwimmer-Festival in <strong>Wien</strong>.<br />
e-<strong>xilant</strong>: Könntest du uns ein bisschen über die Dramaturgie<br />
des Festivals hier in <strong>Wien</strong> erzählen?<br />
Haiko Pfost: Das ist, als ob man ein Stück beschreiben würde.<br />
Man kann ein Festival auch anders lesen, nämlich in der<br />
Gesamtdramaturgie. Dabei stellt sich die Frage, ob ein Festival<br />
mehr als nur die Summe seiner Einzelteile ist. Was ich mir<br />
dabei gedacht habe, ist, dass es natürlich bestimmte Verhältnisse<br />
und Relationen unter den Stücken geben kann. Ich habe<br />
zum einen natürlich eine programmatische Vorgabe, also die<br />
Räume. Auf der anderen Seite wollte ich einen thematischen<br />
Bogen schaffen. Ich glaube, dass z. B. Chuck Morris und King<br />
of the Kings in ihrer großen Unterschiedlichkeit doch ein<br />
sehr ähnliches Thema haben, und trotzdem kann man damit<br />
ästhetisch völlig andere Handschriften nebeneinanderstellen.<br />
So kann man auch eine reflektierende Arbeit wie Your<br />
Majesties nehmen, die sich auch noch mal um Herrschaft<br />
und Macht dreht, aber andere Bezüge schafft. Die Frage von<br />
Interaktion war auch ausschlaggebend. CMMN SNS PRJCT<br />
hatte einen sehr interaktiven Moment mit dem Publikum.<br />
Dieses nahe Verhältnis mit dem Kuss-Stück im Anschluss hat,<br />
finde ich, eine bestimmte Korrespondenz. Insgesamt gab es<br />
auch diesen Spannungsbogen mit mariamagdalena, die Eröffnungsperformance<br />
und Abschlusskonzert gemacht hat. Es<br />
ist wie in einem Stück. Es gibt einen Anfangspunkt und einen<br />
Endpunkt und dazwischen eben auch ruhigere und konzentriertere<br />
Momente.<br />
e: Wie würdest du den roten Faden des Festivals in <strong>Wien</strong><br />
beschreiben?<br />
HP: Der rote Faden sind eigentlich viele Fäden. Das Festival<br />
ist eine Bündelung von sehr unterschiedlichen ästhetischen<br />
Ansätzen, und gerade das macht es so reizvoll. Es gibt sehr unterschiedliche<br />
Herangehensweisen und Darstellungsformen.<br />
Gleichzeitig ist das Festivalthema für mich der rote Faden.<br />
58<br />
Die Frage nach Öffentlichkeit und nach neuen Positionen der<br />
Öffentlichkeit, die wir heute in der darstellenden Kunst ausdrücken<br />
können. Das haben die Arbeiten auf sehr unterschiedliche<br />
Weise getan.<br />
e: Habt ihr die <strong>Wien</strong>er Szene aufgemischt?<br />
HP: Ich glaube nicht, dass man die <strong>Wien</strong>er Szene aufmischen<br />
muss. Die ist schon sehr präsent und sehr stark. Es ist eher so,<br />
dass die Künstler die Chance haben, unterschiedliche räumliche<br />
Erfahrungen durch die Häuser zu machen und damit auch<br />
unterschiedliches Publikum erreichen können. Umgekehrt ist<br />
es für das Publikum hier toll, innerhalb von einer Woche zu<br />
sehen, was für eine lebendige Szene es im deutschsprachigen<br />
Raum gibt.<br />
e: Welches Resümee würdest du für das Freischwimmer-Festival<br />
ziehen?<br />
HP: Ein positives. Es hatte ein sehr großes Spektrum an<br />
inte-ressanten und qualitativ hochwertigen Arbeiten, und<br />
ich hoffe, dass wir das auch weiterhin fortsetzen können.<br />
Das Festival ist oft sehr diametral, aber das ist auch das<br />
Schöne daran. Das macht die Lebendigkeit des Festivals aus.<br />
Die Leute haben die Chance, ein Risiko einzugehen und sich<br />
dabei freizuschwimmen.
Land in Sicht<br />
Rück- und Ausblick auf das Freischwimmer-Festival<br />
mit Aussicht auf hohen Wellengang<br />
von Tea Sahǎcić, 17.04.2011<br />
Wir, die Theater-, Film- und Medienwissenschaftsstudenten<br />
der Übung „Schreiben für die Festivalzeitung Freischwimmer<br />
2011 im <strong>brut</strong>“, haben eine bewegte Woche hinter uns. Ebenso<br />
natürlich alle anderen Beteiligten des dritten Freischwimmer-<br />
Festivals im <strong>brut</strong> <strong>Wien</strong> – Künstler, Leiter, Mitarbeiter. Es gab<br />
viel zu bestaunen, viel Neues, viel nachzudenken. Das bleibt<br />
jedem selbst überlassen.<br />
Wir leben aber auch in einer bewegten Zeit. Während der<br />
Freischwimmer weiter nach Zürich und dann nach Düsseldorf<br />
schwimmt, bleiben wir mit den Eindrücken der verschiedenen<br />
Produktionen zurück. Leise, unbewusste Impressionen von<br />
Chuck Morris; Amüsantes made by Barbara Ungepflegt oder<br />
Laura Kalauz und Martin Schick; Auffälliges wie bei Verena<br />
Billinger und Sebastian Schulz oder beim Institut für Hybridforschung;<br />
wie auch Denkanstöße von mariamagdalena, Alex<br />
Deutinger und Marta Navaridas sowie den Lovefuckers. Diese<br />
bewegten Zeiten bringen eben solche Produktionen wie Your<br />
Majesties oder King of the Kings hervor.<br />
Während Your Majesties trotz seiner überspitzten Gestik<br />
eine würdevolle Satire darstellte, waren die Reaktionen auf<br />
King of the Kings, seiner schrillen Art diametral gegenüberstehend,<br />
eher verhalten. Ein solches Stück, in einer solchen<br />
Zeit – wie weit darf man gehen? Manche haben ein ungutes<br />
Gefühl bei einem solchen Werk, sehen reserviert zu; andere<br />
lachen verlegen; wiederum andere lassen sich mitreißen und<br />
vergessen die <strong>brut</strong>ale Realität. Aber wie ist nun tatsächlich<br />
damit umzugehen?<br />
Alex Deutinger als Barack Obama und die von den Lovefuckers<br />
geführte Gaddafi-Puppe bilden diese Realität gar zu glaubwürdig<br />
ab; ein eloquenter, sicher wirkender und doch hilflos<br />
zappelnder Obama, dem schillernden und unkontrollierbaren<br />
Gaddafi gegenüberstehend. Da werden Informationen ausgetauscht,<br />
Verhandlungen abgehalten und Abkommen geschlossen,<br />
die Hälfte der Bevölkerung verschwiegen bleiben. Und<br />
dennoch: Schlussendlich macht jeder doch, was er will. Barack<br />
Obama kann, sich windend und strampelnd, nicht aus seiner<br />
Haut, ebenso wie Muammar al-Gaddafi das Einsehen nicht<br />
findet – aber eigentlich auch nicht sucht.<br />
Was übrig bleibt, ist, wie üblich, die Rolle des Zuschauers. Diese<br />
Wechselwirkung mag der des Theaters durchaus nahekommen:<br />
Es ist ein ungesehenes Ereignis, dessen Ausgang völlig<br />
offen ist; Drama und Wendungen werden interessiert verfolgt,<br />
aber persönliches Einschreiten findet nicht statt. Wie auch?<br />
Es ist nicht die Sache des Zusehers, sich in die Dramaturgie<br />
einzumischen. Die Menschen auf der Bühne wissen schließlich,<br />
was sie tun.<br />
Dies ist so lange der Fall, ehe die gesamte Produktion einen<br />
nicht mehr zu tolerierenden Weg beschreitet; es mögen persönliche<br />
Anschauungen und Moral verletzt sein und der Saal<br />
daraufhin „verstört und empört“ verlassen werden, oder eben<br />
Ausbeutung und Unterdrückung eine solche Dimension annehmen,<br />
dass das Leben nicht mehr so viel Wert innehat wie<br />
die Freiheit, für die man nun zu sterben bereit ist. Ebendies ist<br />
heute in Libyen, Tunesien, Ägypten und anderen Ländern der<br />
Fall. Ruhig zusehen ist unerträglich geworden, und die Notwendigkeit<br />
zur direkten Partizipation drängt sich nach vorn;<br />
die eine Frage, die bleibt, ist, ob sich Erdulden noch lohnt oder<br />
ob das Einschreiten inzwischen nicht mehr hinauszuzögern ist.<br />
Die Libyer haben sich, wie King of the Kings andeutet, für Letzteres<br />
entschieden. Es gibt für alles Grenzen, die denen, die sie<br />
konstant überschreiten, irgendwann aufgezeigt werden müssen.<br />
Diese Grenzüberschreitungen werden von den Lovefuckers<br />
abgebildet, während Your Majesties die Reaktion darauf<br />
liefert. Ein dem <strong>Wien</strong>er Publikum vorbehaltenes Zwischenspiel,<br />
das an Aktualität und Authentizität nicht zu übertreffen ist.<br />
Somit können wir dieses Festival mit einem lachenden und<br />
einem weinenden Auge beschließen – lachend, in freudiger Erinnerung<br />
an die Stunden des Vergnügens, die uns hier geboten<br />
wurden, und weinend zum einen aufgrund des Endes eines<br />
spannenden Freischwimmers und zum anderen in Ausblick<br />
auf die zu erwartende Zukunft. Doch die Aufklärung wird, wie<br />
immer, früher oder später kommen – spätestens jedoch beim<br />
nächsten Freischwimmer-Festival.<br />
59
Im Rahmen von Freischwimmer 2011 –<br />
Neues aus Theater, Performance und Live Art<br />
www.<strong>brut</strong>-wien.at