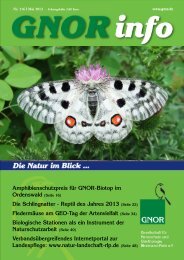Info Aus dem Inhalt - Gnor
Info Aus dem Inhalt - Gnor
Info Aus dem Inhalt - Gnor
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
AK Herpetofauna<br />
25-jährige Langzeitstudie: Der pfälzische Laubfroschbestand<br />
(Hyla arborea) in "GNOR-historischer" Höchstform<br />
Der Laubfrosch (Hyla arborea)<br />
findet im Naturschutz allgemein viel<br />
Klettender Laubfrosch / Foto: Fritz Thomas<br />
Beachtung, da er als Sympathieträger<br />
gilt und einen großen landschaftsökologischen<br />
Zeigerwert besitzt.<br />
In der Roten Liste wird er bereits<br />
seit Jahrzehnten in der Kategorie<br />
"stark gefährdet" eingestuft und<br />
war in den Jahren 1979 bis 1981 in<br />
der Pfalz fast ausgestorben. Die<br />
Gründe des rapiden Rückgangs der<br />
einstigen "Allerweltsart" waren zum<br />
damaligen Zeitpunkt völlig unklar.<br />
Dies hat mich veranlasst, im Rahmen<br />
meiner GNOR-Aktivitäten<br />
umfangreiche Untersuchungen zu<br />
Verbreitung, Bestand, Ökologie,<br />
Gefährdungsursachen und Schutzmöglichkeiten<br />
durchzuführen.<br />
Das erste Intensivuntersuchungsjahr<br />
1981 war ernüchternd: Der<br />
Laubfrosch war nördlich Speyer ausgestorben<br />
und in den Rheinauen<br />
südlich Speyer nur noch in winzigen<br />
Restpopulationen und Einzelindividuen<br />
vorhanden. Lediglich die<br />
Hördter Rheinaue (Landkreis Germersheim)<br />
wies noch einen zusam-<br />
GNOR <strong>Info</strong> 103<br />
menhängenden Bestand auf, der jedoch<br />
vergleichsweise klein war<br />
(wenige hundert adulte Individuen).<br />
Eigene Kartierungen aus den hessischen<br />
und baden-württembergischen<br />
Rheinauen ergaben ein ähnliches<br />
Bild: In Hessen verschollen, in<br />
Baden-Württemberg winzige Restbestände<br />
in den Auen je etwa 30 km<br />
nördlich und südlich von Karlsruhe.<br />
Frisch metamorphosierter Laubfrosch / Foto:<br />
Fritz Thomas<br />
Die Ergebnisse waren so alarmierend,<br />
dass die Untersuchungsintensität<br />
1982 und 1983 noch verstärkt<br />
wurde. Die Ergebnisse dieser Großkartierung<br />
(insgesamt etwa 30 Messtischblätter)<br />
und vergleichender<br />
ökologischer Untersuchungszuchten<br />
in Versuchswannen im eigenen Garten<br />
fanden ihre erste Veröffentlichung<br />
1982 im Rahmen von<br />
"Jugend forscht" und 1983 im Rahmen<br />
der GNOR-Schriftreihe "Naturschutz<br />
und Ornithologie in<br />
Rheinland-Pfalz".<br />
Zu diesem Zeitpunkt wurde auch<br />
klar, was mit unserem "Wetterfrosch"<br />
eigentlich los ist: Als extrem<br />
GNOR Arbeitskreise<br />
dynamische Auenamphibienart ist<br />
er auf großräumig zusammenhängende<br />
Landschaften angewiesen, die<br />
ein weiträumiges, aber engmaschiges<br />
Laichgewässernetz aufweisen; die<br />
Laichgewässer müssen sonnig, temporär<br />
oder semitemporär sein - ein<br />
ohnehin schon sehr seltener Biotoptyp.<br />
Eine Vernetzung aus 50, 70,<br />
100 oder mehr solcher Laichplätze<br />
ist für eine gesunde Population<br />
nötig. Solche Verhältnisse gibt es im<br />
gesamten Oberrheingraben praktisch<br />
nirgends mehr. Damit war aber<br />
klar, wo Schutzmaßnahmen ansetzen<br />
müssen: Verdichtung des Laichgewässernetzes<br />
durch Optimierungsmaßnahmen<br />
und Gewässerneuanlagen<br />
in großräumig geeigneten<br />
Landschaftsabschnitten. Die<br />
GNOR hat dazu mehrere Konzepte<br />
erstellt ( regional zum Beispiel Neustadt<br />
an der Weinstraße, landesweit<br />
das Artenschutzprojekt "AUENAM-<br />
PHIBIEN" (1993, 1994); erste Teilerfolge<br />
sind im Grundlagenwerk<br />
"DIE AMPHIBIEN UND REPTI-<br />
LIEN IN RHEINLAND-PFALZ"<br />
dargestellt.<br />
Die große Populationsdynamik<br />
dieser Auenart wird geradezu drastisch<br />
im Laufe der letzten etwa 15<br />
Jahre sichtbar: Veränderte hydrologische<br />
Verhältnisse im Zusammenhang<br />
mit Klimaschwankungen<br />
(-änderungen?) haben zu einem<br />
stark modifizierten Biotopangebot<br />
in der Rheinaue geführt. Immer<br />
öfter und länger trocknen Altrheine,<br />
Schluten und Kolke aus; gleichzeitig gibt<br />
es immer seltener Hochwasserereignisse.<br />
Dadurch sind immer längere Phasen<br />
mit fischfreien Gewässern möglich.<br />
Da sich Fische und Laubfroschlarven<br />
definitiv ausschließen,<br />
ist klar, warum sich plötzlich die<br />
Tiere so stark vermehren und warum<br />
sie gerade in der rezenten (direkt<br />
überfluteten Aue vor <strong>dem</strong><br />
Deich) Rheinaue reproduzieren,<br />
21