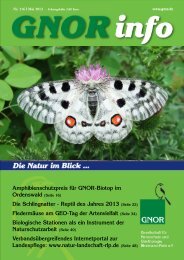Info Aus dem Inhalt - Gnor
Info Aus dem Inhalt - Gnor
Info Aus dem Inhalt - Gnor
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Blätter und Fruchtstand der Herbstzeitlosen im<br />
Frühjahr / Foto: Helmut Müller<br />
zahl der fleischigen, breit lanzettlichen<br />
Blätter ordnet sich diesem<br />
Prinzip unter (ROTHMALER, 1976).<br />
Als Besonderheit zeichnet sich<br />
diese Spezies gegenüber anderen<br />
Gattungen dadurch aus, dass ihre<br />
Blüten zu besagter Jahreszeit allein<br />
ohne Blätter erscheinen. Letztere<br />
entwickeln sich erst im drauffolgenden<br />
Frühjahr zusammen mit <strong>dem</strong><br />
etwas aufgeblasenen, tief zwischen<br />
den trichterförmig angeordneten<br />
Blättern eingesenkten Fruchtstand.<br />
Dieses Verhalten dürfte nach Meinung<br />
des Verfassers ursprünglich<br />
eine spezielle Anpassung an die an<br />
ihren primären Wuchsorten stark<br />
eingeschränkten sommerlichen<br />
Lichtverhältnisse sein und hat sich<br />
später als vorteilhaft in Bezug auf<br />
den Rhythmus der Mähwiesen herausgestellt.<br />
Auf Viehweiden hilft der<br />
Herbstzeitlosen offenbar auch ihre<br />
bekannte Giftigkeit sich zu behaupten<br />
(Weideunkraut).<br />
Charakteristisch für die senkrecht<br />
aufragenden Blüten selbst ist die<br />
bodenwärtige Verlängerung des oberen<br />
eiförmigen Hauptblütenteils in<br />
einen langen, dünn-röhrenförmigen<br />
Schaft, der bis zur kastanienfarbigen<br />
Knolle reicht. Durch ihn erfolgt die<br />
Befruchtung der zu dieser Zeit im<br />
Boden befindlichen Samenanlage.<br />
GNOR <strong>Info</strong> 103<br />
Bezüglich ihrer Ansprüche an die<br />
Substratbeschaffenheit und die<br />
Feuchtigkeitsverhältnisse des Bodens<br />
werden nach OBERDORFER,<br />
1979 "sicker- bis wechselfeuchte,<br />
nährstoffreiche, tiefgründige, milde<br />
bis mäßig saure humose Lehm- und<br />
Tonböden" bevorzugt, wie sie vor<br />
allem in Auenbereichen anzutreffen<br />
sind.<br />
Das in dieser Pflanze enthaltene<br />
Alkaloid Colchicin wird zu pharmazeutischen<br />
Zwecken wie z. B. bei<br />
akuten Gichtanfällen oder vor allem<br />
in der Pflanzenzucht als Zellgift<br />
wegen seines Einflusses auf das Erbgut<br />
zur Mutationsauslösung verwendet.<br />
Der gesellschaftsmäßige Schwerpunkt<br />
des Vorkommens dieser laut<br />
Oberdorfer subatlantisch bis submediteran<br />
verbreiteten Art liegt bei uns<br />
in Feuchtwiesen der Ordnung Molinietalia.<br />
Sie ist jedoch auch in feuchten<br />
bis wechselfeuchten Glatthaferwiesen<br />
der Ordnung Arrhenatheretalia<br />
(PAWL. 28) zu finden. Weiterhin<br />
kommt die Herbstzeitlose in<br />
wohl nicht zu lichtarmen Bach- oder<br />
Flussauenwäldern des Verbandes<br />
Alno-Padion (BR.- BL. ET TX 43)<br />
vor.<br />
Diese Verbreitungspräferenzen liefern<br />
zugleich gewisse Anhaltspunkte<br />
im Zusammenhang mit Naturschutzaspekten.<br />
Wenn auch die<br />
Herbstzeitlose zurzeit noch nicht<br />
selbst gefährdet ist, hat sie doch<br />
ihren Verbreitungsschwerpunkt vorwiegend<br />
in solchen Biotoptypen, die<br />
in Rheinland-Pfalz einem pauschalen<br />
gesetzlichen Bestandsschutz<br />
nach § 28 Landesnaturschutzgesetz<br />
unterliegen. Hierbei wäre nach Meinung<br />
des Verfassers noch eingehender<br />
zu klären, inwieweit sie diesbe-<br />
Floristik<br />
züglich z.B. als Leit- oder Zeigerart<br />
in Frage käme.<br />
Obwohl die Art zumindest im<br />
südlicheren Deutschland momentan<br />
noch relativ häufig vorkommt und<br />
z.B. in der Pfalz nach LANG &<br />
WOLFF (1993) offenbar nur in wenigen<br />
Messtischblattquadranten fehlt,<br />
dürften auch ihre Bestände weiter<br />
abnehmen. Zu den Gründen hierfür<br />
können Veränderungen der landwirtschaftlichen<br />
Nutzungsweisen in<br />
Form zunehmenden Grünlandumbruchs<br />
und Intensivierung der Düngung<br />
von Wiesen und Weiden gezählt<br />
werden. Dies wiederum ermöglicht<br />
ihr eine vermutlich ebenfalls<br />
abträgliche häufigere Mahd und<br />
dürfte die Wuchskraft konkurrierender<br />
Pflanzenarten weiter fördern.<br />
Auch der Rückgang bestimmter<br />
Auwaldtypen mag bei der Bestandsabnahme<br />
eine Rolle spielen.<br />
(HELMUT MÜLLER)<br />
Literatur<br />
LANG, W. UND P. WOLFF (Hrsg.)<br />
(1993) Flora der Pfalz - Verbreitungsatlas<br />
der Farn- und Blütenpflanzen<br />
für die Pfalz und ihre Randgebiete.<br />
Verlag der Pfälzischen Gesellschaft<br />
zur Föderung der Wissenschaften.<br />
Speyer am Rhein.<br />
OBERDORFER, E. (1979) Pflanzensoziologische<br />
Exkursionsflora für Süddeutschland<br />
und die angrenzenden<br />
Gebiete, 4. Auflage, Stuttgart<br />
(Ulmer).<br />
ROTHMALER, W. (1976) Exkursionsflora<br />
für die Gebiete der DDR und<br />
der BRD - Gefäßpflanzen Berlin<br />
(Volk und Wissen Volkseigener Verlag).<br />
31