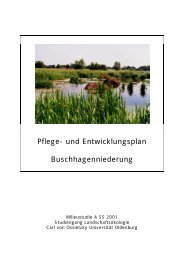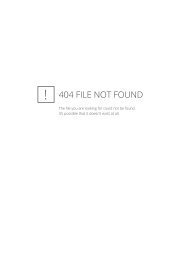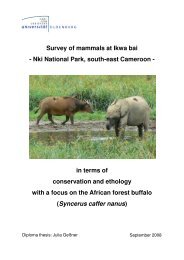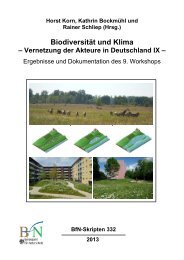(Stand: Mai 2003) - Landscape Ecology
(Stand: Mai 2003) - Landscape Ecology
(Stand: Mai 2003) - Landscape Ecology
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4 Ausblick<br />
Die von uns vorgestellten Pflegeverfahren haben zumindest auf kurze Sicht ihre Eignung bewiesen, in<br />
Konkurrenz zu den herkömmlichen Pflegeverfahren den Artenbestand der Naturschutzgebiete zu erhalten.<br />
Die Frage ist, ob dies nachhaltig ist. So ist in Weidesytemen eine geringe Besatzdichte notwendig, damit die<br />
Tiere im Winter nicht verhungern, wenn der Naturschutz auf kapital- und arbeitsintensive Stallhaltung<br />
verzichten will. Sie führt aber zu großen Problemen in der Abschätzung, ob Flächen mit schutzwürdigem<br />
Arteninventar überhaupt beweidet werden oder im Gegenteil zu sehr beweidet werden, ob die nicht<br />
beweideten Flächen schnell verbuschen, ob diese Verbuschung durch die Tiere in längeren Winterperioden<br />
selbst wieder zurückgedrängt wird und ob die Pflanzen dann erneut offen stehende Habitate auch<br />
wiederbesiedeln können. Insgesamt müssen also die Effekte des zeitlichen und räumlichen Wechsels von<br />
Habitatqualitäten auf das Überleben der Arten prognostiziert werden. Dies kann nicht allein durch<br />
zwangsläufig eher kurzfristige und kleinflächige Geländeuntersuchungen geschehen, sondern nur durch<br />
eine Kombination von Modellen und statistisch ausgewerteten Geländeuntersuchungen. Die Schwierigkeit<br />
bleibt, quantitative Prognosen für alle Arten über lange Zeiträume und große Landschaften zu liefern, da die<br />
dafür benötigten Felderhebungen nicht zu leisten sind. Wir haben eine Reihe von Verfahren vorgestellt, die<br />
in ihrer Kombination einen akzeptablen Kompromiss zwischen Aufwand und Ertrag darstellen. Die<br />
statistischen Habitatmodelle, die in diesem Projekt erstmals konsequent für Tiere und Pflanzen angewendet<br />
werden, ermöglichen eine prädiktive Quantifizierung der realisierten Nische in dem Mosaikzyklus. Die<br />
untersuchten Insektenarten fanden in Magerrasen mit einem verhältnismäßig breiten Spektrum an<br />
Pflegeintervallen geeignete Habitate. Habitatmodelle sind ist unabdingbar, um die Bedeutung der<br />
Pflegemaßnahmen gegen die Bedeutung der sonstigen Habitatfaktoren für das Vorkommen jeder Art<br />
darzustellen. Dabei zeigte sich die Relevanz der Winterbeweidung im Untersuchungsgebiet Müritz.<br />
Habitatmodelle sind für viele Arten relativ schnell zu erstellen, sie sind allerdings statisch und können<br />
sinkende Populationsgrößen über die Zeit nicht darstellen. Dies war mit der Populationsgefährdungsanalyse<br />
von vier Pflanzenarten möglich, welche eine Einschätzung optimaler Intervallraten zwischen den<br />
Pflegemaßnahmen geliefert hat, jedoch nur für diese Arten. Wenn diese Arten allerdings verschiedene<br />
funktionelle Gruppen repräsentieren, können die Ergebnisse auf alle Arten dieser Gruppe übertragen<br />
werden. Die Mobilität kann bei Insekten zum Teil durch Fang-Wiederfang-Methoden bestimmt werden, bei<br />
Pflanzen müssen dazu die Ausbreitungsvektoren untersucht und die Ausbreitung der Samen modelliert<br />
werden. Populationsdynamische Simulationsmodelle zeigen das Spektrum biologischer Eigenschaften, mit<br />
dem ein Überleben in dynamischen Landschaften möglich ist. Diese theoretischen Ergebnisse können<br />
wiederum mit den im Gelände erhobenen biologischen Merkmalen der Arten verglichen werden. Die<br />
Ergebnisse der Integration dieser Verfahren in einem Landschaftsmodell konnten in diese Publikation nicht<br />
mehr einfließen, ebenso wie die Habitatmodelle der Pflanzen im Untersuchungsgebiet Hassberge.<br />
Über die Frage nach optimalen Pflegeverfahren für den Naturschutz hinaus hat das MOSAIK-Projekt auch<br />
Grundlagenforschung betrieben, um Prognosen auf eine sichere Basis zu stellen und bessere Kenntnisse<br />
über die Ökologie der Arten in Landschaften zu erhalten. Dazu zählen zum Beispiel:<br />
• Fehleranalyse bei der Präsenz- / Absenz-Erfassung von mobilen Insekten (PFEIFFER & HENLE 2004)<br />
• Quantifizierte und validierte Habitatmodelle für eine Vielzahl von Arten<br />
• Neue Erkenntnisse zur Bildung funktionaler Gruppen und zur Analyse funktionaler Merkmale von<br />
Pflanzen<br />
• Verschiedene Simulationsmodelle zur Ausbreitung, Raumnutzung und Populationsbiologie von<br />
Pflanzen, Insekten und Weidetieren (KAHMEN & POSCHLOD 2004, FRITZSCH et al. 2004, HEIN &<br />
POETHKE 2004, HINSCH & POETHKE 2004)<br />
12