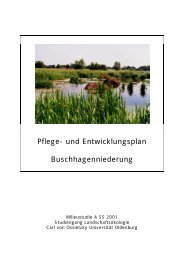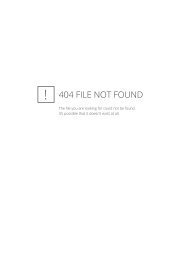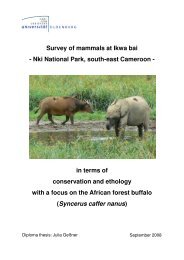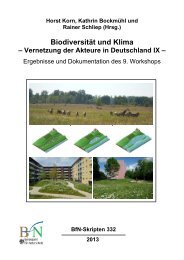(Stand: Mai 2003) - Landscape Ecology
(Stand: Mai 2003) - Landscape Ecology
(Stand: Mai 2003) - Landscape Ecology
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Modellierung notwendigen Parameter und Daten werden durch einen hierarchischen Untersuchungsansatz<br />
im Gelände ermittelt. Neben populationsdynamischen Untersuchungen und Habitatmodellen für einzelne<br />
Pflanzen- und Tierarten verwenden wir für die „community“–Ebene das Konzept der „funktionalen<br />
Pflanzentypen“. Funktionelle Gruppen werden als Gruppen von Pflanzen definiert, die sich in bezug auf<br />
biologische Merkmale der Persistenz, vegetativen und generativen Regeneration und Dauerhaftigkeit der<br />
Diasporenbank ähnlich sind und die bei bestimmten <strong>Stand</strong>ortbedingungen häufig vorkommen, was<br />
bedeutet, dass ihre biologischen Merkmale für diese Bedingungen funktional sind (GITAY & NOBLE 1997,<br />
LAVOREL et al. 1997, KLEYER 1999). In einer Gruppe werden also Pflanzenarten zusammengefasst, die sich<br />
bei Umweltveränderungen ähnlich verhalten, weil ihre Biologie ähnlich ist.<br />
2 Ein ungesteuerter Mosaikzyklus durch freie Beweidung mit geringer Besatzdichte<br />
2.1 Fragestellung<br />
Geringe Besatzdichten besonders widerstandsfähiger Landrassen von Weidetieren haben den Vorteil, dass<br />
die wenigen Tiere auf großer Fläche selbst im Winter bei sehr geringem Futterangebot noch ausreichend zu<br />
fressen finden. Wenn dies möglich ist, entfallen für den Naturschutz die Kosten der Winterfutter-<br />
Vorratswerbung und –lagerung sowie die Stallhaltung mit ihrem hohen Betreuungsaufwand. Unsere<br />
Hypothese ist, dass bei freier Beweidung ohne winterliche Aufstallung die Nahrungsressourcen im Winter<br />
entscheidend sind, während der Aufwuchs im Sommer nicht vollständig konsumiert wird. Das Winter-<br />
Futterangebot bestimmt die Größe der Herde, wobei extreme Winter besonders hohe Regulationseffekte<br />
erzielen. Deshalb wird im Sommer die Verbuschung zunehmen, während im Winter die Büsche durch das<br />
Vieh befressen werden und die Sukzession wieder zurückgesetzt wird. Je geringer die Besatzdichte wird,<br />
desto stärker können die Tiere zudem ihr Futter selektieren. Dann verändert sich das Bild von einer<br />
homogenen Beweidung („homogeneous grazing“) zu einer fleckenhaften Beweidung („patch grazing“) und<br />
dann zu einer zufälligen Auswahl von Einzelpflanzen („random grazing“, ADLER et al. 2001). Patch<br />
grazing tritt auf, wenn die Tiere bestimmte Flächen bevorzugen, (i) um junge, proteinreiche Triebe zu<br />
fördern, (ii) um Weideflächen in Fraßbereiche und Latrinenbereiche zu gliedern (PUTMAN et al. 1991), oder<br />
(iii) um Flächen zu meiden, die windexponiert, zu feucht oder aus anderen Gründen ungünstig sind. Patch<br />
grazing bedeutet für die Pflanzen- und Tierarten eine mosaikförmige Intensivierung der Störung, die bei<br />
Beweidung durch Pferden, Ziegen und Schafen extreme Werte annehmen kann, weil diese ihr Futter sehr<br />
nahe am Boden abbeißen (SAMBRAUS 1991). Die Landschaft sollte sich also langsam in intensiv beweidete<br />
und kaum beweidete, ggf. verbuschende Bereiche aufgliedern. Schutzwürdige Arten würden mithin<br />
entweder den Verbiss nicht überstehen können oder durch Sukzession auskonkurriert werden, womit dieses<br />
Pflegeverfahren in Konflikt zu den Naturschutzzielen geraten könnte. Wenn patch grazing über lange Zeit<br />
ohne Düngung auf den gleichen Flächen etabliert wird, sollte es dort zu einer starken Aushagerung<br />
kommen, so dass die Weidetiere ihren Proteinbedarf nicht mehr decken können. Dann kann erwartet<br />
werden, dass die Weidetiere sich neue Fraßbereiche erschließen und die bisherige Verteilung von Fraß-,<br />
Latrinen- und Ruhebereichen umdrehen. Dies wiederum könnte für empfindliche Arten vorteilhaft sein,<br />
vorausgesetzt, sie können in diese ausgehagerten Flächen wieder einwandern. Langfristig wird die<br />
Habitatqualität für Pflanzen und Tiere zyklische Mosaikstrukturen aufweisen, vermittelt durch die<br />
spezifische Verhaltensökologie der Weidetiere. Über die Frequenzen, Amplituden und räumliche Skalen<br />
dieses Weide-Mosaikzyklus ist so gut wie nichts bekannt.<br />
2.2 Ergebnisse<br />
Auf der Greifswalder Oie (Größe: 0,55 km², Böden: Parabraunerden und geköpfte Parabraunerden;<br />
4