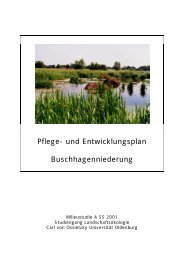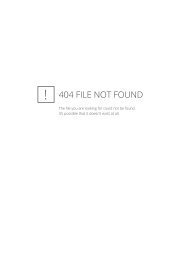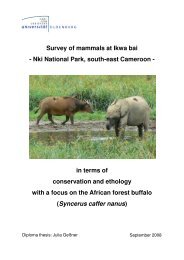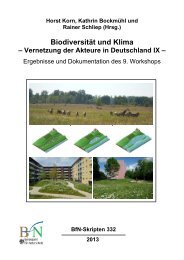(Stand: Mai 2003) - Landscape Ecology
(Stand: Mai 2003) - Landscape Ecology
(Stand: Mai 2003) - Landscape Ecology
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
wird. Dominante Arten entwickeln sich bei freier Sukzession auf gut versorgten <strong>Stand</strong>orten. Auf der<br />
anderen Seite können nur wenige Arten, die sich durch hohe Regenerationspotentiale oder hohe<br />
Stresstoleranzen auszeichnen, hohe Störungsintensitäten oder lang andauernden Nährstoff- und<br />
Wasserstress überstehen. Demnach sollten bei mittleren Störungsintensitäten und mittleren bis geringen<br />
Ressourcenangeboten die meisten Arten vorkommen, denn dann wird einerseits die Dominanz<br />
beschattender Arten gebrochen, andererseits können selbst regenerationsschwache Arten überleben.<br />
Mittlerweile sind diese Theorien gut belegt (GRACE 2001, KLEYER 1999, 2002, MACKEY & CURRIE 2000,<br />
WEIHER <strong>2003</strong>), allerdings ist noch unsicher, was in einer konkreten Landschaft mit „mittleren“<br />
Störungsintensitäten und „mittleren bis geringen“ Ressourcenangeboten gemeint sein kann.<br />
1. 2 Wieviel Störung ist mittlere Störungsintensität und wie kann sie umgesetzt werden?<br />
In der Schere zwischen Intensivierung und Aufgabe der Nutzung gefangen, nimmt die Artenvielfalt des<br />
landwirtschaftlichen Offenlandes immer stärker ab (POSCHLOD & SCHUMACHER 1998). Gerade die<br />
marginalen <strong>Stand</strong>orte sind deshalb in den letzten Dekaden in großer Zahl und Fläche dem behördlichen<br />
Naturschutzes mit der Verpflichtung überantwortet worden, die ursprüngliche Artenvielfalt durch<br />
Maßnahmen zur Offenhaltung zu erhalten. Bei der Gestaltung dieser Pflegemaßnahmen hielt man sich im<br />
Wesentlichen an das Vorbild der historischen bäuerlichen Bewirtschaftung, z.B. zweischürige Mahd,<br />
Schafbeweidung oder ähnliche Bewirtschaftungsformen, die noch vor 50 Jahren typische<br />
landwirtschaftliche Nutzungsformen marginaler <strong>Stand</strong>orte waren. Diese Verfahren entsprechen dem Begriff<br />
„mittlere Störungsintensität“. Mittlere Störungsintensität liegt in etwa zwischen einer zweimaligen Mahd<br />
pro Jahr und einer einmaligen Mahd all drei Jahre oder einer Beweidung von 0,1 bis 2 Großvieheinheiten<br />
pro Hektar (Abb. 1b).<br />
Das gemeinsame Merkmal von Pflegeverfahren, die der historischen bäuerlichen Bewirtschaftung<br />
nachempfunden werden, ist jedoch, dass diese ertragsorientiert sind, mithin Biomasse geerntet wird, die im<br />
früheren landwirtschaftlichen Betrieb als Futter erwünscht war, heute aber in der Regel nicht genügt, um<br />
ausreichende landwirtschaftliche Deckungsbeiträge zu erzielen. Vielfach bleibt nur die Deponie als<br />
Endlagerstätte für den Aufwuchs. Deshalb sind bereits in den siebziger und achtziger Jahren nicht<br />
ertragsorientierte Verfahren zur Entfernung von Biomasse ausprobiert worden, zum Beispiel Mulchen und<br />
Brennen (RIESS 1975, ZIMMERMANN 1975, SCHREIBER 1997a, WEGENER & KEMPF 1982, SCHIEFER 1983,<br />
IFFERT & SIMON 1985, BAKKER 1989, MAERTENS et al. 1990, DIEMONT 1994, DIERSCHKE & PEPPLER-<br />
LISBACH 1997, SCHMIDT et al. 1998). Das wichtigste Projekt stellen die „Bracheversuche in Baden-<br />
Württemberg” dar, die im Jahre 1973 in Auftrag gegeben wurden und nahezu 30 Jahre verfolgt wurden<br />
(z.B. SCHIEFER 1981, NEITZKE 1991, SCHREIBER 1997b). Diese Versuche zeigten, dass Mulchen die<br />
Nährstoffanreicherung nicht verhindern kann (erst im letzten Jahrzehnt des Dauerversuches ergaben sich<br />
Anzeichen für eine Aushagerung der Bestände durch Mulchen) und das Brennen mit einer<br />
Populationsausweitung von Rhizomgräsern verbunden ist, während Hemikryptophyten zurückgehen.<br />
Keines dieser Verfahren kommt ohne Subventionen aus, da sie im Regelfall jährlich angewendet werden<br />
müssen. Da jedoch bei gleichbleibenden öffentlichen Mitteln immer mehr offen zu haltende Fläche<br />
hinzukommt, müssen Verfahren gefunden werden, die preiswerter sind, weil der Arbeitsaufwand zur<br />
Beseitigung des Aufwuchses verringert wird (siehe auch KLEIN et al. 1997, RIECKEN et al. 1997). Dies kann<br />
in Bezug auf die Häufigkeit, die räumliche Ausdehnung oder die Intensität des landschaftspflegerischen<br />
Eingriffs geschehen (vgl. WHITE & JENTSCH 2001). Im ersten Fall wird die Fläche seltener gepflegt, im<br />
zweiten Fall werden jährlich nur Teilflächen gepflegt und im dritten Fall wird ein vergleichsweise geringer<br />
Eingriff wie z.B. Mahd durch einen schwereren Eingriff ersetzt, wie z.B. Fräsen, unter der Annahme, dass<br />
2