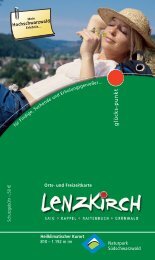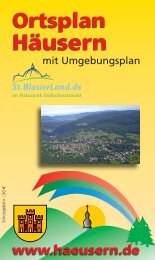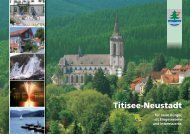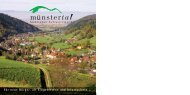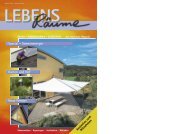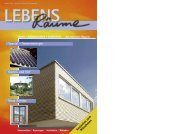5 B C D F G H F G H 6 7 5 6 7 E F E F 12 13 14 15 ... - infoprint Verlag
5 B C D F G H F G H 6 7 5 6 7 E F E F 12 13 14 15 ... - infoprint Verlag
5 B C D F G H F G H 6 7 5 6 7 E F E F 12 13 14 15 ... - infoprint Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4<br />
Geschichte Geschichte<br />
Geologie und Geografie<br />
Die geologische Vorformung des als „Lenzkircher<br />
Wannen“ bezeichneten heutigen Lenzkircher Ge -<br />
mein degebietes erfolgte schon im Unterkarbon durch<br />
die Einsenkung des „Bonndorfer Grabens“, einer<br />
vom Kaiserstuhl zum Bodensee verlaufenden Störung<br />
im Grundgebirgsaufbau des herausgehobenen<br />
Schwarzwaldmassivs. Im etwa 3 km breiten, am tiefsten<br />
eingesunkenen Grabenteil bei Lenzkirch, mit den<br />
parallelen, seitlichen Höhenzügen des Hochfirstrückens<br />
(1 493 m) und des Pflumberges (1 101 m) lassen<br />
sich Verwerfungen bis <strong>15</strong>0 m Höhe feststellen.<br />
Diese vorgeformte Landschaft erfuhr ihre endgültige<br />
Gestalt durch die folgenden Eiszeiten, deren Gletscher<br />
das heutige Talprofil hinterließen, z. B. den Ursee<br />
als verlandenden, in der letzten Würmeiszeit aufgestauten<br />
Gletschersee. Geologisch bedingt ist auch<br />
die Öffnung des Tales nach Osten, wo die Flüsse Gutach<br />
und Haslach an der östlichen Gemeindegrenze<br />
sich vereinigen und gemeinsam die Wutach bilden.<br />
Diese verließ durch Überlaufen bei Achdorf die bisherige<br />
Fließrichtung nach Osten und schuf durch den<br />
viel größeren Höhenunterschied nach Süden zum<br />
Rhein im Verlaufe von Jahrtausenden die großartige,<br />
geologisch und naturkundlich interessante Wutach-<br />
schlucht. Ursee und Wutachschlucht sind heute als<br />
Naturschutzgebiete mit seltener Flora und Fauna bekannte<br />
und viel besuchte Sehenswürdigkeiten.<br />
Klimatisch zeichnet sich die Tallandschaft der beiden<br />
im Hauptort Lenzkirch sich vereinigenden Täler der<br />
Haslach und des Urseebaches durch ein schonendes<br />
Reizklima aus, was nach langen Wetterbeobachtungen<br />
den Titel „Heilklimatischer Kurort“ einbrachte.<br />
Unmittelbar umgeben ist das Gemeindegebiet im Süden<br />
vom Schluchsee, im Westen von Feldberg und Titisee,<br />
im Norden jenseits des Hochfirsts von Neustadt.<br />
Im Osten liegt Richtung Bonndorf der Zugang zur<br />
Wutachschlucht als beliebtes Wanderziel.<br />
Geschichtliches über Lenzkirch<br />
Die Besiedlung erfolgte nachweislich von Osten her<br />
aus dem frühmittelalterlichen Alpgau, der bis zum Titisee<br />
und Feldberg reichte. Sie wurde angeregt durch<br />
eine alte Verkehrsverbindung über den noch unerschlossenen<br />
Hochschwarzwald vom Breisgau zum Bodensee<br />
etwa um die Jahrtausendwende. In Lenzkirch,<br />
dessen Namensgebung die gleichzeitige Gründung<br />
einer Siedlung und einer Pfarrkirche durch einen<br />
„Lanto“ anzeigt, entstand eine Ortsherrschaft, als deren<br />
Inhaber „Swiggerus de Lendischilicha“ um 1<strong>13</strong>0<br />
nachgewiesen ist. Im gleichen Zeitraum lassen sich<br />
Raitenbuch sowie Ort und Kirche in Saig belegen,<br />
während die übrigen Ortsteile erst etwas später nachweisbar<br />
sind.<br />
Von den zunächst im Ortskern ansässigen Herren von<br />
Lenzkirch wurde in der Folge die noch als Ruine bestehende<br />
Burg Urach als Herrschaftsmittelpunkt und<br />
Straßensicherung errichtet, wobei die Namengebung<br />
der Burg und des Besitzergeschlechtes aus der Bezeichnung<br />
des heutigen Urseebaches als „Urach“ zu<br />
vermuten ist.<br />
Nach <strong>13</strong>00 sind die Herren von Blumegg als Besitzer<br />
der jetzt zur Herrschaft Lenzkirch gewordenen Talschaft<br />
bis zum Jahre <strong>14</strong>91 urkundlich belegt. Sie veräußerten<br />
dann ihr Gebiet im Ursee- und Haslachtal<br />
einschließlich der Rechte in der angrenzenden Vogtei<br />
Schluchsee um 6 600 Rheinische Gulden an den<br />
Landgrafen Heinrich zu Fürstenberg. Dieses von den<br />
Herzogen von Zähringen abstammende alte Grafengeschlecht<br />
gliederte diesen neuen Besitz der Herrschaft<br />
Lenzkirch als eigenes Amt ihrem Verwaltungsbereich<br />
„Über Wald“ an. 1620 wurde es mit dem<br />
Amt Neustadt zu einer eigenen Obervogtei in Neustadt<br />
vereinigt und künftig verwaltet. Zu diesem Zeitpunkt<br />
bestand schon längst eine gemeinsame Verwaltungseinheit<br />
der selbständigen Gemeinden Oberund<br />
Unterlenzkirch, Kappel, Saig, Raitenbuch mit<br />
Berg und Fischbach mit einer eigenen niederen Gerichtsorganisation<br />
von <strong>12</strong> Richtern, dem selbstgewählten<br />
Schultheiß und von Bürgermeistern in den<br />
Gemeinden. Die Herrschaft war durch einen Vogt im<br />
Ort vertreten. Bis 1806, als Napoleon durch die Mediatisierung<br />
auch der fürstenbergischen Landesherrschaft<br />
ein Ende bereitete, waren die Lenzkircher Untertanen<br />
für über 300 Jahre den Landgrafen, ab 1716<br />
den Fürsten zu Fürstenberg als obersten Landesherrn,<br />
Treue und Gefolgschaft schuldig.<br />
Es folgte die Zugehörigkeit zum Großherzogtum Baden,<br />
das 1918 vom republikanischen Land Baden abgelöst<br />
wurde, während Lenzkirch heute als Bestandteil<br />
des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald zum<br />
Land Baden-Württemberg gehört. Die Entwicklung<br />
Lenzkirchs von einer klimatisch benachteiligten, ausschließlich<br />
landwirtschaftlich ausgerichteten Schwarzwaldgemeinde<br />
über einen vorindustriellen Zustand<br />
mit Handelskompanien und Uhrenmacherei, bis zum<br />
frühindustriellen Sitz einer weltbekannten Uhrenfabrik<br />
von 1851 bis 1928, nachfolgenden Bemühungen<br />
um Förderung des Fremdenverkehrs, mündete in die<br />
heutigen vielseitige Ausrichtung auf umweltneutrale<br />
Industrie, Kurbetrieb, Dienstleistungen und als Verwaltungszentrum<br />
der Gesamtgemeinde.<br />
Diese Entwicklung stellt sich auch im Ortsbild dar, wo<br />
die alte Bauweise in reiner Holzkonstruktion durch<br />
Brände und Baulust der Handelsmänner des 19. Jh.<br />
zur städtischen Bauart fast vollständig verschwunden<br />
ist. Neueste Bauten lehnen sich zum Teil wieder an<br />
heimische Gestaltungen an, so dass sich das im<br />
19. Jh. ausdrücklich gelobte schöne Ortsbild von<br />
Lenzkirch vorteilhaft weiterentwickelt hat.<br />
Kirchlich gehörten seit ältesten Zeiten Raitenbuch,<br />
Berg, Fischbach, Schwende und Hinterhäuser als Filialen<br />
zur kath. Pfarrei Lenzkirch, wobei in jüngerer Zeit<br />
die letzteren drei Orte sowohl politisch als auch kirchlich<br />
nach Schluchsee umgemeindet wurden. Die heu-<br />
tige Pfarrkirche St. Nikolaus entstand in unterschiedlichen<br />
Bauphasen. Die unteren Turmgeschosse stammen<br />
aus mittelalterlicher Zeit, das Turmoberteil mit<br />
dem auffallend spitzen Turmhelm wurde erst 1820 in<br />
dieser Form erbaut, nachdem einem großen Brand im<br />
Ortskern am <strong>12</strong>. Mai 18<strong>13</strong> Rathaus, Pfarrhaus und<br />
Kirche samt <strong>13</strong> Häuser zum Opfer gefallen waren.<br />
Das aus Platzgründen 1934/35 vergrößerte Kirchenschiff<br />
wurde architektonisch gelungen mit dem vorhandenen,<br />
übereck stehenden unveränderten Turm<br />
verbunden. Die Ausstattung stammt z. T. aus der vorherigen<br />
Kirche und aus noch älterem Bestand.<br />
Obwohl erst seit 1970 eine evangelische Kirchengemeinde<br />
Lenzkirch-Schluchsee besteht, konnte schon<br />
1952 eine bereits vor dem zweiten Weltkrieg geplante<br />
kleine Kirche gebaut werden, die dezent bauliche<br />
und manche kulturellen Akzente setzt.<br />
Ein weiteres kirchliche Gebäude ist die Kapelle des hl.<br />
Cyriak in der Schwende, (heute Pfarrei Schluchsee),<br />
die in früherer Zeit Ziel jährlicher Flurprozessionen aus<br />
Lenzkirch war und noch heute der idyllischen Lage<br />
und der bäuerlich-künstlerischen Ausstattung wegen<br />
oft besucht wird.<br />
Im Hauptort Lenzkirch stand die ehedem zur Burg<br />
Urach bzw. zu deren landwirtschaftlichen Meierhof<br />
gehörende, dann nach dessen Verschwinden 1600<br />
von der Einwohnerschaft Lenzkirchs als Wallfahrtsort<br />
benutzte, ganz in Holz ausgeführte Kapelle des hl.<br />
Eligius. An Stelle dieser Kapelle wurde vom Kapellenfond<br />
1684/85 eine barocke steinerne Nachfolgerin<br />
mit einem Dachreiter in Zwiebelform erbaut, die<br />
1884 erweitert und 1981 mit Anbau versehen wurde.<br />
Seit 1821 diente sie als Friedhofkapelle, da der ehemals<br />
um die Pfarrkirche gelegene überfüllte Gottesacker<br />
nach dem westlichen Ortsausgang verlegt wurde.<br />
An die Tradition der Wallfahrten zur Kapelle des Hl.<br />
Eligius (süddeutsch: Eulogius) schloss sich mit einem<br />
neu aufgenommenen Brauch einer Pferdesegnung<br />
und anschließenden Umzug das bereits zur jährlichen<br />
Tradition gewordene „Eulogifest“ am Sonntag vor<br />
dem Festtag des Heiligen (25. Juni) an.<br />
Saig,<br />
dessen nicht leicht zu deutender Ortsname in mehreren<br />
Varianten nachweisbar ist, darf nach seiner Lage<br />
am südwestlichen Abhang des Hochfirsts als „Siedlung<br />
am geneigten Berghang“ gedeutet werden.<br />
Nicht wenige der Häuser von Saig stehen oberhalb<br />
1000 m Höhe und auch das Ortszentrum befindet<br />
sich mit 990 m nur wenig unter dieser Marke. Nur<br />
der Ortsteil Mühlingen lag mit 840 m tiefer. Ursprünglich<br />
erstreckte sich das Gemeindegebiet bis<br />
zum Feldberg, verlor diesen Teil dann an die neuen<br />
Feldbergorte Bärental, Alt- und Neuglashütten.<br />
Ein Gut und die Kirche Saig werden schon im <strong>12</strong>. Jh.<br />
von Adeligen dem Kloster Allerheiligen in Schaffhausen<br />
übergeben. Dessen Besitz ist mehrfach in z. T. gefälschten<br />
kaiserlichen und päpstlichen Urkunden bestätigt.<br />
Als Besiedlungszeitpunkt darf aber bereits das<br />
11. Jh. angenommen werden. Saig ist als typisches<br />
Hofsiedlungsgebiet mit Blockflur zu betrachten, wie<br />
die übrigen Ortsteile, während Lenzkirch selbst – jedenfalls<br />
seit die Flurform erkennbar ist – Dorfsiedlung<br />
mit Grundstücksstreubesitz aufweist.<br />
Seit der Zeit der Blumegger teilt Saig die Geschicke<br />
der Herrschaft Lenzkirch und nimmt dort auch an deren<br />
Selbstverwaltung gleichberechtigt teil. Die Höhenlage<br />
Saigs mit bis zu 1000 m ließ nur spärliche<br />
landwirtschaftliche Nutzung mit Grünlandwirtschaft<br />
und Viehhaltung, jedoch kaum Getreideanbau, zu.<br />
Gerade deswegen finden sich hier meist größere Hofgüter,<br />
von denen ursprünglich <strong>14</strong> vorhanden waren.<br />
Fremdenverkehr entwickelte sich hier, begünstigt<br />
5