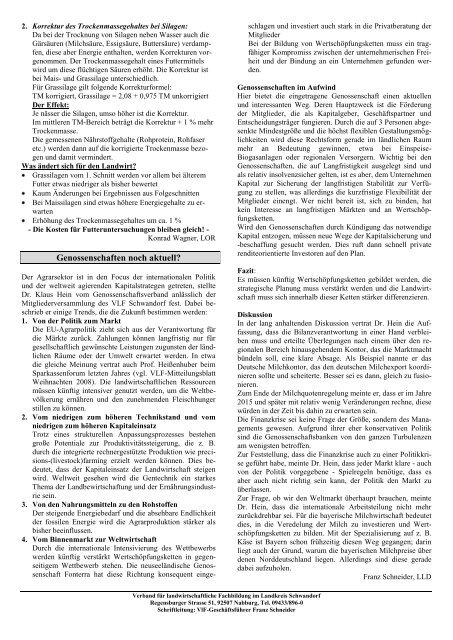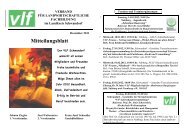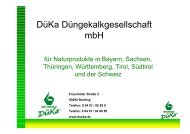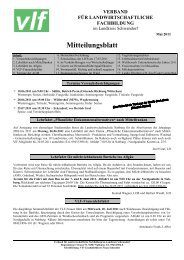Mitteilungsblatt - Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ...
Mitteilungsblatt - Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ...
Mitteilungsblatt - Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2. Korrektur des Trockenmassegehaltes bei Silagen:<br />
Da bei der Trocknung von Silagen neben Wasser auch die<br />
Gärsäuren (Milchsäure, Essigsäure, Buttersäure) verdampfen,<br />
diese aber Energie enthalten, werden Korrekturen vorgenommen.<br />
Der Trockenmassegehalt eines Futtermittels<br />
wird um diese flüchtigen Säuren erhöht. Die Korrektur ist<br />
bei Mais- <strong>und</strong> Grassilage unterschiedlich.<br />
Für Grassilage gilt folgende Korrekturformel:<br />
TM korrigiert, Grassilage = 2,08 + 0,975 TM unkorrigiert<br />
Der Effekt:<br />
Je nässer die Silagen, umso höher ist die Korrektur.<br />
Im mittleren TM-Bereich beträgt die Korrektur + 1 % mehr<br />
Trockenmasse.<br />
Die gemessenen Nährstoffgehalte (Rohprotein, Rohfaser<br />
etc.) werden dann auf die korrigierte Trockenmasse bezogen<br />
<strong>und</strong> damit vermindert.<br />
Was ändert sich <strong>für</strong> den Landwirt?<br />
Grassilagen vom 1. Schnitt werden vor allem bei älterem<br />
Futter etwas niedriger als bisher bewertet<br />
Kaum Änderungen bei Ergebnissen aus Folgeschnitten<br />
Bei Maissilagen sind etwas höhere Energiegehalte zu erwarten<br />
Erhöhung des Trockenmassegehaltes um ca. 1 %<br />
- Die Kosten <strong>für</strong> Futteruntersuchungen bleiben gleich! -<br />
Konrad Wagner, LOR<br />
Genossenschaften noch aktuell?<br />
Der Agrarsektor ist in den Focus der internationalen Politik<br />
<strong>und</strong> der weltweit agierenden Kapitalstrategen getreten, stellte<br />
Dr. Klaus Hein vom Genossenschaftsverband anlässlich der<br />
Mitgliederversammlung des VLF Schwandorf fest. Dabei beschrieb<br />
er einige Trends, die die Zukunft bestimmen werden:<br />
1. Von der Politik zum Markt<br />
Die EU-Agrarpolitik zieht sich aus der Verantwortung <strong>für</strong><br />
die Märkte zurück. Zahlungen können langfristig nur <strong>für</strong><br />
gesellschaftlich gewünschte Leistungen zugunsten der ländlichen<br />
Räume oder der Umwelt erwartet werden. In etwa<br />
die gleiche Meinung vertrat auch Prof. Heißenhuber beim<br />
Sparkassenforum letzten Jahres (vgl. VLF-<strong>Mitteilungsblatt</strong><br />
Weihnachten 2008). Die landwirtschaftlichen Ressourcen<br />
müssen künftig intensiver genutzt werden, um die Weltbevölkerung<br />
ernähren <strong>und</strong> den zunehmenden Fleischhunger<br />
stillen zu können.<br />
2. Vom niedrigen zum höheren Technikstand <strong>und</strong> vom<br />
niedrigen zum höheren Kapitaleinsatz<br />
Trotz eines strukturellen Anpassungsprozesses bestehen<br />
große Potentiale zur Produktivitätssteigerung, die z. B.<br />
durch die integrierte rechnergestützte Produktion wie precisions-(livestock)farming<br />
erzielt werden können. Dies bedeutet,<br />
dass der Kapitaleinsatz der <strong>Landwirtschaft</strong> steigen<br />
wird. Weltweit gesehen wird die Gentechnik ein starkes<br />
Thema der Landbewirtschaftung <strong>und</strong> der <strong>Ernährung</strong>sindustrie<br />
sein.<br />
3. Von den Nahrungsmitteln zu den Rohstoffen<br />
Der steigende Energiebedarf <strong>und</strong> die absehbare Endlichkeit<br />
der fossilen Energie wird die Agrarproduktion stärker als<br />
bisher beeinflussen.<br />
4. Vom Binnenmarkt zur Weltwirtschaft<br />
Durch die internationale Intensivierung des Wettbewerbs<br />
werden künftig verstärkt Wertschöpfungsketten in gegenseitigem<br />
Wettbewerb stehen. Die neuseeländische Genossenschaft<br />
Fonterra hat diese Richtung konsequent einge-<br />
Verband <strong>für</strong> landwirtschaftliche Fachbildung im Landkreis Schwandorf<br />
Regensburger Strasse 51, 92507 Nabburg, Tel. 09433/896-0<br />
Schriftleitung: VlF-Geschäftsführer Franz Schneider<br />
schlagen <strong>und</strong> investiert auch stark in die Privatberatung der<br />
Mitglieder<br />
Bei der Bildung von Wertschöpfungsketten muss ein tragfähiger<br />
Kompromiss zwischen der unternehmerischen Freiheit<br />
<strong>und</strong> der Bindung an ein Unternehmen gef<strong>und</strong>en werden.<br />
Genossenschaften im Aufwind<br />
Hier bietet die eingetragene Genossenschaft einen aktuellen<br />
<strong>und</strong> interessanten Weg. Deren Hauptzweck ist die Förderung<br />
der Mitglieder, die als Kapitalgeber, Geschäftspartner <strong>und</strong><br />
Entscheidungsträger fungieren. Durch die auf 3 Personen abgesenkte<br />
Mindestgröße <strong>und</strong> die höchst flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten<br />
wird diese Rechtsform gerade im ländlichen Raum<br />
mehr an Bedeutung gewinnen, etwa bei Einspeise-<br />
Biogasanlagen oder regionalen Versorgern. Wichtig bei den<br />
Genossenschaften, die auf Langfristigkeit ausgelegt sind <strong>und</strong><br />
als relativ insolvenzsicher gelten, ist es aber, dem Unternehmen<br />
Kapital zur Sicherung der langfristigen Stabilität zur Verfügung<br />
zu stellen, was allerdings die kurzfristige Flexibilität der<br />
Mitglieder einengt. Wer nicht bereit ist, sich zu binden, hat<br />
kein Interesse an langfristigen Märkten <strong>und</strong> an Wertschöpfungsketten.<br />
Wird den Genossenschaften durch Kündigung das notwendige<br />
Kapital entzogen, müssen neue Wege der Kapitalsicherung <strong>und</strong><br />
-beschaffung gesucht werden. Dies ruft dann schnell private<br />
renditeorientierte Investoren auf den Plan.<br />
Fazit:<br />
Es müssen künftig Wertschöpfungsketten gebildet werden, die<br />
strategische Planung muss verstärkt werden <strong>und</strong> die <strong>Landwirtschaft</strong><br />
muss sich innerhalb dieser Ketten stärker differenzieren.<br />
Diskussion<br />
In der lang anhaltenden Diskussion vertrat Dr. Hein die Auffassung,<br />
dass die Bilanzverantwortung in einer Hand verbleiben<br />
muss <strong>und</strong> erteilte Überlegungen nach einem über den regionalen<br />
Bereich hinausgehendem Kontor, das die Marktmacht<br />
bündeln soll, eine klare Absage. Als Beispiel nannte er das<br />
Deutsche Milchkontor, das den deutschen Milchexport koordinieren<br />
sollte <strong>und</strong> scheiterte. Besser sei es dann, gleich zu fusionieren.<br />
Zum Ende der Milchquotenregelung meinte er, dass er im Jahre<br />
2015 <strong>und</strong> später mit relativ wenig Veränderungen rechne, diese<br />
würden in der Zeit bis dahin zu erwarten sein.<br />
Die Finanzkrise sei keine Frage der Größe, sondern des Managements<br />
gewesen. Aufgr<strong>und</strong> ihrer eher konservativen Politik<br />
sind die Genossenschaftsbanken von den ganzen Turbulenzen<br />
am wenigsten betroffen.<br />
Zur Feststellung, dass die Finanzkrise auch zu einer Politikkrise<br />
geführt habe, meinte Dr. Hein, dass jeder Markt klare - auch<br />
von der Politik vorgegebene - Spielregeln benötige, dass es<br />
aber auch nicht richtig sein kann, der Politik den Markt zu<br />
überlassen.<br />
Zur Frage, ob wir den Weltmarkt überhaupt brauchen, meinte<br />
Dr. Hein, dass die internationale Arbeitsteilung nicht mehr<br />
zurückdrehbar sei. Für die bayerische Milchwirtschaft bedeutet<br />
dies, in die Veredelung der Milch zu investieren <strong>und</strong> Wertschöpfungsketten<br />
zu bilden. Mit der Spezialisierung auf z. B.<br />
Käse ist Bayern schon frühzeitig diesen Weg gegangen; darin<br />
liegt auch der Gr<strong>und</strong>, warum die bayerischen Milchpreise über<br />
denen Norddeutschland liegen. Allerdings sind diese gerade<br />
dabei aufzuholen.<br />
Franz Schneider, LLD