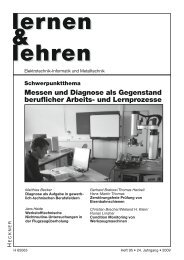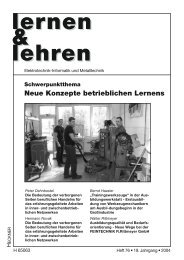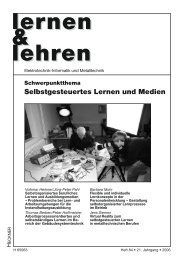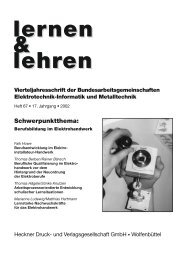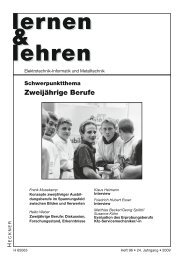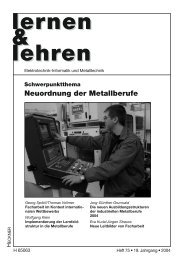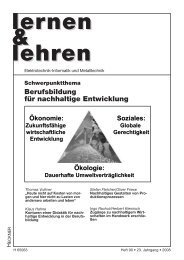Heft 98 - Lernen & Lehren
Heft 98 - Lernen & Lehren
Heft 98 - Lernen & Lehren
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Schwerpunktthema: Handlungsorientiertes <strong>Lernen</strong><br />
lichkeit der vorliegenden empirischen<br />
Ergebnisse ist zudem zu bedenken,<br />
mit welchen Instrumenten unterschiedliche<br />
Wissensbereiche erfasst werden<br />
und was in einzelnen Studien konkret<br />
unter handlungsorientierten Lehr-Lern-<br />
Arrangements verstanden wird. Hier<br />
gehen die Forschungsansätze z. T.<br />
deutlich auseinander.<br />
NICKOLAUS: Wenn wir die Ergebnisse<br />
der empirischen Untersuchungen in<br />
der Elektrotechnik betrachten, wozu<br />
inzwischen ja mehrere Studien vorliegen,<br />
dann kommen wir nicht daran<br />
vorbei, dass dem handlungsorientierten<br />
Unterricht wider Erwarten in der<br />
elektrotechnischen Grundbildung nicht<br />
nur bezogen auf das deklarative Wissen,<br />
sondern auch bezogen auf die<br />
erwarteten Effekte zu prozeduralem<br />
Wissen und fachspezifischer Problemlösefähigkeit<br />
keine günstigeren Effekte<br />
bescheinigt werden können. Zum Teil<br />
ergeben sich sogar Vorteile für den<br />
direktiven Unterricht, insbesondere für<br />
die prozedurale Wissensentwicklung<br />
bei Elektroinstallateuren bzw. Elektronikern<br />
für Energie- und Gebäudetechnik.<br />
Ich denke, die Leserinnen und<br />
Leser sollten sich zu der Frage die Ergebnisübersicht<br />
in diesem <strong>Heft</strong> doch<br />
auch noch einmal selbst ansehen. Zur<br />
Erfassung der fachspezifischen Problemlösefähigkeit<br />
können wir für unser<br />
Instrument zudem zeigen, dass die<br />
Ergebnisse, gemessen an den realen<br />
Anforderungen, valide sind. Ich denke,<br />
wir sollten auch vorsichtig sein mit der<br />
Gewichtung einzelner Befunde. Replikationsstudien<br />
liegen bisher nur<br />
im kaufmännischen und elektrotechnischen<br />
Bereich vor, und überall dort,<br />
wo eine größere Untersuchungseinheit<br />
einbezogen war, zeigen sich größere<br />
Unterschiede innerhalb der methodischen<br />
Ansätze als zwischen den<br />
Ansätzen.<br />
JENEWEIN: Bei aller unterschiedlichen<br />
Grundeinschätzung: In einem zentralen<br />
Punkt ist dem Kollegen NICKO-<br />
LAUS Recht zu geben. Es wäre zu kurz<br />
gedacht, wollte man die Entwicklung<br />
von Wissensstrukturen nur auf die Gegenüberstellung<br />
handlungsorientierter<br />
versus direktiver Unterrichtsformen<br />
zurückführen. Die Unterschiede in den<br />
Lernergebnissen innerhalb der jeweiligen<br />
Unterrichtsformen sind erheblich,<br />
das ist aus den vorliegenden Studien<br />
erkennbar. Auch für moderne Lernkon-<br />
zepte gilt ganz offensichtlich mit dem<br />
Prinzip der Methodenvielfalt ein alter<br />
didaktischer Grundsatz, allerdings aus<br />
heutiger Sicht mit einer weitgreifenden<br />
Einbeziehung handlungsorientierter<br />
Lernarrangements.<br />
KLAUS JENEWEIN, Otto-von-<br />
Guericke-Universität Magdeburg<br />
Professor für Fachdidaktik<br />
technischer Fachrichtungen<br />
Arbeitsgebiete: Lehrerbildung,<br />
Berufliche Didaktik, <strong>Lernen</strong> in virtuellen<br />
und realen Lernumgebungen<br />
Wohl wissend, dass damit jetzt ein<br />
Thema angesprochen wird, das kaum<br />
mit wenigen Sätzen behandelt werden<br />
kann, frage ich Sie nun, Herr NI-<br />
CKOLAUS, welche konkreten Veränderungen<br />
sollten bei den Lernkonzepten<br />
in beruflicher Bildung angestrebt<br />
werden? Was sollte sich auf der Ausbildungs-<br />
und Unterrichtsebene verändern,<br />
damit von „neuen“ Lernkonzepten<br />
gesprochen werden kann? Was<br />
ändert sich nach Ihren Beobachtungen<br />
tatsächlich?<br />
NICKOLAUS: Ich denke, entscheidend<br />
ist nicht primär die Einführung neuer<br />
Konzepte, sondern die Einlösung hoher<br />
Umsetzungsqualitäten innerhalb<br />
der Konzepte. Die Vorstellung, es<br />
gäbe den Königsweg, ist nach allem,<br />
was wir wissen, nicht haltbar. Von hoher<br />
Bedeutung ist die aktive kognitive<br />
Auseinandersetzung mit den Inhalten,<br />
und dies ist in unterschiedlichen Arrangements<br />
erreichbar. Wenn ich mich<br />
beispielsweise unter Berücksichtigung<br />
der angestrebten Lehrziele, der Voraussetzungen<br />
der <strong>Lernen</strong>den, spezifischen<br />
Ansprüche der Inhalte und<br />
den organisatorischen Rahmenbedingungen<br />
für einen eher handlungsorientierten<br />
Unterricht entscheide, dann<br />
wäre es beispielsweise wünschenswert,<br />
dass die notwendige Unterstützung<br />
im Erarbeitungsprozess (individuell)<br />
gewährleistet wird, was entsprechende<br />
diagnostische Fähigkeiten und<br />
gegebenenfalls auch ein Set von Aufgaben<br />
unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades<br />
voraussetzt. Ein direktiver<br />
Unterricht ohne Anwendungsphasen<br />
und die Reflexion der Lösungsansätze<br />
ist eine häufig bemühte Negativfolie<br />
für die Bewertung traditioneller<br />
Unterrichtsformen. Wo dies zutrifft,<br />
sind Optimierungsmöglichkeiten offensichtlich.<br />
Manchmal wäre auch schon<br />
viel gewonnen, wenn eine positive<br />
Beziehungsqualität gesichert werden<br />
könnte, auf die insbesondere Auszubildende<br />
mit größerem Förderungsbedarf<br />
angewiesen sind. Neuere Studien<br />
zeigen allerdings, dass Auszubildende<br />
mit ungünstigeren kognitiven Voraussetzungen<br />
bei entsprechender Förderung,<br />
d. h. einem systematischen von<br />
außen angeleiteten Strategietraining,<br />
eine weit bessere Kompetenzentwicklung<br />
durchlaufen können, als dies im<br />
„normalen“ Lernfeldunterricht üblich<br />
ist. Die entscheidende Frage ist, inwieweit<br />
es gelingt, die verschiedenen<br />
Qualitätsmerkmale unter den je gegebenen<br />
Bedingungen einzulösen.<br />
Herr JENEWEIN, neue Lernkonzepte,<br />
ob nun konkret- oder abstrakt-handlungsorientiert<br />
angelegt, werden oft in<br />
Verbindung mit elektronischen Medien<br />
gebracht. Wo sehen Sie die Impulse<br />
und den Anteil dieser Medien an der<br />
Entwicklung einer neuen Lernkultur im<br />
Berufsbildungsbereich?<br />
JENEWEIN: Neue Lernkonzepte beziehen<br />
sich durchweg auf das <strong>Lernen</strong> an<br />
betrieblichen Arbeitsprozessen und<br />
den dort vorhandenen technischen<br />
Systemen. Diese jedoch stehen für<br />
das <strong>Lernen</strong> oft gar nicht zur Verfügung;<br />
sei es, weil die heutigen Arbeitssysteme<br />
durch hohe Komplexität gekennzeichnet,<br />
häufig an dynamische Vorgänge<br />
gebunden und von einem hohen<br />
Vernetzungsgrad gekennzeichnet<br />
sind oder weil „reale“ Arbeitssysteme<br />
häufig mit „unsichtbaren“ Vorgängen<br />
verbunden sind. Oft entziehen sich<br />
wichtige Funktionen, Strukturen und<br />
Phänomene der menschlichen Wahrnehmung<br />
und dem menschlichen<br />
74 lernen & lehren (l&l) (2010) <strong>98</strong>