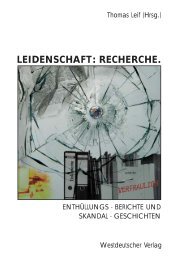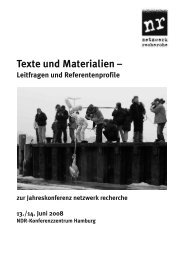nr-Werkstatt: Presserecht in der Praxis - Netzwerk Recherche
nr-Werkstatt: Presserecht in der Praxis - Netzwerk Recherche
nr-Werkstatt: Presserecht in der Praxis - Netzwerk Recherche
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
16<br />
Verdachtsberichterstattung und Persönlichkeitsrechte im Strafverfahren<br />
– Regeln und ethische Grenzen <strong>der</strong> Berichterstattung<br />
von Prof. Dr. Ra<strong>in</strong>er Hamm<br />
Journalisten und Strafjuristen haben etwas geme<strong>in</strong>sam, was sie gleichzeitig<br />
trennt: Unser Handwerkszeug ist die Sprache. Aber wir sprechen gar zu oft<br />
verschiedene Sprachen.<br />
Zu den „ständigen Missverständnissen zwischen Juristen und Journalisten“<br />
gehört <strong>der</strong> unterschiedliche Umgang mit dem Schlüsselbegriffen des<br />
Strafverfahrens: „Verdacht“ – Der Verdacht hat e<strong>in</strong>en großen Bru<strong>der</strong>, <strong>der</strong> ihm<br />
ziemlich ähnlich sieht und <strong>der</strong> auf den Namen „Beweis“ hört. Wegen ihrer<br />
großen Ähnlichkeit werden sie häufig von Laien und Journalisten, aber auch<br />
viel zu oft von Juristen mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verwechselt. Ja, man kann sogar sagen:<br />
die Verwechslungsgefahr zwischen Verdacht und Beweis ist <strong>der</strong> eigentliche<br />
Grund, weshalb man den Strafprozess nicht den Richtern und Staatsanwälten<br />
alle<strong>in</strong>e überlassen darf, obwohl diese beiden Institutionen doch von<br />
Gesetzes wegen und auch von ihrem beruflichen Selbstverständnis her zur<br />
Objektivität und Neutralität verpflichtet s<strong>in</strong>d. Wegen <strong>der</strong> Verwechslungsgefahr<br />
zwischen Verdacht und Beweis muss im Drama des Strafprozesses<br />
auch die Rolle des e<strong>in</strong>seitig für den Beschuldigten agierenden Verteidigers<br />
besetzt se<strong>in</strong>. Und um zu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n, dass diese Akteure sich mit <strong>der</strong> Zeit so<br />
sehr aufe<strong>in</strong>an<strong>der</strong> professionell „e<strong>in</strong>spielen“, dass sie gar nicht mehr merken,<br />
wenn die Ergebnisse ihrer Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzungen vom Publikum nicht mehr<br />
verstanden werden, bedarf es <strong>der</strong> Kontrolle durch die Öffentlichkeit. Dabei<br />
ist es s<strong>in</strong>nvoll, zwischen <strong>der</strong> unmittelbaren Öffentlichkeit und <strong>der</strong> durch die<br />
Medien vermittelten Öffentlichkeit – Publizität genannt – zu unterscheiden.<br />
Diese öffentliche Kontrolle kann trotz <strong>der</strong> gelegentlichen sprachlichen<br />
Verständigungsprobleme zwischen Journalisten und Juristen funktionieren,<br />
weil wir gerade an ihnen erkennen, wo es noch notwendig ist, unsere<br />
Argumente, Anliegen, Rechtsauffassungen und Urteile noch verständlicher zu<br />
machen. Was wir nämlich gerne die „Juristensprache“ nennen, ist nichts weiter<br />
als e<strong>in</strong>e Fachsprache, die sich (im Gegensatz zu an<strong>der</strong>en Fachsprachen)<br />
des Vokabulars <strong>der</strong> Alltagssprache bedient und die e<strong>in</strong>zelnen Begriffe präzisiert.<br />
Man kann auch dies gerade an Unterschieden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Verwendung <strong>der</strong><br />
Vokabeln „Verdacht“ und „Beweis“ verdeutlichen.<br />
Die Sprache <strong>der</strong> Journalisten wendet sich an die Konsumenten ihrer Medien,<br />
also an die Leute aus allen Gesellschaftsschichten. Von ihnen wollen und<br />
müssen sie verstanden werden. Deshalb darf es auch ke<strong>in</strong>e spezielle


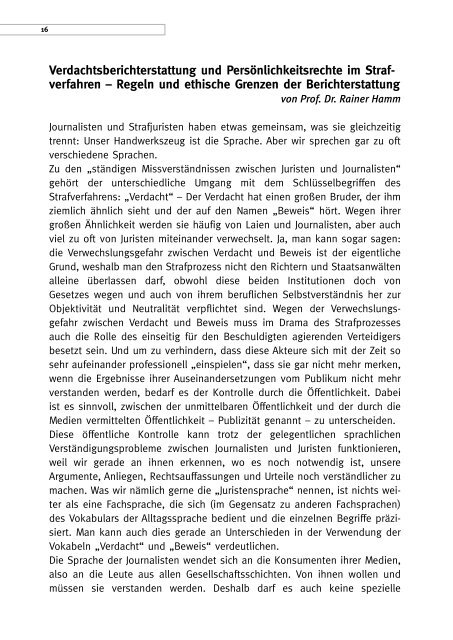
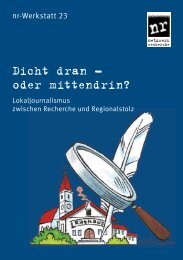
![Kurzbiografien der Referenten und ihre Themen [PDF] - Netzwerk ...](https://img.yumpu.com/21354886/1/184x260/kurzbiografien-der-referenten-und-ihre-themen-pdf-netzwerk-.jpg?quality=85)

![Rede Frank A. Meyer [PDF] - Netzwerk Recherche](https://img.yumpu.com/21238543/1/184x260/rede-frank-a-meyer-pdf-netzwerk-recherche.jpg?quality=85)
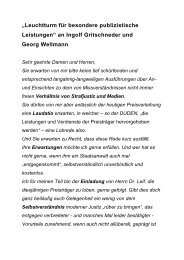


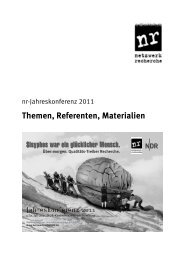


![Die stille Macht [Text] (381 S., 2.142 - Netzwerk Recherche](https://img.yumpu.com/7467581/1/184x260/die-stille-macht-text-381-s-2142-netzwerk-recherche.jpg?quality=85)