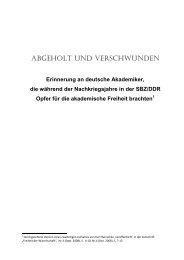fdw Nr. 2 Juni 2009 - Bund Freiheit der Wissenschaft eV
fdw Nr. 2 Juni 2009 - Bund Freiheit der Wissenschaft eV
fdw Nr. 2 Juni 2009 - Bund Freiheit der Wissenschaft eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Rechtsanwalt durch die Landesjustizverwaltung,<br />
Priesterweihe o<strong>der</strong> Ordination<br />
bei Pfarrern). Die oben erwähnten<br />
Doktoren Friedrich-Adolph Willers und<br />
Karl Jordan haben ihr Staatsexamen für<br />
das höhere Lehramt ein Jahr nach ihrer<br />
Promotion abgelegt. Sie waren<br />
anschließend längere Zeit als Gymnasiallehrer<br />
tätig. Willers hat sogar 20 Jahre<br />
lang als Gymnasiallehrer segensreich<br />
ge wirkt, hat in diesen Jahren wesentliche<br />
Forschungsbeiträge zur angewandten<br />
Mathe matik geliefert und sich als<br />
Externer 1923 an <strong>der</strong> TH Berlin-Charlottenburg<br />
habilitiert, um schließlich<br />
1928 als ordentlicher Professor nach<br />
Sachsen berufen zu werden.<br />
Mit dem Doktorgrad war auch keine<br />
universitäre Lehrbefugnis mehr verbunden<br />
wie zu Luthers Zeiten. Der Nachweis,<br />
daß ein promovierter <strong>Wissenschaft</strong>ler<br />
sein Fach in voller Breite<br />
in Forschung und Lehre an einer Fakultät<br />
vertreten kann, mußte an den deutschen<br />
Universitäten des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
durch eine Habilitation erbracht<br />
werden, ge mäß den Bestimmungen <strong>der</strong><br />
Habilita tionsordnung <strong>der</strong> betreffenden<br />
Fakultät. Die Bezeichnung Habilitation<br />
leitet sich aus dem lateinischen Adjektiv<br />
„habilis, e“ (= geeignet, tauglich, befähigt)<br />
ab. Gemäß Habilitationsordnung<br />
<strong>der</strong> Fakultät hatte <strong>der</strong> Bewerber eine<br />
Habilita tionsschrift einzureichen, diese<br />
nach <strong>der</strong> positiven Bewertung durch<br />
bestellte Gutachter öffentlich zu verteidigen<br />
und eine Lehrprobe in Form einer<br />
Probe vorlesung zu bestehen. Noten<br />
wurden im Gegensatz zu Promotionen<br />
nicht vergeben. Mit <strong>der</strong> ordnungsgemäß<br />
ab geschlossenen Habilitation erhielt <strong>der</strong><br />
angehende Universitätslehrer die „venia<br />
legendi“ (= Erlaubnis zu lesen). Sie war<br />
mit dem Titel Privatdozent (privatim<br />
docens) verbunden, also privat Lehren<strong>der</strong>,<br />
<strong>der</strong> an <strong>der</strong> Fakultät Kollegien lesen<br />
darf, ohne als öffentlicher Lehrer angestellt<br />
und besoldet zu sein. Die für ein<br />
bestimmtes Fach (Anatomie, Botanik,<br />
klassische Philologie, Archäologie etc.)<br />
in Forschung und Lehre zuständigen<br />
ordentlichen Professoren (professores<br />
publici ordinarii) berief <strong>der</strong> Landesherr<br />
auf einen Lehrstuhl. Hinzu kamen die<br />
Professoren ohne Lehrstuhl (professores<br />
publici extraordinarii), das waren<br />
Privatdozenten, <strong>der</strong>en Status durch den<br />
verliehenen Titel und eine staatliche<br />
Besoldung aufgewertet worden war,<br />
und die Honorarprofessoren (professores<br />
honorarii). Beispielsweise waren die<br />
Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Berliner Akademie <strong>der</strong><br />
8<br />
<strong>Wissenschaft</strong>en „geborene“ Honorarprofessoren<br />
an <strong>der</strong> Berliner Universität.<br />
In Preußen hatten die ordentlichen Professoren<br />
den Rang <strong>der</strong> Räte vierter<br />
Klasse (ebenso wie Regierungs- und,<br />
Oberlandesgerichtsräte sowie Gymnasialdirektoren),<br />
alle übrigen Professoren<br />
den Rang <strong>der</strong> Räte fünfter Klasse (ebenso<br />
wie Amtsrichter, Oberförster, Gymnasiallehrer<br />
u. a.) Mit <strong>der</strong> Differen -<br />
zierung <strong>der</strong> <strong>Wissenschaft</strong>en und <strong>der</strong><br />
Etablierung neuer <strong>Wissenschaft</strong>sdisziplinen<br />
(Geschichtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften,<br />
Soziologie, ...)<br />
wurde die Abgrenzung <strong>der</strong> philosophischen<br />
Fakultät zu neh mend in Frage<br />
gestellt. In Tübingen differenzierte man<br />
gegen Ende des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts zwischen<br />
einer philosophisch-historischen,<br />
einer mathematisch-naturwissenschaftlichen<br />
und einer staatswissenschaftlichen<br />
Fakultät (Nationalökonomie, Statistik,<br />
Finanzwissenschaft). Nach dem ersten<br />
Weltkrieg verzweigten sich die philosophischen<br />
Fakultäten im mer häufiger in<br />
fachlich engere Fakultätsgebilde, und<br />
aus dem Dr. phil. erwuchs eine Vielfalt<br />
speziellerer Doktorgrade: Dr. rer. nat.,<br />
Dr. rer. oec, Dr. rer. pol., Dr. paed.<br />
An wissenschaftlichen Hochschulen<br />
blieb die Habilitation in Deutschland<br />
bis zum Ende des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts die<br />
Regelvoraussetzung für die Berufung<br />
zum Professor, wobei die Berufungskommissionen<br />
für eine ausgeschriebene<br />
Professorenstelle auch „habilitationsäquivalente<br />
wissenschaftliche Leistungen“<br />
de iure als Qualifikation zuerkennen<br />
durften.<br />
Das Diplom<br />
Bisher wurde das „Diplom“ als akademischer<br />
Grad nicht erwähnt. Das Wort<br />
kommt aus dem Griechischen („diploma“<br />
= „zweifach Gefaltetes“). In <strong>der</strong><br />
römischen Kaiserzeit bedeutete „diploma,<br />
diplomatis n.“ eine vom höchsten<br />
Magistrat ausgefertigte Urkunde mit<br />
Siegel und Unterschrift. In den Jahrhun<strong>der</strong>ten<br />
des Mittelalters wurde das Wort<br />
nicht mehr gebraucht. Erst am Ende<br />
des 17. Jahrhun<strong>der</strong>ts führte es <strong>der</strong> französische<br />
Gelehrte Jean Mabillon<br />
(1632–1707), <strong>der</strong> Begrün<strong>der</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen<br />
Urkundenlehre, durch<br />
sein Werk „De re diplomatica“ in den<br />
wissenschaftlichen Sprachgebrauch ein.<br />
Im engeren Sinne bezeichnete man seither<br />
in Deutschland Urkunden über die<br />
Erteilung des adeligen Standes, über die<br />
Aufnahme in wissenschaftliche Gesellschaften,<br />
über eine abgelegte Prüfung<br />
bei <strong>der</strong> Handwerkskammer und an<strong>der</strong>es<br />
als Diplome. Im Hochschulbereich spielte<br />
das Wort „Diplom“ seit dem letzten<br />
Drittel des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts eine immer<br />
gewichtigere Rolle, zunächst an den<br />
Lehranstalten für qualifizierte technische<br />
Berufe. Im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Entfaltung<br />
<strong>der</strong> Ingenieurkunst und dem Aufkommen<br />
neuer industrieller Technologien<br />
entwickelten sich die technischen<br />
<strong>Wissenschaft</strong>en als damals neue <strong>Wissenschaft</strong>sdisziplin.<br />
In Deutschland gelang<br />
es lei<strong>der</strong> nicht, sie in die Universitäten zu<br />
integrieren. Die zweite Hälfte des 19.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ts war von vielen technischen<br />
Neuerungen geprägt. Die neu entstehenden<br />
Industriebetriebe benötigten viele<br />
gut ausgebildete Techniker und Ingenieure.<br />
Der „Verein Deutscher Ingenieure“<br />
(VDI) wurde 1856 in Alexisbad gegründet<br />
und bis 1890 von Franz Grashof<br />
(1826– 1893) geführt, <strong>der</strong> sich mit großer<br />
Sachkenntnis und Energie den Problemen<br />
des technischen Schulwesens widmete.<br />
Die verschiedenen Ingenieurfächer,<br />
zuzüglich technischer Chemie und<br />
Physik, wurden an technischen Bildungsanstalten<br />
gelehrt und gepflegt. Unter<br />
maßgeblicher För<strong>der</strong>ung durch Handwerkskammern<br />
und mittelständische Un -<br />
ternehmer entstanden zahlreiche technische<br />
Lehranstalten mit sehr unterschiedlichem<br />
Profil. Aus einigen von ihnen<br />
ging gegen Ende des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts in<br />
Deutschland ein neuer Typ von wissenschaftlichen<br />
Hochschulen, die Technischen<br />
Hochschulen, hervor.<br />
Der VDI befürwortete eine zweigleisige<br />
Ingenieurausbildung: Einerseits für das<br />
Gros <strong>der</strong> Ingenieure, einschließlich <strong>der</strong><br />
gehobenen und mittleren Führungspositionen,<br />
eine nichtakademische Ingenieurausbildung<br />
auf <strong>der</strong> Basis berufspraktischer<br />
Kenntnisse an höheren Fachschulen,<br />
an<strong>der</strong>erseits eine akademische<br />
Ingenieurausbildung für einen kleinen<br />
Teil als Vorbereitung für die höhere<br />
Staatslaufbahn, für Forschungsinstitute<br />
und für die obersten Leitungsfunktionen<br />
<strong>der</strong> Wirtschaft.<br />
Als ein Beispiel für die Entwicklung zu<br />
einer akademischen Ausbildungsstätte<br />
wollen wir hier die Sächsische Technische<br />
Hochschule in Dresden betrachten.<br />
Aus den bescheidenen Anfängen <strong>der</strong><br />
1828 gegründeten Technischen Bildungsanstalt<br />
gingen 1851 die Königlich<br />
Sächsische Polytechnische Schule und<br />
1871 das Königlich. Sächsische Polytechnikum<br />
hervor. Dieses wurde 1890<br />
zur Königlich Sächsischen Technischen<br />
Hochschule erhoben. 6<br />
<strong>fdw</strong> 2/<strong>2009</strong>