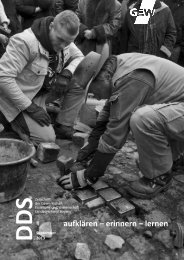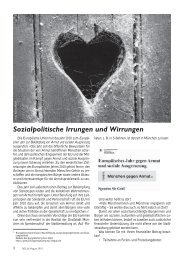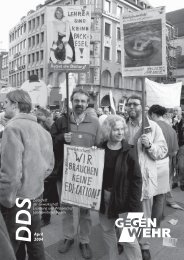Besser Schulsozialarbeit - GEW Landesverband Bayern
Besser Schulsozialarbeit - GEW Landesverband Bayern
Besser Schulsozialarbeit - GEW Landesverband Bayern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
le Bereiche übertragen werden können. Gute Wirkung wird<br />
in der Sozialen Arbeit in der Regel nicht durch standardisiert<br />
gleichbleibende Prozesse und nicht einmal durch die<br />
statistisch gesehen erfolgreichste Vorgehensweise erreicht,<br />
sondern durch eine auf die Situation angepasste Vorgehensweise,<br />
die mit AdressatInnen gemeinsam gewählt und abgestimmt<br />
wird. Das erfordert reflexive Professionalität (vgl.<br />
Dewe 2011) und Strukturen, die Partizipation und Aushandlung<br />
absichern.<br />
Ziele und Wirkungsindikatoren<br />
gemeinsam<br />
entwickeln<br />
Vor dem Hintergrund dieser<br />
Überlegungen und der gerade<br />
erst eingerichteten <strong>Schulsozialarbeit</strong>sstandorte<br />
an Grundschulen<br />
war uns als Forschungsteam<br />
klar, dass mit dem<br />
zeitlich und finanziell sehr kleinen<br />
Budget keine »Wirkungsmessung«<br />
im engeren Sinne<br />
stattfinden kann. Stattdessen<br />
haben wir vereinbart, das Forschungsprojekt<br />
zur <strong>Schulsozialarbeit</strong><br />
an Grundschulen als<br />
partizipativen Prozess anzule-<br />
gen, um zunächst einmal Indikatoren für erwünschte Wirkungen<br />
von <strong>Schulsozialarbeit</strong> beteiligtenorientiert zu ermitteln.<br />
Möglich werden sollte dadurch, realistische, von den<br />
AkteurInnen erwünschte und realisierbare Ziele und Wirkungsindikatoren<br />
zu erheben. Durch diese Form der Erhebung<br />
sollte ein Austausch unter den AkteurInnen der <strong>Schulsozialarbeit</strong><br />
an Grundschulen angeregt werden, um so zu einer<br />
lebendigen Qualitätsentwicklung beizutragen, ebenso wie<br />
mittelfristig zu einer feldangemessenen Wirkungssteuerung<br />
des Bereiches <strong>Schulsozialarbeit</strong> an Grundschulen und deren<br />
fachlich adaptierte Wirkungsberichterstellung.<br />
Konkret haben wir neben der Dokumentenanalyse und<br />
zwei Experteninterviews für die Datenerhebung vier Gruppendiskussionen<br />
durchgeführt, drei an <strong>Schulsozialarbeit</strong>sstandorten<br />
und eine mit Fachkräften der Bezirkssozialarbeit<br />
(BSA). Das hat ermöglicht, trotz begrenzter Ressourcen<br />
möglichst viele Akteursgruppen und deren Perspektiven einzubeziehen<br />
und neben dem Ermitteln zentraler Informationen<br />
auch den Austausch und die Reflexion anzuregen (vgl.<br />
Lamnek 1998, 29 f.). So wurde uns auch bei allen Gruppendiskussionen<br />
am Schluss rückgemeldet, dass der Austausch<br />
gewinnbringend war und sich gelohnt hat.<br />
Eindrücke und Ergebnisse<br />
Die Ergebnisse der Begleitforschung finden sich auf<br />
zwei Ebenen. Zum einen auf der konkreten Handlungsebene<br />
der <strong>Schulsozialarbeit</strong>, zum anderen bezogen auf die<br />
7 DDS Januar/Februar 2012<br />
Vorankündigung<br />
Das Forschungsprojekt »Statistik sozialpädagogischer Fachkräfte<br />
an Schulen« wird von April 2011 bis März 2012 in einem<br />
Forschungsverbund aus WissenschaftlerInnen der Hochschulen<br />
München, Frankfurt am Main und Dortmund durchgeführt und<br />
von der Max-Traeger-Stiftung sowie der Gewerkschaft Erziehung<br />
und Wissenschaft unterstützt.<br />
Das Anliegen ist, <strong>Schulsozialarbeit</strong> sowie alle weiteren bezahlten<br />
sozialpädagogischen Tätigkeiten an Schulen (z. B. für die<br />
Ganztagsschulgestaltung) empirisch genau und auf Dauer zuverlässig<br />
zu erheben. Dafür werden in einer Fragebogenerhebung<br />
die Daten von drei Großstädten und vier Landkreisen ermittelt.<br />
In <strong>Bayern</strong> sind das die Stadt und der Landkreis München. Neben<br />
den konkreten Ergebnissen zu den Modellstandorten ist das<br />
fachliche Ziel des Projektes, mittel- bis langfristig eine bundesweite<br />
Statistik sozialpädagogischer Tätigkeiten an Schulen vorzubereiten<br />
und zu ermöglichen.<br />
Die Veröffentlichung der Ergebnisse des Forschungsstandortes<br />
München sowie der Zusammenschau der Standorte ist für<br />
Herbst 2012 geplant.<br />
Frage, wie eine feldangemessene wirkungsorientierte Steuerung<br />
für <strong>Schulsozialarbeit</strong> aussehen kann.<br />
Zur Systematisierung möglicher Wirkungen und Indikatoren,<br />
die in den Diskussionen benannt wurden, haben<br />
wir eine Matrix von Speck und Olk (2009, 2010) herangezogen.<br />
Darin wird auf der einen Achse nach der Intensität<br />
von Wirkungen (sog. »Wirkungsniveaus«) gefragt, auf der<br />
anderen Achse nach der Reichweite: also ob nur Einzelne<br />
(z. B. Kinder, Eltern) oder Gruppen<br />
(z. B. Klasse, LehrerInnen-<br />
kollegium) von der <strong>Schulsozialarbeit</strong><br />
profitieren, die ganze<br />
Schule oder sogar organisationsübergreifende<br />
Wirkungen<br />
zu beobachten sind. Während<br />
erstaunlicherweise trotz der<br />
z. T. sehr kurzen Zeit von gut<br />
eineinhalb Jahren eine Wirkungsintensität<br />
bis hin zum<br />
höchsten Niveau der Aneignung<br />
benannt wird (veränderte<br />
Klassen- oder sogar Schulkultur;<br />
anderer Umgang der<br />
Kinder mit Konflikten), wurde<br />
die organisationsübergreifende<br />
Wirkungsebene bisher<br />
kaum erreicht.<br />
Insgesamt zeigen die Aussagen,<br />
dass bereits sehr viel geschehen ist. Die Fachkräfte<br />
sind intensiv eingebunden in das alltägliche Schulgeschehen,<br />
werden für die anfallenden Probleme bei Einzelfällen<br />
herangezogen und besonders oft bei Konflikten von und<br />
zwischen Kindern sowie in Klassen. Die andere berufliche<br />
Qualifikation und der vom Kontext Schule sowie Leistungsbeurteilung<br />
unabhängige Zugang der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erIn<br />
zu den Kindern lassen sie eine andere Perspektive<br />
und Herangehensweise einnehmen, wodurch wiederum<br />
das Blickfeld der Lehrkräfte positiv erweitert wird. Individuelle<br />
und familiäre Hintergründe werden für sie verständlicher,<br />
weil die <strong>Schulsozialarbeit</strong> sich um eine subjektorientierte<br />
Perspektive und den Blick »hinter die Kulissen« bemüht.<br />
Sie wird ein Bindeglied zur Lebenswelt der Kinder<br />
und Jugendlichen.<br />
Besonderheiten von <strong>Schulsozialarbeit</strong> an<br />
Grundschulen<br />
Zwei Aspekte von <strong>Schulsozialarbeit</strong> für die Schulform<br />
Grundschule müssen besonders hervorgehoben werden:<br />
Zum einen waren sich alle Befragten sicher, dass <strong>Schulsozialarbeit</strong><br />
aufgrund des jüngeren Alters verbunden mit der<br />
noch frühen Schulerfahrung einen besseren und präventiveren<br />
Zugang zu den Kindern und ihren Familien ermöglicht.<br />
Mit den Kindern könne ein spielerischer Umgang gesucht<br />
werden, der soziales und kognitives Lernen ermöglicht<br />
und den Vertrauensaufbau erleichtert. Betont wurde,