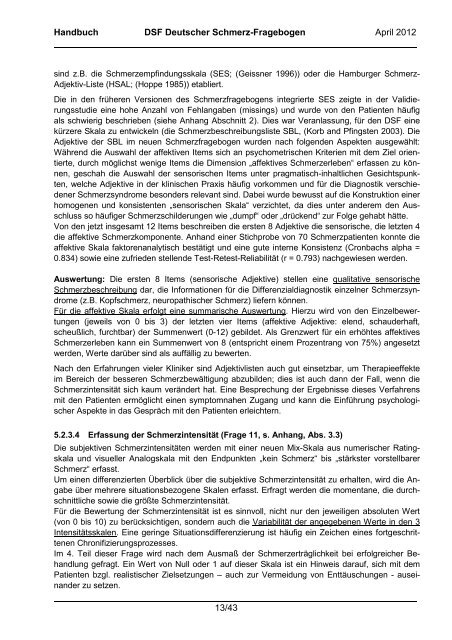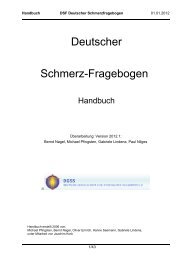Anhang zum Manual des Deutschen Schmerzfragebogens
Anhang zum Manual des Deutschen Schmerzfragebogens
Anhang zum Manual des Deutschen Schmerzfragebogens
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Handbuch DSF Deutscher Schmerz-Fragebogen April 2012<br />
sind z.B. die Schmerzempfindungsskala (SES; (Geissner 1996)) oder die Hamburger Schmerz-<br />
Adjektiv-Liste (HSAL; (Hoppe 1985)) etabliert.<br />
Die in den früheren Versionen <strong>des</strong> <strong>Schmerzfragebogens</strong> integrierte SES zeigte in der Validierungsstudie<br />
eine hohe Anzahl von Fehlangaben (missings) und wurde von den Patienten häufig<br />
als schwierig beschrieben (siehe <strong>Anhang</strong> Abschnitt 2). Dies war Veranlassung, für den DSF eine<br />
kürzere Skala zu entwickeln (die Schmerzbeschreibungsliste SBL, (Korb and Pfingsten 2003). Die<br />
Adjektive der SBL im neuen Schmerzfragebogen wurden nach folgenden Aspekten ausgewählt:<br />
Während die Auswahl der affektiven Items sich an psychometrischen Kriterien mit dem Ziel orientierte,<br />
durch möglichst wenige Items die Dimension „affektives Schmerzerleben“ erfassen zu können,<br />
geschah die Auswahl der sensorischen Items unter pragmatisch-inhaltlichen Gesichtspunkten,<br />
welche Adjektive in der klinischen Praxis häufig vorkommen und für die Diagnostik verschiedener<br />
Schmerzsyndrome besonders relevant sind. Dabei wurde bewusst auf die Konstruktion einer<br />
homogenen und konsistenten „sensorischen Skala“ verzichtet, da dies unter anderem den Ausschluss<br />
so häufiger Schmerzschilderungen wie „dumpf“ oder „drückend“ zur Folge gehabt hätte.<br />
Von den jetzt insgesamt 12 Items beschreiben die ersten 8 Adjektive die sensorische, die letzten 4<br />
die affektive Schmerzkomponente. Anhand einer Stichprobe von 70 Schmerzpatienten konnte die<br />
affektive Skala faktorenanalytisch bestätigt und eine gute interne Konsistenz (Cronbachs alpha =<br />
0.834) sowie eine zufrieden stellende Test-Retest-Reliabilität (r = 0.793) nachgewiesen werden.<br />
Auswertung: Die ersten 8 Items (sensorische Adjektive) stellen eine qualitative sensorische<br />
Schmerzbeschreibung dar, die Informationen für die Differenzialdiagnostik einzelner Schmerzsyndrome<br />
(z.B. Kopfschmerz, neuropathischer Schmerz) liefern können.<br />
Für die affektive Skala erfolgt eine summarische Auswertung. Hierzu wird von den Einzelbewertungen<br />
(jeweils von 0 bis 3) der letzten vier Items (affektive Adjektive: elend, schauderhaft,<br />
scheußlich, furchtbar) der Summenwert (0-12) gebildet. Als Grenzwert für ein erhöhtes affektives<br />
Schmerzerleben kann ein Summenwert von 8 (entspricht einem Prozentrang von 75%) angesetzt<br />
werden, Werte darüber sind als auffällig zu bewerten.<br />
Nach den Erfahrungen vieler Kliniker sind Adjektivlisten auch gut einsetzbar, um Therapieeffekte<br />
im Bereich der besseren Schmerzbewältigung abzubilden; dies ist auch dann der Fall, wenn die<br />
Schmerzintensität sich kaum verändert hat. Eine Besprechung der Ergebnisse dieses Verfahrens<br />
mit den Patienten ermöglicht einen symptomnahen Zugang und kann die Einführung psychologischer<br />
Aspekte in das Gespräch mit den Patienten erleichtern.<br />
5.2.3.4 Erfassung der Schmerzintensität (Frage 11, s. <strong>Anhang</strong>, Abs. 3.3)<br />
Die subjektiven Schmerzintensitäten werden mit einer neuen Mix-Skala aus numerischer Ratingskala<br />
und visueller Analogskala mit den Endpunkten „kein Schmerz“ bis „stärkster vorstellbarer<br />
Schmerz“ erfasst.<br />
Um einen differenzierten Überblick über die subjektive Schmerzintensität zu erhalten, wird die Angabe<br />
über mehrere situationsbezogene Skalen erfasst. Erfragt werden die momentane, die durchschnittliche<br />
sowie die größte Schmerzintensität.<br />
Für die Bewertung der Schmerzintensität ist es sinnvoll, nicht nur den jeweiligen absoluten Wert<br />
(von 0 bis 10) zu berücksichtigen, sondern auch die Variabilität der angegebenen Werte in den 3<br />
Intensitätsskalen. Eine geringe Situationsdifferenzierung ist häufig ein Zeichen eines fortgeschrittenen<br />
Chronifizierungsprozesses.<br />
Im 4. Teil dieser Frage wird nach dem Ausmaß der Schmerzerträglichkeit bei erfolgreicher Behandlung<br />
gefragt. Ein Wert von Null oder 1 auf dieser Skala ist ein Hinweis darauf, sich mit dem<br />
Patienten bzgl. realistischer Zielsetzungen – auch zur Vermeidung von Enttäuschungen - auseinander<br />
zu setzen.<br />
13/43