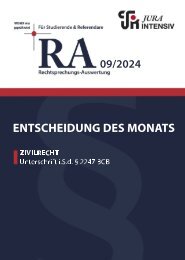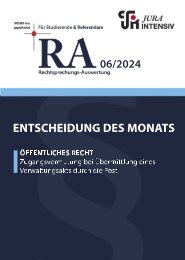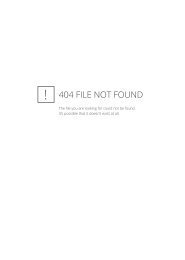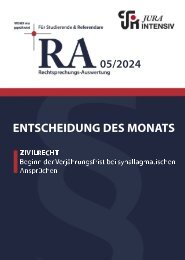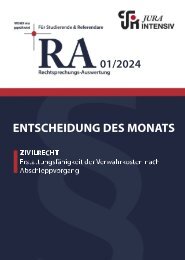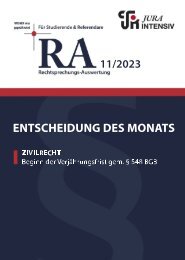Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Chefredaktion:<br />
Redakteure:<br />
Chef vom Dienst:<br />
Abonnement:<br />
Bezugspreis:<br />
Nachbestellung:<br />
Werbung:<br />
Rathausplatz 22, 46562 Voerde, Tel.: 02855/96171-80; Fax: 02855/96171-82<br />
Internet: http://www.verlag.jura-intensiv.de - E-Mail: info@verlag.jura-intensiv.de<br />
Rechtsanwalt Oliver Soltner (V.i.S.d.P.)<br />
Theresa Bauerdick &<br />
Richterin am Amtsgericht Dr. Katharina Henzler (Zivilrecht)<br />
Assessor Dr. Dirk Schweinberger (Nebengebiete)<br />
Rechtsanwalt Dr. Dirk Kues (Öffentliches Recht)<br />
Rechtsanwalt Uwe Schumacher (Strafrecht)<br />
Ines Hickl<br />
Abonnement (monatlich kündbar) zum Vorzugspreis von 5,50 Euro/Heft,<br />
für ehemalige Kursteilnehmer von JU<strong>RA</strong> INTENSIV 4,99 Euro/Heft (regulärer<br />
Einzelpreis: 6,50 Euro/Heft) inkl. USt. und Versandkosten. Lieferung nur<br />
gegen Einzugsermächtigung. Lieferung erstmals im Monat nach Eingang<br />
<strong>des</strong> Abonnements, sofern nichts anderes vereinbart.<br />
Regulär 6,50 Euro/Heft. 12 Hefte pro Jahr. Ermäßigungen für Abonnenten.<br />
Einzelne Hefte können zum Preis von 6,50 Euro/Heft nachbestellt werden,<br />
solange der Vorrat reicht.<br />
Die <strong>RA</strong> steht externer Werbung offen. Mediadaten sind unter<br />
info@verlag.jura-intensiv.de erhältlich.<br />
© Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG
564 Zivilrecht <strong>RA</strong> <strong>11</strong>/<strong>2017</strong><br />
Problem: Keine Haftung <strong>des</strong> Tanzpartners bei freiwillig<br />
ausgeführtem Paartanz<br />
Einordnung: Deliktsrecht<br />
OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 02.08.<strong>2017</strong><br />
13 U 222/16<br />
LEITSATZ<br />
Ein Tanzpartner haftet nicht für<br />
Unfallfolgen eines gemeinsamen<br />
freiwilligen Paartanzes, denn die<br />
Gefahr eines Sturzes besteht grundsätzlich<br />
und ist allgemein bekannt.<br />
Aufgrund der freiwilligen<br />
Selbstgefährdung sind die Folgen<br />
dem Tanzpartner haftungsrechtlich<br />
nicht zuzurechnen.<br />
EINLEITUNG<br />
Im Mittelpunkt der vorliegenden <strong>Entscheidung</strong> steht die Frage, ob beim<br />
Tanzen zugezogene Verletzungen selbstverschuldet sind und dem Tanzpartner<br />
daher nicht angelastet werden können.<br />
SACHVERHALT<br />
Die Klägerin (K) und der Beklagte (B) sind Bekannte und gemeinsam auf einer<br />
Geburtstagsfeier eingeladen. K tanzt auf der Feier allein auf der Tanzfläche,<br />
als B sie an ihren Händen nimmt und zu einem gemeinsamen Paartanz auffordert.<br />
K teilt B mit, dass sie nicht tanzen könne und das „Ganze zu schnell für<br />
sie“ sei. B erklärt ihr, dass er zwar nur wenige Tanzkurse besucht habe, aber<br />
dennoch als der „Tanzkönig“ seines Ortes gelte. Nach einer schwungvollen<br />
Drehung lässt er K los. Sie verliert das Gleichgewicht und fällt zu Boden. K<br />
erleidet einen komplizierten Beinbruch und verlangt von B Schadenersatz für<br />
die entstandenen Heilbehandlungskosten.<br />
Zu Recht?<br />
LÖSUNG<br />
A. K gegen B gem. §§ 823 I, 249 II 1 BGB<br />
K könnte gegen B einen Anspruch auf Zahlung der Heilbehandlungskosten<br />
gem. §§ 823 I, 249 II 1 BGB haben.<br />
I. Rechtsgutsverletzung<br />
Als verletzte Rechtsgüter i.S.d. § 823 I BGB kommen hier sowohl die Körper- als<br />
auch die Gesundheitsverletzung in Betracht. Körperverletzung ist jeder unbefugte<br />
Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, die Gesundheitsschädigung<br />
liegt in jedem Hervorrufen eines von den normalen körperlichen Funktionen<br />
nachteilig abweichenden Zustands. Der von K erlittene komplizierte Beinbruch<br />
stellt sowohl eine Körper- als auch eine Gesundheitsverletzung dar.<br />
II. Verhalten <strong>des</strong> Anspruchsgegners<br />
B hat K nach einer schwungvollen Drehung losgelassen. Dadurch verlor K das<br />
Gleichgewicht und fiel zu Boden.<br />
Das Verhalten <strong>des</strong> B war äquivalent<br />
und adäquat kausal für die Rechtsgutsverletzung<br />
der K.<br />
III. Haftungsbegründende Kausalität<br />
B müsste diese Rechtsgutverletzung adäquat kausal durch sein Verhalten hervorgerufen<br />
haben. Nach der Äquivalenztheorie ist eine Handlung dann für<br />
den Erfolg kausal, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der<br />
konkrete Erfolg entfiele. Nur durch das Verhalten <strong>des</strong> B stürzte K. Der Kausalverlauf<br />
war auch nicht außerhalb <strong>des</strong> nach der allgemeinen Lebenserfahrung<br />
wahrscheinlichen.<br />
© Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG
<strong>RA</strong> <strong>11</strong>/<strong>2017</strong><br />
Zivilrecht<br />
565<br />
„[Dennoch kann B] unter Zugrundelegung der gemachten Angaben bei<br />
wertender Betrachtung die verbundene Schädigung nicht zugerechnet<br />
werden.<br />
Zwar ist mit K davon auszugehen, dass die alleinige - und nachhaltige -<br />
Initiative zu dem schließlich von den Parteien auf der privaten Geburtstagsfeier<br />
ausgeführten Paartanz von B ausgegangen ist. Durch das an den Händen fassen<br />
der K hat B - konkludent - seinem Wunsch Ausdruck verliehen, mit K einen<br />
Paartanz auszuführen. Von seinem Vorhaben hat sich B durch die Äußerungen<br />
der K, dass sie nicht tanzen könne und das Ganze zu schnell für sie sei, nicht<br />
abhalten lassen und mit der Ausführung von Tanzschritten begonnen.<br />
Wenngleich der Senat das Verhalten <strong>des</strong> B als egoistisch und wenig<br />
einfühlsam bewertet, kann nicht davon ausgegangen werden, dass B<br />
Gewalt ausgeübt hat und sein Verhalten - strafrechtlich relevanten -<br />
Nötigungscharakter erreicht hat.<br />
Vielmehr ist nach den eigenen Angaben der K davon auszugehen, dass<br />
sie sich letztlich freiwillig auf den Tanz mit B eingelassen hat.<br />
Es ist im vorliegenden Zusammenhang insbesondere nicht hinreichend<br />
von K dargetan, dass sie ohne jedwe<strong>des</strong> eigenes Zutun und gegen ihren<br />
ausdrücklich erklärten Willen von B geradezu zum Tanzen „gezwungen“<br />
worden sei. Nach dem als unstreitig anzusehenden Sachverhalt hat K<br />
- lediglich - geäußert, sie könne nicht tanzen und das Ganze sei zu schnell<br />
für sie.<br />
Eine klare und ausdrückliche Erklärung gegenüber B wie etwa „nein, ich<br />
möchte bzw. werde nicht mit dir/Ihnen tanzen“, hat K nicht abgegeben.<br />
Ebenso wenig ist ersichtlich, dass für K keine ihr zumutbare Möglichkeit<br />
bestanden hätte, dem Tanzwunsch <strong>des</strong> B entgegenzuwirken bzw. sich<br />
diesem zu entziehen. Es hätte in der konkreten Situation nach Einschätzung<br />
<strong>des</strong> Senats durchaus die Möglichkeit bestanden, sowohl in verbaler<br />
und auch physischer Hinsicht, etwa durch eine klar artikulierte Absage<br />
gegenüber B, ein Verlassen der Tanzfläche oder wenn ihr dies aufgrund<br />
<strong>des</strong> an den Händen Gehaltenwerdens durch B nicht ohne weiteres möglich<br />
gewesen sein sollte, durch ein einfaches Stehenbleiben in zumutbarer<br />
Weise den Tanz mit B und die daraus resultierenden Folgen zu vermeiden.<br />
Statt<strong>des</strong>sen hat K sich dem Wunsch <strong>des</strong> B gebeugt und mit ihm getanzt.<br />
Das Ausführen der Tanzschritte durfte B letztlich als Einwilligung<br />
der K in den Paartanz auffassen, wobei diese rechtliche Bewertung<br />
durch den Senat keineswegs so verstanden werden soll, dass der Senat<br />
das Verhalten <strong>des</strong> B als solches gutheißt. Nachdem K sich auf den Tanz<br />
mit B letztlich eingelassen hat, musste sie dann allerdings auch mit dem<br />
üblicherweise beim Paartanz zur Anwendung kommenden Tanzschritten<br />
und Drehungen der Tanzpartner rechnen.<br />
Im Unterschied zur Haftung für den Schaden, der einem außenstehenden<br />
Dritten zugefügt wird, welcher mehr oder weniger zufällig<br />
mit einer von einem bzw. mehreren anderen angesetzten Gefahr<br />
in Berührung kommt, was etwa dann der Fall gewesen wäre, wenn<br />
durch den Tanz, beim Sturz der K eine andere auf der Tanzfläche<br />
befindliche Person verletzt worden wäre, steht vorliegend die eigene<br />
freie Willensentscheidung der K im Vordergrund. K hat den Tanz mit B<br />
ausgeführt und hätte die hiermit verbundenen Gefahren, insbesondere<br />
im Hinblick auf ihr eigenes fehlen<strong>des</strong> tänzerisches Können, erkennen<br />
können. Für die von ihr getroffene <strong>Entscheidung</strong>, sich auf einen Tanz mit B<br />
- wenn auch zunächst widerwillig - einzulassen und die damit verbundene<br />
Selbstgefährdung ist K letztlich selbst verantwortlich.<br />
Eine Selbstschädigung durch ein<br />
Handeln auf eigene Gefahr wird von<br />
der Rspr. unterschiedlich verortet, im<br />
Strafrecht wie hier beim Kausalzusammenhang,<br />
im Zivilrecht eigentlich<br />
eher bei § 254 BGB oder auch als<br />
Einwand <strong>des</strong> venire contra factum<br />
propriums gem. § 242 BGB.<br />
K hat jedoch freiwillig mit B getanzt,<br />
sodass ihm nach Meinung <strong>des</strong> OLG-<br />
Senates die Rechtsgutsverletzung<br />
nicht zugerechnet werden kann.<br />
Siehe auch die <strong>Entscheidung</strong> <strong>des</strong><br />
OLG Frankfurt in <strong>RA</strong> <strong>2017</strong>, 393.<br />
Hier sieht der OLG-Senat den entscheidenden<br />
Aspekt <strong>des</strong> Falles: K<br />
wusste, dass sie nicht tanzen kann.<br />
Dennoch hat sie sich auf den Tanz<br />
eingelassen. Hätte sie sich deutlicher<br />
geweigert und wäre sie<br />
genötigt worden, läge keine Selbstgefährdung<br />
vor.<br />
K hätte sich der für sie gefährlichen<br />
Situation entziehen können. Dies<br />
hat sie jedoch nicht getan, sodass B<br />
ihr Verhalten als Einwilligung in den<br />
Paartanz werten durfte.<br />
Eigene<br />
der K<br />
freie Willensentscheidung<br />
Erkennbarkeit der Gefahren für K<br />
Freiwillige Selbstgefährdung<br />
© Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG
566 Zivilrecht <strong>RA</strong> <strong>11</strong>/<strong>2017</strong><br />
Der OLG – Senat beruft sich auf das<br />
Urteil <strong>des</strong> BGH vom 21.01.1986,<br />
VI ZR 208/84. Danach besteht kein<br />
absolutes Verbot, einen anderen zur<br />
Selbstgefährdung auf psychische<br />
Weise zu veranlassen. Beachten Sie<br />
aber: Der BGH hat das Problem der<br />
Selbstgefährdung in der zitierten<br />
<strong>Entscheidung</strong> unter dem Einwand<br />
<strong>des</strong> widersprüchlichen Verhaltens<br />
gem. § 242 BGB (venire contra<br />
factum proprium) verortet.<br />
Wer sich in die Obhut eines Experten<br />
begibt, der eine Garantenstellung<br />
übernimmt, muss seinen Schaden<br />
nicht vollständig selbst tragen. B<br />
nannte sich zwar „Tanzkönig“, aber<br />
weder Tanzlehrer noch Profi-Tänzer.<br />
Ein Zurechnungszusammenhang<br />
kann auch auf einer besonderen<br />
Garantenstellung beruhen – eine<br />
solche lag hier aufgrund der unzureichenden<br />
Tanzfähigkeiten <strong>des</strong> B<br />
allerdings nicht vor. Die Selbstbezeichnung<br />
als „Tanzkönig“ reicht<br />
insoweit nicht aus.<br />
Noch einmal: Zum selben Ergebnis<br />
gelangt, wer das Problem <strong>des</strong> Handelns<br />
auf eigene Gefahr an das<br />
Verbot <strong>des</strong> Selbstwiderspruchs gem.<br />
§ 242 BGB knüpft (venire contra<br />
factum proprium).<br />
In Fällen der vorliegenden Art gilt nach st. Rspr. <strong>des</strong> BGH der Grundsatz,<br />
dass weder ein allgemeines Gebot besteht, andere vor Selbstgefährdung<br />
zu bewahren, noch ein Verbot, sie zur Selbstgefährdung psychisch<br />
zu veranlassen, sofern nicht - was vorliegend ausscheidet - das<br />
selbstgefährdende Verhalten durch Hervorrufen einer min<strong>des</strong>tens im<br />
Ansatz billigenswerten Motivation „herausgefordert“ worden ist. Der<br />
BGH hat in der vorgenannten <strong>Entscheidung</strong> u.a. ausgeführt: „Beschränkt<br />
sich die Rolle <strong>des</strong> für die Selbstschädigung <strong>des</strong> Geschädigten zur<br />
Mitverantwortung herangezogenen Schädigers dergestalt auf die bloße<br />
Teilnahme an dem gefahrenträchtigen Unternehmen, dann fehlt es nach<br />
Auffassung <strong>des</strong> Senats an dem erforderlichen inneren Zusammenhang<br />
zwischen dem Schadenserfolg und einer von dem “Schädiger“ verletzten<br />
Verhaltungsnorm, der es rechtfertigen könnte, den Geschädigten anders<br />
zu behandeln, als wenn er das Unternehmen für sich allein durchgeführt<br />
hätte und schon <strong>des</strong>halb mit seinem Schaden allein belastet bliebe.“<br />
Nach der Rspr. <strong>des</strong> BGH, der sich der Senat in vollem Umfang anschließt,<br />
kommt die Annahme eines Zurechnungszusammenhanges zwischen der<br />
schädigenden Handlung und dem eingetretenen Erfolg allenfalls dann in<br />
Betracht, wenn der „Schädiger“ - hier also B - durch die Inanspruchnahme<br />
einer übergeordneten Rolle als „Experte“ K gegenüber eine Garantenstellung<br />
für die Durchführung <strong>des</strong> gemeinsamen Unternehmens<br />
übernommen oder durch sein Verhalten einen zusätzlichen Gefahrenkreis<br />
für die Schädigung der K eröffnet hätte. Wenngleich sich B selbst als<br />
„Tanzkönig“ seines Ortes bezeichnet und seine Tanzkünste diejenigen der<br />
K deutlich übersteigen, kann er nicht als Experte im vorstehenden Sinne<br />
angesehen werden. B ist weder beruflich mit dem Tanzsport verbunden noch<br />
führt die Teilnahme an einigen - wenigen - Tanzkursen zu einer Experten- und<br />
damit Garantenstellung gegenüber K. Vielmehr zeigt das Verhalten <strong>des</strong> B, dass<br />
es sich bei ihm gerade nicht um einen routinierten und professionellen Tänzer<br />
handelt, da ein solcher - anders als B - entweder der - zunächst - ablehnenden<br />
Haltung der K gegenüber dem gemeinsamen Tanz Rechnung getragen und<br />
nach einer anderen Tanzpartnerin Ausschau gehalten hätte oder zumin<strong>des</strong>t<br />
die Art und Weise der Ausführung <strong>des</strong> Tanzes an den Tanzkenntnissen und<br />
Fertigkeiten <strong>des</strong> schwächeren Tanzpartners ausgerichtet hätte.<br />
Die Gefahr eines Sturzes beim Tanz besteht grds. und war für alle<br />
Beteiligten, insbesondere für K aufgrund ihrer fehlenden Paartanzkenntnisse,<br />
gleichermaßen erkennbar.“<br />
Mithin kann B die Rechtsgutverletzung nicht zugerechnet werden.<br />
B. Ergebnis<br />
K hat gegen B keinen Anspruch auf Zahlung der Heilbehandlungskosten gem.<br />
§§ 823 I, 249 II 1 BGB.<br />
FAZIT<br />
Es besteht kein Verbot, einen anderen zur Selbstgefährdung auf psychische<br />
Weise zu veranlassen, solange das selbstgefährdende Verhalten durch<br />
Hervorrufen einer im Ansatz billigenswerten Motivation – hier das Tanzen –<br />
hervorgerufen wurde. In diesen Fällen fehlt es an dem für einen Schadensersatzanspruch<br />
erforderlichen inneren Zusammenhang zwischen Schadenserfolg<br />
und einer vom Schädiger verletzten Verhaltsnorm. Alternativ besteht<br />
ein Ausschlussgrund gem. § 242 BGB wegen eines Selbstwiderspruchs.<br />
© Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG
Jetzt zur<br />
VOLLVERSION<br />
WISEN...,<br />
9'91Vft\Oinl •• 'a<br />
udierende & Refere ndare<br />
1 T<br />
m<br />
JU<strong>RA</strong><br />
<strong>11</strong> INTENSIV<br />
<strong>RA</strong><br />
DIGITAL<br />
<strong>11</strong>/<strong>2017</strong><br />
Jura Intensiv<br />
- JU<strong>RA</strong><br />
rf INTENSIV<br />
verlag.jura-intensiv.de