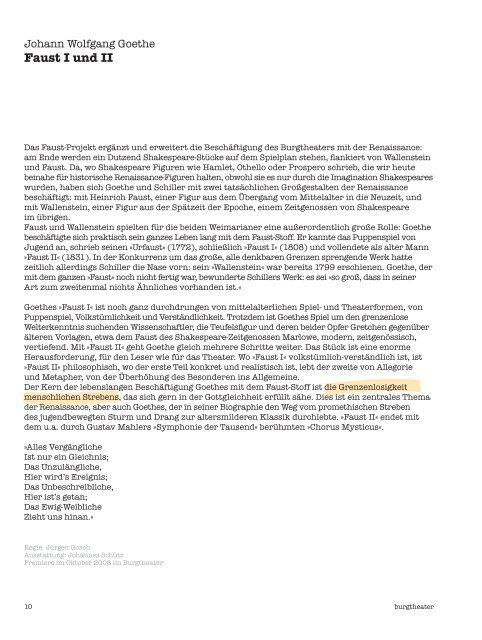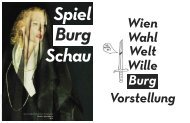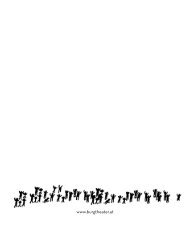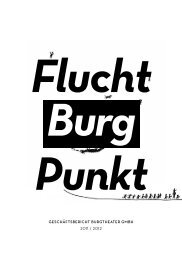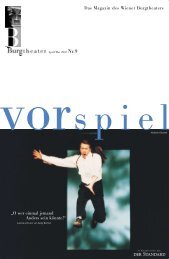Burgtheater
Burgtheater
Burgtheater
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Johann Wolfgang Goethe<br />
Faust I und II<br />
Das Faust-Projekt ergänzt und erweitert die Beschäftigung des <strong>Burgtheater</strong>s mit der Renaissance:<br />
am Ende werden ein Dutzend Shakespeare-Stücke auf dem Spielplan stehen, fl ankiert von Wallenstein<br />
und Faust. Da, wo Shakespeare Figuren wie Hamlet, Othello oder Prospero schrieb, die wir heute<br />
beinahe für historische Renaissance-Figuren halten, obwohl sie es nur durch die Imagination Shakespeares<br />
wurden, haben sich Goethe und Schiller mit zwei tatsächlichen Großgestalten der Renaissance<br />
beschäftigt: mit Heinrich Faust, einer Figur aus dem Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit, und<br />
mit Wallenstein, einer Figur aus der Spätzeit der Epoche, einem Zeitgenossen von Shakespeare<br />
im übrigen.<br />
Faust und Wallenstein spielten für die beiden Weimarianer eine außerordentlich große Rolle: Goethe<br />
beschäftigte sich praktisch sein ganzes Leben lang mit dem Faust-Stoff. Er kannte das Puppenspiel von<br />
Jugend an, schrieb seinen »Urfaust« (1772), schließlich »Faust I« (1808) und vollendete als alter Mann<br />
»Faust II« (1831). In der Konkurrenz um das große, alle denkbaren Grenzen sprengende Werk hatte<br />
zeitlich allerdings Schiller die Nase vorn: sein »Wallenstein« war bereits 1799 erschienen. Goethe, der<br />
mit dem ganzen »Faust« noch nicht fertig war, bewunderte Schillers Werk: es sei »so groß, dass in seiner<br />
Art zum zweitenmal nichts Ähnliches vorhanden ist.«<br />
Goethes »Faust I« ist noch ganz durchdrungen von mittelalterlichen Spiel- und Theaterformen, von<br />
Puppenspiel, Volkstümlichkeit und Verständlichkeit. Trotzdem ist Goethes Spiel um den grenzenlose<br />
Welterkenntnis suchenden Wissenschaftler, die Teufelsfi gur und deren beider Opfer Gretchen gegenüber<br />
älteren Vorlagen, etwa dem Faust des Shakespeare-Zeitgenossen Marlowe, modern, zeitgenössisch,<br />
vertiefend. Mit »Faust II« geht Goethe gleich mehrere Schritte weiter. Das Stück ist eine enorme<br />
Herausforderung, für den Leser wie für das Theater. Wo »Faust I« volkstümlich-verständlich ist, ist<br />
»Faust II« philosophisch, wo der erste Teil konkret und realistisch ist, lebt der zweite von Allegorie<br />
und Metapher, von der Überhöhung des Besonderen ins Allgemeine.<br />
Der Kern der lebenslangen Beschäftigung Beschäftigung Goethes mit dem Faust-Stoff ist ist die Grenzenlosigkeit<br />
Grenzenlosigkeit<br />
menschlichen menschlichen Strebens, das sich gern in in der Gottgleichheit erfüllt sähe. Dies ist ein zentrales zentrales Thema<br />
der Renaissance, aber auch Goethes, der der in in seiner Biographie den Weg vom promethischen Streben Streben<br />
des jugendbewegten Sturm und Drang zur altersmilderen Klassik durchlebte. »Faust II« endet mit<br />
dem u.a. durch Gustav Mahlers »Symphonie der Tausend« berühmten »Chorus Mysticus«.<br />
»Alles Vergängliche<br />
Ist nur ein Gleichnis;<br />
Das Unzulängliche,<br />
Hier wird’s Ereignis;<br />
Das Unbeschreibliche,<br />
Hier ist’s getan;<br />
Das Ewig-Weibliche<br />
Zieht uns hinan.«<br />
Regie: Jürgen Gosch<br />
Ausstattung: Johannes Schütz<br />
Premiere im Oktober 2008 im <strong>Burgtheater</strong><br />
10 burgtheater