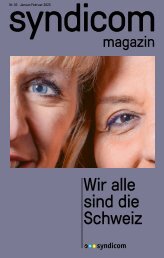syndicom magazin Nr. 4 - Holen wir unsere Zeit zurück!
Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.
Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>syndicom</strong><br />
<strong>Nr</strong>. 4 März–April 2018<br />
<strong>magazin</strong><br />
<strong>Holen</strong> <strong>wir</strong><br />
<strong>unsere</strong> <strong>Zeit</strong><br />
<strong>zurück</strong>!
Anzeige<br />
Bis zu<br />
10 %<br />
Prämien<br />
sparen<br />
Eine einfache Online-Krankenkasse und persönliche Beratung?<br />
Als Mitglied von <strong>syndicom</strong> bekommen Sie beides<br />
und erst noch günstiger. Jetzt mit nur ein paar Klicks wechseln:<br />
kpt.ch/<strong>syndicom</strong>
Inhalt<br />
4 Unsere Werberinnen<br />
5 Kurz und bündig<br />
6 Die andere Seite<br />
7 Gastautor<br />
8 Dossier: Arbeitszeit<br />
16 Arbeitswelt<br />
21 Affäre PostAuto<br />
22 Service public<br />
25 Recht so!<br />
26 Freizeit<br />
27 1000 Worte<br />
28 Bisch im Bild<br />
30 Aus dem Leben von ...<br />
31 Kreuzworträtsel<br />
32 Inter-aktiv<br />
Liebe Leserinnen und Leser<br />
Unsere Gesellschaft steht vor grossen Herausforderungen:<br />
Die Arbeit verlässt die Werkhallen,<br />
und damit verschwimmen die Grenzen zwischen<br />
Arbeit und Freizeit. Eine solche «Entgrenzung»<br />
der Arbeitszeit greift die Grundlagen an, auf<br />
denen unser Alltag, <strong>unsere</strong> Lebensformen und<br />
die soziale Sicherheit gebaut sind.<br />
Bisher galt: Der Arbeitstag ist begrenzt, der<br />
Rest <strong>unsere</strong>r <strong>Zeit</strong> gehört uns. Wir nennen es die<br />
<strong>Zeit</strong>autonomie. Sie ist die wichtigste Errungenschaft<br />
aus langen gewerkschaftlichen Kämpfen:<br />
das Menschenrecht auf freie <strong>Zeit</strong>.<br />
Der Arbeitsvertrag fusste auf dem Grundsatz,<br />
dass <strong>wir</strong> <strong>unsere</strong> Arbeitskraft dem Unternehmer<br />
während einer begrenzten <strong>Zeit</strong> für einen fixen<br />
Preis (Lohn) zur Verfügung stellen. Heute flexibilisieren<br />
die Arbeitgeber <strong>unsere</strong> Arbeitszeit<br />
immer stärker. Der digitale Umbau beschleunigt<br />
diesen Prozess. Flexibel ist die neue Norm.<br />
Bringt das die selbstbestimmte Gestaltung<br />
der Arbeitszeit? Nein. Es ist ein einseitiger<br />
Vorgang: Der Arbeitgeber bestimmt das Arbeitsvolumen<br />
und damit <strong>unsere</strong> Arbeitszeit. Sie<br />
verlängert sich, work und life geraten aus der<br />
Balance, <strong>wir</strong> verlieren <strong>unsere</strong> <strong>Zeit</strong>souveränität.<br />
Hier droht ein Rückfall in dunkle <strong>Zeit</strong>en. Wir<br />
Gewerkschaften können ihn verhindern, wenn<br />
<strong>wir</strong> den Kampf um die <strong>Zeit</strong> am Arbeitsplatz mit<br />
der Beherrschung der <strong>Zeit</strong> in der ganzen<br />
Gesellschaft verbinden.<br />
4<br />
8<br />
21<br />
Giorgio Pardini, Leiter Sektor ICT
4<br />
Teamporträt<br />
Die besten Werbenden für <strong>syndicom</strong><br />
Rémy Ségur (26)<br />
Kommt aus Gerlafingen SO, ist gelernter<br />
Schreiner und arbeitet seit 2013 als<br />
Customer Service Desk Steering bei der<br />
Swisscom in Ittigen BE. Zudem ist er<br />
Therapeut in Aquatischer Körperarbeit.<br />
Bei <strong>syndicom</strong> seit 2016.<br />
Cornelia Ziehler (44)<br />
Stammt aus Boniswil AG und ist als<br />
gelernte kaufmännische Angestellte<br />
seit zwanzig Jahren in verschiedenen<br />
Funktionen bei Sunrise tätig. Aktuell<br />
arbeitet sie im Bereich Geschäftskunden.<br />
Seit 2004 Mitglied von <strong>syndicom</strong>.<br />
Sie ist im Zentralvorstand und im<br />
Sektorvorstand Telecom/IT aktiv.<br />
Senol Kilic (37)<br />
Wohnt in Bassersdorf ZH und arbeitet<br />
seit 2009 in der Briefzustellung bei der<br />
Post. Davor war er während zehn<br />
Jahren in Berlin bei der deutschen<br />
Post. Dort engagierte er sich bei der<br />
Gewerkschaft Ver.di, mit dem Umzug in<br />
die Schweiz wechselte er zu <strong>syndicom</strong>.<br />
Text: Nina Rudnicki<br />
Bild: Yoshiko Kusano<br />
Die Unternehmen<br />
schenken uns nichts.<br />
Darum muss <strong>syndicom</strong><br />
noch stärker werden.<br />
Beim Werben von neuen Mitgliedern<br />
können <strong>wir</strong> nur gewinnen. Wenn <strong>wir</strong><br />
jemanden ansprechen, ist die erste<br />
Reaktion fast immer ein Nein. Aber<br />
<strong>wir</strong> haben gute Argumente und<br />
Strategien, die das Interesse dennoch<br />
wecken.<br />
Einige von uns Werbenden gehen<br />
mit einem kleinen Geschenk wie<br />
einem <strong>syndicom</strong>Kugelschreiber auf<br />
die Personen zu. Ein guter Ort und<br />
Moment dafür sind etwa die Arbeitspausen.<br />
Die Leute wissen, dass <strong>wir</strong><br />
Mitglieder von <strong>syndicom</strong> sind. Wir<br />
engagieren uns in der Personalvertretung<br />
<strong>unsere</strong>r Firmen oder als<br />
Jugenddelegierte. Diese Vertrauensposition<br />
ist wichtig: Gibt es Probleme<br />
im Job oder drohen gar Entlassungen,<br />
kommen die Kollegen von<br />
sich aus auf uns zu.<br />
Wir zeigen ihnen, dass es keine<br />
bessere und günstigere Arbeitnehmerversicherung<br />
gibt, als Mitglied<br />
einer Gewerkschaft zu sein. Zudem<br />
wollen <strong>wir</strong> deutlich machen, dass die<br />
Gewerkschaft umso mehr erreichen<br />
kann, je mehr Mitglieder sie hat.<br />
Umgekehrt gilt, dass es einfacher ist,<br />
neue Mitglieder zu gewinnen, wenn<br />
die Gewerkschaft die Arbeitnehmendenrechte<br />
stärken kann. Haben <strong>wir</strong><br />
beispielsweise erfolgreich einen<br />
neuen Gesamtarbeitsvertrag ausgehandelt,<br />
zieht das viele Neuanmeldungen<br />
nach sich.<br />
Wir sind aus Überzeugung<br />
Werbende. Darum ehrt es uns, dass<br />
<strong>wir</strong> an regionalen Anlässen bis April<br />
als beste Werber und Werberinnen<br />
ausgezeichnet werden. Wir müssen<br />
den grossen Firmen auf die Finger<br />
schauen. Grundsätzlich haben <strong>wir</strong><br />
gute Arbeitsbedingungen, aber es<br />
gibt keinen Grund, darauf zu<br />
vertrauen, dass die Situation so<br />
bleibt. Der Arbeitsmarkt hat sich<br />
stark gewandelt. Es ist längst nicht<br />
mehr selbstverständlich, dass<br />
jemand seinen Job behält – selbst<br />
dann nicht, wenn er seit vielen<br />
Jahren für das Unternehmen arbeitet.<br />
Unternehmen schenken uns<br />
nichts, alles muss verhandelt<br />
werden. Wir betonen aber immer,<br />
dass es zwischen Unternehmen und<br />
Gewerkschaft keine Feindschaft gibt.<br />
Vielmehr stehen <strong>wir</strong> in einer Sozialpartnerschaft.<br />
Es ist ein Geben und<br />
Nehmen.»
Kurz und<br />
bündig<br />
Notime: Die Post ist in der Pflicht \ Ringier feuert und knausert \<br />
Der SGB nach Rechsteiner \ AHV: falsche Lösung vom Bundesrat \<br />
Tamedia: mehr Journalismus! \ Widmers Weltausstellung<br />
5<br />
Die Post kauft Notime.<br />
Jetzt muss ein GAV her!<br />
Mitte März hat die Post 51 Prozent der<br />
(Velo-)Kurierfirma Notime AG übernommen.<br />
Dieser Teil der Logistikbranche ist<br />
weitgehend unreguliert. Bisher hatte<br />
sich die Firma geweigert, GAV-Verhandlungen<br />
aufzunehmen. Jetzt besteht die<br />
Gefahr, dass die Post Aufträge von<br />
PostLogistics an ihre neue Tochterfirma<br />
weiterreicht – zu sehr viel schlechteren<br />
Löhnen und Arbeitsbedingungen.<br />
<strong>syndicom</strong> nimmt die Post deswegen in<br />
die Pflicht und verlangt, dass jetzt über<br />
einen GAV verhandelt <strong>wir</strong>d. Es soll ein<br />
Muster-GAV für die digitale Plattformökonomie<br />
werden. Eine Chance für die<br />
Post, ihr angeschlagenes Image etwas<br />
aufzu frischen.<br />
Ringier feuert – und knausert<br />
Sie haben 40 Jahre lang treu geschuftet<br />
und für Ringier gedruckt. Nun sollen sie<br />
nach der Schliessung der Druckerei<br />
Adligenswil LU knausrig abgespiesen<br />
werden. 172 Jobs werden zerstört.<br />
Doch erst weigerte sich Ringier, über<br />
Lösungsvorschläge der Belegschaft<br />
und der Gewerkschaften auch nur zu<br />
sprechen. Mit derselben Arroganz<br />
verweigert der Grosskonzern nun die<br />
Verbesserung des alten Sozialplanes.<br />
Vor allem bei den Abgangsentschädigungen<br />
und den frühzeitigen Pensionierungen<br />
spart Ringier.<br />
Nach Paul Rechsteiner.<br />
Die grossen Herausforderungen<br />
für den SGB<br />
Paul Rechsteiner tritt ab, nach<br />
20 Jahren als SGB-Präsident. Ende<br />
November <strong>wir</strong>d sein Nachfolger oder<br />
seine Nachfolgerin gekürt. Während<br />
Rechsteiners Präsidentschaft hat sich<br />
die Schweizer Gewerkschaftsszene<br />
stark verändert. Kräfte wurden<br />
zusammengelegt. Die Industriegewerkschaft<br />
hat sich politisiert, der Tertiär,<br />
bisher gewerkschaftliche Wüste, ist<br />
begrünt worden. Damit reagierten die<br />
Gewerkschaften auf Veränderungen<br />
des Wirtschaftssystems und der<br />
Gesellschaft. Heute stehen neue,<br />
grosse Herausforderungen an: der<br />
digitale Umbau und eine starke<br />
Industriepolitik. Die Renaissance des<br />
Service public. Die akute Umverteilungsfrage.<br />
Der Klimawandel. Den<br />
Gewerkschaften und dem SGB kommt<br />
in diesem verschärften politischen<br />
Umfeld eine neue, kräftigere Rolle zu.<br />
Der 30. November, wenn Rechsteiners<br />
Nachfolge bestimmt <strong>wir</strong>d, ist ein<br />
wichtiges Datum für die Schweiz.<br />
Bundesrat und AHV:<br />
nachsitzen!<br />
Die Pensionskassenrenten sinken. Und<br />
die AHV reicht nicht. Statt die AHV zu<br />
erhöhen, will der Bundesrat das<br />
Rentenalter für Frauen hochsetzen.<br />
Er muss nochmals über die Bücher.<br />
Tamedia: 170 000 000 für Brei<br />
Jede und jeder Zweite, die und der eine<br />
<strong>Zeit</strong>ung liest, muss sich beim Tamedia-<br />
Konzern bedienen. Der Einheitsbrei<br />
bringt 170 Millionen Gewinn. <strong>syndicom</strong><br />
fordert von Tamedia, das Geld in<br />
besseren Journalismus zu investieren.<br />
Das beginnt mit einem GAV.<br />
In eigener Sache:<br />
Widmers Weltausstellung<br />
Gute Cartoon-Zeichner unterscheiden<br />
sich von anderen Menschen durch<br />
ihren besonderen Blick auf die Welt.<br />
Ruedi Widmer, der auch in dieser<br />
Ausgabe für das <strong>magazin</strong> zeichnet<br />
(Seite 27), schaut den Absonderlichkeiten<br />
<strong>unsere</strong>r Gegenwart schräg von<br />
der Seite ins Auge. Immer leicht<br />
verschoben. «Das macht die Dinge erst<br />
sichtbar», sagt Widmer, und deshalb<br />
hat der gelernte Grafiker auch diesen<br />
«fast schludrigen» Cartoon-Stil<br />
gewählt. Jetzt ist sein neues Buch<br />
erschienen: Widmers Weltausstellung.<br />
Rotpunktverlag, Zürich 2018.<br />
Mehr: ruediwidmergrafik.ch<br />
Agenda<br />
April<br />
5.<br />
Führung durch die Reitschule<br />
Bern<br />
Den kontroversen Ort aus eigener<br />
Anschauung kennen. Eine Führung der<br />
IG Jugend. Anmeldung nur über den<br />
persönlichen my.<strong>syndicom</strong>-Account.<br />
17.30 bis 19 Uhr<br />
7.<br />
Der 15. Tag der Schrift<br />
Ein Muss nicht nur für Grafiker,<br />
Typografen und Gestalter. Ab 9 Uhr<br />
Referate, am Nachmittag Workshops.<br />
Morgen: CHF 50.–, Nachmittag<br />
CHF 30.–. 50% Ermässigung für<br />
Lernende und Mitglieder <strong>syndicom</strong>.<br />
Schule für Gestaltung Zürich,<br />
Aus stellungsstrasse 104.<br />
Anmeldung: tagderschrift.org<br />
13. bis 21.<br />
Erweiterung der Pupillen<br />
Auf nach Nyon, zum weltweit<br />
bedeutenden Dokumentarfilm-<br />
Feststival «Visions du Réel». Umwerfend.<br />
Danach sieht man die Welt neu.<br />
Alle Infos: visionsdureel.ch<br />
Mai<br />
1.<br />
Alle heraus zum 1. Mai<br />
3.<br />
Tag der Pressefreiheit<br />
Diverse Veranstaltungen. amnesty.ch<br />
Vorschau<br />
09. 06.<br />
A.o. Kongress <strong>syndicom</strong><br />
Bern, Kursaal, 9.15 Uhr<br />
10. 06.<br />
Abstimmung Vollgeldinitiative<br />
<strong>syndicom</strong>.ch –> agenda
6 Die andere<br />
Martin Camenisch<br />
Seite<br />
ist seit 2017 Leiter Personalmanagement bei der<br />
Schweizerischen Post. Nachdem er 2007 von der Swisscom<br />
zur Post gewechselt hatte, arbeitete er in den Bereichen<br />
PostMail, bei Presto und im Immobilienmanagement.<br />
1<br />
Planen Sie Arbeitszeitmodelle mit<br />
kürzeren Arbeitszeiten?<br />
Nein. Aktuell sind Modelle mit<br />
weniger Wochenarbeitszeit oder<br />
andere Arbeitszeitmodelle kein<br />
konkretes Thema. Aber <strong>wir</strong> setzen<br />
uns damit auseinander. Bei jedem<br />
GAV stellt sich die Frage nach der<br />
Wochenarbeitszeit, aber dort sind <strong>wir</strong><br />
oft von Branchensituationen und<br />
<strong>wir</strong>tschaftlichen Überlegungen<br />
getrieben. Spannend finde ich aber<br />
die Frage, ob <strong>wir</strong> eines Tages mal<br />
<strong>Zeit</strong>verhandlungen miteinander<br />
führen statt Lohnverhandlungen.<br />
2<br />
Wie garantieren Sie, dass eine<br />
Flexibilisierung auch den Arbeitnehmenden<br />
dient?<br />
Das müssen <strong>wir</strong> in der Sozialpartnerschaft<br />
gemeinsam schaffen. Der<br />
Flexibilisierungsdruck nimmt<br />
allenthalben zu, und manchmal<br />
fehlen effektiv noch die guten Ideen,<br />
wie man mit stark variierendem<br />
Arbeitsanfall umgehen soll. Extremvorschläge,<br />
die Arbeit auf Abruf<br />
favorisieren, erscheinen mir genauso<br />
wenig zielführend wie solche, die<br />
einzig langfristige Vorausplanung<br />
und fixe Dienstpläne propagieren.<br />
3<br />
Wie einigen Sie sich im Konfliktfall<br />
mit Ihren Mitarbeitenden?<br />
Miteinander reden und eventuell<br />
verloren gegangenes Vertrauen<br />
wiederaufbauen, ist die Basis für eine<br />
Lösung. Bislang bin ich damit immer<br />
sehr gut gefahren. Für einen zielführenden<br />
Dialog bin ich jedoch auch<br />
auf mein Gegenüber ange wiesen.<br />
4<br />
Bieten die Gewerkschaften bei der<br />
Organisation der Arbeitszeit Hand?<br />
Wenn ich das auch ein wenig als<br />
Aufforderung formulieren darf:<br />
Ich denke schon, oder?<br />
Text: Sina Bühler<br />
Bild: Swisscom<br />
5<br />
Fördern Sie das gewerkschaftliche<br />
Engagement im Betrieb?<br />
Alleine schon aus Interesse bin ich<br />
nah am Thema. So wie ich das<br />
mitbekomme, machen Ihre<br />
Kolleginnen und Kollegen das aber<br />
tipptopp. Ich hatte bislang das<br />
Privileg, immer auf konstruktive<br />
Partner zu treffen, und erlebe den<br />
sozialpartnerschaftlichen Dialog als<br />
Bereicherung. Klar ist man nicht<br />
immer einer Meinung, aber das<br />
gehört schlicht dazu – gerade deshalb<br />
sprechen <strong>wir</strong> ja miteinander und<br />
suchen zusammen nach Lösungen.<br />
6<br />
Was regt Sie an den Gewerkschaften<br />
richtig auf?<br />
Ich bin mit einem Verhandlungsergebnis<br />
nie zufrieden, wenn es nur<br />
einer bestimmten Gruppe dient.<br />
Denn damit lassen <strong>wir</strong> einen Teil der<br />
Belegschaft hängen. Das ist nicht<br />
fair – aber es kommt sehr selten vor.<br />
Womit ich Probleme hätte, wäre,<br />
wenn Einzelne den Diskurs in der<br />
Gewerkschaft bestimmen, um<br />
letztlich die Interessen einer bestimmten<br />
Klientel durchzusetzen.<br />
Damit wäre meiner Meinung nach<br />
niemandem gedient.
Gastautor<br />
Wie oft habe ich schon von flexiblen<br />
Arbeitszeiten reden gehört, das Wörtlein «Flexibilität»,<br />
wie oft drang es schon an mein Ohr. Und<br />
natürlich weiss ich, was «flexibel» bedeutet:<br />
biegsam, anpassungsfähig. Und warum muss<br />
etwas biegsam sein oder anpassungsfähig?<br />
Offensichtlich deshalb, weil es nötig ist. Ein Ast<br />
biegt sich im Wind und bricht nicht. Schön. Aber<br />
die Frage stellt sich doch: Wie steht es um die<br />
Flexibilität des Windes? Könnte nicht auch der<br />
Wind sich anpassen an den Ast und ein bisschen<br />
weniger heftig wehen oder seinen Luftstrom um<br />
den Ast herumbiegen, sodass der sich nicht<br />
biegen muss? Warum kann der Wind eigentlich<br />
nicht Rücksicht nehmen auf das Bedürfnis des<br />
Astes, nicht ständig flexibel zu sein? Warum<br />
bläst der einfach stur weiter, obwohl diese Flexibilität<br />
und ständige Anpassungsbereitschaft<br />
eine ziemlich anstrengende Angelegenheit sind?<br />
Und wie steht es in der Arbeitswelt? Wer biegt<br />
sich dort und wer bleibt stur? Ist es etwa das<br />
arme Ästlein der globalisierten Wirtschaft, das<br />
sich dem scharfen Wind beugen muss, der ihm<br />
von der Sturheit der Arbeitnehmenden entgegenschlägt?<br />
Wie ist es denn, wenn die Angestellten<br />
auf ihrem Feierabend oder freien Sonntag<br />
beharren und in ihrer Sturheit die Flexibilität<br />
partout nicht aufbringen wollen, sich jederzeit<br />
über ihr Handy zu beugen, um abzuchecken, ob<br />
der Vorgesetzte ihnen vielleicht jetzt gerade<br />
eine Mail geschrieben hat? Ist der Vorgesetzte<br />
dann etwa bereit, sich an die Sturheit seiner<br />
Angestellten anzupassen? Bringt er die nötige<br />
Flexibilität auf und wartet geduldig auf seine<br />
Antwort? Solange es als naturgegeben<br />
erscheint, wer im Kapitalismus die Ästlein sind<br />
und woher der Wind bläst, dem sie sich zu<br />
biegen haben, solange also die Rollen zwischen<br />
Sturen und Flexiblen so einseitig verteilt bleiben,<br />
erlaube ich mir meinerseits die Sturheit, das<br />
Wörtlein «Flexibilität» in die Ecke der ideologischen<br />
Kampfbegriffe zu stellen, mit denen eben<br />
dieser Kapitalismus seine Herrschaft behauptet.<br />
Vom Ästlein und<br />
dem scharfen Wind<br />
Gerhard Meister schreibt Theaterstücke,<br />
Hörspiele und Gedichte. Mit seinen Spoken<br />
WordTexten steht er selber auf der<br />
Bühne. Unter anderem in der Formation<br />
Bern ist überall und als Duo meistertrauffer<br />
mit der Musikerin Anna Trauffer.<br />
Ende März hat sein neues Stück «Das<br />
grosse Herz des Wolodja Friedmann» am<br />
Schauspielhaus Zürich Premiere.<br />
gerhardmeister.ch<br />
7
Arbeitszeit: das grosse Ringen um die <strong>Zeit</strong>autonomie<br />
Die Gewerkschaft und die <strong>Zeit</strong>räuber<br />
So macht die Arbeitslast in digitalen <strong>Zeit</strong>en <strong>unsere</strong> Arbeitszeit<br />
Grafik: die ersten 150 Jahre bis zum 8-Stunden-Tag<br />
Dossier 9<br />
Höchste<br />
<strong>Zeit</strong> für<br />
mehr<br />
freie <strong>Zeit</strong>
10 Dossier<br />
<strong>Zeit</strong>räuber vs. <strong>Zeit</strong>autonomie: der grosse<br />
Streit um Arbeitszeit und Zivilisation<br />
In vielen Kämpfen haben die Gewerkschaften<br />
kürzere Arbeitszeiten durchgesetzt. Freie <strong>Zeit</strong><br />
ist ihre grösste Errungenschaft. Nun aber<br />
sollen <strong>wir</strong> wieder länger arbeiten. Viel länger.<br />
Text: Oliver Fahrni<br />
Bilder: Thierry Porchet<br />
Nur noch sechs Stunden täglich arbeiten und dabei gut<br />
verdienen? Lassen <strong>wir</strong> uns das einmal auf der Zunge zergehen.<br />
Das Modell ist ein halbes Jahrtausend alt. 1518 entwarf<br />
der britische Staatsmann und Humanist Thomas<br />
Morus in seiner Schrift «Utopia» eine Gesellschaft, die<br />
ihre notwendige Arbeit regelmässig auf alle verteilt. Da<br />
bleibt viel freie <strong>Zeit</strong> für Sinnesgenüsse und die Schärfungen<br />
des Verstandes.<br />
Morus skizzierte seine ideale Republik in frühkapitalistischen<br />
<strong>Zeit</strong>en, umgeben von darbenden Taglöhnern,<br />
Heimarbeiterinnen und Landarbeitern. Damals waren Arbeitstage<br />
von 16 Stunden üblich, 6½ Tage jede Woche des<br />
Jahres. Was Wunder, wurde «Utopia» im Laufe der Jahrhunderte<br />
ein Bestseller.<br />
500 jahre später <strong>wir</strong>d hier und dort mit dem 6-Stunden-Tag<br />
experimentiert, meist unter bösem Geschrei von<br />
Arbeitgebern und ihrer Ökonomen, die den <strong>wir</strong>tschaftlichen<br />
Untergang heraufbeschwören. Doch die Sechsstundenexperimente,<br />
zum Beispiel im schwedischen Göteborg,<br />
beweisen: Die Arbeit <strong>wir</strong>d gemacht, die Fehlzeiten<br />
wegen Krankheit oder Burn-outs nehmen radikal ab, das<br />
Arbeitsklima gewinnt. Die Menschen leben besser. Und es<br />
werden neue Jobs geschaffen. Das wären mindestens so<br />
respektable Ziele wie die Profite der Konzerne.<br />
Warum also nicht noch weniger arbeiten? Im «Sonnenstaat»<br />
(1623) des Frühsozialisten Campanella schaffen es<br />
die Menschen mit vier Stunden Arbeit, ihre Existenz zu<br />
sichern. Morus und Campanella bauten auf eine lange<br />
Tradition: In sämtlichen Gesellschaftsutopien seit der<br />
biblischen Antike spielte die Arbeitszeitverkürzung eine<br />
zentrale Rolle. Das kann kein Zufall sein. Weniger zu arbeiten,<br />
ist offenbar ein universeller und sehr alter Traum<br />
der Menschheit.<br />
Er ist noch lange nicht ausgeträumt. 1973 holte in<br />
Michael Endes Roman «Momo» ein Kind die «gestohlene<br />
<strong>Zeit</strong>» von den «<strong>Zeit</strong>dieben» <strong>zurück</strong>. Danach, so lesen <strong>wir</strong>,<br />
konnte «jeder sich zu Allem so viel <strong>Zeit</strong> nehmen, wie er<br />
brauchte und haben wollte, denn von nun an war ja wieder<br />
genug davon da».<br />
Lebenszeit nicht mit Überleben vergeuden<br />
In all diesen Entwürfen geht es um die Befreiung des Menschen<br />
vom Zwang, ein Übermass an Arbeit leisten zu müssen.<br />
Wer sich diesem Arbeitsregime entzieht, riskiert, in<br />
Not zu geraten. Jedenfalls in einem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem,<br />
das auf diesen Zwang gebaut ist.<br />
Was die Menschen hingegen seit jeher antreibt, ist das<br />
Begehren, die Lebenszeit nicht allein mit Überleben zu<br />
verbringen. Freie <strong>Zeit</strong> für wichtigere Dinge zu gewinnen<br />
als Arbeit, für Kinder, Freunde, Sport, Erkundung der<br />
Welt, Wissen, musische und geistige Verfeinerung. Wofür<br />
auch immer. Wir nennen das <strong>Zeit</strong>autonomie. Die Verfügung<br />
über die eigene <strong>Zeit</strong> ist das Mass der Freiheit, die<br />
Vorausetzung jeder Selbstbestimmung. Karl Marx hat von<br />
der «<strong>Zeit</strong> als Raum menschlicher Entwicklung» gesprochen.<br />
Freie <strong>Zeit</strong> ist also ein Menschenrecht. Doch nur sehr<br />
wenige schaffen es, dank besonders günstigen Umständen,<br />
sich ein bisschen <strong>Zeit</strong>autonomie einzurichten. Die<br />
meisten unter uns machen die Erfahrung, dass nicht einmal<br />
die «Freizeit» <strong>wir</strong>klich freie <strong>Zeit</strong> ist. Die Wirtschaft<br />
bindet uns weit über <strong>unsere</strong> Arbeitszeit hinaus ein. Was<br />
<strong>wir</strong> im Alltag ausserhalb des Jobs tun, unterliegt immer<br />
stärker fremdbestimmten Konsummustern. In digitalen<br />
<strong>Zeit</strong>en mehr denn je. «Wir machen dein Leben, dein ganzes<br />
Leben», sagt Google in seinen Publikationen sinngemäss.<br />
Ungefragt übernehmen <strong>wir</strong> immer mehr Arbeiten,<br />
die zuvor im Unternehmen oder in einer Verwaltung verrichtet<br />
wurden, bis hin zum Warendesign, strategischer<br />
Planung von Verkehrssystemen und dem Training von<br />
automatischen Kommuniationsmaschinen (Bots), also<br />
der Künstlichen Intelligenz, welche die Unternehmmen<br />
einsetzen.<br />
Freie <strong>Zeit</strong> ist kein individueller Luxus, sondern<br />
ein kollektives Projekt<br />
Von dieser Arbeit wussten <strong>wir</strong> nichts, und <strong>wir</strong> haben keinen<br />
Vertrag dafür. Was <strong>wir</strong> hingegen gut kennen, ist die<br />
<strong>Zeit</strong>not. Sie ist das beherrschende Gefühl moderner Gesellschaften.<br />
In den 1990er-Jahren prägten Soziologen<br />
das Wort «<strong>Zeit</strong>wohlstand», um sinkende Arbeitszeiten zu<br />
beschreiben. Heute aber <strong>wir</strong>d kein Satz so häufig gesagt<br />
wie: «Ich habe keine <strong>Zeit</strong>.»<br />
Geht es nach den Arbeitgebern, soll das zum Mantra<br />
das 21. Jahrhunderts werden. Sie haben im Ringen um <strong>unsere</strong><br />
<strong>Zeit</strong> gerade eine grosse Front eröffnet: Sie wollen die<br />
Arbeitszeit entgrenzen. 150 Jahre lang ging der Trend<br />
Richtung kürzere Arbeitszeit und mehr Ferien. Wir sind,<br />
grob gesprochen, bei der 40-Stunden-Woche angekommen.<br />
Theoretisch. Faktisch steigt die real geleistete Ar-<br />
Die zentrale<br />
Frage lautet:<br />
Arbeiten <strong>wir</strong><br />
nur, oder sind<br />
<strong>wir</strong> zivilisiert?
11<br />
beitszeit wieder an. Nun fordert der Gewerbeverband die<br />
50-Stunden-Woche als gesetzliche Norm. Der Freisinn<br />
will 48 Stunden und die Kontrolle der Arbeitszeit schleifen.<br />
Digitalunternehmer greifen die Kollektivverträge und<br />
die Schutzbestimmungen im Arbeitsrecht an. Sie lagern<br />
zunehmend Arbeit in Heimarbeit, an Plattformen und in<br />
Crowdworking aus.<br />
Sollten die Arbeitgeber diese Auseinandersetzung gewinnen,<br />
wäre dies ein historischer Bruch. Spätestens hier<br />
<strong>wir</strong>d deutlich, dass <strong>Zeit</strong>autonomie kein individueller Luxus<br />
ist, sondern ein kollektives Projekt.<br />
Bei den aktuellen Diskussionen etwa über den Versuch<br />
der Arbeitgeber, die Arbeitszeit auszudehnen – mit mehr<br />
Wochenstunden, mehr Samstags-, Sonntags- und Nachtarbeit<br />
–, geht oft ein elementarer Zusammenhang vergessen:<br />
<strong>Zeit</strong>autonomie ist die Bedingung für sozialen<br />
Frieden, Fortschritt und Wissenschaft.<br />
Die entscheidende Frage heisst: Arbeiten <strong>wir</strong> nur (für<br />
Lohn und Überleben), oder sind <strong>wir</strong> zivilisiert? Jede Zivilisation<br />
in der Geschichte baute darauf, dass sie über das<br />
banale ökonomische Problem (ausreichende Produktion)<br />
hinaus Musse und <strong>Zeit</strong> produzierte für all die Dinge, die<br />
eine Gesellschaft <strong>wir</strong>klich braucht, wenn sie erst einmal<br />
gegessen und ein Dach über dem Kopf hat.<br />
Die wahre Geschichte der Gewerkschaften<br />
Fast überall war die Verfügung über die eigene <strong>Zeit</strong> einer<br />
Minderheit vorbehalten, die sich dem ökonomischen<br />
Zwang nicht stellen musste. Hier setzt die eigentliche Geschichte<br />
der Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften<br />
ein: Sie ist der Kampf um eine doppelte Emanzipation des<br />
Menschen. Befreiung von Not und ökonomischen Zwängen.<br />
Und damit auch Befreiung von einem <strong>Zeit</strong>regime, das<br />
uns die <strong>Zeit</strong> stiehlt.<br />
Es brauchte Hunderte von Streiks und viele Arbeitskämpfe<br />
in den Betrieben, um die 6½-Tage-Woche in eine<br />
Fünftagewoche zu bringen. Der Generalstreik von 1918<br />
forderte den Achtstundentag. Heraus kam, um 1930, in<br />
den meisten Branchen die 48-Stunden-Woche. Enormer<br />
Fortschritt, gegen die elend langen Arbeitszeiten (auch<br />
für Kinder) des 19. Jahrhunderts, wie sie etwa durch die<br />
Glarner und Zürcher Fabrikgesetze nur schwach eingedämmt<br />
worden waren. Unsere Grafik auf Seite 15 zeigt im<br />
<strong>Zeit</strong>raffer die Geschichte der Arbeitszeit in der Schweiz.<br />
In der Regel geschah die Arbeitszeitverkürzung in einem<br />
Wechselspiel von Gesetz und Gesamtarbeitsverträgen,<br />
wobei das Gesetz bis heute weit hinter den GAV <strong>zurück</strong>hängt<br />
(siehe Seite 14). Die Arbeitgeber wehrten sich<br />
in Regel mit Händen und Füssen gegen kürzere Arbeitszeiten<br />
oder mehr Ferien. Anders als beim Lohn, der in<br />
manchen Jahren fast ohne Widerrede erhöht wurde,<br />
musste jede Minute freier <strong>Zeit</strong> den Konzernbesitzern hart<br />
abgerungen werden.<br />
Der Grund dafür liegt weniger in objektiven <strong>wir</strong>tschaftlichen<br />
Zahlen als im grundsätzlichen Verhältnis zwischen<br />
Arbeit und Kapital: Die Arbeitgeber bestehen darauf, über<br />
<strong>unsere</strong> Lebenszeit verfügen zu können. In der Arbeitszeit<br />
spiegelt sich exakt das momentane Kräfteverhältnis zwischen<br />
uns und den Arbeitgebern.<br />
Hebel der Gewerkschaften bei Arbeizszeitverkürzungen<br />
ist ein starkes <strong>wir</strong>tschaftliches Argument: die steigende<br />
Produktivität. Schaffen Arbeitende in kürzerer <strong>Zeit</strong><br />
mehr Produkte oder Dienstleistungen, sind kürzere Arbeitstage<br />
oder mehr Ferien nur gerecht. Eine lange Reihe<br />
<strong>wir</strong>tschaflicher Daten weist nach: Verkürzungen der Arbeitszeit<br />
führten in der Regel zu höherer Produktivität.<br />
Die Furcht vor noch mehr Verdichtung der Arbeit<br />
Doch seit 2002 lehnten die Stimmbürgerinnen und -bürger<br />
die 36-Stunden-Woche, die flexible Frühpensionierung<br />
und die Initiative für sechs Wochen Ferien ab, zum<br />
Teil mit krassen Nein-Anteilen. Was ist bloss mit den<br />
Schweizern los? fragten ausländische Medien. SGB-Präsident<br />
Paul Rechsteiner bilanzierte in einem Interview vor<br />
acht Jahren: «Arbeitszeitverkürzungen stehen vorläufig<br />
nicht auf der Agenda.»<br />
Offenbar ist die Sache mit der Arbeitszeit nicht so<br />
einfach. Schon der Begriff verlangt nach Klärung: Wir<br />
sprechen über Lohnarbeitszeit, die <strong>Zeit</strong>, die <strong>wir</strong> im Tausch<br />
gegen Lohn arbeiten. Der Rest gilt als Freizeit. Das trügt.<br />
Damit eine Gesellschaft funktioniert, braucht sie viel<br />
mehr Arbeit. Zum Beispiel die Erziehungs- und Versor-
gungsarbeit (Haushalt, Pflege usw.). Auf 7,3 Milliarden<br />
Stunden bezahlte Arbeit kommen in der Schweiz 8,3 Milliarden<br />
Stunden unbezahlte Arbeit. Die ist ungleich verteilt:<br />
Frauen leisten den Grossteil der unbezahlten Arbeit.<br />
Der Zusammenhang mit notwendigen Arbeitszeitverkürzungen<br />
ist doppelt: Zum einen könnten sie ein Antoss<br />
sein, die unbezahlte Arbeit besser auf die Geschlechter zu<br />
verteilen. Zum anderen möchten zwar auch Vollzeitangestellte,<br />
in der Mehrzahl Männer, weniger arbeiten, wie diverse<br />
Umfragen zeigen. Doch sie ziehen aus der Lohnarbeit,<br />
die gesellschaftlich überhöht <strong>wir</strong>d, Legitimation und<br />
Identität. Lohnarbeit ist Janus-köpfig. Sie <strong>wir</strong>d als Zwang,<br />
manchmal gar als Gewaltverhältnis erlebt, doch auch als<br />
Ort, wo man sich persönlich oder gesellschaftlich ver<strong>wir</strong>klicht.<br />
Allerdings auch zunehmend unter den veränderten<br />
Bedingungen leidend. Brutale Managementmethoden<br />
haben die Arbeit in den vergangenen Jahren verdichtet,<br />
quer durch alle Branchen. Der Takt ist schneller geworden,<br />
die faktische Arbeitszeit wurde ausgedehnt, die Kontrolle<br />
verschärft. Zu Stress und körperlicher Belastung gesellt<br />
sich der Verlust der vielen kleinen Formen von<br />
Selbstbestimmung der herkömmlichen Arbeitsformen.<br />
Manche fürchten, Arbeitszeitverkürzungen würden diese<br />
Hetze noch verschärfen.<br />
Die Last der Arbeit<br />
Seit 1980 zunehmend flexibilisiert (siehe Seite 14), <strong>wir</strong>d<br />
die Grenze zwischen Arbeits- und Freizeit zunehmend<br />
porös. Die Arbeitgeber glauben, die digitale Revolution<br />
liefere ihnen nun den Hammer, um 150 Jahrte sozialen<br />
Fortschritt zu zertrümmern. Marc Rezzonico beschreibt<br />
(Seite 13), wie per digitaler Heimarbeit und Plattformen<br />
gesicherte Arbeitsverträge abgeschafft werden und die Begrenzung<br />
der Arbeitszeit immer schwieriger <strong>wir</strong>d. Der zu<br />
erledigende Auftrag <strong>wir</strong>d das Mass. Doch weil das Kräfteverhältnis<br />
einer Plattform-Wirtschaft sehr einseitig zugunsten<br />
der Auftraggeber ausfällt, <strong>wir</strong>d die Arbeitszeit via<br />
Arbeitslast rasch zunehmen.<br />
Die Verfügung über<br />
die eigene <strong>Zeit</strong> ohne<br />
ökonomischen Zwang<br />
ist ein Mass <strong>unsere</strong>r<br />
Freiheit.<br />
So stellen sich für die Gewerkschaften in ihrem Vorhaben,<br />
für die Arbeitenden <strong>Zeit</strong>autonomie zu gewinnen,<br />
neue Herausforderurungen.<br />
In den Kollektivverträgen sollten Arbeitszeitverkürzungen<br />
durchgesetzt werden. Allein schon, um neue Jobs<br />
zu schaffen (wie es in Frankreich mit der 35-Stunden-<br />
Woche gelang). Ziel: die schwindende Lohnarbeit der<br />
Wirtschaft 4.0 besser zu verteilen. Dies muss ohne Einkommensverlust<br />
geschehen. Möglichst viele der neuen<br />
Arbeitsformen gehören deshalb einem universellen Arbeitsvertrag<br />
unterstellt. Schwierigster Part: <strong>syndicom</strong><br />
muss die Arbeitslast in ein Verhältnis zur Arbeitszeit stellen.<br />
Da hatte es Thomas Morus doch vergleichsweise einfach.<br />
seco.admin.ch –> Arbeit –> Merkblätter und Checklisten
Dossier<br />
Arbeitszeit ist das eine. Doch es<br />
geht auch um Arbeitsbelastung<br />
13<br />
Mit der Digitalisierung verschwimmen die<br />
üblichen arbeitsrechtlichen Standards.<br />
Wer kürzere Arbeitszeiten will, muss den<br />
digitalen Akkord bekämpfen.<br />
Text: Marc Rezzonico<br />
Immer mehr Beschäftigte haben keinen genau definierten<br />
«Arbeitsort» mehr, sondern arbeiten auch von zu Hause<br />
aus oder unterwegs. Die «Arbeitsverträge» enthalten<br />
nicht mehr die üblichen Bedingungen und Zusicherungen.<br />
Vor allem aber scheint die für die Definition der<br />
«Work-Life-Balance» so grundlegende «Arbeitszeit» plötzlich<br />
ihr Alter Ego – die «Freizeit» – vereinnahmt zu haben.<br />
Sie nimmt heute nicht nur die Arbeitstage, sondern auch<br />
die Wochenenden und Ferien der Beschäftigten voll und<br />
ganz in Anspruch.<br />
Statt Work-Life-Balance heisst es nun Work-Life: Alles<br />
verschwimmt! Wenn Privat- und Berufsleben nicht mehr<br />
getrennt, sondern vermischt werden (Blending) – wie<br />
sollen der Staat oder die Gewerkschaften Arbeitsmodelle<br />
vorschlagen, bei denen die «Arbeitszeit» eine Rolle spielt?<br />
Die Grenzlinien verwischen sich.<br />
Was tun?<br />
Auf der Suche nach den Grundlagen für die neuen Arbeitsgesetze<br />
haben verschiedene europäische Länder Thinktanks<br />
(beispielsweise den WRR in den Niederlanden),<br />
Arbeitsgruppen zur Industrie 4.0 (Deutschland), Aktionspläne<br />
(wie Digital Belgium) oder Strategiepläne für die<br />
Digitalisierung (Grossbritannien) aktiviert und Berichte<br />
über den digitalen Wandel erstellt (etwa den Mettling-<br />
Bericht in Frankreich). In Dänemark wurde vor Kurzem<br />
gar der weltweit erste Tech-Botschafter ernannt und die<br />
#techplomacy erfunden.<br />
Konkrete Ergebnisse lassen aber noch auf sich warten.<br />
Nur eines ist klar: Aus der Schweiz werden sie nicht<br />
stammen, denn der Bundesrat hat zwar 2017 einen Bericht<br />
über den Stand der vierten industriellen Revolution<br />
verabschiedet, darin aber beschlossen, an seiner Position<br />
von 2016 festzuhalten. Das bedeutet: Der Bund <strong>wir</strong>d weder<br />
direkt noch finanziell noch über die Schaffung einer entsprechenden<br />
Verwaltungsstelle in den Prozess der Digitalisierung<br />
der Wirtschaft eingreifen.<br />
Ist wenigstens klar, in welche Richtung es geht?<br />
Die Vermischung von Privatem und Geschäftlichem – das<br />
Blending oder Blurring – ist genau das Arbeitsmodell, auf<br />
das Google und die übrigen Firmen des Silicon Valley so<br />
stolz sind. Das Prinzip von Leistung und Gegenleistung:<br />
Der Arbeitgeber kann von den Angestellten mehr Flexibilität<br />
fordern, weil er ihnen gewisse Freiheiten gewährt.<br />
Diese Freiheit ist eine Illusion, wie unser Dossier zeigt.<br />
In der Realität verlagert sich das Kräfteverhältnis in<br />
Richtung der Arbeitgeber, wenn die Unterscheidung<br />
zwischen Arbeits- und Freizeit aufgehoben <strong>wir</strong>d.<br />
Weil die <strong>Zeit</strong> kein entscheidender Faktor mehr ist,<br />
<strong>wir</strong>d automatisch die «Arbeitsbelastung» zentral. Aber wie<br />
misst man diese? Gemäss der ANACT (Agence nationale<br />
française pour l’amélioration des conditions de travail –<br />
Französische nationale Agentur zur Verbesserung der<br />
Arbeitsbedingungen) lässt sich die Arbeitsbelastung<br />
mithilfe eines Modells messen, das folgende drei Dimensionen<br />
umfasst: (quantitative und qualitative) Vorgaben,<br />
tatsächliche Belastung (was Einzelpersonen und Gruppen<br />
effektiv realisieren) und subjektive Wahrnehmung (wie<br />
die Beschäftigten ihre eigene Arbeitsbelastung bewerten).<br />
Das ist nur ein Vorschlag, aber das Problem der<br />
«Arbeitszeit» in der digitalen Wirtschaft könnte ein Problem<br />
sein, das überdacht werden muss. Wenn die Gewerkschaften<br />
die Arbeit in der digitalen Revolution mitgestalten<br />
möchten, müssen sie die Arbeitsbelastung in ihre<br />
Überlegungen und Strategien einbeziehen, auch wenn sie<br />
weiterhin für eine angemessenere «Arbeitszeit» kämpfen.<br />
Ein Beispiel: In der Jobstudie von Ernst & Young von<br />
2016 gab knapp jeder zweite Befragte an, dass die Anforderungen<br />
am Arbeitsplatz in den letzten Jahren gestiegen<br />
sind. Für jeden siebten Beschäftigten haben sie gar «stark<br />
zugenommen». Wie man sieht, ist die Arbeitszeitreduktion<br />
nur die halbe Frage. Man müsste von der Arbeitsbelastung<br />
während einer definierten Arbeitszeit sprechen.<br />
goo.gl/ByquzW<br />
verdi-Studie: goo.gl/PwPQo5
14<br />
Dossier<br />
Schuften bis zum Umfallen.<br />
Darum ist Flexibilisierung Betrug.<br />
Während überall Experimente mit kürzeren<br />
Arbeitszeiten blühen, greifen Arbeitgeber das<br />
Sozialmodell an. Sie fordern die Entgrenzung<br />
der Arbeit und Mehrarbeit. Gratis.<br />
Oliver Fahrni<br />
Was sollte man schon gegen Flexibilisierung haben? Der<br />
Begriff suggeriert Freiheit. Es ist doch fein, wenn ich im<br />
März Überstunden akkumulieren kann, dafür im Mai ein<br />
paar Freitage nehme, und morgen früh komme ich später,<br />
weil ich mit der Klassenlehrerin meiner Tochter sprechen<br />
will.<br />
Seien <strong>wir</strong> nicht naiv. Unsere Bedürfnisse spielen bei<br />
der Flexibilisierung keine Rolle. Sie dient den Unternehmen<br />
dazu, <strong>unsere</strong> Arbeit an eine möglichst profitable<br />
Betriebsführung (zum Beispiel an die Auftragslage) anzupassen,<br />
Lohnkosten und andere Kosten zu senken und<br />
heimlich die Arbeitszeiten zu erhöhen.<br />
Die Länge der Arbeitszeiten und der Takt (Rhytmus,<br />
Schichteinteilung usw.) <strong>unsere</strong>r Arbeit unterliegen dem<br />
Kräftevehältnis zwischen Arbeit und Kapital. Am Ende<br />
bestimmt immer das Unternehmen, wann ich arbeiten<br />
muss, wann länger als die Normalarbeitszeit, und ob ich<br />
im Mai <strong>wir</strong>klich kompensieren kann.<br />
Flexibilisierung der Arbeit ist das grosse Dada der<br />
Arbeitgeber. Im Kern geht es darum, <strong>unsere</strong> Arbeit mit<br />
möglichst wenig Regeln (die uns schützen) zu vermarkten.<br />
Dafür haben Betriebs<strong>wir</strong>tschafter Dutzende von<br />
Formen erfunden.<br />
Feilschen um <strong>Zeit</strong>formen, Pausen, Schichtorganisation,<br />
Ausnahmen bei der Arbeitszeit usw. <strong>wir</strong>d sichergestellt,<br />
dass <strong>wir</strong> <strong>unsere</strong> Arbeit und <strong>unsere</strong> Freizeit verlässlich<br />
planen können. Das Schweizer Arbeitsgesetz leistet das<br />
nicht. Es ist so lasch, dass es fast alles zulässt, was die Aktionäre<br />
freut. Der Link auf dieser Seite führt zu den wichtigsten<br />
Bestimmungen. Eine ernüchternde Lektüre.<br />
Dennoch versuchen die Arbeitgeber heute, auch<br />
diesen schwachen Schutz auszuhebeln. Drei Punkte<br />
stehen auf ihrer Agenda: Die Erhöhung der Arbeitszeit.<br />
Die Abschaffung der Arbeitszeitkontrolle. Und die Aufweichung<br />
der Arbeitsverträge. Strategisches Ziel ist dabei, die<br />
Trennung zwischen Arbeit und Freizeit zu beenden, also<br />
die Verfügungsmacht über die Arbeitenden auszudehnen.<br />
Auch hier argumentieren sie mit der Freiheit. Absurd: Will<br />
ich 60 Stunden ohne Lohnzuschlag arbeiten, zieht mir<br />
heute niemand den Stecker. Das Gesetz soll umgeschrieben<br />
werden, damit man die Arbeitenden zur Gratismehrarbeit<br />
zwingen kann. Fernziel: Outsourcing der Arbeit in<br />
neue Formen von Heimarbeit (Crowdworking usw.) ohne<br />
Arbeitszeitvorschriften.<br />
Da steht den Gewerkschaften eine harte Konfrontation<br />
bevor. Sie wollen im Gegenteil die Normalarbeitszeit<br />
rabiat reduzieren, um die schwindende Menge digitalisierter<br />
Arbeit besser auf alle zu verteilen.<br />
goo.gl/v9JBMM<br />
Wachstum und Gewinn ohne Arbeit<br />
Gleitarbeitszeit mit Kernzeiten sind noch deren mildeste<br />
Form. Über <strong>Zeit</strong>konten (etwa aufs Jahr) arbeiten <strong>wir</strong> nur,<br />
wenn das Unternehmen uns braucht. Damit <strong>wir</strong>d uns ein<br />
Teil des Unternehmerrisikos aufgebürdet, was eigentlich<br />
illegal ist. Vertrauensarbeitszeit trägt ihren Namen<br />
schlecht. Sie ist meistens eine Form von Betrug, die<br />
«de-facto-Verlängerung der Arbeitszeiten ohne jeg liche<br />
zeitliche oder finanzielle Kompensation», sagt die<br />
Arbeitsforscherin Christa Herrmann. Bei flexibler<br />
Arbeitszeit fallen die Lohnzuschläge weg. Vertrauensarbeitszeit<br />
<strong>wir</strong>d oft mit Produktionsinseln kombiniert, etwa<br />
in den Arbeitsformen des Toyotismus. Reicht den Unternehmen<br />
diese interne Flexibilisierung nicht, richten sie<br />
Arbeit auf Abruf ein oder greifen auf Outsourcing <strong>zurück</strong> –<br />
heute eine grassierende Form externer Flexibilisierung.<br />
In fast allen Betrieben der Schweiz <strong>wir</strong>d heute eine Kombination<br />
diverser Formen von Outsourcing, flexiblem<br />
Arbeitseinsatz und verdichtetem Arbeitstakt eingesetzt.<br />
Das ist das Resultat des neoliberalen Umbaus, der in<br />
der Schweiz in den 198oer-Jahren begann. Den Neoliberalen<br />
geht es darum, den Schutz der Arbeit durch Gesetz und<br />
Gewerkschaften zu zerstören. Ihr Traum ist Wachstum<br />
und Gewinn ohne Arbeit. Eine Illusion, weil nur lebendige<br />
Arbeit Wert schafft. Seither geben die Besitzer der<br />
Unternehmen die Produktivitätsgewinne nicht mehr<br />
weiter. Diese Verteilung war die Grundlage der Sozialpartnerschaft.<br />
Folgen: Die Löhne stagnieren, der Lohnkostenanteil<br />
sinkt in fast allen Branchen, und die Lohnund<br />
Vermögensdiskrepanzen explodieren. Darum sind<br />
Gesamtarbeitsverträge so wichtig. Im detailreichen<br />
Fotostrecke<br />
Das Titelbild, die Fotos auf den Seiten 8 bis 14 und das Bild im<br />
Inhaltsverzeichnis hat der Waadtländer Fotograf Thierry<br />
Porchet geschaffen. Dafür hat er sich eine aufwen dige<br />
Inszenierung einfallen lassen: Er bat den Multijobber Bernard<br />
Fière, der auch schon als Industrietaucher gearbeitet hat,<br />
frühmorgens in ein Becken des Thermalbades von Yverdonles-Bains<br />
zu steigen.<br />
Für Porchet, in der Romandie ein bekannter Meister seines<br />
Fachs, ist <strong>Zeit</strong> eine Materie im Fluss, wie Licht oder Wasser.<br />
In seinen Bildern verschmelzen Arbeitszeit und freie <strong>Zeit</strong>.<br />
Wir danken Laure Favre, der Marketingverantwortlichen der<br />
Bäder von Yverdon, für die Unterstütung.<br />
Mehr Einsichten in die Arbeit von Thierry Porchet: image21.ch
Freie <strong>Zeit</strong>, <strong>Zeit</strong> ohne Lohnarbeit, ist ein Menschenrecht. <strong>Zeit</strong> für Familie, Kultur<br />
und Nichtstun, für gesellschaftliches Leben und Engagements. Sie musste in<br />
ungezählten Kämpfen erobert werden – <strong>unsere</strong> wichtigste Errungenschaft.<br />
15<br />
Der Kampf für freie <strong>Zeit</strong><br />
1864:<br />
12 Stunden<br />
Glarner<br />
Fabrikgesetz<br />
1871:<br />
10,5 Stunden<br />
Maschinenindustrie<br />
1917:<br />
59-h-Woche<br />
Eidg.<br />
Fabrikgesetz<br />
1920:<br />
48-h-Woche<br />
In diversen<br />
Branchen<br />
1815:<br />
12–14 Stunden<br />
ZH Kinderarbeit<br />
1848:<br />
15 Stunden<br />
Glarus<br />
1870:<br />
10 Stunden<br />
Typographen,<br />
Uhren<br />
1877:<br />
11 Stunden<br />
Eidg. Fabrikgesetz<br />
1899:<br />
10 Stunden<br />
1. Mai-<br />
Forderung<br />
1909:<br />
8 Stunden<br />
Maschinensetzer<br />
1918:<br />
48-h-Woche<br />
Forderung<br />
Landesstreik<br />
um 1830 1900 2010<br />
1930:<br />
48-h-Woche<br />
Wird üblich<br />
1958:<br />
46-h-Woche<br />
SMUV-GAV<br />
4500 Jahresstunden 2700 1931<br />
1959:<br />
44 Stunden<br />
SGB-Initiative<br />
Gesetz: 46 h–50 h<br />
1963:<br />
44-h-Woche<br />
GAV<br />
Maschinen<br />
1971:<br />
44 h und mehr<br />
50 % arbeiten<br />
länger<br />
1971:<br />
40-h-Woche<br />
POCH-Initiative,<br />
1976 abgelehnt<br />
1983:<br />
40-h-Woche<br />
SGB-Initiative<br />
1979:<br />
40-h-Woche<br />
Typographen-<br />
Vertrag<br />
1988:<br />
40-h-Woche<br />
MEM-GAV<br />
2010:<br />
41,6-h-Woche<br />
Reale Arbeitszeit<br />
Quelle: Historisches Lexikon<br />
Arbeitszeit ist jener Teil <strong>unsere</strong>r Lebenszeit, den <strong>wir</strong> einem Unternehmer gegen Lohn zur Verfügung<br />
stellen. Wir tun dies nicht freiwillig. Mit der Lohnarbeit bezahlen <strong>wir</strong> <strong>unsere</strong>n Lebensunterhalt und alles,<br />
was damit zusammenhängt, etwa die Altersvorsorge oder die Ausbildung <strong>unsere</strong>r Kinder. In der Arbeitsdauer<br />
zeigt sich unverhüllt das Machtverhältnis zwischen Arbeit und Kapital. Seit dem 19. Jahrhundert<br />
haben die Arbeitenden die Verkürzung der Arbeitszeit um mehr als die Hälfte erzwungen. Von 15 Tagesstunden<br />
zum 8-Stunden-Tag. Von der 6½-Tage-Woche zur 5-Tage- Woche. Von null auf 5 Wochen Ferien.<br />
© Grafiken: Tom Hübscher und Lars Weiss, tnt-graphics<br />
Soviel arbeiten <strong>wir</strong> jede Woche<br />
Vollzeitstelle, Arbeitszeit in Stunden<br />
Frankreich<br />
Finnland<br />
Italien<br />
Schweden<br />
Spanien<br />
Deutschland<br />
Schweiz<br />
Grossbritannien<br />
Griechenland<br />
Quelle: Eurostat, BfS Zahlen für 2016<br />
* nach Eurostat<br />
37,6<br />
37,9<br />
38,2<br />
38,7<br />
39,1<br />
40,3<br />
nach BFS 41,2 42,8*<br />
42,8<br />
30 32 34 36 38 40 42 44<br />
44,6<br />
In der Schweiz <strong>wir</strong>d länger gearbeitet als anderswo, weit<br />
über 40 Stunden pro Woche bei einer Vollzeitstelle. Länger<br />
etwa als in Deutschland, und sogar gut einen halben Tag<br />
mehr pro Woche als in Frankreich. Schlimmer: Der Trend geht<br />
derzeit Richtung verlängerte Arbeitszeiten. 2017 ist die Zahl<br />
der tatsächlich geleisteten Stunden zum ersten Mal seit<br />
vielen Jahren gestiegen.<br />
So lange <strong>wir</strong>d pro Jahr gearbeitet<br />
Durchschnittliche Zahl Arbeitsstunden pro beschäftigte Person<br />
Deutschland<br />
Frankreich<br />
Schweiz<br />
Spanien<br />
Japan<br />
Italien<br />
USA<br />
Russland<br />
Griechenland<br />
Quelle: OECD 2014, Zahlen für 2012<br />
1393<br />
1479<br />
1619<br />
1666<br />
1745<br />
1752<br />
1790<br />
1982<br />
0 500 1000 1500 2000<br />
2034<br />
Die Zahl der geleisteten Jahresarbeitsstunden variiert je<br />
nach Land stark. Das liegt nicht nur an den Ferientagen.<br />
Die erstaunlichen Unterschiede zeigen auch die krasse<br />
Ungleichverteilung der Lohnarbeit. Weisen die fleissigen<br />
Deutschen oder Schweizer weniger Stunden auf, spiegelt<br />
dies auch die Zunahme der Teilzeitjobs – sie sind oft eine<br />
unfreiwillige Unterbeschäftigung, vor allem von Frauen.
16<br />
Eine bessere<br />
Arbeitswelt<br />
Die Schweiz ist kein<br />
Sonderfall. Nehmen <strong>wir</strong><br />
die rosa Brille runter.<br />
In der Schweiz lässt es sich ganz<br />
ordentlich leben. Meistens und für die<br />
meisten jedenfalls. Etwas verwundert<br />
beobachten <strong>wir</strong>, wie drei Viertel der<br />
Italienerinnen und Italiener ihr Land<br />
in ein Trumpistan verwandeln wollen,<br />
obschon die linke Regierung gerade<br />
das Wachstum <strong>zurück</strong>gebracht hat.<br />
Entsetzt beobachten <strong>wir</strong>, wie in<br />
Deutschland die Armut der Arbeitenden<br />
wächst – und mit ihr die AfD.<br />
Kopfschüttelnd sehen <strong>wir</strong> das rasende<br />
Tempo, mit dem der französische<br />
Präsident die 35 Stunden, den Service<br />
public und die soziale Sicherheit demontiert.<br />
Die neoliberale Dampfwalze<br />
hat wieder Fahrt aufgenommen.<br />
Nur in der Schweiz nicht? Eine<br />
optische Täuschung. Freisinnige nehmen<br />
die PostAuto-Affäre zum Anlass,<br />
eine neue Privatisierungswelle anzustossen.<br />
Der Gewerbeverband will uns<br />
50 Wochenstunden arbeiten lassen,<br />
Avenir Suisse möchte die GAV und die<br />
AHV killen. Bei SBB, Post, Swisscom,<br />
SRG laufen heftige Sparprogramme.<br />
Und noch etwas teilen <strong>wir</strong> mit Italien,<br />
Deutschland, Frankreich: Hier<br />
wie dort sind die Gewerkschaften die<br />
wichtigste Kraft geworden, um den sozialen<br />
Fortschritt zu verteidigen.<br />
Ende Idyll: FDP und SVP nutzen die PostAuto-Affäre für eine neue Attacke auf den Service public.<br />
Stresstest für den Service public:<br />
goo.gl/K1MRp1<br />
Stop Lohndumping: Der<br />
Gewerkschaftsbund<br />
Bern gibt den Takt vor.<br />
Lohndumping ist illegal. Und dreifach<br />
pervers: Weil tiefe Löhne die Arbeitenden<br />
in Not stürzen. Weil der Volks<strong>wir</strong>tschaft<br />
Kaufkraft entzogen <strong>wir</strong>d und<br />
die Sozial versicherungen Beiträge<br />
verlieren. Und weil Lohn dumping ein<br />
politisches Klima schafft, das Fremdenfeinden<br />
und den Rechtsradikalen<br />
der SVP nützt, die <strong>unsere</strong> geregelten<br />
Beziehungen zu den europäischen<br />
Nachbarn kippen wollen.<br />
Unternehmen organisieren den<br />
Lohnbeschiss mit Subunternehmerketten.<br />
Ein Auftrag <strong>wir</strong>d an ein anderes<br />
Unternehmen weitergegeben, das<br />
ihn wiederum weiterreicht. Solche<br />
Ketten können über viele Stufen gehen.<br />
Unterwegs <strong>wir</strong>d auf jeder Stufe<br />
Gewinn abgeschöpft und der Preis gedrückt.<br />
Am Ende der Kette werden nur<br />
noch Hungerlöhne bezahlt. Auch<br />
öffentliche Unternehmen greifen zu<br />
dieser Praxis. Das will der Gewerkschaftsbund<br />
des Kantons Bern nun<br />
per Volksinitiative unterbinden.<br />
Für alle Aufträge, die im öffentlichen<br />
Beschaffungswesen vergeben<br />
werden, muss künftig das Unternehmen,<br />
das den Auftrag erhält, ihn selbst<br />
ausführen. Zu GAV-Löhnen.<br />
Diese Initiative ist einfach, <strong>wir</strong>ksam<br />
und gerecht. Bitte nachmachen.<br />
srf.ch/news/schweiz/wenn-subunternehmerketten-die-loehne-druecken
«Der Bundesrat trägt die Verantwortung für die Zerstörung<br />
von fast 1400 Stellen in zwei Jahren bei Swisscom.» Giorgio Pardini<br />
17<br />
Jobs weg für Boni und die fette<br />
Dividende des Bundes<br />
Swisscom soll 100 Millionen Franken sparen, 700 Stellen werden<br />
gestrichen. Trotz Milliardengewinn. Das verlangt der<br />
grösste Aktionär, der Bund. Er will den öffentlichen Betrieb<br />
weiter melken. Eine bizarre Vorstellung von Service public.<br />
Der Unmut wächst. Scharfe Worte<br />
machen sich Luft. Widerstand gärt.<br />
Wenn am 4. April die Aktionäre des<br />
Swisscom-Konzerns zur Generalversammlung<br />
zusammentreten, werden<br />
sich die Geschäftsleitung und vor<br />
allem der Hauptaktionär, der Bund,<br />
warm anziehen müssen. Mehrere<br />
Aktionäre wollen nicht mehr hinnehmen,<br />
dass Swisscom 2018 ein<br />
verschärftes Sparprogramm fährt und<br />
dafür weitere 700 Stellen zerstört. Dies<br />
bei einem Betriebsergebnis von<br />
4,3 Milliarden und einem Reingewinn<br />
von 1,57 Milliarden Franken.<br />
Schon 2017 hatte der ICT-Riese<br />
684 Jobs gestrichen. Giorgio Pardini,<br />
Leiter des Sektors ICT bei <strong>syndicom</strong>,<br />
nennt das «eine Renditestrategie auf<br />
dem Buckel des Personals». Für die<br />
Jahre 2018 bis 2020 hat Swisscom jetzt<br />
das Sparziel von 60 auf 100 Millionen<br />
Franken erhöht. Pro Jahr.<br />
Ohne Not werden hier Arbeit und<br />
das hohe Wissen von Mitarbeitenden<br />
vernichtet. Der Konzern ist gut aufgestellt.<br />
Die Verschuldung ist mässig,<br />
die Substanz enorm, und Swisscom<br />
konnte 2017 fast 2400 Millionen in<br />
neue Infrastrukturen investieren. Der<br />
Glasfaserausbau kommt schnell voran,<br />
und jetzt <strong>wir</strong>d 5G aufgelegt.<br />
<strong>syndicom</strong> fordert, den harten Spardruck vom<br />
Swisscom-Personal wegzunehmen. (© Swisscom)<br />
ICT-Fachorgane nennen das Swisscom-Netz<br />
im internationalen Vergleich<br />
«exzellent». Sogar die PK meldet<br />
stolze fünf Prozent Ertrag.<br />
Milchkuh mit prallem Euter<br />
Swisscom geht es so gut, dass sie<br />
immer wieder Privatisierungsgelüste<br />
weckt – erst gerade wieder, 2016.<br />
Dass es bei der Sparstrategie um<br />
höhere Renditen geht, zeigt das<br />
Verhältnis von zwei Kennzahlen: Bei<br />
sinkenden Margen in einem hart<br />
umkämpften Markt und stabilem Umsatz<br />
(11,7 Milliarden) hat Swisscom ihren<br />
Reingewinn fast halten können.<br />
Und zahlt eine unverändert hohe Dividende<br />
aus.<br />
Genau da setzt die Kritik der<br />
Gewerkschaft an. Pardini sieht den<br />
Bundesrat als Hauptverantwortlichen<br />
für die andauernde Jobvernichtung.<br />
Die Eidgenossenschaft hält 51 Prozent<br />
der Aktien. Da fallen für 2017 gut 600<br />
Millionen Franken Dividende ab.<br />
Swisscom ist eine Milchkuh, die der<br />
Bundesrat weiter melken will. Er hat<br />
dem Konzern mindestens die Werterhaltung,<br />
besser eine Wertsteigerung<br />
ins Pflichtenbuch geschrieben. Jahr<br />
um Jahr werden die Ziele hochgeschraubt.<br />
Das Parlament nickt das ab.<br />
Dass ein Betrieb des Service public<br />
Leute entlässt oder nicht mehr ersetzt,<br />
um den hohen Gewinn zu halten,<br />
nennt Pardini «nicht mehr vernünftig».<br />
Es ist eine milde Umschreibung.<br />
Tatsächlich stelle sich «hier wie bei<br />
der Post und der SBB ein politisches<br />
Grundproblem: Erste Aufgabe eines<br />
öffentlichen Betriebes kann nicht<br />
sein, möglichst viel Geld zu machen.<br />
Im Vordergrund muss der Dienst an<br />
der Allgemeinheit stehen.» Konkret:<br />
Ausbau der Infrastruktur, vernünftige<br />
Preise, eine nachhaltige Digitalisierungsstrategie.<br />
Und intern, so Pardini,<br />
«ist eine umfassende Weiterbildungsoffensive<br />
nötig».<br />
Heute ist die Gewerkschaft froh,<br />
dass sie die Nachbesserung des Sozialplans<br />
2013 durchgesetzt hat. Der Stellenabbau<br />
trifft vor allem erfahrene<br />
Leute. Pardini: «Zusammen mit dem<br />
steigenden Druck durch die neuen<br />
Managementsysteme setzt das eine<br />
Abwärtsspirale in Gang.Jetzt muss der<br />
Spardruck gelockert werden.»<br />
goo.gl/6tv5GB<br />
Unsere <strong>Zeit</strong> ist mehr<br />
wert<br />
Schweden testet den 6-Stunden-Arbeitstag<br />
bei vollem Lohn und macht<br />
gute Erfahrungen damit. Die Produktivität<br />
ist nicht gesunken – im Gegenteil,<br />
die Verkürzung der Arbeitszeit ist<br />
der Arbeitsleistung zuträglich, und<br />
den Menschen geht es gesundheitlich<br />
besser. Sie sind motivierter und haben<br />
weniger Absenz- und Krankentage.<br />
Die Arbeitgeber müssen zusätzliches<br />
Personal einstellen. Das kostet. Andererseits<br />
steigt die Produktivität, und<br />
die Kosten für Arbeitslosengeld,<br />
So zialhilfe und Krankheit sinken. Und<br />
es bleibt mehr <strong>Zeit</strong> für Freizeit und<br />
familiäre Betreuungsaufgaben.<br />
Elinor Odeberg von der schwedischen<br />
Gewerkschaft Kommunal<br />
betonte aber am SGB-Frauenkongress<br />
im Januar, Arbeitszeitverkürzung sei<br />
nicht die einzige Antwort auf die<br />
Abwesenheit der Männer in der<br />
Hausarbeit oder die erzwungene Teilzeitarbeit<br />
von Frauen. Denn Untersuchungen<br />
zeigten, dass die verwurzelten<br />
Rollenbilder dazu führten, dass<br />
auch bei ähnlichem Einkommen die<br />
Frauen die unbezahlte Care-Arbeit<br />
übernehmen und dafür manchmal<br />
sogar Teilzeit arbeiten. Der SGB-Frauenkongress<br />
hat unter Teilnahme von<br />
über zwanzig <strong>syndicom</strong>-Frauen eine<br />
Re solution verabschiedet, die fordert:<br />
«maximal 35 Stunden Vollzeit statt<br />
Teilzeitfalle».<br />
Patrizia Mordini, Leiterin Gleichstellung,<br />
Mitglied der Geschäftsleitung
18 Arbeitswelt<br />
Die SDA-Belegschaft erfährt in ihrem Kampf von anderen<br />
Redaktionen und aus der Politik starke Unterstützung.<br />
Streik bei der sda: «Wir sind<br />
nicht für Profite da!»<br />
Während dieser Artikel entsteht, ist der Streik der SDA-Redaktion<br />
«sistiert». Warum die Schweizerische Depeschenagentur so<br />
wichtig ist für die Medien und die Menschen in diesem Land.<br />
Das Debakel begann schon vor Monaten.<br />
Im Hintergrund sogar noch früher,<br />
als die Verlage beschlossen, mit<br />
ihrer Schweizerischen Depeschenagentur<br />
SDA künftig dickes Geld zu<br />
machen.<br />
Jetzt bedroht das Missmanagement<br />
der Besitzer die Existenz der<br />
ältesten und letzten Schweizer Nachrichtenagentur.<br />
36 von 150 Vollzeitstellen<br />
wollen sie zerstören. Das ist ein<br />
Viertel der Redaktion. So kann die<br />
Agentur ihre Aufgabe nicht mehr<br />
wahrnehmen. Wer liefert dann die<br />
Grundversorgung der Schweizer Medien<br />
mit Nachrichten aus dem In- und<br />
Ausland, aus Politik, Wirtschaft, Sport<br />
und Kultur?<br />
Entlassen <strong>wir</strong>d mit den Journalistinnen<br />
und Journalisten viel Wissen,<br />
Können und Erfahrung. Gehen sollen<br />
vor allem die Älteren, die besser verdienen<br />
als jene, die frisch von der Uni<br />
kommen. Anständige Frühpensionierungen<br />
sehen die Besitzer nicht vor.<br />
Schliesslich habe man jahrelang in die<br />
Arbeitslosenversicherung einbezahlt,<br />
meinte der SDA-CEO in einem Interview<br />
schnoddrig. Jetzt sollen das RAV<br />
und die Steuerzahlenden für die Entlassenen<br />
aufkommen. Manchen droht<br />
der bittere Gang aufs Sozialamt.<br />
Rückgrat der freien Information<br />
Entstanden ist die Schweizerische<br />
Depeschenagentur vor bald 125 Jahren,<br />
am 1. Januar 1895, als Reaktion<br />
auf die marktbeherrschende Stellung<br />
ausländischer Nachrichtenagenturen<br />
in der Schweiz. Sie befindet sich im<br />
gemeinsamen Besitz verschiedener<br />
Medienunternehmen. Den weitaus<br />
grössten Teil der Aktien teilen sich Tamedia,<br />
die NZZ-Gruppe, die SRG und<br />
der Westschweizer Verlegerverband<br />
Die SDA ist eine Form<br />
von Service public,<br />
der für die Meinungsbildung<br />
von zentraler<br />
Bedeutung ist.<br />
«Médias Suisses». Die grössten Besitzer<br />
der SDA sind gleichzeitig ihre<br />
grössten Kunden – da liegt das Problem<br />
begraben.<br />
Der SDA ging es bis vor kurzem<br />
finanziell gut. Mit dem Aufkommen<br />
der Gratisblätter und der Onlinemedien<br />
hatte sie neue Kunden gewonnen.<br />
Rendite musste sie keine abwerfen.<br />
Denn schliesslich war die SDA ein gemeinsamer<br />
Dienst, der einen unabhängigen<br />
Informationsfluss sicherte.<br />
Eine Form von Service public, für die<br />
Meinungsbildung in einer Demokratie<br />
von zentraler Bedeutung. Weil die<br />
SDA keine Dividenden ausschüttete,<br />
konnte sie über die Jahrzehnte 20 Millionen<br />
Franken Reserven ansammeln.<br />
230 000 Depeschen pro Jahr<br />
Die Bedeutung des Nachrichtendienstes<br />
nahm angesichts des Niedergangs<br />
der Qualitätspresse zu. Wo die Verleger<br />
ihre Redaktionen schrumpfen,<br />
zusammenlegen und kleinsparen,<br />
sinkt die Eigenleistung der betroffenen<br />
<strong>Zeit</strong>ungen. Die Lücken werden<br />
mit Agenturmaterial gefüllt. Gegen<br />
230 000 Meldungen verschickt die<br />
SDA pro Jahr. Sie sind sauber recherchiert,<br />
mehrfach abgesichert und bemühen<br />
sich um Neutralität.<br />
So bilden sie die Grundversorgung<br />
der Schweiz mit Nachrichten und Hintergrundberichten.<br />
Schätzungsweise<br />
ein Drittel der Berichten in Schweier<br />
Medien basiert auf mehr oder weniger<br />
stark ergänzten oder auch nur leicht<br />
umgeschriebenen Texten der SDA. Bei<br />
den Gratisblättern «Le Matin» und<br />
«20 minutes» von Tamedia in der<br />
Romandie machen sie um die 50 Prozent<br />
der Artikel aus. Online <strong>wir</strong>d viel<br />
SDA-Material sogar unverändert übernommen.<br />
Mit Ausnahme des Autorenkürzels<br />
(sda), das dabei gerne «vergessen»<br />
geht.<br />
Gespart <strong>wir</strong>d in den Medienhäusern<br />
weiterhin. Warum aber funktioniert<br />
das Geschäftsmodell der SDA<br />
plötzlich nicht mehr? Eben weil die<br />
Medienhäuser gleichzeitig Besitzer<br />
und Kunden sind.<br />
Als Besitzer kennen sie schon seit<br />
Jahren nur eine Strategie für ihre Medien:<br />
Journalistinnen entlassen, Fotografenpensen<br />
kürzen, <strong>Zeit</strong>ungen zusammensparen<br />
und Artikel zwei-,<br />
drei-, vier- oder möglichst zehnmal<br />
verwenden, ohne dafür zu zahlen. Sie<br />
nennen es «Contentmanagement».<br />
Als Kunden der SDA tun sie genau<br />
dasselbe: Sie weigern sich, die neuen<br />
Tarife zu zahlen.<br />
Jodeln in Bulgarien<br />
Ohne Rabatt, so drohten vor allem<br />
NZZ und AZ-Medien, würden sie eine<br />
billigere Konkurrenzagentur gründen,<br />
die «Bulgaria». Angedacht war die<br />
Auslagerung der Arbeit an «ehemalige<br />
Flüchtlinge, die lange genug in<br />
Deutschland gelebt und studiert haben,<br />
um die Sprache zu beherrschen,<br />
und nun in ihre Heimat in Osteuropa<br />
<strong>zurück</strong>gekehrt sind», wie es beim Korrektorat<br />
der NZZ-Gruppe heisst und<br />
bereits praktiziert <strong>wir</strong>d.<br />
Aus der Konkurrenzagentur <strong>wir</strong>d<br />
wohl nichts. Stattdessen wurde am<br />
30. Oktober 2017 die Fusion mit der<br />
Fotoagentur Keystone verkündet –<br />
gleichzeitig mit der Kündigung von<br />
SDA-Chefredaktor Bernard Maissen.
Nur weil die SDA verlässliche Nachrichten liefert, können die<br />
Medien ihren Informationsauftrag überhaupt erfüllen.<br />
19<br />
Wer uns <strong>unsere</strong> <strong>Zeit</strong><br />
stiehlt – kleine Liste<br />
in drei Teilen<br />
Arbeitgeber nehmen uns Arbeit weg<br />
In der Medienbranche veranstalten<br />
reiche Unternehmer Massenentlassungen<br />
oder schliessen ganze Betriebe:<br />
Der SDA-Verwaltungsrat will einen<br />
Viertel der Redaktion auf die Strasse<br />
stellen, und der Ringier-Verlag lässt<br />
die Druckerei in Adligenswil auf Ende<br />
Jahr vom Erdboden verschwinden.<br />
Arbeitskampf ist zeitintensiv<br />
Davon können die engagierten Kollegen<br />
und Kolleginnen der SDA-Redaktion<br />
ein Lied singen. Seit mehr als zwei<br />
Monaten wehren sie sich gegen die<br />
verheerenden Entscheide der Unternehmensspitze<br />
und sind am 30. Januar<br />
in Streik getreten. Nach vier Tagen<br />
konnte der Verwaltungsrat an den<br />
Verhandlungstisch gezwungen werden.<br />
Seither ist der Streik lediglich<br />
sistiert. Dieser Arbeitskampf ist noch<br />
nicht abgeschlossen.<br />
Journalismus braucht <strong>Zeit</strong><br />
Medien verlangen <strong>Zeit</strong>. So auch das<br />
neue Online-Magazin «Republik». Die<br />
vielen öfters langen Artikel liefern uns<br />
Einsichten und Denkstoff. Aber nur<br />
im Zusammenspiel mit der medialen<br />
Grundversorgung der SDA, die den<br />
anderen Medien verlässlichen, verifizierten,<br />
umfassenden Nachrichtenjournalismus<br />
aus allen Landesteilen<br />
liefert, können die <strong>Zeit</strong>ungen, Onlinemedien<br />
und Radio- sowie TV-Sender<br />
ihren Informationsauftrag erfüllen. .<br />
Stephanie Vonarburg ist Vizepräsidentin<br />
<strong>syndicom</strong> und leitet den Sektor Medien.<br />
Statt Transparenz über<br />
die finanzielle Lage gab<br />
es blaue Briefe. Die<br />
Redaktion hatte keine<br />
andere Wahl als Streik.<br />
Der CEO, Markus Schwaab, sprach<br />
nun plötzlich von 1,8 Millionen Franken<br />
Defizit, das sich wegen der Kundenrabatte<br />
im vergangenen Jahr angehäuft<br />
habe. Er warnte, in den<br />
kommenden zwei Jahren müsse ein<br />
Viertel der Stellen eingespart werden.<br />
Dann ging es Schlag auf Schlag: Im Dezember<br />
wurde bekannt, dass von der<br />
«neuen» SDA erwartet werde, Dividenden<br />
an die Aktionäre auszuschütten.<br />
Schwaab: «Die SDA ist nur ihren Aktionären<br />
etwas schuldig.»<br />
Ein Paradigmenwechsel: Bisher<br />
hatte man sich bei der Nachrichtenagentur<br />
als nicht profitorientiertes<br />
Unternehmen verstanden. Statt die<br />
echte Kostenstruktur offenzulegen,<br />
wie es die Angestellten am 8. Dezember<br />
in einer Resolution verlangten,<br />
liess Schwaab im Januar die Kündigungen<br />
verschicken.<br />
Die Betroffenen handelten. An<br />
diversen Redaktionsversammlungen<br />
organisierte sich das Personal, formulierte<br />
Forderungen an die Unternehmensleitung<br />
und machte die Vorgänge<br />
öffentlich. Doch Geschäftsleitung<br />
und Verwaltungsrat verweigerten das<br />
Gespräch.<br />
Schlimmer noch: Um die Zitrone<br />
ganz auszupressen, verlangten die<br />
grossen Medienhäuser (Tamedia und<br />
NZZ) die Auszahlung der Gewinnreserven,<br />
vor der Fusion mit Keystone.<br />
Streik mit starkem Echo<br />
Am 23. Januar beschlossen die Redaktionsmitglieder<br />
einen dreistündigen<br />
Warnstreik und traten schliesslich am<br />
30. Januar geschlossen in Streik. Aus<br />
anderen Redaktionen und aus der<br />
Politik kam und kommt viel Unterstützung.<br />
Allein, bei den Verantwortlichen<br />
stiess sie auf taube Ohren. Nachdem<br />
die Belegschaft mit Unterstützung der<br />
Gewerkschaften in Bern, Zürich und<br />
Lausanne vier Tage lang gestreikt hatte,<br />
bequemte sich der Verwaltungsrat<br />
endlich an den Verhandlungstisch.<br />
Verleger auf blindem Crashkurs<br />
Seit dem 2. Februar ist der Streik nun<br />
sistiert, aber nicht beendet. Die<br />
SDA-Journalistinnen und -Journalisten<br />
haben nicht nur eine breite Welle<br />
der Solidarität erfahren, sondern sich<br />
auch weiterhin zu Wort gemeldet. Sie<br />
schrieben offene Briefe an die Verwaltungsräte,<br />
versuchten auf dem Verhandlungsweg<br />
bessere Bedingungen<br />
auszuhandeln und besuchten am<br />
5. März die Fragestunde im Bundeshaus,<br />
um die Politiker und Politikerinnen<br />
von ihrem Einsatz für den Erhalt<br />
der SDA zu überzeugen. Je länger der<br />
Konflikt andauert, desto konkreter<br />
werden die Zerstörungspläne der<br />
SDA-Besitzer. Während die Angestellten<br />
um die Zukunft ihrer Agentur bangen<br />
und auf einen verbesserten Sozialplan<br />
für die Entlassenen hinarbeiten,<br />
igeln sich der Verwaltungsrat und die<br />
Geschäftsleitung wieder ein.<br />
Es ist höchste <strong>Zeit</strong>, dass die SDA<br />
aus dem profitorientierten Korsett<br />
herausgelöst <strong>wir</strong>d. Ein kleiner Anteil<br />
der Gebühren im Umfang von vier Millionen<br />
Franken würde kurzfristig eine<br />
Verschnaufpause geben, um den Basisdienst<br />
der SDA in drei Sprachen<br />
weiterzuführen. <strong>syndicom</strong> fordert die<br />
Politik auf, entsprechende Weichen<br />
zu stellen, bevor es zu spät ist.<br />
(Nina Scheu)<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/aktuell/
20 Arbeitswelt<br />
«Die minutengenaue Sequenzierung der Arbeitszeit führt zu<br />
Problemen. Unsere Aufgabe ist es, sie anzugehen.» Matteo Antonini<br />
Arbeitshetze im<br />
Minutentakt macht<br />
uns krank.<br />
Im frühen Kapitalismus wurde nicht<br />
die <strong>Zeit</strong> als Wert gesehen, sondern die<br />
Tätigkeit und ihr Produkt (Akkordlohnarbeit).<br />
Erst später, mit den sozialen<br />
Errungenschaften, ersetzte <strong>Zeit</strong>lohnarbeit<br />
die Akkordlohnarbeit: Nun<br />
wurde die Arbeitszeit als Normwert<br />
definiert. Die Akkordlohnarbeit ist jedoch<br />
nie aus dem Obligationenrecht<br />
verschwunden, und heute erleben <strong>wir</strong><br />
eine verheerende Rückkehr in die Vergangenheit,<br />
etwa durch die Uberisierung.<br />
Noch beunruhigender ist aber<br />
der Druck, der über die permanent erhöhten<br />
Produktivitätsanforderungen<br />
ausgeübt <strong>wir</strong>d. Die Zunahme der Berufskrankheiten,<br />
anerkannt oder auch<br />
nicht, ist eine Folge davon. Dazu kommen<br />
neue Arbeitsformen wie Temporärarbeit<br />
und die Unterbeschäftigung.<br />
Die minutengenaue Sequenzierung<br />
der Arbeitszeit führt in den<br />
verschiedenen Sektoren <strong>unsere</strong>r Organisation<br />
zu neuen Problemen wie<br />
Lohneinbussen oder erschwerter Vereinbarkeit<br />
von Berufs- und Privatleben.<br />
Es liegt in <strong>unsere</strong>r Verantwortung<br />
als Gewerkschaft, diese Herausforderungen<br />
im Interesse <strong>unsere</strong>r Mitglieder<br />
anzugehen. Um ihr Ausmass besser<br />
zu erfassen, haben <strong>wir</strong> eine Umfrage<br />
beim Vertriebspersonal lanciert.<br />
Danach werden <strong>wir</strong> <strong>unsere</strong> Forderungen<br />
zur Verbesserung der Situation<br />
definieren.<br />
Matteo Antonini ist Leiter des Sektors Logistik und<br />
Mitglied der <strong>syndicom</strong>-Geschäftsleitung<br />
Erfolgreich verhandelt:<br />
Löhne ICT ziehen an<br />
Bei UPC hält die Gewerkschaft derzeit still,<br />
um Jobs zu retten.<br />
Die Konjunktur zieht an. Die Lage der öffentlichen Finanzen<br />
ist besser als von den Regierungen erwartet. Die<br />
Teuerung regt sich wieder. Derweil explodieren die Krankenkassenprämien.<br />
Vor diesem Hintergrund fordern die SGB-Gewerkschaften<br />
generelle Lohnerhöhungen von bis zu 1,5% sowie einheitliche<br />
Frankenbeträge. Im Telecom- oder ICT-Sektor<br />
hat <strong>syndicom</strong> ihre Aufgabe erfüllt: Es wurde eine durchschnittliche<br />
Lohnerhöhung von 1,1% ausgehandelt.<br />
Im Einzelnen haben sich <strong>syndicom</strong> und Swisscom auf<br />
eine Lohnerhöhung von 1,1% für GAV-Mitarbeitende geeinigt.<br />
Die Anhebung der Löhne der Mitarbeitenden richtet<br />
sich nach ihrer Leistung und der Lage im Lohnband. Für<br />
die Mehrheit der Mitarbeitenden ist eine Lohnerhöhung<br />
von mindestens 0,5% pro Jahr festgelegt worden.<br />
Der Lohnabschluss bei Cablex sieht eine Steigerung der<br />
Lohnsumme 2018 um 1,1% vor. Der Ziellohn (bei erreichten<br />
Zielen) der Cablex-Mitarbeitenden <strong>wir</strong>d um 960 Franken<br />
pro Jahr erhöht. Dies entspricht einer monatlichen Lohnzunahme<br />
von bis zu 80 Franken ab dem 1. April 2018. Mit<br />
dem Erfolgsanteil im April 2019 <strong>wir</strong>d allenfalls noch der<br />
Rest der Lohnerhöhung ausbezahlt.<br />
Da sich UPC in einer schwierigen Phase befindet, hat<br />
<strong>syndicom</strong> bei den diesjährigen Lohnverhandlungen einer<br />
Nullrunde zugestimmt. Diese Zustimmung ist mit der<br />
Bedingung verbunden, dass das Unternehmen auf einen<br />
Stellenabbau möglichst verzichtet.<br />
Hingegen haben sich Sunrise und <strong>syndicom</strong> auf eine<br />
Lohnerhöhung von 1% geeinigt, nachdem sie auch den<br />
neuen GAV 2018–2021 abgeschlossen hatten.<br />
In der Hochburg<br />
der Sexisten<br />
Der Ständerat zementiert illegale,<br />
diskriminierende Lohnunterschiede.<br />
Anfang Monat hat der Ständerat eine Vorlage an die Kommission<br />
<strong>zurück</strong>gewiesen, welche die Unternehmen zur<br />
Lohntransparenz verpflichten wollte. Mit der Vorlage sollten<br />
die Lohnungleichheiten zwischen Männern und Frauen<br />
bekämpft werden. Diese Ungleichheiten bestehen weiter,<br />
obwohl das Recht auf gleichen Lohn für gleichwertige<br />
Arbeit seit 37 Jahren in der Verfassung verankert und das<br />
Gleichstellungsgesetz bereits seit 22 Jahren in Kraft ist.<br />
Am Weltfrauentag vom 8. März kündigte die französische<br />
Regierung an, dass sie bis in drei Jahren den Lohnunterschied<br />
von 9% zwischen Männern und Frauen für gleichwertige<br />
Arbeit eliminieren will. Dies dank einer Software,<br />
die ungerechtfertigte Lohndifferenzen in den Unternehmen<br />
aufspüren soll. Die haben drei Jahre <strong>Zeit</strong>, diese Lohnunterschiede<br />
auszugleichen. Andernfalls droht ab 2022<br />
eine Geldstrafe von bis zu 1% der gesamten Lohnsumme.<br />
Wäre eine solche Strafe nicht auch eine Lösung für die<br />
Schweiz? Strafgebühren sind in der Schweiz nichts Neues.<br />
Man denke an die CO 2<br />
-Abgabe (wer verschmutzt, zahlt), die<br />
Tabaksteuer, die Ersatzabgaben für den Militär- oder Feuerwehrdienst<br />
etc.<br />
Das Grundproblem<br />
wäre damit<br />
nicht gelöst, aber<br />
es würde ein wenig<br />
Rechtsgleichheit<br />
geschaffen ...<br />
8. März in Bern: weltweiter<br />
Kampftag für<br />
die Rechte der Frauen<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/branchen/telecom/<br />
sgb.ch/themen/gleichstellung/
«Wir müssen uns entscheiden: Wollen <strong>wir</strong> eine Post, die allen<br />
dient, oder einen Konzern, der die Bundeskasse füllt?» Daniel Münger<br />
21<br />
«Die ganze Wahrheit über die<br />
Post muss nun auf den Tisch!»<br />
<strong>syndicom</strong>-Präsident Daniel Münger über die PostAuto-Affäre,<br />
fette Gewinne und die Heuchelei des Parlaments.<br />
Die Bundespolizei ermittelt, und<br />
Politiker fordern den Rücktritt von<br />
Postchefin Susanne Ruoff. <strong>syndicom</strong><br />
tut dies nicht. Daniel Münger, sind<br />
Sie zu sehr in der Sozialpartnerschaft<br />
gefangen?<br />
Unsinn! Im Moment* ist Frau Ruoff<br />
einfach nicht unser dringendstes<br />
Problem. Die Personaldebatte lenkt<br />
nur von sehr viel wichtigeren Themen<br />
für die Zukunft der Post und des Service<br />
public ab. Jetzt muss erst einmal<br />
die Wahrheit über PostAuto und die<br />
Post auf den Tisch, die ganze Wahrheit.<br />
Lückenlos. Die öffentliche Hand<br />
darf nicht beschissen werden. Subventionen<br />
erschleichen, das geht gar<br />
nicht.<br />
Offenbar hat sich die PostAuto AG so<br />
verhalten wie gewöhnliche Konzerne<br />
das tun: Sie hat Gewinne mit Buchhaltungstricks<br />
versteckt.<br />
Da kommen <strong>wir</strong> dem Kern des Problems<br />
schon näher. Bei PostAuto hat<br />
sich, soviel <strong>wir</strong> heute wissen, niemand<br />
persönlich bereichert. Es ging offenbar<br />
darum, Vorteile für den Konzern<br />
zu ertricksen. Das enthüllt einen<br />
grundlegenden Widerspruch. Einerseits<br />
soll die Post eine umfassende<br />
öffentliche Dienstleistung erbringen,<br />
bis in die hintersten Ecken des Landes.<br />
Das ist richtig, weil es für die Kunden,<br />
die Schweiz und ihren Zusammenhalt<br />
von elementarer Bedeutung<br />
ist. Andererseits soll der Postkonzern<br />
dem Aktionär, also dem Bund, hohe<br />
Gewinne abliefern. Dass auch ein Service<br />
public <strong>wir</strong>tschaftlich arbeitet, ist<br />
vernünftig. Aber muss er auch noch<br />
die Staatskasse füllen und sich dafür<br />
wie ein Konzern verhalten, der Leistungen<br />
abbaut, die Löhne drückt, die<br />
Arbeitsbedingungen verschlechtert,<br />
Betriebsteile auslagert, um sie dem<br />
GAV zu entziehen, und die Zahlen frisiert?<br />
Das ist der falsche Weg.<br />
Der Chef des Bundesamtes für Ver -<br />
kehr sagt, er sei «erschüttert über das<br />
falsche Gewinndenken» bei PostAuto.<br />
Derselbe Mann will durchfahrende<br />
Chauffeure vom Schweizer Lohnschutz<br />
ausnehmen, damit die Löhne<br />
Daniel Münger redet Klartext. (© Res Keller)<br />
gedrückt werden können. Er ist wie<br />
jene Parlamentarier, die jetzt Erstaunen<br />
heucheln, aber die Gewinnvorgaben<br />
mitbeschlossen haben.<br />
Das tönt fast so, als wollten Sie das<br />
Postmanagement in Schutz nehmen?<br />
Im Gegenteil. Wir kämpfen gegen den<br />
Poststellenkahlschlag und Entlassungen.<br />
Wir kritisieren die verschlechterten<br />
Arbeitsbedingungen, die Auslagerungen<br />
und vieles mehr. Und über die<br />
Führung von PostAuto hätten <strong>unsere</strong><br />
Mitglieder eine Menge zu erzählen.<br />
Und über die exorbitanten Löhne von<br />
Frau Ruoff und der Postspitze und die<br />
wachsenden Boni ...<br />
Auch darüber. Dass <strong>wir</strong> bei der Post<br />
solche Managerinnen und Manager<br />
haben, ist das Resultat der gleichen<br />
Logik: Es ist absurd und fatal, einen so<br />
wichtigen öffentlichen Dienst wie einen<br />
Konzern mit Gewinnmaximierung<br />
zu führen. Dafür aber liegt die<br />
Verantwortung beim Besitzer. Also<br />
beim Bund.<br />
Hat nur PostAuto die Zahlen frisiert?<br />
Können Sie heute den Zahlen über<br />
die fehlende Rentabilität der Poststellen<br />
noch glauben?<br />
Lassen Sie es mich so sagen: Seit die<br />
Post ihre Rechnung der Poststellen<br />
auf eine neue Grundlage gestellt hat,<br />
schneiden viele schlechter ab als<br />
zuvor. Da <strong>wir</strong>d man schon nachdenklich.<br />
Wir brauchen heute Kostenwahrheit.<br />
Für die Poststellen genauso wie<br />
für PostAuto: Wir wollen wissen, wie<br />
viel ein Kilometer PostAuto <strong>wir</strong>klich<br />
kostet. Und welche Kosten bei den<br />
Poststellen <strong>wir</strong>klich entstehen.<br />
Riskieren Sie dabei nicht, den<br />
Privatisierungsturbos Argumente zu<br />
liefern? Es gibt doch immer ein<br />
privates Unternehmen, das dann<br />
sagt: Wir machen das billiger.<br />
Zu Dumpinglöhnen, mit gefährlich<br />
langen Arbeitszeiten und weniger<br />
Sicherheit für Chauffeure und Passagiere.<br />
Schauen Sie, was in der Logistik<br />
geschieht. Dort herrschen teilweise<br />
Wildwestverhältnisse. Man muss<br />
schon wissen, was man will. Will man<br />
eine Post, die der Gemeinschaft dient,<br />
und dieses Land gut versorgt, oder<br />
wollen <strong>wir</strong> eine Milliarde Gewinn?<br />
Wollen <strong>wir</strong> ein gutes öffentliches Verkehrsnetz,<br />
die Verlagerung des Verkehrs<br />
und korrekte Arbeitsbedingungen,<br />
oder wollen <strong>wir</strong> Lohndumping,<br />
Arbeitslose und verheerte Landschaften?<br />
Zivilisation gibt es nicht zum<br />
Nulltarif. Es ist höchste <strong>Zeit</strong> für eine<br />
klare Gesamtstrategie.<br />
Eine Gesamtstrategie für PostAuto?<br />
Für PostAuto, aber auch ein Konzept<br />
für das Poststellennetz und eine<br />
Strategie für die gesamte Post. Sie ist<br />
ein phantastisches Unternehmen mit<br />
Mitarbeitenden, die Enormes leisten,<br />
zuverlässig, und pünktlich. Der Raubbau<br />
an diesem Bijou muss heute<br />
gestoppt werden. Schluss mit Päcklisekunden<br />
und Pausenstreichungen<br />
und heimlichen Arbeitszeitverlängerungen,<br />
mit <strong>Zeit</strong>druck, Frust und<br />
Lohnklemmerei. Und wo bleibt<br />
eigentlich eine glaubhafte Digitalisierungsstrategie?<br />
Manchmal male ich<br />
mir die Post der Zukunft aus. Eine<br />
Post, die ein mächtiges Bildungsprogramm<br />
auflegt, statt Arbeitsbedingungen<br />
zu verschlechtern. Eine<br />
moderne, ganz auf Dienstleistung für<br />
die Allgemeinheit getrimmte Post. Sie<br />
wäre ein starkes Atout für die Schweiz.<br />
* Das Interview wurde am 26. Februar<br />
geführt.<br />
goo.gl/xmtqJd
22 Politik<br />
Die Renaissance des<br />
Service public<br />
Im 20. Jahrhundert galt der<br />
Service public als Rückgrat<br />
der Schweiz. Post, Eisenbahn,<br />
Strassen, Telekommunikation,<br />
aber auch Bildung,<br />
Forschung und Information<br />
sind für den nationalen<br />
Zusammenhalt wesentlich.<br />
Deshalb muss der Abbau<br />
gestoppt werden, wie<br />
Graziano Pestoni in seinem<br />
Buch «Die Privatisierung<br />
der schweizerischen Post»<br />
schreibt. Hier lesen Sie<br />
Auszüge aus dem Vorwort<br />
von <strong>syndicom</strong>-Präsident<br />
Daniel Münger und weitere<br />
Passagen. Herausgegeben<br />
<strong>wir</strong>d das Buch von <strong>syndicom</strong><br />
und der Fondazione Pellegrini-Canevascini.<br />
Es erscheint<br />
im Sommer auf Deutsch.<br />
Der Service public ist eine Form von<br />
Gemeineigentum, wie früher die<br />
Allmenden. Erfunden haben den<br />
Service public und die ersten<br />
Sozialversicherungen ursprünglich<br />
die Denker der bürgerlichen<br />
Aufklärung und die ersten Arbeiterorganisationen.<br />
Ihnen war klar,<br />
dass die Demokratie nur funktionieren<br />
kann, wenn alle Menschen einer<br />
Gesellschaft über eine elementare<br />
Sicherheit und den Zugang zu<br />
öffentlichen Diensten verfügen.<br />
Das reichste Prozent der<br />
Schweizer Bevölkerung braucht<br />
keine Schulen, keine öffentlichen<br />
Krankenhäuser, kein dichtes<br />
öffentliches Verkehrsnetz und keine<br />
Poststelle in der Nähe. Die Reichen<br />
organisieren sich das privat. Doch<br />
die überwiegende Mehrheit der<br />
Schweizerinnen und Schweizer ist<br />
existenziell auf AHV, ALV und<br />
Krankenversicherung angewiesen<br />
und genauso auf einen effizienten,<br />
breit aufgestellten Service public.<br />
Gewerkschaften und Sozialdemokratie<br />
haben Dinge wie die AHV<br />
durchgesetzt – sie war schon eine<br />
Forderung des Landesstreiks von<br />
1918. Aber öffentliche Dienste und<br />
soziale Sicherheit sind keine<br />
Marotten von Sozis: Sie sind das<br />
gemeinsame Eigentum von uns<br />
allen, die Commons, wie man heute<br />
Der Service public<br />
ist Gemeineigentum.<br />
Er ist die<br />
Grundlage, auf der<br />
unser sozialer<br />
Frieden steht.<br />
sagt. Sie sind die Grundlage, auf der<br />
unser Gesellschaftsmodell wie auch<br />
der soziale Frieden im Land stehen.<br />
Diese Grundlage <strong>wir</strong>d seit vielen<br />
Jahren systematisch demontiert,<br />
wie im Buch von Graziano Pestoni<br />
«Die Privatisierung der schweizerischen<br />
Post. Ursprung, Gründe,<br />
Konsequenzen» ausführlich beschrieben.<br />
Die Folgen der Privatisierung<br />
Die grossen Staatsbetriebe, wie die<br />
ehemaligen Regiebetriebe des<br />
Bundes (Post, Fernmeldewesen,<br />
Eisenbahn), stellten bis zur Mitte<br />
der 1990er-Jahre Pfeiler der nationalen<br />
Gemeinschaft dar.<br />
Diese Bundes- wie auch die<br />
Kantons- und Gemeindebetriebe<br />
boten qualifizierte Arbeitsplätze,<br />
Versorgungssicherheit, soziale<br />
Sicherheit, Gleichbehandlung und<br />
Gerechtigkeit. Ihr Ziel bestand in<br />
der Bereitstellung von Gütern oder<br />
Dienstleistungen: Trinkwasser,<br />
Bildung, Post- oder Verwaltungsdienste,<br />
öffentliche Verkehrsmittel.<br />
Der finanzielle Aspekt wurde<br />
berücksichtigt, stand aber nicht im<br />
Vordergrund. Der Service public<br />
unterlag der demokratischen<br />
Kontrolle. Nicht nur die strategische<br />
Verantwortung dafür wurde von<br />
einem gesetzgebenden Organ<br />
(eidgenössische Räte, Grossrat oder<br />
Gemeinderat) getragen, sondern<br />
auch die operative Verantwortung<br />
lag bei der öffentlichen Hand. Man<br />
konnte jederzeit korrigierend<br />
eingreifen. Und die Bürgerinnen
Graziano Pestoni liefert ein beherztes und argumentiertes Plädoyer für eine starke öffentliche<br />
Hand. Sie soll die Basis wieder herstellen, auf die unser Gesellschaftsmodell baut: Einen Service<br />
public, der sich als Gemeineigentum versteht. Denn das reichste eine Prozent braucht keinen<br />
öffentlichen Dienst – die 99 Prozent hingegen schon. Gerade in <strong>Zeit</strong>en der Digitalisierung.<br />
23<br />
und Bürger konnten über ihre<br />
Vertreterinnen und Vertreter oder<br />
mittels Amtsenthebungsreferenden<br />
die Entscheidungen beeinflussen,<br />
die sie betrafen. Die Aktiengesellschaften,<br />
die danach in Mode<br />
kamen, entziehen sich dagegen<br />
dieser Kontrollen. Durch die<br />
Privatisierung und die Liberalisierung<br />
wurden die Dienstleistungen<br />
und die Arbeitsbedingungen zu<br />
Waren.<br />
Heute brauchen <strong>wir</strong> einen<br />
allgemeinen Richtungswechsel, den<br />
Wiederaufbau des Service public.<br />
Das bedeutet die Wiederherstellung<br />
der «alten», aber effizienten Regiebetriebe<br />
des Bundes.<br />
Ziel der Post sollte nicht mehr<br />
die Er<strong>wir</strong>tschaftung bestmöglicher<br />
finanzieller Ergebnisse, sondern die<br />
Wahrung der Interessen der Nutzenden<br />
sein. Dazu müssten die in den<br />
letzten Jahren gestrichenen Dienstleistungen<br />
sowohl in den städtischen<br />
Zentren als auch in den<br />
Randregionen wiedereingeführt<br />
werden. Die Post soll wieder zu<br />
einem bürgernahen Dienst werden.<br />
Dabei sollen die neuen Technologien<br />
das Dienstleistungsangebot<br />
ergänzen, aber nicht ersetzen.<br />
Zugang und Zugangsmacht<br />
Ausgerechnet die Digitalisierung<br />
– wie Daniel Münger im Vorwort<br />
schreibt – zeigt heute, wie aktuell<br />
und wie notwendig ein stark<br />
ausgebautes Gemeineigentum ist.<br />
Ohne Service public gibt es keine<br />
Zukunft für eine soziale, fortschrittliche<br />
Digitalisierung. Mit den<br />
Netzen fängt das an. Nur eine<br />
<strong>wir</strong>klich flächendeckende, diskriminierungsfreie<br />
Versorgung des<br />
ganzen Landes mit den neuesten<br />
Technologien garantiert den<br />
Zugang aller zu den neuen Kommunikations-<br />
und Arbeitsformen.<br />
Ohne Service<br />
public gibt es keine<br />
Zukunft für eine<br />
soziale und<br />
fortschrittliche<br />
Digitalisierung.<br />
Zugang ist das<br />
entscheidende<br />
Wort. Nur der freie<br />
und günstige<br />
Zugang löst die<br />
Versprechen der<br />
Digitalisierung ein.<br />
Private Anbieter, das ist hundertfach<br />
belegt, sind aus einsichtigen<br />
Gründen nicht in der Lage, dieses<br />
Angebot zu gewährleisten.<br />
Zugang ist das entscheidende<br />
Wort im digitalen Umbruch. Nur ein<br />
freier, kostengünstiger Zugang zu<br />
Netzen, Diensten und Möglichkeiten<br />
löst die Versprechen der<br />
Digitalisierung ein. Das zeigt das<br />
Beispiel der Big Data. Big-Data-Anwendungen<br />
sind ein Grundwerkzeug<br />
der digitalen <strong>Zeit</strong>. Stehen sie<br />
nur jenen Konzernen zur Verfügung,<br />
die sich die teure Entwicklung<br />
von Big Data leisten können, <strong>wir</strong>d<br />
dies die Konzentration <strong>wir</strong>tschaftlicher<br />
Macht extrem beschleunigen.<br />
Ohne Zugang zu solchen<br />
Werkzeugen würden Zehntausende<br />
von KMU schliessen müssen. Hier<br />
(und nicht nur hier) erkennen <strong>wir</strong>:<br />
Der Service public muss zu einem<br />
digitalen Service public ausgebaut<br />
werden. Die öffentliche Hand muss<br />
diese Werkzeuge anbieten.<br />
Immer geht es um Zugang, um<br />
Verfügungsmacht – Zugang zu den<br />
eigenen Daten und zu deren<br />
Kontrolle, Zugang zu allen Diensten,<br />
ohne dass private Anbieter<br />
diese teuer versilbern, Zugang zu<br />
Bildungs- und Informationsangeboten.<br />
Soll die Digitalisierung nicht zu<br />
einem mächtigen Instrument der<br />
Diskriminierung und der modernen<br />
Heimarbeits-Sklaverei werden,<br />
muss der Service public massiv<br />
ausgebaut werden, unterstützt von<br />
GAV und Arbeitsschutzgesetzen, die<br />
verhindern, dass die neuen Arbeitsformen<br />
zu katastrophalen sozialen<br />
Rückschritten führen.<br />
Drei Szenarien<br />
Pestoni unterscheidet drei Szenarien.<br />
Das erste ist das dunkle<br />
Szenario oder der neoliberale Weg.<br />
Das Postgesetz und die Politik der<br />
Führungskräfte der Post bleiben<br />
hierbei unverändert. Das hiesse<br />
weitere Poststellenschliessungen,<br />
mehr Abbau des Zustelldienstes,<br />
Preiserhöhungen, den Verkauf von<br />
PostFinance-Aktien an Private und<br />
noch schlechtere Arbeitsbedingungen.<br />
Dieses Szenario würde das<br />
Ende der Schweizerischen Post<br />
bedeuten.<br />
Das zweite Szenario ist heute<br />
Realität. Während der Vernichtungsprozess<br />
weiterläuft, machen<br />
andere Akteure den Unterschied:<br />
Bevölkerung, Gemeinden, Kantone,<br />
Gewerkschaften, progressive Kräfte<br />
setzen sich zur Wehr. Ihnen ist es<br />
gelungen, einige Beschlüsse zu<br />
ändern, einige Verschlechterungen<br />
zu verhindern und weitere hinauszuzögern.<br />
Sie konnten den Schaden<br />
begrenzen. Diese Bewegungen<br />
reichen jedoch nicht aus, um einen<br />
richtigen öffentlichen Postdienst zu<br />
erhalten oder wiederherzustellen.<br />
Beim letzten Szenario stellt<br />
sich die Frage nach der Rückkehr<br />
der Post zum Service public, damit<br />
Universalität, Zugänglichkeit, Kontinuität,<br />
Effizienz, sozialer Nutzen,<br />
gute Arbeitsbedingungen und<br />
Vertraulichkeit gewährleistet sind.<br />
Was tun?<br />
Die Lösung, die Pestoni vorschlägt,<br />
mag im <strong>Zeit</strong>alter der Liberalisierung<br />
utopisch scheinen. Aber Utopien<br />
dienen dazu, uns den Weg zu<br />
weisen. Das Buch schliesst mit<br />
einem Zitat des vor Kurzem verstorbenen<br />
Philosophen Zygmunt<br />
Bauman: «Zukunft ist, was <strong>wir</strong><br />
daraus machen.» Alles hange von<br />
uns ab, sagt Pestoni.<br />
Der Wiederaufbau des Service<br />
public, nicht nur im Postbereich,<br />
bedeutet, die Interessen der<br />
Allgemeinheit, die Bürgerrechte<br />
und die Lebensqualität der Bevölkerung<br />
über die marktbestimmten<br />
Denkmuster zu stellen. Schwierig,<br />
aber nicht unmöglich. In anderen<br />
Ländern haben die Proteste der<br />
Bevölkerung die Regierungen und<br />
Parlamente gezwungen, vorher<br />
private Dienste wieder in die<br />
öffentliche Hand <strong>zurück</strong>zunehmen.<br />
So gestalten <strong>wir</strong> die Gesellschaft<br />
und die Welt von morgen.<br />
Buchbesprechung siehe Seite 26
24 Nach dem klaren Ja zum Service-public-<br />
Auftrag der Medien: So geht der Kampf um die<br />
Medien vielfalt in der Schweiz weiter.<br />
Weil die Demokratie<br />
unabhängige Medien braucht<br />
Bereits vier Monate vor der Abstimmung habt Ihr Euch, liebe<br />
Kongressdelegierte von <strong>syndicom</strong>, wuchtig gegen die gefährliche<br />
No-Billag-Initiative ausgesprochen. Und für einen starken<br />
Service- public-Auftrag in den Medien. Viele <strong>syndicom</strong>-Mitglieder<br />
haben sich mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft im<br />
Abstimmungskampf eingesetzt, und Ihr habt am 4. März recht<br />
bekommen. Dafür danken <strong>wir</strong> Euch herzlich!<br />
Gemeinsame Siege soll man feiern. Am 4. März haben die<br />
Schweizerinnen und Schweizer gesagt: Wir wollen keinen<br />
rechten Informationsbrei und keinen Kommerz auf Megahertz.<br />
Jetzt führen <strong>wir</strong> den Kampf für die Stärkung des Service<br />
public in den Medien, aber auch für eine neue Medienförderung<br />
mit allen fortschrittlichen Kreisen offensiv weiter. Denn schon<br />
am Abstimmungssonntag haben die SRG-Feinde neue Angriffe<br />
auf das öffentliche Radio und Fernsehen lanciert. Wir werden<br />
sie kontern. Unverständlich, dass die SRG-Spitze in vorauseilendem<br />
Gehorsam neue Sparmassnahmen samt Stellenabbau<br />
ankündigte. Das Personal hat Besseres verdient!<br />
Die <strong>Zeit</strong> drängt, jetzt endlich die Medienvielfalt in <strong>Zeit</strong>ungen,<br />
Online und Radio/TV zu stärken: Tamedia, NZZ, AZ Medien oder<br />
Somedia schaffen durch das Zusammenlegen der Redaktionen<br />
und den fortwährenden Personalabbau gerade die Medienvielfalt<br />
ab. Google, Facebook und Co. sowie die Online-Werbeplattformen<br />
der grossen Verleger saugen Geld aus dem Werbemarkt<br />
der Medien ab und generieren Gewinne für die Konzerne und<br />
deren Besitzer. Diese Gelder müssen wieder in besseren Journalismus<br />
und das Personal investiert werden!<br />
Das Recht auf umfassende Information ist ein Grundrecht,<br />
das nur durch einen starken Service public in den Medien<br />
garantiert werden kann. Qualität und Vielfalt brauchen eine<br />
solide <strong>wir</strong>tschaftliche Grundlage. Darum müssen die Besteuerung<br />
der Gewinne von Google, Facebook und Co. sowie Abgaben<br />
auf Werbeeinnahmen auf die politische Traktandenliste.<br />
Keine Minute verlieren dürfen <strong>wir</strong> im Fall der Schweizerischen<br />
Depeschenagentur (sda): Die Verleger bedrohen mit dem<br />
Abbau eines Viertels der Redaktion die Grundlagen einer informierten<br />
Gesellschaft. Sie versagen bei ihrem Service-public-Auftrag,<br />
also muss die Politik eingreifen. Schon wenige<br />
Gebühren-Promille für die sda, wie sie der Bundesrat vorschlägt,<br />
würden ihr helfen, ihre Rolle weiter wahrzunehmen.<br />
Das ist kostengünstige Medienförderung, denn viele kleinere<br />
Medien sind existenziell abhängig von den Nachrichten der sda.<br />
Stephanie Vonarburg, Roland Kreuzer
Recht so!<br />
25<br />
Fragen an den <strong>syndicom</strong>-Rechtsdienst:<br />
Guten Tag<br />
Ich habe verschiedene rechtliche Fragen zum Ausgleich der<br />
Feiertage, die auf einen arbeitsfreien Tag fallen, und zur Abrechnung<br />
von Ferientagen bei Teilzeit. Seit Kurzem arbeite<br />
ich zu 60%, jeweils 8 Stunden am Montag, Dienstag und<br />
Donnerstag. Jetzt habe ich erfahren, dass der nächste<br />
Feiertag, der Karfreitag, nicht kompensiert <strong>wir</strong>d, da ich an<br />
diesem Wochentag nicht arbeite. Ich finde das ungerecht.<br />
Ist es zulässig?<br />
Ich möchte ausserdem wissen, wie es bei den Ferientagen<br />
ist. Werden diese nach meinem Teilzeitgrad berechnet?<br />
Ausserdem besteht mein Arbeitgeber darauf, dass ich<br />
Arztbesuche auf arbeitsfreie Tage lege. Ist das üblich?<br />
Vielen Dank, dass Ihr mich über meine Rechte aufklärt.<br />
Antwort des <strong>syndicom</strong>-Rechtsdienstes<br />
Für die Arbeitszeitberechnung bei<br />
Teilzeitarbeit gibt es zwei Methoden:<br />
1. Die Arbeit <strong>wir</strong>d an fixen Tagen<br />
geleistet: Fällt ein Feiertag auf einen<br />
Arbeitstag, <strong>wir</strong>d die normalerweise<br />
geleistete Anzahl Stunden berücksichtigt.<br />
Fällt der Feiertag aber auf<br />
einen arbeitsfreien Tag, gibt es keine<br />
Entschädigung. Dies <strong>wir</strong>d nicht als<br />
Ungleichbehandlung gegenüber<br />
Vollzeitangestellten betrachtet. Denn<br />
die Situation gleicht sich über das<br />
Jahr wieder aus, da nicht alle Feiertage<br />
auf denselben Wochentag fallen.<br />
2. Die wöchentliche Arbeitszeit <strong>wir</strong>d<br />
durch die Zahl Arbeitstage geteilt.<br />
Das ergibt eine tägliche Arbeitszeit<br />
(für ein 60%-Pensum 4 h 50’ pro Tag).<br />
Für die Feiertage ist diese Arbeitszeit<br />
massgebend (da Du am Montag 8 h<br />
arbeitest, werden etwa an Ostern nur<br />
4 h 50’ berücksichtigt). Dein Arbeitgeber<br />
wendet die erste Methode an<br />
und handelt damit rechtmässig.<br />
Der Ferienanspruch ist für Teilzeitund<br />
Vollzeitangestellte gleich. Es ist<br />
nicht so, dass Du mit einem<br />
60%-Pensum nur 12 Ferientage von<br />
den vier Wochen beziehen kannst.<br />
Dir stehen 20 Ferientage pro Jahr zu.<br />
Angestellte haben gemäss Artikel<br />
321a OR eine Treue- und Sorgfaltspflicht<br />
gegenüber ihrem Arbeitgeber.<br />
Dies bedeutet etwa, dass sie ihre<br />
Absenzen möglichst beschränken.<br />
Wenn ein Arbeitgeber aber von<br />
Teilzeitangestellten verlangt, dass sie<br />
während der Arbeitszeit keine<br />
Arzttermine wahrnehmen, überschreitet<br />
er seine Befugnisse. Dies<br />
kann man als Fall von Ungleichbehandlung<br />
gegenüber den Vollzeitangestellten<br />
betrachten.<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/recht/rechtso
26 Freizeit<br />
Tipps<br />
Ein Kompass für die digitale<br />
Revolution. Und viel mehr<br />
Dass die digitale Revolution von uns<br />
einen Effort zur Weiterbildung<br />
verlangt, ist fast schon eine Binse.<br />
Nur wenn <strong>wir</strong> Gewerkschafterinnen<br />
und Gewerkschafter das Thema<br />
beherrschen, erkennen <strong>wir</strong> seine<br />
Risiken. Doch Weiterbildung ist ein<br />
weites Feld mit zahllosen Optionen.<br />
Licht in diesen Dschungel bringt die<br />
SGB- und Movendo-Tagung «Digitalisierung?<br />
Weiterbildung!» am<br />
28. Juni 2018 in Freiburg. Anmeldung<br />
und Infos über movendo.ch.<br />
Donnerstag, 28. Juni, 09.00 bis<br />
16.30 Uhr. Für Mitglieder der Gewerkschaft<br />
gratis (Nichtmitglieder<br />
CHF 250.–).<br />
Mitglieder, die in den Medien, in<br />
der Visuellen Kommunikation oder<br />
in der Grafischen Industrie arbeiten,<br />
können am sehr reichen Kursangebot<br />
von Helias teilnehmen.<br />
Helias ist das gemeinsame Bildungsinstitut<br />
von <strong>syndicom</strong>, syna und Viscom.<br />
Bildungszeit ist Arbeitszeit. Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmer<br />
haben grundsätzlich Anspruch<br />
auf bezahlten Bildungsurlaub während<br />
der Arbeitszeit. Voraussetzung<br />
ist, dass der Betrieb Mitglied von<br />
Viscom ist oder dass er die Vertragstreue<br />
erworben hat. Das Kursangebot<br />
im Einzelnen, von Digitaler Fotografie<br />
über Typografie in InDesign<br />
bis Mobiles Publizieren mit Twixl<br />
Publisher: goo.gl/MUEAP6. Allgemeine<br />
Informationen (Preise usw.):<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/mitgliederservice/<br />
aus-und-weiterbildung/helias/.<br />
Und nicht vergessen: Meldet<br />
Euch rechtzeitig für die Movendo-Kurse<br />
ab dem Sommer an.<br />
Gemeinsam die Stadt<br />
begrünen. Auch politisch<br />
zVg<br />
Mit den frühlingshaften Temperaturen<br />
zieht es die Gärtnerinnen und<br />
Gärtner unter uns wieder in ihre<br />
Beete: Seien das ausrangierte Einkaufswagen<br />
auf dem Trottoir, alte<br />
Badewannen, Jutesäcke, SBB-Paletten<br />
oder Brachen. Urban Gardening,<br />
der weltweite Trend, der in den<br />
70er-Jahren in benachteiligten<br />
Stadtteilen New Yorks begann, ist<br />
in den Schweizer Städten angekommen.<br />
Es geht um nachhaltigen Anbau,<br />
lokale Produkte, Artenvielfalt,<br />
aber nicht nur: Für Urban Gardener<br />
ist der Garten kein privater Rückzugsort,<br />
sondern ein Labor für neue<br />
Formen urbanen Lebens.<br />
Von St. Gallen bis Genf ist der<br />
gemeinsame Garten Ausgangspunkt<br />
für Begegnung: mit Nachbarinnen<br />
und Nachbarn aus verschiedenen<br />
Kulturen, Generationen oder sozialen<br />
Schichten. Wer ebenfalls beim<br />
Gärtnern über Saatzeiten, Gott und<br />
die Welt philosophieren möchte,<br />
kann sein eigenes Projekt aufziehen<br />
oder sich einem Garten in der Nachbarschaft<br />
anschliessen. In Basel<br />
listet der Verein Urban Agriculture<br />
Basel über 50 Initiativen auf – von<br />
generationsübergreifenden Gärten<br />
über Permakultur-Projekte bis zur<br />
Bienenschutzbewegung – und bietet<br />
Unterstützung bei der Realisierung<br />
von eigenen Ideen.<br />
In Zürich ist beispielsweise der<br />
Merkurgarten weit mehr als ein gemeinsam<br />
be<strong>wir</strong>tschaftetes Gartenbeet;<br />
hier gibts auch Konzerte, Theater,<br />
Ausstellungen oder Lesungen<br />
im Grünen. In Genf und Lausanne<br />
ist die NGO Equiterre aktiv, die unter<br />
anderem einen Garten in einem<br />
Asylzentrum mitinitiiert hat.<br />
(Barbara Spycher)<br />
© Die Post<br />
Buch: Zurück in die Zukunft.<br />
Der richtige Weg für die Post<br />
«Es war der Anfang einer verhängnisvollen<br />
Veränderung, der Anfang<br />
vom Ende eines Betriebs, der auf die<br />
<strong>wir</strong>tschaftliche und soziale Entwicklung,<br />
auf die Verminderung von<br />
Ungleichheiten und auf die Gleichbehandlung<br />
aller Einwohnerinnen<br />
und Einwohner <strong>unsere</strong>s Landes<br />
Wert legte.» Die ersten Zeilen von<br />
Graziano Pestoni in seinem Buch<br />
über die Privatisierung der Post siedeln<br />
den Anfang des Problems 1997<br />
an. In jenem Jahr hörte die Schweizerische<br />
Post auf, eine Grundversorgerin<br />
zu sein, und wurde zum gewöhnlichen<br />
Konzern.<br />
Pestoni erklärt, welche Folgen<br />
das hatte. Die rentablen Sektoren<br />
wie das Fernmeldewesen oder die<br />
Zustellung von Paketen in der Stadt<br />
wurden privatisiert oder liberalisiert.<br />
Die defizitären Bereiche wie<br />
die Zustellung in den Randregionen<br />
wurden der Post überlassen. Gleichzeitig<br />
wurde diese aber verpflichtet,<br />
Gewinne abzuliefern.<br />
So wandelte sich <strong>unsere</strong> Post immer<br />
mehr zu einer unsympathischen<br />
Aktiengesellschaft. Pestoni<br />
erläutert, wie sich die politischen<br />
Entscheide auf den Service public<br />
und die Arbeitsbedingungen ausge<strong>wir</strong>kt<br />
haben. Eine der Folgen sind<br />
die frisierten Bilanzen von PostAuto<br />
– frisiert auf Kosten der Allgemeinheit,<br />
in deren Eigentum der Betrieb<br />
aber immer noch ist.<br />
Pestonis Buch kommt genau<br />
zum richtigen <strong>Zeit</strong>punkt. Heute<br />
muss über einen Richtungswechsel<br />
für die Post nachgedacht werden.<br />
Ein Richtungswechsel, für den der<br />
Autor ein klares Wort hat: Wiederverstaatlichung.<br />
(Giovanni Valerio)<br />
movendo.ch, <strong>syndicom</strong>.ch/mitgliederservice/aus-und-weiterbildung<br />
equiterre.ch, merkurgarten.ch<br />
urbanagriculturebasel.ch<br />
Graziano Pestoni: La privatizzazione della<br />
Posta Svizzera. Deutsch im Sommer 2018
1000 Worte<br />
Ruedi Widmer<br />
27
28 Bisch im Bild Wenn unser starker Arm es will... Die Gewerkschaften sind in Bewegung.<br />
Wo Aktionäre die Nachrichtenagentur SDA zu Grunde richten, wo rechte Feinde<br />
des freien Wortes dem öffentlichen Radio und TV den Stecker ziehen wollen oder<br />
wo Frauen verfassungswidrig diskriminiert werden, fahren <strong>wir</strong> dazwischen.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4
Bilder 1 bis 4: Impressionen von diversen Veranstaltungen der SDA-Belegschaft in ihrem Kampf gegen Massenentlassungen, für Verhandlungen<br />
und für eine breite, sorgfältig recherchierte Grundversorgung mit Information (siehe Seite 18 dieses Hefts).<br />
Bilder 5 bis 7: «Aktion Gegen Lichterlöschen» am 30. Januar vor dem Bundeshaus. Die Kampagne gegen No Billag und den rechten Informations-<br />
Einheitsbrei war erfolgreich: Das Volk lehnte die Initiative mit einem scharfen Nein ab. (© Florian Aicher)<br />
Bilder 8 bis 10: weltweiter Frauenkampftag 8. März in Bern. Die noch immer nicht eingelöste Lohngleichheit war das Leitthema, aber es ging um<br />
mehr. Gegen sexuelle Übergriffe, die Renaissance sexistischer Herrschaftsansprüche und generell um die Forderung Chancengleicheit.<br />
29<br />
6<br />
5<br />
7<br />
8<br />
9 10
30<br />
Aus dem<br />
Leben von ...<br />
Marzia Giudicetti<br />
Die Gewerkschaft ist die zweite Familie<br />
1976 geboren und in Roveredo aufgewachsen,<br />
lebt Marzia heute mit ihrem<br />
Lebensgefährten Davide in Val Calanca.<br />
Nach der Kantonalen Verwaltungsschule<br />
in Bellinzona begann sie 1996<br />
ihre berufliche Laufbahn mit dem<br />
Eintritt in die Personalersatzabteilung<br />
beim Schweizerischen Posthalterverband<br />
(SPV). 2002 wechselte sie als<br />
Kunden betreuerin am Schalter in das<br />
Postamt von Claro, 2900 Einwohner.<br />
Die Post von Claro figuriert auf der<br />
«schwarzen Liste» und läuft Gefahr,<br />
geschlossen zu werden. Dieser<br />
Umstand hat Marzia dazu bewegt, der<br />
Aktionsgruppe des Postnetzes beizutreten.<br />
Die Gruppe kämpft für den<br />
Erhalt des Universaldienstes.<br />
Text: Barbara Iori<br />
Bild: zVg<br />
Transparenz und<br />
Solidarität leiten mich.<br />
«Es liegt offenbar ein bisschen in der<br />
Familie: Schon meine Mama arbeitete<br />
bei der Post und ist bis heute<br />
eingetragenes Gewerkschaftsmitglied.<br />
Mein Grossvater, Luigi Bologna,<br />
genannt der «Ciri», tagsüber<br />
Land<strong>wir</strong>t und nachts Arbeiter bei<br />
Monteforno, hasste Ungerechtigkeiten<br />
und verteidigte stets die Schwachen:<br />
Er war Mitbegründer der<br />
Sozialistischen Partei in Roveredo<br />
und Mitglied des SMUV. Von ihm<br />
habe ich diesen Geist der Solidarität<br />
geerbt.<br />
Als ich in der Personalersatzabteilung<br />
anfing, kam postwendend<br />
der Einzahlungsschein der Gewerkschaft.<br />
Zu jener <strong>Zeit</strong> waren alle bei<br />
der Gewerkschaft, es war völlig<br />
normal, Mitglied zu sein. Ich schrieb<br />
mich also in die Gewerkschaft für<br />
Kommunikation ein, das was heute<br />
<strong>syndicom</strong> ist. In meiner Abteilung<br />
musste ich verschiedene Aufgaben<br />
übernehmen: Ich besorgte Ersatz für<br />
Abteilungsleiter, Schalterkollegen<br />
und bisweilen auch für Mitarbeiter<br />
der Zustellung.<br />
Meine wahre Begegnung mit der<br />
Gewerkschaft hatte ich im Jahr 2005,<br />
als ich Marco Forte, den <strong>syndicom</strong>-<br />
Regionalsekretär kennenlernte. Ihn<br />
bat ich um Hilfe, als ich nach<br />
Reorganisationsmassnahmen unter<br />
den Sozialplan fiel. Was mir bei der<br />
Post während der Reorganisation<br />
fehlte, war die Achtung vor Werten<br />
wie Transparenz, die mir sehr am<br />
Herzen liegen. Und das alles in<br />
einem schwierigen Moment, denn<br />
meine Grossmutter lag gerade im<br />
Sterben. Ich fühlte mich schwach.<br />
Doch <strong>syndicom</strong> hat mich unterstützt,<br />
ohne über mich zu urteilen und ohne<br />
Bedingungen. Denn das ist Gewerkschaft:<br />
Du fühlst dich nie allein.<br />
Meine Leidenschaft für die Arbeit<br />
hat mich dazu gebracht, 2017 in die<br />
Aktionsgruppe des Postnetzes<br />
einzutreten, um der neuen<br />
Schliessungswelle bei den Postämtern<br />
entgegenzutreten. Hier trafen<br />
<strong>wir</strong> uns mit verschiedenen Kollegen<br />
aus allen Teilen des Tessins, und<br />
gemeinsam haben <strong>wir</strong> über <strong>unsere</strong><br />
Aktionen entschieden. Dazu tauschten<br />
<strong>wir</strong> <strong>unsere</strong> Erfahrungen aus. Wir<br />
sind alle Mitglieder der Gewerkschaft,<br />
und allen ist unser Betrieb in<br />
besonderer Weise wichtig.<br />
Arbeitsstress? Sicherlich, manchmal<br />
haben <strong>wir</strong> mehr Arbeit, aber als<br />
richtig gutes Team helfen <strong>wir</strong> uns<br />
gegenseitig. Nur weiss ich, dass nicht<br />
in allen Postämtern dieselbe Harmonie<br />
herrscht wie in Claro.<br />
Wirklicher Stress ist eine unsichere<br />
Zukunft. Angst, den Arbeitsplatz<br />
zu verlieren. In solchen <strong>Zeit</strong>en<br />
ist man sehr verwundbar. Die Post<br />
sollte mehr Rücksicht zeigen. Das ist<br />
der Grund, warum ich mit meiner<br />
Mama in Bellinzona am 6. Mai an der<br />
Demonstration zur Verteidigung des<br />
Postdienstes teilgenommen habe.<br />
Auch bei der Demonstration gegen<br />
die Initiative No Billag am 27. Januar<br />
haben <strong>wir</strong> nicht gefehlt, um dort alle<br />
zusammen mit lauter Stimme zu<br />
rufen: Hände weg vom öffentlichen<br />
Dienst!»<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/aktuell/artikel/schluss-mitprofit-im-service-public/
Impressum<br />
Redaktion: Sylvie Fischer, Marie Chevalley,<br />
Giovanni Valerio, Marc Rezzonico, Oliver Fahrni<br />
Tel. 058 817 18 18, redaktion@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Porträts, Zeichnungen: Katja Leudolph<br />
Fotos ohne Copyright-Vermerk: zVg<br />
Layout und Korrektorat: Stämpfli AG, Bern<br />
Druck: Stämpfli AG, Wölflistrasse 1, 3001 Bern<br />
Adressänderungen: <strong>syndicom</strong>, Adressverwaltung,<br />
Monbijoustrasse 33, Postfach, 3001 Bern<br />
Tel. 058 817 18 18, Fax 058 817 18 17<br />
Inserate: priska.zuercher@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Abobestellung: info@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Abopreis ist im Mitgliederbeitrag inbegriffen. Für<br />
Nichtmitglieder: Fr. 50.– (Inland), Fr. 70.– (Ausland)<br />
Verlegerin: <strong>syndicom</strong> – Gewerkschaft<br />
Medien und Kommunikation, Monbijoustr. 33,<br />
Postfach, 3001 Bern<br />
Das <strong>syndicom</strong>-Magazin erscheint sechsmal im Jahr.<br />
Ausgabe <strong>Nr</strong>. 5 erscheint am 25. Mai 2018<br />
Redaktionsschluss: 14. April 2018.<br />
31<br />
Das <strong>syndicom</strong>-Kreuzworträtsel<br />
Der praktische Zustupf: Zu gewinnen<br />
gibt es eine Geschenkkarte im Wert von<br />
40 Franken, gespendet von <strong>unsere</strong>r<br />
Dienstleistungspartnerin Coop. Das<br />
Lösungswort <strong>wir</strong>d in der nächsten<br />
Ausgabe zusammen mit dem Namen<br />
der Gewinnerin oder des Gewinners<br />
veröffentlicht.<br />
Lösungswort und Absender auf einer<br />
A6-Postkarte senden an: <strong>syndicom</strong>-<br />
Magazin, Monbijoustrasse 33, Postfach,<br />
3001 Bern. Einsendeschluss: 16.4.18<br />
Der Gewinner<br />
Die Lösung des <strong>syndicom</strong>-Kreuzworträtsels<br />
aus dem <strong>syndicom</strong>-Magazin<br />
<strong>Nr</strong>. 3 lautet: VERNETZUNG. Gewonnen hat<br />
das Cold Pack <strong>unsere</strong>r Partnerin KPT die<br />
Familie Meier-Giger aus Cavardiras.<br />
Herzlichen Glückwunsch!<br />
Anzeige<br />
Spezialofferte<br />
Bestellen Sie Ihre AgipPLUS-Karte<br />
RABATT: - 4,5 Rp/Lt. Treibstoff (Bleifrei und Diesel)<br />
Jahresgebühr CHF 10.- offeriert<br />
-4.5<br />
Montliche Rechnungsgebühr CHF 2.50 offeriert<br />
Verlangen Sie Ihren Kartenantrag beim Zentralsekretariat<br />
Rp pro Liter<br />
+41 (0)58 817 18 18 - mail@<strong>syndicom</strong>.ch
32 Inter-aktiv<br />
<strong>syndicom</strong> social<br />
Mobile 27.02.2018<br />
Die nächste mobile Kommunikationsgeneration<br />
<strong>wir</strong>d 2018 in der Schweiz landen.<br />
Swisscom will zusammen mit der ETH<br />
Lausanne den 5G-Standard lancieren, der bis<br />
zu 100-mal schneller als der aktuelle 4G sein<br />
könnte. Einziger Haken: Die Smartphones, die<br />
über diese Technologie verfügen, werden erst<br />
ab 2019 im Handel sein.<br />
LINKEDIN 20.02.2018<br />
Das LinkedIn Profil von <strong>syndicom</strong><br />
wurde aktualisiert! Folgt uns!<br />
Dort findet ihr Neuigkeiten, Artikel,<br />
Berichte wie auch <strong>unsere</strong> Stellenangebote.<br />
Es ist auch der ideale Ort,<br />
um Euer professionelles Netzwerk<br />
auszuweiten und <strong>unsere</strong> Angestellten<br />
kennenzulernen.<br />
Welttag 27.02.2018<br />
Schon gewusst? Am 28. Februar wurde zum 8. Mal der<br />
Welttag ohne Facebook gefeiert. Die 2 Miliarden Benutzer<br />
wurden aufgefordert, 24 Stunden offline zu gehen.<br />
@Majina 02.03.2018<br />
Jede Kuh aus einem Schweizer Stall ist im #parlCH besser<br />
repräsentiert als die Frauen, die arbeiten und seit<br />
37 Jahren auf die Umsetzung ihres Verfassungsrecht<br />
warten, das die Lohngleichheit vorsieht! :-(<br />
@<strong>syndicom</strong>_de 02.03.2018<br />
<strong>syndicom</strong> <strong>wir</strong>d am nächsten Weltsozialforum<br />
in Brasilien teilnehmen, wo die<br />
Gewerkschaft ihr «Manifest Arbeit 4.0 –<br />
die digitale Arbeitswelt» vorstellen <strong>wir</strong>d.<br />
E-Umwelt 01.03.2018<br />
Die ökologischen Kosten jedes E-Mails<br />
betragen 19 Gramm CO2 (das entspricht<br />
dem Verbrauch einer Glühbirne während<br />
1 Stunde). Für eine Organisation wie<br />
<strong>syndicom</strong> macht das etwa 6 Tonnen CO2<br />
im Jahr. Denkt daran, bevor ihr ein E-Mail<br />
schickt (und ausdruckt).<br />
@SergiooFerrari 23.02.2018<br />
Das Personal der SDA will verhandeln, aber die Direktion<br />
hat die Verhandlungen unterbrochen. Die Redaktion will<br />
ein Schlichtungsverfahren eröffnen. @<strong>syndicom</strong>_ch<br />
@SVonarburg 04.03.2018<br />
@mediaforti_de 04.03.2018<br />
Das #NeinzuNoBillag ist ein klares Bekenntnis zum<br />
Journalismus und zu starken Medien. Es ist höchste <strong>Zeit</strong><br />
für eine Reform der Medienpolitik!<br />
Die #SRG verlängert ihren Vertrag<br />
mit der #SDA zu den heutigen<br />
Bedingungen bis Ende 2019. Auch<br />
die anderen grossen Medienkunden<br />
müssen mit ihrem zerstörerischen<br />
Preisdruck aufhören und ein<br />
Bekenntnis zur SDA abgeben. Auch<br />
nach 2020! @inside_sda<br />
FACEBOOK (1) Januar 2018<br />
Im Januar 2018 hat Facebook seinen Algorithmus für die<br />
Newsfeeds verändert. Jetzt haben die Posts des Freunde<br />
und der Familie Vorrang gegenüber den Firmen, Marken<br />
und Medien. Deshalb unbedingt die <strong>syndicom</strong>-Seite<br />
abonnieren, um ja nichts zu verpassen!<br />
FACEBOOK (2) März 2018<br />
«Um die Benutzererfahrung zu verbessern»<br />
hat Facebook via Benachrichtigung<br />
begonnen, den Usern die<br />
Gesichtserkennung vorzuschlagen.<br />
Ihr könnt diese Funktion bei den<br />
«Einstellungen -> Gesichtserkennung»<br />
blockieren.


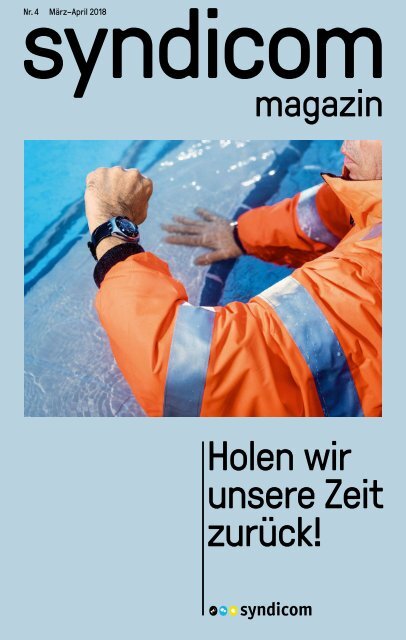


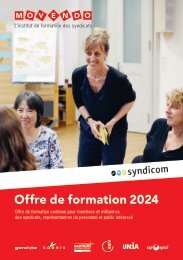



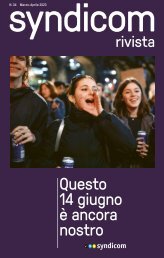

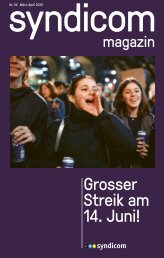


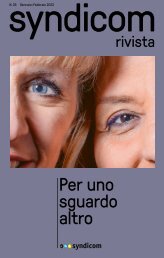
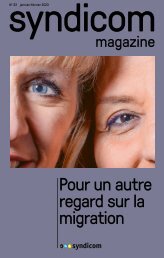
![2202456_[230122]_Syndicom_33_2023_DE_LOW_150_dpi](https://img.yumpu.com/67501302/1/164x260/2202456-230122-syndicom-33-2023-de-low-150-dpi.jpg?quality=85)