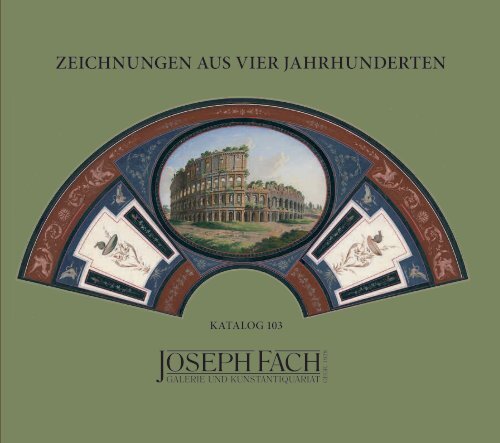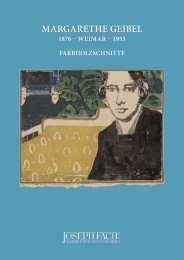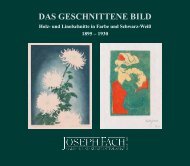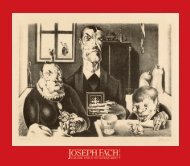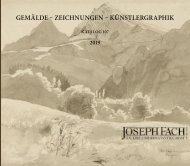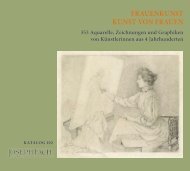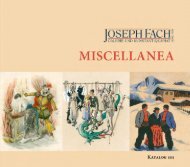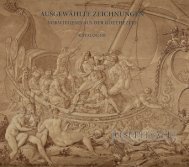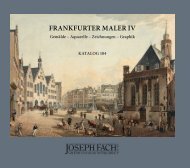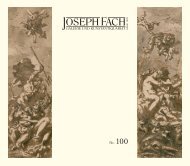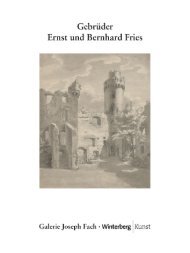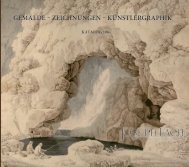Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ZEICHNUNGEN AUS VIER JAHRHUNDERTEN<br />
KATALOG <strong>103</strong><br />
GALERIE UND KUNSTANTIQUARIAT<br />
GEGR.1928
ZEICHNUNGEN<br />
AUS 4 JAHRHUNDERTEN<br />
<strong>Katalog</strong> <strong>103</strong><br />
GALERIE UND KUNSTANTIQUARIAT<br />
GEGR.1928<br />
Am Weingarten 7 – 60487 Frankfurt am Main<br />
Telefon: (0 69) 28 77 61 - Fax: (0 69) 28 58 44<br />
info@galerie-fach.de<br />
www.galerie-fach.de
Schlesischer Wappenmaler<br />
um 1600<br />
1.<br />
Wappen derer von Schweinichen<br />
Schwarze Tusche, Feder in Braun<br />
und Aquarell, mit Deckweiß gehöht,<br />
auf Bütten. 23,4:18,6 cm.<br />
Provenienz: Sammlung R. Holtkott,<br />
nicht bei Lugt.<br />
Sehr fein ausgearbeitete Wappenmalerei,<br />
vielleicht ehemals aus einem<br />
Wappenbuch stammend.<br />
Die Herren von Schweinichen gehörten<br />
zum Uradel in Niederschlesien,<br />
deren Stammsitz war die bedeutende<br />
Burg Swinia (Schweinhausburg) nahe<br />
Bolkenhain in Niederschlesien.<br />
Einer der bekanntesten Vertreter dieses<br />
Geschlechts war der herzoglichliegnitzsche<br />
Hofmarschall Hans von<br />
Schweinichen (1552-1616), der mit<br />
der Beschreibung seines Dienstes am<br />
Hofe dreier schlesischer Herzöge zu<br />
den namhaftesten Sittenschilderern<br />
des 16. Jahrhunderts zählt.<br />
3
2.<br />
Deutsch, Mitte 17. Jahrhundert<br />
Diogenes in der Tonne umgeben von kämpfenden Persern und Griechen, über der Szene schwebend Chronos.<br />
Feder in Braun, grau laviert, mit brauner Feder oben und unten, rechts<br />
teilweise umrandet, verso geschwärzt, auf Bütten. 14:18,2 cm.<br />
Insgesamt leicht faltig, vertikale Mittelfalte geglättet.<br />
Vorzeichnung für eine Illustration.<br />
Auf der von Chronos gehaltenen Schriftrolle ist in Spiegelschrift<br />
zu lesen: „Der Böse / Maul: u: Heuchel / Christ beschämt<br />
/ Durch den Glau / ben u: das Leben / der Heyden und / anderer<br />
Natür / licher Menschen.“<br />
4
5<br />
2.
3.<br />
Deutsch, Mitte 17. Jahrhundert<br />
Umkreis Johann Heinrich Schönfeld<br />
1609 Biberach a.d. Riß – Augsburg 1684<br />
Reiter, Reiterin und Pilger am Brunnen, im Vordergrund zwei liegende Hunde.<br />
Feder in Braun, braun laviert, über leichter Stift-Vorzeichnung, auf Bütten. 23:18,8 cm.<br />
Verso mehrere Schriftzeichen. Feder in Braun.<br />
Papier vergilbt, zwei horizontale Knickfalten geglättet, mehrere kleine Löchlein sorgfältig restauriert.<br />
Die alte Zuschreibung an J.H. Schönfeld (1609-1684) wurde von<br />
Dr. M. Kaulbach, Staatsgalerie Stuttgart (Brief vom 15.02.2011)<br />
unterstützt, von Dr. G. Krämer, Augsburg (E-Mail vom<br />
12.04.2011), jedoch abgelehnt. Er begründet dies folgendermaßen:<br />
„..., leider kann ich in Ihrer Zeichnung nicht die Handschrift<br />
von Schönfeld erkennen. .... die Zeichnung ist eindeutig<br />
die eines Rechtshänders, nur so lassen sich die Schraffuren deuten;<br />
...“.<br />
6
7<br />
3.
4.<br />
WILHELM VON BEMMEL<br />
1630 Utrecht – Wöhrd/Nürnberg 1708<br />
Südliche Landschaft mit klassischer Ruine.<br />
Feder in Grau, grau laviert, mit schwarzer Feder umrandet, auf Bütten, rechts unten<br />
signiert „W. van Bemel“. 26,6:21,5 cm, auf Sammlungsuntersatz montiert.<br />
Provenienz: Sammlung Peter Vischer (1751-1823), Basel, Lugt<br />
2115; Auktion C. Le Blanc, Paris, 19.04. – 15.07.1852; Sammlung<br />
Jules Dupan, Genf, Lugt 1440; Sammlung Chr. Hammer, Stockholm<br />
(1818-1905), Lugt 1237 und 1238; Auktion J.M. Heberle,<br />
Köln, 30.06. – 15.07.1897; nicht identifizierte Sammlungsnummern<br />
„No. 1946“ (recto auf dem Untersatz) sowie „971“ (verso);<br />
erworben bei H. Marcus, Amsterdam, 1968; Sammlung Hans<br />
van Leeuwen (1908-2010), Amsterdam, Lugt Suppl. 2799a.<br />
Ausstellungen: Auf folgenden Ausstellungen der Sammlung<br />
van Leeuwen wurde unser Blatt gezeigt: Utrecht 1978, Nr. 6;<br />
Bremen/Braunschweig/Stuttgart 1979/1980, Nr. 8; Freiburg/<br />
Passau/Trier/Aachen/Nürnberg 1982, Nr. 5.<br />
Wilhelm von Bemmel, Stammvater der großen in mehreren<br />
Generationen in Nürnberg tätigen Künstlerfamilie, war aus<br />
Holland kommend, 1662 nach Nürnberg übergesiedelt.<br />
Er war ausschließlich als Landschaftsmaler tätig und als solcher<br />
bei seinen Zeitgenossen, z.B. bei Joachim von Sandrart (1606-<br />
1688), hoch angesehen.<br />
8
9<br />
4.
5.<br />
JAN LUYKEN<br />
1649 – Amsterdam – 1712<br />
Der Verkündigungsengel erscheint den schlafenden Hirten auf dem Felde,<br />
im Hintergrund – skizzenhaft angedeutet – die Heilige Familie mit dem Jesuskind.<br />
Feder in Braun, braun und grau laviert, mit brauner Feder umrandet, auf Bütten,<br />
auf Sammlungsuntersatz montiert. 11,1:10,5 cm.<br />
Vorzeichnung für eine Illustration, möglicherweise für die Bibel.<br />
Luyken war Zeichner und Buchillustrator. Sein gestochenes<br />
Werk umfasst mehr als 3000 Blätter. Er illustrierte religiöse<br />
Werke, vor allem die Bibel, geschichtliche und allegorische<br />
Werke sowie Reisebeschreibungen.<br />
Zahlreich sind seine Federzeichnungen, Entwürfe für seine Buchillustrationen,<br />
die sich durch Erfindungsreichtum und Kompositionsgabe<br />
auszeichnen.<br />
10
11<br />
5.
6. DOMENICO TEMPESTI oder genannt DOMENICO DE MARCHIS<br />
1652 – Florenz – um 1718<br />
Madonna mit dem Jesus- und Johannesknaben, links – skizzenhaft angedeutet - die Eltern des Johannes,<br />
Elisabeth und Zacharias.<br />
Rötel und Feder in Dunkelbraun, auf Bütten, unten signiert (?) „Di Dom.co Tempesti Fiorent.o“. 17,2:14 cm.<br />
Papier etwas gebräunt, leichter Lichtrand ringsum.<br />
Domenico Tempesti war ein Verwandter des Antonio<br />
Tempesta (1555-1630) und Schützling von Cosimo III.<br />
von Toskana. Zunächst Schüler von B. Franceschini (gen.<br />
Volterrano, 1611-1689) und 1676/78 von R. Nanteuil (1623-<br />
1678) und G. Edelinck (1640-1707) in Paris.<br />
Nach seiner Rückkehr nach Florenz 1679 erhielt er eine<br />
Wohnung in der Galleria Granducale. Er war zunächst<br />
als Bildnisstecher tätig, wandte sich dann aber der Pastellmalerei<br />
zu und ging zur weiteren Ausbildung für zwölf<br />
Jahre nach Rom zu C. Maratti (1625-1713).<br />
Auf Vermittlung eines Auftraggebers reiste er nach London<br />
und Paris und hielt sich auch einige Zeit in Düsseldorf<br />
am kurpfalzbayrischen Hofe auf, wo er Porträts der<br />
kurfürstlichen Familie anfertigte. Wieder in Florenz war<br />
er auch als Lehrer tätig.<br />
Verso: Bewegungsstudie eines nach links fliehenden<br />
Aktes und andere Figuren. Feder in Dunkelbraun, unten<br />
mittig undeutliche Zahlen, vermutlich ein Datum (recto<br />
durchscheinend).<br />
12
13<br />
6.
7.<br />
PAUL TROGER<br />
1698 Welsberg/Pustertal – Wien 1762<br />
Zwei miteinander raufende Putten.<br />
Contre épreuve einer Rötelzeichnung, auf Bütten mit Fragment des Wasserzeichens: Anker im Kreis. 12,7:17,6 cm.<br />
Auf alten Büttenuntersatz montiert.<br />
Provenienz: Sammlung Fürst von Lichnowsky, Lugt 1707;<br />
Sammlung PS im Queroval (Wiener Sammlung), nicht identifiziert,<br />
Lugt 2111; Sammlung OJJ im Kreis, nicht bei Lugt.<br />
Vergleichsliteratur: Die Bestimmung unseres Blattes basiert<br />
auf dem Vergleich mit der Zeichnung „Schwebender Putto<br />
mit Ölzweig“ (vgl. Ausst. <strong>Katalog</strong>: Paul Troger & Brixen. Hrsg.<br />
von L. Andergassen, Brixen 1998, Nr. 4.9, Farbabb. 55; W.<br />
Aschenbrenner/G. Schweighofer, Paul Troger. Leben und Werk,<br />
Salzburg 1965, S. 129, Abb. Zeichnungen 11).<br />
Eine besonders große Ähnlichkeit in der Haltung der zwei miteinander<br />
raufenden Putten besteht mit der Zeichnung „Drei<br />
Putten unter Ruinen“ aus dem Landesmuseum in Brünn, vgl.<br />
op. cit. Zeichnungen 28, Abb. 28.<br />
Die Gegenseitigkeit unserer Zeichnung gegenüber dem Blatt<br />
aus Brünn bestätigt, daß es sich bei unserem Blatt um einen<br />
Gegendruck handelt. Vergleichbare Gruppen von spielenden<br />
Engelputten sind im Werk Trogers, in den Fresken und auch in<br />
den Altargemälden, sehr häufig anzutreffen.<br />
14
15<br />
7.
8.<br />
AUGUST JOHANN RÖSEL VON ROSENHOF<br />
1705 auf Schloß Augustenburg bei Arnstadt/Thüringen – Nürnberg 1759<br />
Eisvogel auf einem Zweig sitzend.<br />
Gouache auf dunkelbraun grundiertem Pergament, am Unterrand signiert „A.J. Rösl“.<br />
25,8:20,9 cm, zum Achteck geschnitten.<br />
Vergleichsliteratur: H. Ludwig, Nürnberger naturgeschichtliche<br />
Malerei im 17. und 18. Jahrhundert. Marburg, Basilisken-<br />
Presse 1998, Ss. 370-373, Farbabb. XXXVI.<br />
Mit seinen naturhistorischen Tafelwerken zählt Rösel zu den<br />
bekanntesten Tier- und Insektenmalern im 18. Jahrhundert.<br />
Die Zeichnungen zu Rösels bedeutendster Publikation der<br />
„Insecten-Belustigung“ befinden sich neben den Vorstudien<br />
zur „Natürlichen Geschichte der Frösche“ in der Bayerischen<br />
Staatsbibliothek in München. Ein bereits um 1745 gefaßter Plan<br />
für ein Vogel- und ein Konchylienbuch wurde zugunsten des<br />
Insektenwerkes aufgegeben.<br />
Einige wenige frühe Vogelaquarelle Rösels aus den Jahren 1721<br />
bis 1725 haben sich jedoch in der Staatl. Graphischen Sammlung<br />
in München erhalten.<br />
Die vorliegende Gouache eines Eisvogels entstand wahrscheinlich<br />
nach einem Stopfpräparat aus Rösels eigenem Naturalienkabinett,<br />
dessen postumer Verkauf belegt ist.<br />
Die Darstellung des Vogels mit seinem schillernden Gefieder<br />
vor dunklem Grund stellt diese Gouache in die Tradition der<br />
Nürnberger naturgeschichtlichen Malerei, wie sie etwa von<br />
Barbara Regina Dietzsch (1706-1783) vertreten wird.<br />
16
17<br />
8.
9. JOHANN GEORG WILLE<br />
1715 Obermühle/Biebertal – Paris 1808<br />
Ruinen der Abtei von Saint-Maur.<br />
Feder in Braun, grau laviert, auf Bütten mit Fragment des Wasserzeichens: bekröntes Lilienwappen, unten signiert<br />
und datiert „J.G. Wille 1762.“. 24:33,2 cm. Auf eine französische Sammlungsmontierung des 18. Jahrhunderts<br />
aufgelegt und mit mehreren Tuschlinien und grünlich aquarellierter Umrandung versehen.<br />
Mit winzigem Braunfleck im Himmel, sonst tadellos.<br />
Vergleichsliteratur: H.-Th. Schulze Altcappenberg: Le Voltaire<br />
de L’ Art: Johann Georg Wille (1715-1808) und seine Schule in<br />
Paris: Studien zur Künstler- und Kunstgeschichte der Aufklärung;<br />
mit einem Werkverzeichnis der Zeichnungen von J. G.<br />
Wille und einem Auswahlkatalog der Arbeiten seiner Schüler<br />
von Aberli bis Zingg, Bd. 16, Münster 1987, S. 300 f., Nrn. 210-<br />
214; Bassenge, Berlin, Auktion 87: Kunst des 15.-19. Jahrhunderts,<br />
25./26.05.2006, Nr. 5636, Farbabb. S. 272.<br />
Der 1736 nach Paris ausgewanderte Wille malte die Ruinen von<br />
Saint-Maur mehrfach; sicher zu dokumentieren sind fünf weitere<br />
Federzeichnungen, eine von 1762, die anderen stammen<br />
von 1763. Es ist mit relativer Sicherheit anzunehmen, daß auch<br />
unser Blatt auf einer von Willes Exkursionen entstand. Wille<br />
betrieb seit spätestens den späten 50er Jahren das direkte Studium<br />
vor der Natur und unternahm jährlich mehrere kürzere<br />
und längere Fahrten, meist in Begleitung seiner Schüler oder<br />
anderer Künstlerkollegen.<br />
Eine der immer wieder aufgesuchten Orte war Saint-Maur. Interessant<br />
ist dieses Thema in Bezug darauf, daß die Ruinen von<br />
Saint-Maur erst im frühen 19. Jahrhundert zu einem beliebten<br />
Motiv wurden. Zur Entstehungszeit unseres Blattes war im allgemeinen<br />
die heimische Ruine des Mittelalters kein gebräuchliches<br />
Thema, so daß Wille mit dessen Entdeckung gewissermaßen<br />
als Vorreiter einer Tradition angesehen werden kann,<br />
die sich erst in den letzten Dezennien des 18. Jahrhunderts ausbildete.<br />
Es muß davon ausgegangen werden, daß Wille bereits um 1760<br />
eine Zeichnung von Saint-Maur schuf, die der unseren in Komposition<br />
und Aufbau vergleichbar ist und Franz Edmund Weirotter<br />
(1730-1771) als Vorlage (seitenverkehrt) für eine um 1760<br />
zu datierende Radierung diente (vgl. Thilo Winterberg: Franz<br />
Edmund Weirotter. Der Landschaftsradierer, Werkverzeichnis<br />
der Radierungen, Heidelberg 1998, Nr. 82; für diesen Hinweis<br />
danken wir Dr. Th. Winterberg, Heidelberg). Weirotter, der<br />
1759 nach Paris kam, erhielt direkt nach seiner Ankunft von<br />
Wille Aufträge für Landschaftsgemälde. 1761 beteiligte er sich<br />
zudem gemeinsam mit A. Zingg (1734-1816) und D. Hien (1725-<br />
1773) an einer Zeichnungsexkursion Willes in die Normandie,<br />
um vor Ort zu zeichnen. Weitere Aufträge und ein gemeinsame<br />
Exkursion 1765 folgten.<br />
Die heute nicht mehr existierende Abtei von Saint Maur war<br />
im Mittelalter eine der berühmtesten Abteien des französischen<br />
Königreiches. Sie lag in Lothringen, heute Dept. Vogesen.<br />
18
19<br />
9.
10.<br />
JOSEPH ROOS (ROSA)<br />
1726 – Wien – 1805<br />
Pastoralen in südlicher Gebirgslandschaft<br />
mit Ruine.<br />
2 Blatt: Feder in Grau, braun laviert, mit<br />
grauer Feder umrandet, auf chamoisfarbenem<br />
Velin, jeweils links unten signiert<br />
„Roos“.<br />
Darstellungsgröße 23,5: ca. 18 cm, Blattgröße<br />
27,3:19,7 cm, bzw. 25,2:19,7 cm.<br />
Leicht stockfleckig.<br />
Möglicherweise handelt es sich um Vorzeichnungen<br />
für Radierungen.<br />
Joseph Roos, Sohn und Schüler des Cajetan<br />
(1690-1770), Vater des Historienmalers und<br />
Kustos’ an der Belvedere-<strong>Galerie</strong> Joseph II<br />
Roos (1760-1822), studierte zuerst an der<br />
Wiener Akademie, dann in Dresden, wo<br />
20
10.<br />
er unter G.S. Bibiena (1726-1805) und<br />
G.N. Servandoni (1695-1766) für die<br />
Ausstattung der Oper tätig war.<br />
1757 in Berlin tätig, seit 1758 wieder in<br />
Dresden, von wo aus er 1772 die Ausstellungen<br />
der Society of Art in London<br />
beschickte.<br />
1772 wurde er als Direktor der kaiserl.<br />
Gemäldegalerie nach Wien berufen<br />
und leitete als solcher 1777 deren<br />
Überführung aus der Stallburg in das<br />
Belvedere und führte 1796 und 1804<br />
deren <strong>Katalog</strong>isierung durch.<br />
Seit 1773 war er Mitglied der Akademie<br />
S. Luca in Rom, seit 1800 der in<br />
Parma, ferner der von Florenz, Bologna<br />
und Madrid.<br />
Er war als Landschafts- und Tiermaler<br />
sowie als Radierer tätig.<br />
21
11. Umkreis<br />
ANTON RAPHAEL MENGS<br />
1728 Aussig/Böhmen – Rom 1779<br />
Ansicht des Colosseums in Rom.<br />
Ansicht des Grabmahls der Caecilia Metella, gelegen an der Via Appia Antica.<br />
1 Paar Fächerblätter. Die Darstellungen sind in Form von querovalen Medaillons gerahmt, mit floralem Rankenwerk, Vasen und<br />
Vögeln; in der Art pompejanischer Wandmalereien sind die übrigen Bildfelder ausgefüllt. Deckfarben, auf dünnem Pergament<br />
(Schwanenhaut ?); im Format eines Halbkreises. Je ca. 19,7:36 cm.<br />
22
Vergleichsliteratur: St. Röttgen: Mengs. Die Erfindung des<br />
Klassizismus, München 2001, vgl. Nr. 81 mit Farbabb.<br />
„Der Fächer als unverzichtbares modisches Accessoire erlebte<br />
seine Blüte in Europa im 18. Jahrhundert, zunächst als fester<br />
Bestandteil des Hofzeremoniells, bald aber auch in bürgerlichen<br />
Kreisen. In englischen, italienischen und vor allem französischen<br />
Manufakturen wurden die dort hergestellten Fächerblätter<br />
auf die häufig aus China importierten Fächerhälse montiert.<br />
Es gab eine unbegrenzte Vielfalt in Typus, Form und Material,<br />
wenn der Dekor des Fächerblattes auch im allgemeinen den<br />
modischen Dekorationsformen folgte [...]. Charakteristische<br />
Motive der italienischen Fächer, die gerne als Reiseandenken<br />
hergestellt und gekauft wurden, waren mythologische Themen,<br />
oft nach bildlichen Interpretationen von Malern des 17.<br />
Jahrhunderts, „Capricci“, also römische Ruinenlandschaften,<br />
berühmte italienische Denkmäler oder Stadtansichten,<br />
insbesondere von Neapel und dem Vesuv. Eine weitere italienische<br />
Besonderheit waren pompejanische Wandmalereien,<br />
die in den Fächerbildern reproduziert oder nachempfunden<br />
wurden“ (zit. aus: op. cit., S. 253).<br />
11.<br />
23
12.<br />
JACOPO ALESSANDRO CALVI, genannt IL SORDINO<br />
1740 – Bologna –1815<br />
Allegorie der Malerei – Putto malend im Atelier.<br />
Feder in Braun, braun laviert, auf Bütten. 7,8:9,5 cm.<br />
Etwas fleckig.<br />
Vergleichsliteratur: Kat. 51, <strong>Galerie</strong> Sabrina Förster, Düsseldorf,<br />
2010, Nrn. 15-17 mit Farbabb. Wie auch bei diesen Zeichnungen,<br />
Allegorien der Malkunst, der Radierkunst und der<br />
Töpferkunst, wird auch bei unserer Zeichnung die Allegorie<br />
durch ihre Tätigkeit, die Malerei an der Staffelei und ihre Attribute<br />
dargestellt.<br />
Weitere Zeichnungen von Calvi befinden sich in Windsor<br />
Castle und in der Sammlung F. Frhr. von Koenig, Schloß <strong>Fach</strong>senfeld.<br />
Der kleinwüchsige und von Kindheit an taube Künstler wurde<br />
wegen dieser Gebrechen „Il Sordino“ genannt. Seine Ausbildung<br />
absolvierte der Maler und Kupferstecher in seiner Geburtsstadt<br />
bei G. Varotti (1715-1789) und G.P. Cavazzoni-Zanotti (1674-<br />
1765).<br />
Er schuf Gemälde für verschiedene Bologneser Kirchen sowie<br />
elf Reproduktionen nach Gemälden des Klosters San Michele<br />
in Bosco bei Bologna. Daneben hat er sich auch als Dichter und<br />
Kunstschriftsteller betätigt.<br />
24
25<br />
12.
13.<br />
FERDINAND KOBELL<br />
1740 Mannheim – München 1799<br />
Altes Stadttor mit einem Rundturm und Resten einer Stadtmauer.<br />
Feder in Braun, grau laviert, auf Bütten mit undeutlichem Wasserzeichen. 18,8:30,3 cm.<br />
Insgesamt nicht ganz frisch.<br />
Vergleichsliteratur: St. von Stengel, Catalogue raisonné des<br />
estampes de Ferd. Kobell. Nürnberg 1822 (Nachtrag 1824), Nr.<br />
208-210 und 229. Diese 4 Radierungen zeigen ähnliche Stadttore<br />
wie das auf unserer Zeichnung abgebildete.<br />
Wir danken Thomas Herbig, München, für die Bestätigung unserer<br />
Zuschreibung (E-Mail vom 6.09.2012). Er äußert sich wie<br />
folgt: „bei näherer Betrachtung der Zeichnung (via Ferndiagnose)<br />
verdichtet sich mein Eindruck, dass Sie wohl mit Ihrer Vermutung<br />
richtig liegen. Tatsächlich zeigt auch mein archiviertes<br />
Material, dass das Motiv des ruinösen Torbogens bzw. einer<br />
Ruine mit Torbogen bei Ferdinand wiederholt auftaucht. Der<br />
Baumschlag erinnert an Franz und Ferdinand. Bei Ferdinand<br />
findet man immer wieder die Kombination von brauner Feder<br />
und grauer Lavierung. Typisch für ihn ist die Art wie die Figuren<br />
skizziert sind (vgl. v. a. den sitzenden Mann), typisch auch<br />
die gitterartige Struktur des Federstrichs auf dem Mauerwerk<br />
und der einleitende Weg mit den Bruchstücken. Vergleichsbeispiele<br />
finden sich vor allem in den 70er Jahren (u.a. denke ich an<br />
Inv. Nr. 23478, Hamburger Kunsthalle).“<br />
Nach einem Studium der Rechtswissenschaft in Heidelberg<br />
wurde Fedinand Kobell Hofkammersekretär in Mannheim.<br />
1762 ermöglichte ihm die Unterstützung von Kurfürst Karl<br />
Theodor ein Studium an der Mannheimer Zeichenakademie<br />
bei P.A. von Verschaffelt (1710-1793). Da dort jedoch die Landschaftsmalerei<br />
nicht zum Lehrstoff gehörte, erlernte Kobell diese<br />
durch autodidaktische Studien in der näheren Umgebung.<br />
1764-1766 war er als Theaterdekorationsmaler an der Hofoper<br />
tätig. 1768/70 reiste er zum Weiterstudium nach Paris und war<br />
Schüler von J.G. Wille (1715-1808). Nach seiner Rückkehr 1771<br />
wurde er zum Kabinettsmaler des Mannheimer Hofes ernannt,<br />
1798 erfolgte die Ernennung zum Direktor der dortigen <strong>Galerie</strong>.<br />
26
27<br />
13.
14.<br />
zugeschrieben<br />
PHILIPP JAKOB LOUTHERBOURG d.J.<br />
1740 Straßburg – Chiswick/London 1812<br />
Innenansicht eines Bergwerks mit Arbeitern bei der Erzschmelze.<br />
Pinsel in Braun, mit reicher Deckweißhöhung, über Bleistift, auf braunem Bütten mit Wasserzeichen:<br />
kleiner Wappenschild mit daranhängender Traube sowie den Initialen AIC. 41,8:56,8 cm.<br />
Provenienz: Grafen Andlau. Diese alte Adelsfamilie ist im Elsaß<br />
beheimatet.<br />
Nach einer Ausbildung bei seinem Vater, Ph.J. Loutherbourg<br />
d.Ä. (um 1698-1768) war der Zeichner seit 1755 Schüler bei C.<br />
van Loo (1705-1765), J.H. Tischbein (1722-1789) und Fr. Casanova<br />
(1727-1802). 1764 ging Loutherbourg nach Paris, 1768<br />
wurde er Mitglied der Académie royale. 1771 ging er als Bühnenmaler<br />
nach London, wo er bald bedeutenden Ruf erlangte<br />
und 1781 Mitglied der Royal Academy wurde. Als Maler war<br />
er Eklektiker und malte anfänglich Ideallandschaften in der<br />
Art Jan Boths (um 1610-1652), später Marinen und Schlachtendarstellungen<br />
in der Art von S. Rosa (1615-1673) und J. Vernet<br />
(1714-1789). Er war Freund und Anhänger Aless. Cagliostros.<br />
28
29<br />
14.
15.<br />
PHILIPPE LOUIS PARIZEAU<br />
1740 – Paris – 1801<br />
Das Opfer der Vestalinnen.<br />
Feder in Schwarz, braun laviert, über Bleistiftskizze, auf Bütten, auf Untersatz mit Tuschlinien und<br />
Aquarellrand montiert, dort rechts unten signiert und datiert „Parizeau fecit 1775“. 15,8:23,5 cm.<br />
Vergleichsliteratur: Ausst. <strong>Katalog</strong>: Von Callot bis Greuze.<br />
Französische Zeichnungen des 17. und 18. Jahrhunderts. Im<br />
Blickfeld der Goethezeit V. Weimar 2005, S. 220, Nr. 81 mit farb.<br />
Abb.<br />
Über Parizeaus Leben und Werk ist wenig bekannt und es fehlt<br />
bisher eine grundlegende Arbeit über ihn. Seit Beginn der sechziger<br />
Jahre war er Schüler von J.Gg. Wille (1715-1808) und als<br />
Maler und Radierer in Paris tätig. Nur wenige seiner Gemälde<br />
sind bisher bekannt geworden und es scheint, als wäre er hauptsächlich<br />
als Zeichner tätig gewesen.<br />
Blätter von seiner Hand befinden sich in den Graph. Sammlungen<br />
Düsseldorf, Basel, Darmstadt, dem Metropolitan Museum<br />
New York sowie in der Sammlung von Jeffrey E. Horvitz. Georg<br />
Melchior Kraus (1737-1806) hat nach ihm gezeichnet.<br />
30
31<br />
15.
16.<br />
GIUSEPPE PIATTOLI<br />
um 1740/50 - Florenz – nach 1818<br />
Der auf Wolken stehende und von Engeln umgebene Christus wird von zwei Frauen<br />
angebetet, von denen die linke eine Krone trägt und die rechte einen Blütenkranz<br />
im Haar und Getreideähren in einer Hand trägt.<br />
Feder in Braun, über leichter Skizze in schwarzer Kreide, braun und grau laviert, mit schwarzer Feder umrandet,<br />
verso von neuerer Hand mit Bleistift „Giuseppe Piattoli“ bezeichnet, auf Bütten mit Wasserzeichen: bekröntes Wappen,<br />
im Schild ein F. Darstellung oben rundbogig geschlossen. 36,1:21 cm.<br />
Mit kleinen Restaurierungen in den Ecken, etwas fleckig.<br />
Provenienz: Süddeutsche Privatsammlung.<br />
Piattoli war als Maler, Zeichner und Kupferstecher tätig. Von<br />
1785-1807 lehrte er als Zeichenmeister an der Akademie in Florenz.<br />
Von seinem zeichnerischen Oeuvre sind nur relativ wenige<br />
Blätter publiziert.<br />
Unsere Zeichnung zeigt eine gewisse Verwandtschaft mit venezianischen<br />
Künstlern, wie Seb. Ricci (1659-1734) oder G.B.<br />
Tiepolo (1696-1770). Dies wird bei den beiden weiblichen allegorischen<br />
Halbfiguren, die am linken Bildrand zu sehen sind,<br />
besonders deutlich.<br />
32
33<br />
16.
17.<br />
JOHANN GEORG WAGNER<br />
1744 – Meissen – 1767<br />
Flußlandschaft mit einer Wassermühle.<br />
Pinsel in Schwarzbraun, braun laviert, über Bleistift, mit schwarzer Tuschlinie umrandet, auf cremefarbenem Bütten,<br />
rechts unten monogrammiert „W.“, verso von älterer Hand bezeichnet. 13,4:18 cm.<br />
Provenienz: Frankfurter Privatsammlung.<br />
Als Sohn des Malerehepaares Johann Jacob W. (um 1710-1797)<br />
und Maria Dorothea W. (1728-1792) erhielt Johann Georg zunächst<br />
Unterricht bei seinen Eltern. Dann besuchte er in Dresden<br />
den Unterricht des Bruders seiner Mutter, des berühmten<br />
Malers und Radierers C.W.E. Dietirch (1712-1774).<br />
Seine Ausbildung konnte er 1764 trotz seines Wunsches nicht<br />
bei J. Roos (1726-1805) beenden, da jener ihn lieber in seinem<br />
Atelier beschäftigte – denn nach dessen Meinung konnte er<br />
Wagner auf künstlerischem Gebiet nichts mehr beibringen.<br />
1765 wurde Wagner bereits Pensionär und Unterlehrer an der<br />
Dresdener Akademie.<br />
Eine Studienreise auf Vermittlung des Direktors der <strong>Galerie</strong><br />
und mit Unterstützung Prinz Xavers, sollte der Künstler durch<br />
seinen jähen Tod infolge einer Erkältung nicht mehr antreten<br />
können.<br />
Der bereits im Alter von 22 Jahren verstorbene Künstler erfreute<br />
sich schon früh der Anerkennung des Publikums und seiner<br />
Künstlerkollegen – viele seiner Zeichnungen und Bilder wurden<br />
von seinen Zeitgenossen in Stichen und Wiederholungen<br />
wiedergegeben. So ahmten nach Goethe etwa die Brüder J.Ph.<br />
(1737-1807) und J.G. Hackert (1744-1773) seine Bilder nach.<br />
J.Chr. Klengel (1751-1824) bezeichnete ihn später gar als „Raphael<br />
der Landschaftsmalerei“.<br />
34
35<br />
17.
18.<br />
JOHANN ALEXANDER DAVID FRIEDRICH<br />
1744 – Dresden-Friedrichstadt – 1793<br />
Aegeus, Medea und Theseus.<br />
Feder in Schwarzbraun, mit Sepia laviert, auf Bütten, verso betitelt,<br />
monogrammiert und datiert „Fr: Inv: 1769.“. 23,9:20,3 cm.<br />
Dargestellt ist die Szene in der Aigeus seinen verschollenen Sohn<br />
Theseus an seinem Schwert erkennt und dessen Tod durch Gift<br />
in letzter Sekunde verhindert. Medea, die ihren Gatten Aigeus<br />
ursprünglich zu dem Giftmord angestiftet hatte, verläßt daraufhin<br />
wütend, in eine Wolke gehüllt, die Szene.<br />
Bildmäßig ausgeführte Zeichnung!<br />
Alexander Friedrich ist der älteste Sohn von David Friedrich<br />
(1719-1766), dem Stammvater einer im 18. und 19. Jahrhundert<br />
in Dresden-Friedrichstadt ansässigen Künstlerfamilie. Nach<br />
ersten Studien bei seinem Vater ging er 1764 als einer der ersten<br />
„Scholaren“ an die gerade gegründete Dresdener Kunstakademie.<br />
Im Zeichnen wurde er von Ch. Hutin (1715-1776) unterrichtet,<br />
in Architektur vom Hofbaumeister F.A. Krubsacius<br />
(1718-1790). Friedrich wandte sich der Historienmalerei zu und<br />
setzte dieses Studium bei G.A. Casanova (1728-1795) fort. Nach<br />
dem Tod des Vaters übernahm er dessen Werkstatt für Tapetenmalerei.<br />
1768 wurde Friedrich Zeichenlehrer an der Dresdener<br />
Akademie und erteilte auch privaten Zeichenunterricht. Ferner<br />
beteiligte er sich seither an den Dresdener Akademieausstellungen.<br />
36
37<br />
18.
19.<br />
Umkreis<br />
DOMINIQUE VIVANT DENON<br />
1747 Chalon-sur-Saône – Paris 1825<br />
Bildnis einer jungen Frau mit gelocktem Haar, Büste en face.<br />
Feder in Dunkelbraun und Schwarz, über Bleistift, auf bräunlichem Velin. 29:24,8 cm.<br />
Ecken unregelmäßig schräg geschnitten, insgesamt etwas fleckig.<br />
Provenienz: Sammlung Prof. F. Beuker, Düsseldorf.<br />
Stark verschattete Gesichtshälften wie bei unserer Zeichnung<br />
findet man im zeichnerischen und graphischen Werk Denons<br />
immer wieder, auch die Art und Weise wie er mit Schraffuren<br />
modelliert: am Décolletée, an den Schultern, im Hintergrund,<br />
findet man ebenso bei gesicherten Zeichnungen von Denon.<br />
Vergleichsliteratur: M.-A. Dupuy-Vachey, Les itinéraires de Vivant<br />
Denon dessinateur et illustrateur. Nimes 2007, Ss. 9, 19, 41<br />
und 43.<br />
Ursprünglich Diplomat, entwarf Denon nach der Französischen<br />
Revolution von 1789 auf Anregung J. L. Davids (1748-<br />
1825) die Costumes républicains als Vorbilder für das offizielle<br />
Nationalkostüm. 1798-1799 begleitete er Napoleon Bonaparte<br />
als Kriegszeichner nach Italien und Ägypten.<br />
1788 erwarb er das gesamte radierte Werk von Rembrandt aus<br />
der Sammlung A.M. Zanetti in Venedig. Seit 1804 war er Generalinspektor<br />
der Museen in Paris, in dieser Funktion wählte er<br />
in den eroberten Ländern die Kunstschätze aus, die Napoleon<br />
als Siegestrophäen nach Paris bringen ließ.<br />
Denon betätigte sich als Kunstsammler, Schriftsteller, Zeichner,<br />
Radierer, Lithograph und Medailleur. „Daneben sammelte<br />
er Kunstwerke und radierte mit leichter Hand kleine Bildnisse<br />
von geistreichen Zeitgenossen und schönen Damen der Gesellschaft...“.<br />
(zitiert aus: Thieme-Becker, Bd. IX, S. 79).<br />
38
39<br />
19.
20.<br />
JOHANNES FRANCISCUS GOUT<br />
um 1748 vermutl. Berlin – 1812<br />
Interieur einer dreihalligen barocken Kirche mit mehreren Figuren.<br />
Feder in Schwarz, grau laviert, über Bleistift, mit doppelter Tuschlinie umrandet, auf Bütten<br />
mit Fragment des Wasserzeichens: C & I Honig, rechts am Fuße einer Säule<br />
signiert und datiert „Johannes Franciscus Gout inv: et delin 1777.“. 28,5:34,2 cm.<br />
Durchgehend etwas braunfleckig.<br />
Die Zeichnung stammt vermutlich noch aus der Zeit, in der<br />
Gout als Dekorationsmaler in Schloß Birkenfeld in Unterfranken<br />
tätig war.<br />
Des Malers und Radierers Gout früheste Arbeiten sind in Nürnberg<br />
nicht lange vor 1773 entstanden. 1773 und die folgenden<br />
Jahre war er in Schloß Birkenfeld tätig. 1780 war er Hofmaler<br />
in Bayreuth, 1782 wurde er von Goethes Freund, dem Kriegsrat<br />
Merck, an den Hof in Darmstadt empfohlen und scheint später<br />
Großherzogl. Hessen-Darmstädter Theatermaler geworden zu<br />
sein und war als solcher auch in Wiesbaden und Frankfurt am<br />
Main tätig. 1808 ist er noch in Wiesbaden nachweisbar.<br />
Im Historischen Museum, Frankfurt am Main, befinden sich<br />
zwei Gemälde, Landschaften mit antiken Gebäuden, die ehemals<br />
aus dem Prehn’schen Kabinett stammen.<br />
40
41<br />
20.
21.<br />
FRANZ JOSEF INNOCENZ KOBELL<br />
1749 Mannheim – München 1822<br />
Gebirgslandschaft mit einem Gewässer, rechts auf einem schroffen Felsen eine Burg, links eine Baumgruppe.<br />
Feder in Schwarz und Bleistift, braun laviert, auf Bütten. 19,2:30,9 cm.<br />
Auf alten Sammlungsuntersatz montiert.<br />
Nach einer Ausbildung zum Kaufmann in Mainz kehrte Franz<br />
Kobell 1762 in seine Geburtsstadt Mannheim zurück, wo er von<br />
seinem Bruder Ferdinand (1740-1799) auch künstlerisch unterstützt<br />
wurde. 1771-1778 bildete er sich zusätzlich an der Mannheimer<br />
Zeichnungsakademie aus.<br />
1778 erhielt er von Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz eine<br />
Pension, die ihm eine Reise nach Italien ermöglichte, wo er sich<br />
hauptsächlich in Rom aufhielt.<br />
Hier war er insbesondere dem Maler F. Müller (1749-1825), dem<br />
Dichter W. Heise und dem Bildhauer A. Trippel (1744-1793)<br />
freundschaftlich verbunden.<br />
Die Beschäftigung mit der Malerei N. Poussins (1594-1665) und<br />
Cl. Lorrains (1600-1682) hatte großen Einfluß auf sein späteres<br />
Werk; er wandte sich ganz und gar der Landschaftskunst zu.<br />
Bereits 1780 wurde er zum Hofmaler am 1778 nach München<br />
verlegten Mannheimer Hof ernannt. 1784 kehrte er aus Italien<br />
nah München zurück.<br />
Ab 1793 lebte er in Wohngemeinschaft mit seinem Bruder Ferdinand<br />
und seinem Neffen Wilhelm von Kobell (1766-1853) in<br />
München. Der zeichnerische Nachlaß des Künstlers wird auf<br />
mehr als 10.000 Blatt geschätzt.<br />
42
43<br />
21.
22.<br />
zugeschrieben<br />
FRIEDRICH MÜLLER, gen. MALER MÜLLER<br />
1749 Kreuznach – Rom 1825<br />
Waldrand mit einem Weg im Vordergrund, im Hintergrund rechts weite Landschaft.<br />
Feder in Schwarzbraun, über Bleistift, auf blauem Bütten. 20,3:31,8 cm.<br />
Vergleichsliteratur: Sattel Bernardini/Schlegel, Friedrich Müller<br />
1749-1825. Der Maler. Landau, 1986, S. 264, mittlere Abb., S.<br />
288 untere Abb., S. 311, obere Abb.<br />
Charakteristische schnell skizzierte Landschaft mit vielen<br />
Schraffuren, wie sie in Müllers Zeichnungen zahlreich zu finden<br />
sind, auch farbige Papiere sind in seinem zeichnerischen<br />
Werk häufig anzutreffen.<br />
Friedrich Müller war ein typischer Vertreter des „Sturm und<br />
Drang“ und eine Doppelbegabung. Er war als Schriftsteller,<br />
Maler, Zeichner und Radierer tätig und in Rom auch als Fremdenführer<br />
und Antiquar.<br />
Müllers früh sich zeigende Begabung brachte ihn 1767 nach<br />
Zweibrücken in die Lehre des Malers D. Hien (1725-1773) und<br />
damit in die Sphäre des französischen Rokoko. Sehr bald bekam<br />
er, durch Studium der Niederländer, zu seinem für die Zeit<br />
ganz ungewöhnlich kühnen und starken Realismus in der Darstellung<br />
von Tieren und Landschaften. Er war für die Höfe in<br />
Zweibrücken und Mannheim tätig. 1778 gaben ihm Kurfürst<br />
Karl Theodor von der Pfalz und Weimarer Freunde die Mittel<br />
für eine Reise nach Rom. Zeitgenossen, wie Goethe, Ringeis<br />
und Uexküll, äußerten sich kritisch über die Werke seiner<br />
Spätzeit. Jedoch in den genialen Werken seiner Frühzeit, den<br />
Zeichnungen und Radierungen, zeigt er sich als Bahnbrecher<br />
des Realismus in der Zeit des „Sturm und Drang“.<br />
44
45<br />
22.
23.<br />
FRANZ SCHÜTZ<br />
1751 Frankfurt am Main - Genf 1781<br />
Landschaft mit einem Gewässer, rechts ein Bauernhaus hinter Bäumen, vorne mittig ein Holzsteg,<br />
der auf eine Landzunge führt, mit Figuren.<br />
Feder und Pinsel in Grau, mit einzelner schwarzer Tuschlinie umrandet, auf festem Bütten, rechts von der Mitte<br />
signiert und datiert „Franz Schütz 1780“, verso bezeichnet „F Schütz fec“. 19,2:28 cm.<br />
Provenienz: Sammlung H. Stiebel, Frankfurt am Main, Lugt<br />
1367.<br />
Literatur: Nach Ph.Fr. Gwinner, Kunst und Künstler in Frankfurt<br />
am Main... Frankfurt a.M., 1862, S. 315, sind ausgeführte<br />
Zeichnungen von Franz Schütz, einem ausgesprochenen „Originalgenie“<br />
der Sturm- und Drangzeit, selten.<br />
Schütz’ Zeichnungen, die während oder nach der Reise durch<br />
die Schweiz nach Mailand, in Begleitung seines Gönners Gedeon<br />
Burckhard entstanden, und zwar u. a. diejenigen nach dem<br />
Besuch Mailands, sind hervorragende Zeugnisse für die Entwicklung<br />
der deutschen Landschaftskunst gegen Ende des 18.<br />
Jahrhunderts, weg von der Ideallandschaft und den bereits realistischen<br />
niederländischen Vorbildern hin zu einer rein naturnahen<br />
Wiedergabe. Zu denken wäre in diesem Zusammenhang<br />
z.B. an die bekannten Aschaffenburger Ansichten des Ferd. Kobell<br />
(1740-1799) um 1786 (vgl. M. Biedermann: Ferdinand Kobell.<br />
Das malerische und zeichnerische Werk. München 1973,<br />
Nrn. 340-347).<br />
Unter dem Eindruck der gewaltigen Schweizer Gebirgslandschaft<br />
und der Mailänder Gemäldesammlungen muß sich<br />
Schütz vollends von der hergebrachten Darstellungsweise befreit<br />
haben, so daß er nun in der Lage war, die vorgefundene<br />
Natur adäquat und zum Teil völlig spontan zu charakterisieren,<br />
was ihn letzten Endes über die Kunst seines berühmten Vaters<br />
hätte weit hinausführen müssen, wenn er länger gelebt hätte<br />
(vgl. op. cit., S. 313 ff.).<br />
46
47<br />
23.
24.<br />
JOHANN ALBRECHT FRIEDRICH RAUSCHER<br />
1754 – Coburg – 1808<br />
Landschaft mit großen Eichen links, unter denen zwei Wanderer ruhen, rechts Flüßchen<br />
mit kleiner Schnelle und ländliches Anwesen.<br />
Gouache mit schwarzer Tuschlinie umrandet, auf Bütten mit Wasserzeichen, verso in der rechten unteren Ecke<br />
bezeichnet oder signiert „Rauscher“. 22,2:27,3 cm.<br />
Wunderbar frisch erhaltene und typische Arbeit des Coburger Hofmalers.<br />
Rauscher war Schüler der Düsseldorfer Akademie und Hofmaler<br />
des Herzogs von Coburg und als Landschaftsmaler und<br />
Radierer tätig. Arbeiten von ihm befinden sich im Besitz des<br />
Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha auf Schloß Ehrenburg,<br />
der Graphischen Sammlung der Veste Coburg, in den Museen<br />
von Frankfurt a.M., Leipzig und Berlin.<br />
48
49<br />
24.
25.<br />
MONOGRAMMIST M<br />
deutscher oder holländischer Zeichner um 1780/90<br />
Bürgerliche, fröhliche Tafelrunde aus drei Frauen und vier Männern sowie einem Flötenspieler.<br />
Aquarell und Pinsel in Grau mit Deckweißhöhungen, über Bleistift, mit schwarzer Tuschlinie umrandet,<br />
auf Bütten mit Wasserzeichen: D & C Blauw, rechts unten monogrammiert „M“. 31,8:43 cm.<br />
Es ist uns nicht gelungen, den Künstler, der diese qualitätvolle<br />
Arbeit schuf, zu identifizieren. Wir halten es aber für nicht ganz<br />
ausgeschlossen, daß sich hinter dem Monogramm „M“ ein Mitglied<br />
der aus Rudolstadt stammenden Frankfurter Malerfamilie<br />
Morgenstern verbirgt.<br />
50
51<br />
25.
26.<br />
LUDWIG HESS<br />
1760 – Zürich – 1800<br />
Sägemühle im Muotatal.<br />
Aquarell und Deckfarben auf braunem Velin. 27,2:37,8 cm.<br />
Vergleichsliteratur: M. Bircher / G. Lammel, Helvetien in<br />
Deutschland. Schweizer Kunst aus Residenzen deutscher Klassik<br />
1770-1830. Zürich, 1991, S. 98, Farbabb. S. 99, Nrn. 74-80<br />
mit Abb.<br />
Heß erlernte das väterliche Gewerbe eines Metzgers. Wenn er<br />
zum Vieheinkauf über Land ging, zeichnete er oder nahm sich<br />
Tierköpfe von der Schlachtbank als Modell mit heim. Auf diese<br />
Weise und Gemälde kopierend, bildete er sich vorzugsweise<br />
autodidaktisch. Einige Monate (1778) genoß er die Anleitung<br />
von H. Wuest und gewann die Freundschaft von H. Freudweiler,<br />
J. H. Meyer und S. Gessner, dessen Landschaften ihn entscheidend<br />
beeinflußten, von Lavater und Bodmer, durch die er<br />
Käufer, namentlich seiner Hochgebirgsbilder auch unter Engländern<br />
und Dänen, Deutschen und Franzosen fand. Er unternahm<br />
zahlreiche Wanderungen in die Alpen, ins Tessin und an<br />
den Comer See; einmal ging er bis Mailand und Genua. 1792<br />
besuchte er Chamonix und malte ein berühmtes Montblanc-<br />
Gemälde, das in England verschollen ist.<br />
Auf diesen Reisen entwickelte er seinen Sinn für die Größe der<br />
Alpenwelt und eine bis dahin unerreichte Naturnähe der malerischen<br />
Darstellung. Schließlich wanderte er nach Rom (1794),<br />
wo ihn die Kunst Claude Lorrains und N. Poussins anzog. Als<br />
1798 die französische Revolution das Reisen erschwerte, verlegte<br />
er sich aufs Radieren und schuf etwa achtzig Platten nach seinen<br />
früheren Gemälden und Zeichnungen.<br />
Das Muotatal ist im Kanton Schwyz östlich vom Vierwaldstätter<br />
See gelegen.<br />
52
53<br />
26.
27.<br />
JOHANN HEINRICH RAMBERG<br />
1763 – Hannover – 1840<br />
„Didon abandonnée par Enée.“ Aeneas’ Abschied von Dido.<br />
Feder in Schwarz, rotbraun laviert und mit Deckweiß gehöht, über Bleistift, auf bräunlichem Papier,<br />
mit Goldlitze, mehreren Tuschlinien und hellgrün lavierter Umrandung, unten Mitte<br />
eigenhändig in franz. Sprache betitelt, rechts unten signiert und datiert<br />
„Dessiné et inv: par H. Ramberg Mens: Aug: 1776“. 27,9:41 cm.<br />
„Ein umfänglicher Bestand an Zeichnungen des Knaben Ramberg,<br />
die sich als Geschenk von Rambergs Nachfahren, ... in<br />
Hannover erhalten haben, erlaubt Einblicke, wie Ramberg von<br />
seinem Vater angeleitet und wie seine Begabung gefördert wurde.<br />
Die Blätter reichen bis 1774 zurück, als Ramberg in seinem<br />
elften Lebensjahr in Rötel nach antiken Vorlagen, Gipsen und<br />
Graphiken, wie sie in der Sammlung des Kriegssekretärs vorhanden<br />
waren, zeichnete ... 1776 widmete er sich Hirten- und<br />
Fischerszenen, Putten, aber auch Köpfe und Figuren im Stil<br />
Rembrandts sowie klassischen Themen wie Mucius Scävola.“<br />
(Zit. aus: A. von Rohr, Johann Heinrich Ramberg 1773-Hannover-1840.<br />
Maler für König und Volk. Hannover 1998, S. 13).<br />
54
55<br />
27.
28.<br />
GEORG EMANUEL OPIZ<br />
1775 Prag – Leipzig 1841<br />
Große Tischrunde beim Punsch.<br />
Aquarell, Pinsel und Feder in Grau, mit Deckweiß gehöht, auf Velin, auf Bütten aufgezogen,<br />
links unten signiert „erfunden u. gezeich. von G. Opiz.“. 29,5:34 cm.<br />
Papier leicht vergilbt, in den linken Ecken etwas berieben.<br />
Provenienz: Sammlung Bernhard, Stuttgart.<br />
Nach seiner Ausbildung bei. G.B. Casanova (1730-1795) in<br />
Dresden kam Opiz 1801 als Wanderkünstler nach Wien, wo<br />
er sein Talent für Darstellungen charakteristischer Szenen aus<br />
dem Volksleben ausbildete. 1814 ging er nach Paris, dann nach<br />
Heidelberg und später nach Altenburg. Seit 1820 war er in Leipzig<br />
ansässig.<br />
56
57<br />
28.
29.<br />
LUDWIG EMIL GRIMM<br />
1790 Hanau – Kassel 1863<br />
Weiblicher Akt in Rückenansicht.<br />
Bleistift, auf Velin, rechts oben datiert „23 Juny 41“. 32,4:18,1 cm.<br />
Literatur: I. Koszinowski/V. Leuschner, Marburg 1990, I 37.<br />
Obwohl der Akt nach rechts gewendet dargestellt ist, handelt es<br />
sich bei unserem Blatt vermutlich um eine Vorstudie zu einer<br />
Illustration zu „Dornröschen, die Königin im Bade, um 1840“<br />
(op. cit. I 35, I 36).<br />
Der vor allem als Radierer tätige Ludwig Emil Grimm war 1804-<br />
1808 Schüler der Kasseler Akademie bei G. Kobold (1769-1809),<br />
A. Range (1762-1828) und E.F.F. Robert (1763-1843). Durch seine<br />
Brüder Jacob und Wilhelm Grimm wurde er mit C. Brentano<br />
(1778-1842) und A. von Arnim (1781-1831) bekannt, mit<br />
denen er zusammenarbeitete.<br />
Vermutlich 1807 lernte Grimm Bettine Brentano (1785-1859)<br />
kennen, von der er mehrere Porträts anfertigte. Im November<br />
1808 zog er nach Landshut zu Brentano und dessen Schwager<br />
F.C. von Savigny. Auf ihre Vermittlung hin ging er nach München<br />
und erlernte die Technik des Kupferstechens bei C. Heß<br />
(1755-1828). Zugleich studierte er an der Münchner Akademie<br />
unter A. Seidl (1760-1834) – wegen der Teilnahme an den Freiheitskriegen<br />
1814 mußte er allerdings sein Studium unterbrechen.<br />
Mit dem Frankfurter Bankier Georg Brentano reiste er im<br />
Frühjahr 1816 nach Italien, wo er zwei Monate blieb – zahlreiche<br />
Skizzen zeugen von dieser Reise. 1817 kehrte er nach Kassel<br />
zurück.<br />
1824 reiste Grimm zum ersten Mal nach Willingshausen und<br />
wurde zum Mitbegründer der Willingshäuser Malerkolonie,<br />
eine der ältesten Malerkolonien Deutschlands. 1832 wurde er<br />
an die Kasseler Kunstakademie als Lehrer berufen.<br />
58
59<br />
29.
30.<br />
JOHANN ADAM KLEIN<br />
1792 Nürnberg – München 1875<br />
Landschaft bei Mariabrunn.<br />
Feder in Schwarz, über Bleistift, auf Bütten, oben bezeichnet und datiert<br />
„Bei Mariabrunn. Den 29 Mai 1812“, links oben numeriert „13“, verso bezeichnet, signiert und<br />
datiert „Landschaft bei Maria Brunn zwei Stunden v. Wien. Federzeichn J.A. Klein d. 29. Mai 1812“.<br />
13,2:19,9 cm. Verso 2 Skizzen.<br />
Provenienz: Sammlung R.Ph. Goldschmidt, Berlin, Lugt 2926;<br />
Graphisches Kabinett, München, bis 12.02.1937, dort erworben<br />
von Direktor Schütze, München; Süddeutsche Privatsammlung.<br />
Vergleichsliteratur: R. Freitag-Stadler, Johann Adam Klein<br />
1792-1875. Zeichnungen und Aquarelle. Nürnberg 1975, Nrn.<br />
37-57. Unter diesen 1812 bzw. um 1812 entstandenen Zeichnungen<br />
befinden sich zwei, Nr. 37 und 45, die in Wien, ebenfalls im<br />
Mai, nämlich am 8. bzw. 22 Mai 1812 datiert sind.<br />
Bereits als Achtjähriger erhielt Klein Zeichenunterricht durch<br />
den Maler G.C. II. von Bemmel (1765-1811). 1802 war G.P.<br />
Zwinger (1779-1819) an der Nürnberger Zeichenschule sein<br />
Lehrer. 1805-1811 war er Lehrling bei dem Maler, Zeichner und<br />
Kupferstecher A. Gabler (1762-1834). Ab 1811 Studium an der<br />
Kunstakademie in Wien.<br />
1814 und 1816 folgten Reisen nach Ungarn und 1815 eine Studienreise<br />
an Main und Rhein. 1818 hielt er sich in München auf,<br />
wo er mit P. von Hess (1792-1871) und M.J. Wagenbauer (1775-<br />
1829) verkehrte. 1819 ging er in seine Heimatstadt zurück. Von<br />
dort aus unternahm er mit seinen Freunden J.C. Erhard (1795-<br />
1822), den Brüdern F.P. (1779-1840) und H. Reinhold (1788-<br />
1825) sowie E. Welker (1788-1857) eine Reise ins Salzkammergut.<br />
Von Ende 1819 bis August 1821 weilte Klein in Italien, kehrte<br />
dann aber nach Nürnberg zurück. 1833 wurde er zum Mitglied<br />
der Berliner Kunstakademie ernannt. 1839 zog er nach München,<br />
wo er bis zu seinem Tode leben sollte. 1848 begann ein<br />
Augenleiden, was in den nächsten Jahren zu einer zunehmenden<br />
Beeinträchtigung des Sehvermögens führen und schließlich<br />
ab 1871 das Arbeiten unmöglich machen sollte.<br />
Klein ist ein charakteristischer Vertreter der Biedermeierzeit.<br />
Sein Hauptgebiet war die Genremalerei. Einflüsse der holländischen<br />
Maler und Radierer K. Dujardin (1622-1678) und A.<br />
van de Velde (1636-1672) sowie des Tiermalers J.H. Roos (1631-<br />
1685) sind zu beobachten, die er jedoch gut umzusetzen wußte.<br />
Darüber hinaus ließ er sich von Wagenbauer, Hess und W. von<br />
Kobell (1766-1853) anregen.<br />
60
61<br />
30.
31.<br />
FRIEDRICH WILHELM MORITZ<br />
1793 im Kanton St. Gallen – Neuchâtel 1855<br />
Am Brienzer See gelegenes Bauernhaus mit Hochgebirge im Hintergrund, im Vordergrund<br />
am Ufer des Sees ein mit mehreren Personen besetztes Boot.<br />
Aquarell über Bleistift, auf cremefarbenem Velin, rechts auf einem Stein signiert „Moritz“. 18,3:24,9 cm.<br />
Provenienz: Aus Familienbesitz des Malers, auf beigefügtem<br />
Karton bezeichnet: „Lac de Brienz Suisse peint par Moritz le<br />
beau Frère de ma Grandmère Sophie Willnauer née Touchon<br />
dont il avait épousé la sœur“.<br />
Literatur: Lt. Thieme-Becker (Bd. XXV, S. 158) stammt Moritz<br />
aus Herborn in Hessen, was jedoch nicht belegt ist. Lt. Brun,<br />
Schweizerisches Künstler-Lexikon (Frauenfeld, 1908, Bd. II,<br />
S. 427) hat der Künstler einige Zeit im Hause seines Onkels L.<br />
Lory (1784-1846) in Bern gelebt und in dessen Verlag gearbeitet.<br />
Dann verbrachte er einige Jahr in Italien. Nach seiner Rückkehr,<br />
1831, war er bis 1850 Zeichenlehrer an einem Gymnasium<br />
für Mädchen. 1842-1855 stellte er zahlreiche Aquarelle auf Ausstellungen<br />
der „Société des Amis des Arts de Neuchâtel“ aus. Er<br />
zählt heute zu den geschätzten Aquarellmalern der Schweizer<br />
Schule in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.<br />
62
63<br />
31.
32.<br />
AUGUST WILHELM AHLBORN<br />
1796 Hannover – Rom 1857<br />
Ansicht von Burg Runkelstein bei Bozen.<br />
Aquarell über Bleistift, auf Velin, unten bezeichnet und datiert „Runkelstein d 23 Sept. 1840.“ 18,5:21,4 cm.<br />
Ahlborn hatte nach einer ersten Ausbildung als Zimmermaler<br />
an der Akademie von Berlin studiert und bereiste von 1827-1831<br />
zusammen mit seinen Studienkollegen A.W.F. Schirmer (1802-<br />
1866) und A.F. Hopfgarten (1807-1896) Italien, wo er sich dem<br />
Kreis der Nazarener anschloß.<br />
Nach einigen sehr erfolgreichen Jahren in Berlin als Landschaftsmaler<br />
konvertierten er und seine Frau unter J. Führichs<br />
(1800-1876) Einfluß 1838 zum Katholizismus. Er bereiste<br />
zwischen 1840 und 1845 im Auftrag der Königin Friedrike<br />
von Hannover die ehemaligen welfischen Besitzungen in Süddeutschland<br />
und Italien. Kurz nach seiner Rückkehr übersiedelte<br />
er 1847 endgültig nach Italien.<br />
Das 19. Jahrhundert brachte die Wiederentdeckung der Burg<br />
Runkelstein durch Josef von Görres (1776-1848). Er erkannte<br />
als erster den hohen künstlerischen Wert der dort vorhandenen<br />
Wandmalereien und machte König Ludwig I. von Bayern auf<br />
diese aufmerksam. Auf seine Veranlassung hin studierten und<br />
kopierten Hofarchitekten und Hofmaler die Burg Runkelstein<br />
und brachten Zeichnung davon mit nach München.<br />
Dieser Zyklus von Wandmalereinen ist der größte noch erhalten<br />
gebliebene profane Freskenzyklus aus dem Mittelalter, entstanden<br />
zwischen 1388 bis ca. 1410. Er erzählt u.a. Geschichten von<br />
den Rittern der Tafelrunde König Artus’ sowie die Geschichte<br />
von Tristan und Isolde.<br />
64
65<br />
32.
33.<br />
JAKOB GÖTZENBERGER<br />
1802 Heidelberg – Darmstadt 1866<br />
Obsternte, Titelblatt zum Frauentaschenbuch, Neunter Jahrgang 1823.<br />
Feder und Pinsel in Grauschwarz, mit grauer Tuschlinie umrandet, auf chamoisfarbenem Velin,<br />
links unten signiert „Götzenbeger del.“ sowie mit dem Buchtitel innerhalb der Darstellung. 14,4:9 cm.<br />
Kleine Fehlstelle rechts oben außerhalb der Darstellung ergänzt.<br />
Provenienz: verso nicht identifizierbarer Sammlerstempel,<br />
Lugt 2745.<br />
Illustrationsvorlage, die der Kupferstecher A. Chr. Reindel<br />
(1784-1853) ausführte.<br />
Der als Historienmaler tätige Jakob Götzenberger war ab 1820<br />
an der Düsseldorfer Kunstakademie Schüler von P. Cornelius<br />
(1783-1867). 1828-1832 folgte ein Aufenthalt in Italien. Anschließend<br />
bis 1835 gemeinsam mit seinen ehemaligen Cornelius-Mitschülern<br />
C. Hermann (1802-1880) und E. Förster (1800-<br />
1885) Ausgestaltung der Fresken in der Aula der Universität<br />
Bonn.<br />
1844 schuf er für die Loggia der Trinkhalle Baden-Baden Fresken<br />
nach Sagen und Mythen des Schwarzwaldgebietes. 1833<br />
folgte die Ernennung zum badischen Hofmaler und 1845 zum<br />
<strong>Galerie</strong>inspektor in Mannheim. Kurze Zeit darauf Aufgabe der<br />
Stellung und Umzug nach England, wo er erfolgreich als Bildnis-<br />
und Freskomaler in Adelshäusern tätig war.<br />
66
67<br />
33.
34.<br />
AUGUST LUCAS<br />
1803 – Darmstadt – 1863<br />
Fluß mit kleinem Wasserfall.<br />
Bleistift, auf zwei herausgelösten und zusammengeklebten Skizzenbuchblättern, recht unten bezeichnet<br />
und datiert „Corneto ai 13 di Maggio (1831)“ 11,2:33,2 cm. Verso rechts: Zwei Skizzen eines Jägers,<br />
verso links: Kleiner Landschaftsausschnitt. Bleistift. Gering fleckig.<br />
Provenienz: Sammlung Hugo von Rittgen, nicht bei Lugt;<br />
Hessische Privatsammlung.<br />
Literatur: Ausst. <strong>Katalog</strong>: Zeichnungen Darmstädter Romantiker.<br />
Aus der Sammlung Hugo v. Rittgen. Hamm/Darmstadt/<br />
Gießen 1984, Nr. 65, Abb. S. 73.<br />
Lucas unternahm zwei Reisen nach Italien. Die erste konnte er<br />
1829 antreten. In Rom und Umgebung sich meist aufhaltend,<br />
kehrte er erst fünf Jahre später nach Darmstadt zurück. Eine<br />
zweite Reise unternahm er 1850. Im Mittelpunkt beider Aufenthalte<br />
stand das Naturstudium, die Landschaft war zentrales<br />
Thema seines Schaffens.<br />
Frische und dynamische Zeichnung Lucas’, die die auf seiner<br />
Italienreise gewonnenen Erkenntnisse auf dem Gebiet der wirklichkeitsgetreuen<br />
Naturauffassung deutlich aufzeigt.<br />
August Lucas zeichnete bereits im Alter von 14 Jahren nach graphischen<br />
Vorlagen, aber auch nach der Natur. 1819-1824 war<br />
er Schüler der Darmstädter Museumszeichenschule bei dem<br />
<strong>Galerie</strong>direktor F.H. Müller (1784-1835). Im Odenwald betrieb<br />
er darüber hinaus gemeinsam mit J.H. Schilbach (1798-1851)<br />
Landschaftsstudien.1825 führte ihn eine Studienreise mit D.<br />
Fohr (1801-1862) ins Berner Oberland.<br />
Im gleichen Jahr ging er zum Weiterstudium nach München<br />
und wurde an der Kunstakademie von P. von Cornelius (1783-<br />
1867) unterrichtet.<br />
Das Studium brach er jedoch 1826 aufgrund mangelnden Interesses<br />
an der Historienmalerei ab und er kehrte nach Darmstadt<br />
zurück. In den beiden darauffolgenden Jahren betrieb er erneut<br />
Studien in und um Darmstadt.<br />
Mit finanzieller Unterstützung der großherzoglichen Erbprinzessin<br />
Mathilde reiste er 1829 über Mailand nach Italien. In<br />
Rom wurde er gemeinsam mit dem Darmstädter Maler P.W.<br />
App (1803-1855) in den Künstlerkreis der Ponte-Molle-Gesellschaft<br />
aufgenommen.<br />
Von Rom aus unternahm er Ausflüge in die Albaner und Sabiner<br />
Berge, 1832 eine Reise über Neapel nach Sorrent und Capri.<br />
In Rom trat er auch in Kontakt zu J.A. Koch (1768-1839).<br />
Erst 1834 kehrte Lucas nach Deutschland in seine Geburtsstadt<br />
zurück. Eine erneute Romreise ist für das Jahr 1850 zu verzeichnen.<br />
In Darmstadt war er als freischaffender Künstler tätig, verdiente<br />
sich zudem später auch als Privatlehrer seinen Lebensunterhalt.<br />
1861 war er einer der Mitbegründer der Darmstädter<br />
Künstlergesellschaft.<br />
68
69<br />
34.
35.<br />
ADRIAN LUDWIG RICHTER<br />
1803 – Dresden – 1884<br />
Winkel vor einem Bauernhaus in Loschwitz.<br />
Bleistift, auf Bütten, rechts unten bezeichnet und datiert „Loschwitz 4. Sept. 44“. 21,5:25,8 cm.<br />
Im ganzen nicht ganz frisch.<br />
Provenienz: Sammlung M.K.H. Rech, Lugt Suppl. 2745b.<br />
Lt. Überlieferung stammt die Zeichnung aus dem Nachlaß Ludwig<br />
Richters.<br />
Als Sohn des Malers C.A. Richter (1770-1848) erhielt Ludwig<br />
Richter seinen ersten Unterricht im Malen, Zeichnen und Radieren<br />
bei seinem Vater. Mittels eines 3jährigen Reisestipendiums<br />
konnte er 1823-1826 nach Italien gehen, wo er regen Kontakt<br />
mit deutschen Künstlern pflegte. Nach seiner Rückkehr<br />
blieb er für wenige Jahre in Dresden, zog 1828 nach Meißen, wo<br />
er bis 1835 als Zeichenlehrer in der Porzellanmanufaktur tätig<br />
war. Nach deren Schließung Ende 1835 kehrte er nach Dresden<br />
zurück, wo er Lehrer an der Kunstakademie wurde, 1841 erhielt<br />
er die Professur, und bis 1876 lehrte.<br />
Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich Loschwitz<br />
und seine Umgebung zu einem beliebten Wohn- und Naherholungsgebiet<br />
mit zahlreichen Sommerhäusern und vornehmen<br />
Villenvierteln. Zahlreiche Dresdener Maler hielten sich dort<br />
auf. Auch Richter verbrachte dort die Sommermonate zwischen<br />
1852 und 1884.<br />
70
71<br />
35.
36.<br />
PAUL GAVARNI (eigentlich HIPPOLYTE GUILLAUME SULPICE CHEVALIER)<br />
1804 Paris – Auteuil 1866<br />
„Gens de Paris. Boulevard de Gand Fleur des Pois.“<br />
Modisch gekleideter Mann in Frack, mit Spazierstock und Zylinder.<br />
Pinsel in Schwarz, Aquarell, über Bleistift, mit zarter Bleistiftlinie umrandet, um 1845,<br />
auf Velin, links unten signiert „Gavarni“. 23,5:16 cm.<br />
Mit leichten Werkstattspuren, linke untere Ecke ergänzt.<br />
Literatur: E. u. J. de Goncourt, Gavarni. Der Mensch und das<br />
Werk. 2 Bde. Berlin 1918, Abb. Bd. 1, Seite 115. Illustration zu<br />
dem Werk: Le Diable à Paris, J. Hetzel, 1845.<br />
Mit den Brüdern de Goncourt, seine ersten und bis heute wichtigsten<br />
Biographen, war Gavarni eng befreundet.<br />
Gavarni, der zu den Meistern der Lithographie des 19. Jahrhunderts<br />
zählt, entschloß sich erst 1825 zur künstlerischen Laufbahn.<br />
Davor hatte er bei einem Mechaniker und dann bei einem<br />
Maschineningenieur eine Lehre absolviert. 1824 hatte er<br />
bereits Unterricht bei J. Adam (tätig um 1820/25) im Kupferstechen<br />
erhalten.<br />
1824/25 ging er nach Bordeaux, anschließend begab er sich für<br />
drei Jahre auf Wanderschaft durch die Pyrenäen. Nach seiner<br />
Rückkehr nach Paris 1828 begann er autodidaktisch auf geistreich-ironische<br />
Weise das Pariser Leben der Salons, der Bälle<br />
und des Theaters zu erfassen.<br />
Diese ersten, jetzt mit „Gavarni“ signierten Blätter fanden rasch<br />
Anerkennung. Die bekanntesten Magazine und Modezeitschriften<br />
warben ihn als Illustrator an. Ab 1837 arbeitete er für<br />
das Satireblatt „Le Charivari“, das zwischen 1832 und 1837 herausgegeben<br />
wurde und durch das er internationale Bekanntheit<br />
erlangte. Für diese Zeitschrift, aber auch den „Figaro“ und die<br />
zweite „Caricature“ schuf er die berühmtesten Folgen. Ab 1831<br />
war er auch literarisch tätig.<br />
Ein Aufenthalt in London 1847-1851 brachten eine bedeutende<br />
motivische Erweiterung: Er zeigt sich jetzt nicht mehr als<br />
„Chronist“ der mondän-eleganten Welt, sondern als Anhänger<br />
der sogenannten „Arme-Leute-Malerei“ mit ihrer realistischen<br />
und nicht idealisierenden Absicht. Es entstanden zahlreiche<br />
Blätter, die das Leben der Armen auf vielfältige Weise thematisierten.<br />
Der Tod seines Sohnes und zunehmende Krankheiten<br />
führten zum Rückzug von der Umwelt und letztendlich auch<br />
von der künstlerischen Arbeit. In den letzten Jahren entstanden<br />
keine Zeichnungen mehr und nur wenige Aquarelle.<br />
72
73<br />
36.
37.<br />
FRIEDRICH PRELLER d.Ä.<br />
1804 Eisenach – Weimar 1878<br />
Große Eiche an einem Abhang.<br />
Pinsel in Braun, braun laviert, über Bleistift, auf cremefarbenem Velin, rechts unten signiert „F. Preller“. 19,7:26,8 cm.<br />
Bereits im Alter von erst 10 Jahren begann Friedrich Preller,<br />
dessen Talent von seinen Eltern gefördert wurde, mit Studien an<br />
der Weimarer Zeichenschule. 1818 setzte er bei dessen Direktor,<br />
dem Maler und Kunstschriftsteller H. Meyer (1760-1832), einem<br />
engen Freund und Mitarbeiter Goethes, seine Malstudien<br />
fort. 1821 – er hatte sich Geld durch Kolorieren von Stichen für<br />
F.J.J. Bertuch (1747-1822) verdient – ging er nach Dresden. Hier<br />
begann er mit dem Kopieren von Altmeistergemälden aus der<br />
Dresdener <strong>Galerie</strong>. Erste Fahrten mit anderen Kunststudenten<br />
zum Studium der Natur in die nähere Umgebung Dresdens<br />
folgten.<br />
Durch Goethes Vermittlung – Preller war inzwischen dessen<br />
Schützling geworden – lernte er auch C.G. Carus (1789-1869)<br />
kennen, der ihn künstlerisch anleitete. Goethe selbst beauftragte<br />
Preller nach dessen erstem Dresden-Aufenthalt, für seine naturwissenschaftlichen<br />
Untersuchungen Reinzeichnungen von<br />
Wolkenstudien anzufertigen.<br />
Mit finanzieller Unterstützung des Großherzogs Karl August<br />
konnte Preller nach Antwerpen reisen, wo er 1824-1826 an der<br />
Akademie bei M.I. van Bree (1773-1839) seine Studien fortsetzte.<br />
Kurz nach seiner Rückkehr ermöglichte ihm jetzt ein Jahresstipendium<br />
des Großherzogs 1826-1828 einen Aufenthalt in<br />
Mailand, wo er an der Akademie bei G. Cattaneo (1771-1841)<br />
studierte.<br />
1828-1831 hielt Preller sich in Rom auf und wurde maßgebend<br />
von J.A. Koch (1768-1839), mit dem er Ausflüge in die nähere<br />
Umgebung der Stadt unternahm, beeinflußt; daneben hatten<br />
die Landschaftsmaler Cl. Lorrain (1600-1682), N. Poussin<br />
(1594-1665) und G. Dughet (1613-175) Vorbildcharakter; die<br />
Freundschaft mit B. Genelli (1798-1868) brachte darüber hinaus<br />
Anregungen für seinen Figurenstil. Von Rom aus besuchte<br />
Preller Olevano und Neapel. Auch war er rege am deutschrömischen<br />
Kunstleben beteiligt, so war er Gründungsmitglied<br />
des römischen Kunstvereins sowie General der Ponte-Molle-<br />
Gesellschaft.<br />
Nach seiner Rückkehr nach Weimar wurde Preller 1832 erst<br />
Lehrer an der Zeichenschule, 1844 erfolgte die Ernennung zum<br />
Professor und Hofmaler. 1837 unternahm er, zunächst aus gesundheitlichen<br />
Gründen, eine erste Reise nach Rügen; 1839,<br />
1847 und zuletzt 1872 folgten weitere – Prellers Nordlandbegeisterung<br />
führte ihn 1840 zudem nach Norwegen. Sein Ruf als<br />
bedeutender Maler melancholischer nordischer Landschaften<br />
und wilder Seestücke wurde dadurch noch ausgebaut. Ein zweiter,<br />
fast eineinhalbjähriger Aufenthalt in Italien folgte 1859-<br />
1861 – vor Ort wollte er Studien für seinen zweiten berühmten<br />
Zyklus der Odyssee-Wandbilder anfertigen, ein Auftrag des<br />
Großherzogs. 1868 wurde Preller schließlich Direktor der Weimarer<br />
Zeichenschule.<br />
74
75<br />
37.
38. CARL JULIUS VON LEYPOLD<br />
1806 Dresden – Niederlößnitz/Dresden 1874<br />
Burgen und Schlösser in der Pfalz:<br />
a) „Schloß Castelaun bei Simmern.“<br />
b) „und das Schloß in Simmern.“<br />
c) „Schloß Arnstein.“<br />
d) „Schloß Kautzenburg in Creutznach an der Nahe, unweit Bingen am Rhein.“<br />
e) „Burg Zabern bei Weissenburg.“<br />
f) „Schloß Staleck zu Bacharach.“<br />
6 Blatt Bleistiftzeichnungen, mit Sepia laviert, auf cremefarbenem Velin. Je 12,2:20,6 cm.<br />
Aus einem Skizzenbuch mit Burgen und Schlössern in der Pfalz und Schwaben.<br />
76
Der Landschaftsmaler Carl Julius von Leypold war von 1822-<br />
1829 Schüler von T.L. Pochmann (1762-1830) und F. Matthäi<br />
(1777-1845) an der Dresdener Akademie und zuletzt im Atelier<br />
von J. C. Dahl (1788-1857). 1857 folgte die Ernennung zum<br />
Ehrenmitglied der Akademie. Um 1826 bis 1828 stand er unter<br />
starkem Einfluß von C.D. Friedrich (1774-1840). Seine<br />
deutliche Vorliebe für alte Schlösser, Burgen und Ruinen,<br />
die er sich zeitlebens erhalten hat, wird durch diese kleinen<br />
Studien eindrucksvoll dokumentiert.<br />
38.<br />
77
39.<br />
EMIL EDUARD EBERS<br />
1807 Breslau – Beuthen/Oder 1884<br />
St. Goar predigt am Rhein das Evangelium.<br />
Bleistift, teilweise blau, grau und braun laviert, auf gelblichem Papier, verso betitelt „Der Erzähler“.<br />
29,2:36,4 cm; oben rundbogig geschlossen.<br />
In den Ecken leicht knitterfaltig, kleine Einrisse in den Rändern restauriert.<br />
Der oben rundbogige Abschluß der Darstellung läßt darauf<br />
schließen, daß das Bildmotiv ursprünglich als Wandmalerei<br />
ausgeführt werden sollte.<br />
Vorstudie zu dem Gemälde von 1834, das sich im Besitz des<br />
Museum Altona in Hamburg befindet.<br />
Vergleichsliteratur: Boetticher Bd. I, Tl. 1, S. 264, Nr. 6; Lexikon<br />
der Düsseldorfer Malerschule 1819-1918. München, Bruckmann,<br />
1997, Bd. I, S. 307/308, Abb. 356.<br />
Ebers studierte seit 1829/30 an der Düsseldorfer Akademie;<br />
zwar sind in den Schülerlisten die Namen seiner Lehrer nicht<br />
genannt, doch dokumentierte A. Graf Raczynski, daß Ebers im<br />
1. Halbjahr 1834 zu jenen Schülern zählte, die „unter der unmittelbaren<br />
Leitung des Direktors Schadow“ arbeiteten (A. Raczynski,<br />
Geschichte der neueren deutschen Kunst. 3 Bde. Berlin<br />
1836-41. Bd. I, S. 114). Nach einem dreijährigen Aufenthalt in<br />
seiner Heimat gehörte er 1837 der Meisterklasse der Düsseldorfer<br />
Akademie an. Von Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit<br />
an wählte er Motive aus dem Milieu der Schmuggler, Fischer,<br />
Schiffer oder Soldaten, die teils dramatisch, teils humoristisch<br />
geschildert sind. Weiterhin beschäftigten ihn historische und<br />
romantisch-mittelalterliche Themen.<br />
In Komposition und Gebärden der Figuren läßt sich der Einfluß<br />
von C.F. Lessing (1808-1880) nachweisen. Durch Kontakte<br />
zu Düsseldorfer Malerkollegen wurde er in seiner Auffassung<br />
der Genremalerei bestärkt. Ferner schuf er Porträts, Marineund<br />
Landschaftsbilder.<br />
1844 kehrte Ebers in seine Heimatstadt zurück und heiratete<br />
1845 Lessings Schwester Fanny. Nach 1850 wechselte er häufig<br />
seinen Wohnort. Er lebte in Gaffron bei Lüben, in Dresden,<br />
Görlitz und nach 1869 in Beuthen an der Oder. Seit den 1860er<br />
Jahren war er kaum noch künstlerisch tätig, stellte aber doch<br />
1881 und 1883 in Dresden aus.<br />
78
79<br />
39.
40.<br />
ALEXANDRE CALAME<br />
1810 Vevey – Mentone 1864<br />
Waldlichtung mit Holzsammlern.<br />
Bleistift, auf bräunlichem Velin, rechts unten signiert „A. Calame f“. 21,3:28,2 cm.<br />
Verso an den oberen Ecken Reste von alter Verklebung.<br />
Calame wuchs in bitterer Armut auf. Not zwang ihn, die Schule<br />
vorzeitig zu verlassen, er begann in Genf eine Banklehre. Der<br />
Tod seines Vaters 1826 nötigte ihn, auch für den Unterhalt seiner<br />
Mutter aufzukommen und durch Kolorieren von Schweizer<br />
Landschaften Geld zu verdienen.<br />
In der Folge wurde er Schüler des berühmten Schweizer Alpenmalers<br />
F. Diday (1802-1877). Dieser weckte in ihm den Sinn für<br />
die Gebirgsnatur und die Liebe für wildromantische Schönheit.<br />
Nach dreijähriger Lehrzeit verließ er Didays Atelier. 1835<br />
reiste er erstmals ins Berner Oberland, 1837 nach Paris, 1838<br />
nach Holland. In Düsseldorf beeindruckten ihn die Werke J.W.<br />
Schirmers (1807-1863) und A. Achenbachs (1815-1910).<br />
In den vierziger und fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts war<br />
Calame sehr erfolgreich und wurde mit Auszeichnungen bedacht.<br />
Er war ein begehrter Lehrer. Franzosen, Deutsche, Russen,<br />
Engländer, Fürsten und Adelige, Großbürger erwarben seine<br />
Gemälde.<br />
80
81<br />
40.
41.<br />
EDWARD JAKOB VON STEINLE<br />
1810 Wien – Frankfurt am Main 1886<br />
Kopf der Salome.<br />
Bleistift, auf cremefarbenem Velin. 25,7:19,5 cm.<br />
Studie zum Fresko auf Burg Rheineck „Enthauptung Johannes<br />
des Täufers“ entstanden 1837-1840. Die insgesamt 8 Fresken<br />
in der von Bethmann-Hollweg’schen Schloßkapelle auf Burg<br />
Rheineck zur Bergpredigt waren im Auftrag von Prof. Bethmann-Hollweg<br />
entstanden. Steinle war mit den Entwürfen und<br />
Kartons in den Jahren 1837 und 1838 beschäftigt und führte die<br />
Bilder selbst in den Sommern 1839 und 1840 mit Assistenz der<br />
Maler F. Brentano (1801-1841) und Ph. Suttner (1814-181852) al<br />
fresco aus.<br />
Provenienz: Hessischer Privatbesitz; <strong>Galerie</strong> Joseph <strong>Fach</strong>,<br />
Frankfurt am Main; Hessischer Privatbesitz.<br />
Literatur: A.M. von Steinle, Edward von Steinle. Des Meisters<br />
Gesamtwerk in Abbildungen. Kempten/München, 1910, vgl.<br />
Abb. 583.<br />
Schon 1823 trat Steinle in die Wiener Akademie ein, seit 1826<br />
wurde er von L. Kupelwieser (1796 - 1862) unterrichtet.<br />
Zwischen 1828 und 1833 hielt er sich zweimal in Rom auf und<br />
fand dort Anschluß an den Kreis der Nazarener (Fr. Overbeck,<br />
1789 - 1869; Ph. Veit, 1793 - 1877; J. von Führich, 1800 - 1876).<br />
1829 arbeitete er zusammen mit Overbeck an der Porziuncula<br />
bei Assisi. 1833 wieder in Wien, 1837 folgte eine Reise nach<br />
Frankfurt am Main und an den Rhein.<br />
1839 übersiedelte er nach Frankfurt am Main und fand Anschluß<br />
an den Nazarener-Kreis um Veit.<br />
1850 wurde er Professor für Historienmalerei am Städelschen<br />
Kunstinstitut.<br />
82
83<br />
41.
42.<br />
OTTO FRIEDRICH THEODOR<br />
(IN RUSSLAND: FJODOR ANTONOWICH)<br />
VON MOELLER<br />
1812 Kronstadt – St. Petersburg 1874<br />
Bildnis der Vittoria Caldoni (1806 Albano –<br />
um 1872), Halbfigur im Profil nach links, den<br />
Kopf auf die Rechte gestützt.<br />
Schwarze Kreide, weiß gehöht, auf bräunlichem<br />
Velin. 45,8:29,4 cm.<br />
Vergleichsliteratur: R. Giuliani, Vittoria Caldoni<br />
Lapcenko. La ‘fanciulla di Albano’ nell’arte. Rom,<br />
1995; Amrei I. Gold, Der Modellkult um Sarah Sissons,<br />
Emma Hamilton, Vittoria Caldoni und Jane<br />
Morris. Ikonographische Analyse und Werkkatalog.<br />
Münster/New York, 2009; U. Koeltz, Vittoria Caldoni<br />
– Modell und Identifikationsfigur des 19. Jahrhunderts.<br />
Frankfurt a.M., 2010.<br />
Biographie: siehe rechts Nr. 43<br />
84
OTTO FRIEDRICH THEODOR<br />
(IN RUSSLAND: FJODOR ANTONOWICH)<br />
VON MOELLER<br />
1812 Kronstadt – St. Petersburg 1874<br />
Bildnis der Vittoria Caldoni (1806 Albano –<br />
um 1872), Büste im Profil nach rechts, den Blick<br />
gesenkt.<br />
Schwarze Kreide, weiß gehöht, auf bräunlichem<br />
Velin. 45,5:29,5 cm.<br />
43.<br />
Vergleichsliteratur: siehe links Nr. 42<br />
Dasselbe Modell – Vittoria Caldoni – porträtierte<br />
von Moeller auch auf seinem Gemälde „Junges Mädchen,<br />
gedankenverloren mit einem Ring am Zeigefinger<br />
spielend. Hüftbildnis im Profil nach rechts,<br />
1843“ (vgl. Auktion 643, 15.-18.09.2012, Leo Spik<br />
GmbH, Berlin, Kat.-Nr. 137, Farbabb. Seite 55).<br />
Der russische Historien-, Genre- und Bildnismaler<br />
war deutsch-baltischer Abstammung. Anfänglich<br />
Offizier, nahm er 1835 seinen Abschied, um an der<br />
Petersburger Akademie als Schüler von K.P. Brülloff<br />
(1799-1852) zu studieren. 1839/41 bereiste er Italien,<br />
wo das Gemälde „Der Kuß“ entstand, das seinen<br />
Ruhm begründete. Ein zweiter Aufenthalt in Italien<br />
folgte 1847/57, wo er unter den Einfluß Fr. Overbecks<br />
(1789-1869) geriet und den goldenen Lorbeerkranz<br />
der römischen Künstlerkolonie für das Gemälde<br />
„Johannes predigt auf Patmos den Bacchusdienern“<br />
bekam. Den Professoren-Titel der Petersburger Akademie<br />
erhielt er 1857.<br />
85
44.<br />
MICHAEL STOHL<br />
1813 – Wien – 1881<br />
„Luisa di Veletri“. Halbfigürliches Porträt einer jungen Frau, im Halbprofil nach links.<br />
Aquarell, über Bleistift, auf hellbraunem Papier, links unten von fremder Hand bezeichnet,<br />
rechts von der Stuhllehne signiert und datiert „Stohl 1844“, rechts unten bezeichnet und<br />
datiert „Luisa di Veletri Roma 1844“. 35,2:26,5 cm.<br />
Provenienz: <strong>Galerie</strong> Joseph <strong>Fach</strong>, Frankfurt am Main, Kat. 34,<br />
1985, Nr. <strong>103</strong>; Süddeutscher Privatbesitz.<br />
Stohl studierte an der Wiener Akademie bei L.F. Schnorr von<br />
Carolsfeld (1788-1853). Anschließend war er mit seinem Bruder<br />
Franz Stohl (1799-1882) und J. Kriehuber (1800-1876) als<br />
Lithograph tätig. 1840 arbeitete er im Auftrag des belgischen<br />
Konsuls Craigher in Triest. Er fand mehrere Förderer und wurde<br />
als Maler von Aquarellbildnissen populär. Von seiner Tätigkeit<br />
als Landschaftsmaler sind Motive aus Sorrent, Amalfi und<br />
Pompeji bekannt. Auf einer Reise nach Rom 1842 begegnete er<br />
der russischen Großfürstin Maria Nicolajewna, die 1852 seine<br />
Berufung nach St. Petersburg unterstützte. Als Hofmaler von<br />
Nikolaus I. kopierte Stohl zwischen 1853 und 1872 mehr als 800<br />
Gemälde alter Meister in Aquarell.<br />
Velletri liegt in den Albaner Bergen etwa 40 km südöstlich von<br />
Rom.<br />
86
87<br />
44.
45.<br />
zugeschrieben<br />
BERNHARD FRIES<br />
1820 Heidelberg – München 1879<br />
Ischia, Blick auf Lacco Ameno.<br />
Bleistift, blaugrau laviert, auf gelblichem Velin. 19:22 cm.<br />
Verso: Heilige Familie. Bleistiftskizze. – Wahrscheinlich Studie nach einem Altmeister-Gemälde.<br />
Provenienz: Sammlung Fritz Hasselmann, München, Lugt<br />
1012.<br />
Hier handelt es sich um eine Zeichnung nach C. Rottmanns<br />
(1797-1850) Fresko, ausgeführt 1832, aus dem Italien-Zyklus,<br />
den Rottmann im Auftrag König Ludwig I. für die Hofgarten-<br />
Arkaden in München ausführte.<br />
Der Sohn des wohlhabenden Heidelberger Bankiers und Fabrikanten<br />
Chr.A. Fries und jüngere Bruder des Landschaftsmalers<br />
Ernst Fries (1801-1833) erhielt seinen ersten Unterricht bei J.K.<br />
Koopmann (1797-1894) in Karlsruhe, wo er Anatomie und Figurenzeichnen<br />
erlernte.<br />
Von 1835-1837 absolvierte er ein Studium an der Münchner<br />
Akademie, anschließend ging er nach Rom, wo er 1840-1843<br />
unterbrochen von einem Aufenthalt in Düsseldorf zur Ausbildung<br />
an der Kunstakademie bis 1846 weilte.<br />
Dann kehrte er über Genf und Paris nach München zurück, wo<br />
er sich mit B. Genelli (1798-1868), C. Rahl (1812-1865) und D.<br />
Fohr (1801-1862) befreundete.<br />
Nachdem er sich politisch der 1848er Revolution angeschlossen<br />
hatte, mußte er 1852 München als „Demokrat“ verlassen.<br />
Er ging nach Heidelberg und erneut nach Rom. 1854 kehrte er<br />
schließlich nach München zurück.<br />
88
89<br />
45.
46.<br />
HERMANN KARL KERSTING<br />
1825 Meißen – Dresden 1850<br />
Faust und Gretchen – sie in einem Schwanenschlitten – er auf Schlittschuhen – auf dem Eis.<br />
Im Hintergrund eine Winterlandschaft, in der Ferne angedeutet ein gotischer Dom.<br />
Feder in Grau, Aquarell, über Bleistift, auf cremefarbenem Velin, auf dem Köcher mit Amors Pfeilen<br />
monogrammiert „HK“ (ligiert). 14,2:20,7 cm, rundum auf Untersatz montiert, rechte obere Ecke leicht beschädigt.<br />
Provenienz: Sammlung L. Blucke, Chemnitz/Dresden.<br />
Die Figur des Faust ist angelehnt an J.H. Naekes Faust in der Illustration<br />
„Faust, Szene auf der Straße“, gest. von C.A. Schwerdgeburth<br />
(1785-1878), erschienen in: Urania Taschenbuch für<br />
Damen“, Leipzig/Altenburg 1815.<br />
Der Sohn von Georg Friedrich Kersting (1785-1847) erhielt erste<br />
Anleitung zum Malen bei seinem Vater. Um sich weiterzubilden<br />
besuchte er die Dresdener Akademie unter E. Bendemann<br />
(1811-1889) und J. Schnorr von Carolsfeld (1794-1872).<br />
Kleine Landschaften und Bildnisse bezeugen sein ererbtes starkes<br />
Talent. Dem Zuge der Zeit folgend, wandte er sich der historischen<br />
Malerei zu, war damit erfolgreich und wurde auch von<br />
seinen Lehrern gefördert. Seinen alternden Vater unterhielt der<br />
fein gebildete Künstler von Dresden aus mit geistreichen Schilderungen<br />
über die neuesten künstlerischen Entwicklungen<br />
und kopierte für ihn sogar einzelne Bilder aus der Düsseldorfer<br />
Schule.<br />
Einige köstliche Aquarelle in seinem Nachlaß zeigen ihn als den<br />
Spuren M. von Schwinds (1804-1871) folgend. Ein Lungenleiden<br />
brachte ihm einen frühen Tod.<br />
90
91<br />
46.
47.<br />
ERNST ERWIN OEHME<br />
1831 – Dresden – 1907<br />
„Das Bravtkrönchen der Vrahne“.<br />
Aquarell und Deckfarben, über Bleistift, mit reicher Deckweißhöhung, auf braunem Karton,<br />
rechts oben datiert und signiert „zum 14 Dec. E. E. Oehme 1875.“. 36:20,8 cm.<br />
Die reizvolle, märchenhaft wirkende Szene zeigt ein junges<br />
Mädchen, gekleidet in der Mode des 16. Jahrhunderts, das gedankenverloren<br />
eine Brautkrone aus einem Kasten nimmt,<br />
während der Geist der Urahne sie dabei beobachtet.<br />
Ernst Erwin Oehme war zuerst Schüler seines Vaters E.F. Oehme<br />
(1797-1855), kurze Zeit auch von L. Richter (1803-1884). Seit<br />
1846 besuchte er die Dresdener Akademie und bildete sich auf<br />
Reisen weiter.<br />
Er war seit 1894 Ehrenmitglied der Dresdener Akademie und<br />
Professor und war als Landschafts- und Genremaler tätig.<br />
92
93<br />
47.
48.<br />
LUDWIG VON HOFMANN<br />
1861 Darmstadt – Pillnitz 1945<br />
Strand mit Muschelsammlerinnen.<br />
Pastell und schwarze Kreide, auf chamoisfarbenem Bütten, links unten mit schwarzer Kreide<br />
monogrammiert „L v H“ sowie mit Bleistift datiert „1906“, mit Umfassungslinien oben und unten. 20,7:ca. 31,3 cm.<br />
Auf Untersatz montiert, dort Sammlungsnummer „LF 63 n.“.<br />
Während des Aufenthaltes in Italien, vermutlich in der Umgebung<br />
von Neapel entstanden.<br />
Ludwig von Hofmann absolvierte seine Ausbildung an den<br />
Kunstakademien von Dresden und Karlsruhe. Ein Aufenthalt<br />
in Paris 1889, um an der Académie Julian zu studieren, schloß<br />
sich an. Ab 1890 lebte Hofmann in Berlin. 1894-1900 ging er auf<br />
Reisen, längere Zeit verbrachte er in Rom und in seiner Villa bei<br />
Fiesole. Die Rezeption der Antike und eine bestimmte Vorstellung<br />
von einem Arkadien sollten sein Werk entscheidend beeinflussen.<br />
Ab 1895 war er Mitarbeiter der Zeitschrift „Pan“, ab<br />
1898 Mitglied der „Berliner Secession“. 1903 wurde er Professor<br />
der Weimarer Kunstschule, 1916-1931 der Kunstakademie in<br />
Dresden.<br />
94
95<br />
48.
49.<br />
WILHELM KUHNERT<br />
1865 Oppeln – Flims/Graubünden 1926<br />
Afrikanische Landschaft mit Pavianen.<br />
Pinsel in Grau, grau laviert, über Bleistift, mit schwarzer Tuschlinie umrandet, auf chamoisfarbenem Zeichenkarton,<br />
rechts unten signiert „W. Kuhnert“. Darstellungsgröße 19,5:31,4 cm, Blattgröße 24,7:36,5 cm.<br />
Vorzeichnung für eine Buchillustration.<br />
Kuhnert, der als Maler, Illustrator und Autor tätig war, zählt<br />
zu den bedeutendsten deutschen Tiermalern seiner Zeit. Nach<br />
einem Studium 1883-1887 an der Kunstakademie in Berlin als<br />
Schüler von F. Bellermann (1814-1889) und P. Meyerheim (1842-<br />
1915) unternahm er von dort aus Reisen nach Ägypten, Ostafrika<br />
und Indien, um vor Ort Tier- und Landschaftsstudien zu<br />
betreiben.<br />
96
97<br />
49.
50.<br />
REINHOLD EWALD<br />
1890 – Hanau – 1974<br />
In einer Kabine stehender weiblicher Akt (in der Art einer Gliederpuppe).<br />
Bleistift, auf gelblichem Velin, rechts unten mit Feder monogrammiert und datiert „R.E. 24“,<br />
links unten nummeriert „No 79“. Darstellungsgröße ca. 29,5:15,5 cm, Blattgröße ca. 32,3:24 cm.<br />
Linker Rand ungleich geschnitten.<br />
Nach einer Lehre 1905-1906 als Dekorationsmaler und einjährigem<br />
Studium an der Hanauer Zeichenakademie war Ewald<br />
1907-1911 Schüler der Berliner Kunstgewerbeschule bei R. Böhland<br />
(1868-1935) und M. Koch (1859-1930). 1913 folgten Studienaufenthalte<br />
in Paris und Italien.<br />
Bereits 1914 hatte er seine erste große Einzelausstellung im<br />
Kunstsalon Schames, Frankfurt am Main. 1914-1918 war er<br />
Soldat und Kriegsmaler. 1919 wurde er Mitglied der Darmstädter<br />
Sezession. 1921 begann seine Lehrtätigkeit an der Hanauer<br />
Zeichenakademie. 1924 beteiligte er sich an den Ausstellungen<br />
„Neue Deutsche Kunst“ in Stuttgart (neben Beckmann, Bissier,<br />
Campendonk, Dix, Klee, Feininger u.a.) und „Neue Sachlichkeit“<br />
in Mannheim.<br />
1933 wurde er aus seinem Lehramt der Hanauer Zeichenakademie<br />
entlassen, ebenso aus der Darmstädter Sezession ausgeschlossen<br />
und 1937 seine Werke aus öffentlichen Sammlungen<br />
konfisziert. 1937-1944 reiste er wiederholt nach Leba an der<br />
Ostsee (Pommern) und Bayrischzell in Oberbayern. 1941 verbrachte<br />
er längere Zeit bei seinem ehemaligen Schüler W. Wagenfeld<br />
(1900-1990) in der Oberlausitz. 1945 wurde Ewald zum<br />
Volkssturm eingezogen, desertierte jedoch am ersten Tag. Ab<br />
1949 unterrichtete er wieder an der Hanauer Zeichenakademie.<br />
98
99<br />
50.
KÜNSTLERVERZEICHNIS<br />
Ahlborn, August Wilhelm ............................. 32<br />
Bemmel, Wilhelm von ................................. 4<br />
Calame, Alexandre ................................... 40<br />
Calvi, Jacopo Alessandro .............................. 12<br />
Denon, Dominique Vivant............................. 19<br />
Deutsch, Mitte 17. Jahrhundert........................ 2, 3<br />
Ebers, Emil Eduard ................................... 39<br />
Ewald, Reinhold...................................... 50<br />
Friedrich, Johann Alexander David ..................... 18<br />
Fries, Bernhard zugeschrieben ......................... 45<br />
Gavarni, Paul ........................................ 36<br />
Götzenberger, Jakob .................................. 33<br />
Gout, Johannes Franciscus............................. 20<br />
Grimm, Ludwig Emil ................................. 29<br />
Hess, Ludwig ........................................ 26<br />
Hofmann, Ludwig von ................................ 48<br />
Kersting, Hermann Karl ............................... 46<br />
Klein, Johann Adam .................................. 30<br />
Kobell, Ferdinand .................................... 13<br />
Kobell, Franz Josef Innocenz ........................... 21<br />
Kuhnert, Wilhelm .................................... 49<br />
Leypold, Carl Julius von ............................... 38<br />
Loutherbourg, Philipp Jakob d.J. zugeschrieben. .......... 14<br />
Lucas, August. ....................................... 34<br />
Luyken, Jan. .......................................... 5<br />
Mengs, Anton Raphael Umkreis ........................ 11<br />
Moeller, Otto Friedrich Theodor von.................42, 43<br />
Monogrammist M .................................... 25<br />
Moritz, Friedrich Wilhelm. ............................ 31<br />
Müller, Friedrich zugeschrieben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />
Oehme, Ernst Erwin .................................. 47<br />
Opiz, Georg Emanuel ................................. 28<br />
Parizeau, Philippe Louis ............................... 15<br />
Piattoli, Giuseppe .................................... 16<br />
Preller, Friedrich d.Ä. ................................. 37<br />
Ramberg, Johann Heinrich ............................ 27<br />
Rauscher, Johann Albrecht Friedrich .................... 24<br />
Richter, Adrian Ludwig ............................... 35<br />
Rösel von Rosenhof, August Johann. ..................... 8<br />
Roos, Joseph. ........................................ 10<br />
Schlesischer Wappenmaler ............................. 1<br />
Schönfeld, Johann Heinrich Umkreis..................... 3<br />
Schütz, Franz ........................................ 23<br />
Steinle, Edward Jakob von ............................. 41<br />
Stohl, Michael ....................................... 44<br />
Tempesti, Domenico. .................................. 6<br />
Troger, Paul .......................................... 7<br />
Wagner, Johann Georg ................................ 17<br />
Wille, Johann Georg ................................... 9<br />
100
VERKAUFSBEDINGUNGEN<br />
Sämtliche in diesem <strong>Katalog</strong> angezeigte Werke sind verkäuflich,<br />
soweit sie nicht während der Drucklegung des <strong>Katalog</strong>es<br />
verkauft wurden.<br />
Bis zur Annahme durch den Empfänger ist das Angebot unverbindlich.<br />
Festbestellungen haben in der Abwicklung Vorrang<br />
vor Ansichtsbestellungen. Wenn nichts anderes ausdrücklich<br />
vereinbart wurde, sind Liefertermine grundsätzlich unverbindlich.<br />
Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers, soweit<br />
dieser nicht Verbraucher im Sinne des § 474 BGB ist. Die<br />
Kosten einer Transportversicherung trägt der Käufer.<br />
Der Kaufpreis ist fällig bei Lieferung, er enthält 7% Mehrwertsteuer.<br />
Zahlungen aus dem Ausland werden durch Banküberweisung<br />
spesenfrei erbeten. Der Käufer kommt auch ohne<br />
Mahnung in Zahlungsverzug, wenn er den Kaufpreis nicht spätestens<br />
4 Wochen nach Lieferung entrichtet.<br />
Das Eigentum an der (den) erworbenen Sache(n) geht erst mit<br />
vollständiger Zahlung des Kaufpreises an den Käufer über. Erfüllungsort<br />
und Gerichtsstand im kaufmännischen Verkehr ist<br />
Frankfurt am Main.<br />
Die Beschreibung aller angezeigten Zeichnungen erfolgte nach<br />
bestem Wissen und Gewissen. Ihr Zustand ist gut bis tadellos,<br />
wenn nicht besondere Mängel angegeben sind. Die Maßangaben<br />
beziehen sich auf die Bild- oder Blattgröße oder die Darstellungs-<br />
und Blattgröße wie angegeben. Die Höhe steht vor<br />
der Breite.<br />
Der <strong>Katalog</strong> verliert seine Gültigkeit am 31.12.2013.<br />
IHRE BESTELLUNGEN RICHTEN<br />
SIE BITTE AN:<br />
<strong>Galerie</strong> Joseph <strong>Fach</strong> GmbH<br />
Am Weingarten 7<br />
60487 Frankfurt am Main<br />
Telefon (069) 28 77 61<br />
Fax (069) 28 58 44<br />
Öffnungszeiten:<br />
Di. - Fr. 14 - 18 Uhr, Sa. 11 - 14 Uhr<br />
info@galerie-fach.de<br />
www.galerie-fach.de<br />
www.der-kunsthaendler.de<br />
BANKKONTEN:<br />
Frankfurter Sparkasse<br />
Konto-Nr. 20 66 15 (BLZ 500 502 01)<br />
IBAN: DE 83 5005 0201 0000 2066 15,<br />
BIC: HELADEF1822<br />
Postbank Frankfurt am Main<br />
Konto-Nr. 115 607-603 (BLZ 500 100 60)<br />
IBAN: DE 48 5001 0060 0115 6076 03,<br />
BIC: PBNKDEFF
85 Jahre <strong>Galerie</strong> Joseph <strong>Fach</strong>, Frankfurt am Main<br />
10 Jahre <strong>Galerie</strong> Joseph <strong>Fach</strong> im Internet<br />
WWW.GALERIE-FACH.DE<br />
WWW.DER-KUNSTHAENDLER.DE<br />
Unser Forum für Kunstliebhaber und Sammler aus aller Welt<br />
mit täglich bis wöchentlich aktualisierten, vielfältigen Angeboten<br />
an Kunstwerken aus den klassischen Gattungen der bildenden Kunst<br />
MALEREI, ZEICHNUNG UND GRAPHIK<br />
von Künstlern und Künstlerinnen aus 5 Jahrhunderten.
WWW.GALERIE-FACH.DE