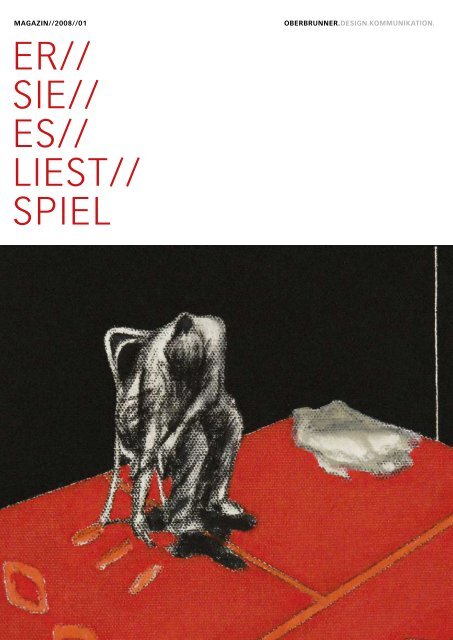ER// SIE// ES// LIEST// SPIEL
ER// SIE// ES// LIEST// SPIEL
ER// SIE// ES// LIEST// SPIEL
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
MAGAZIN//2008//01<br />
<strong>ER</strong>//<br />
<strong>SIE</strong>//<br />
<strong>ES</strong>//<br />
LI<strong>ES</strong>T//<br />
<strong>SPIEL</strong><br />
OB<strong>ER</strong>BRUNN<strong>ER</strong>.D<strong>ES</strong>IGN.KOMMUNIKATION.
MAGAZIN//THEMA//<br />
<strong>SPIEL</strong><br />
„Ergötzen ist der Musen erste Pflicht,<br />
Doch spielend geben sie den besten Unterricht.“<br />
(C.M. Wieland, 1733-1813)<br />
AUF DEN <strong>ER</strong>STEN BLICK BEGEGNEN WIR DEM THEMA<br />
<strong>SPIEL</strong> IM THEAT<strong>ER</strong>, IN D<strong>ER</strong> KUNST, D<strong>ER</strong> LIT<strong>ER</strong>ATUR,<br />
D<strong>ER</strong> MUSIK, IM KINDLICHEN <strong>SPIEL</strong> UND IM SPORT.<br />
WÄHREND KIND<strong>ER</strong> SICH IM <strong>SPIEL</strong> AUF DIE WIRKLICHKEIT<br />
VORB<strong>ER</strong>EITEN, NUTZEN <strong>ER</strong>WACHSENE DIE UNT<strong>ER</strong>SCHIED-<br />
LICHEN FORMEN D<strong>ES</strong> <strong>SPIEL</strong>S ALS MÖGLICHKEIT D<strong>ER</strong><br />
Z<strong>ER</strong>STREUUNG.<br />
„<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T“ GREIFT IN DI<strong>ES</strong><strong>ER</strong> AUSGABE EINIGE<br />
WILLKÜRLICH ZUSAMMENG<strong>ES</strong>TELLTE BEI<strong>SPIEL</strong>E ZUR<br />
THEMATIK <strong>SPIEL</strong> H<strong>ER</strong>AUS. DIE BEITRÄGE MACHEN<br />
DEUTLICH, DASS <strong>SPIEL</strong> KEIN<strong>ES</strong>WEGS ALS GEGENSATZ<br />
ZUR WIRKLICHKEIT V<strong>ER</strong>STANDEN W<strong>ER</strong>DEN WILL.<br />
AUS UNT<strong>ER</strong>SCHIEDLICHEN P<strong>ER</strong>SPEKTIVEN H<strong>ER</strong>AUS<br />
NÄH<strong>ER</strong>N SICH DIE AUTOREN DEM KONZEPT: SO STOSSEN<br />
WIR AUF <strong>SPIEL</strong> ALS GRUNDBEDINGUNG FÜR EIN FUNK-<br />
TIONI<strong>ER</strong>END<strong>ES</strong> MITEINAND<strong>ER</strong> OD<strong>ER</strong> ALS KONSTRUKT<br />
FÜR DIE WIRKLICHKEIT. WIR <strong>ER</strong>FAHREN <strong>SPIEL</strong> ALS Z<strong>ER</strong>-<br />
STÖR<strong>ER</strong>ISCHE MACHT OD<strong>ER</strong> ALS BEFLÜGELNDE KRAFT,<br />
UND WIR <strong>ER</strong>LEBEN DEN MENSCHEN ALS „TEILNEHM<strong>ER</strong><br />
AN EINEM GROSSEN <strong>SPIEL</strong>“, WIE <strong>ES</strong> D<strong>ER</strong> FRANZÖSISCHE<br />
DICHT<strong>ER</strong> STÉPHANE MALLARMÉ EINMAL FORMULI<strong>ER</strong>TE.<br />
DEM L<strong>ES</strong><strong>ER</strong> SOLL SICH D<strong>ER</strong> AND<strong>ER</strong>E BLICKWINKEL<br />
<strong>ER</strong>ÖFFNEN, WENN <strong>ES</strong> UM DAS <strong>SPIEL</strong> D<strong>ES</strong> LEBENS, <strong>SPIEL</strong><br />
ALS SUCHT, DAS <strong>SPIEL</strong> IN D<strong>ER</strong> LIT<strong>ER</strong>ATUR, <strong>SPIEL</strong> ALS<br />
METAPHORISCH<strong>ES</strong> ZIVILISATIONSKONZEPT OD<strong>ER</strong> AB<strong>ER</strong><br />
UM <strong>SPIEL</strong> ALS Z<strong>ER</strong>STREUUNG GEHT.<br />
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//02
2008//01<br />
<strong>ER</strong>//<br />
<strong>SIE</strong>//<br />
<strong>ES</strong>//<br />
LI<strong>ES</strong>T//<br />
<strong>SPIEL</strong><br />
» LASST UNS <strong>SPIEL</strong>EN<br />
IM <strong>SPIEL</strong> L<strong>ER</strong>NEN WIR DAS LEBEN UND DEN TOD KENNEN<br />
VON THOMAS G<strong>ER</strong>N<strong>ER</strong><br />
» DAS <strong>SPIEL</strong>, DIE SUCHT, DIE LIT<strong>ER</strong>ATUR<br />
DOSTOJEWSKI UND DIE FASZINATION AM ROULETTE<br />
VON ANDREAS GEBHARDT<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//03
<strong>ER</strong> liest<br />
»<br />
LASST UNS <strong>SPIEL</strong>EN!<br />
IM <strong>SPIEL</strong> L<strong>ER</strong>NEN WIR<br />
DAS LEBEN UND DEN<br />
TOD KENNEN<br />
<strong>SPIEL</strong>EN UND ARBEITEN<br />
Wozu spielen wir? Eine seltsame Frage, denn gerade Spielen geschieht<br />
doch zweckfrei und grundlos. Weil es mir Spaß macht, lautet deswegen<br />
die vielleicht beste Antwort. Weil ich abschalten will nach einem harten<br />
Arbeitstag, so könnte eine weitere Begründung lauten, oder: Weil ich<br />
so meine Freizeit am besten nutzen kann. Allerdings wird hier bereits<br />
wieder ein Zweck, ein Nutzen erkennbar.<br />
Traditionell wird das Spielen dem Arbeiten gegenübergestellt. Nutz-<br />
los-zweckfreie Lebensfreude hier und drückend-mühsame Existenzsi-<br />
cherung dort. Arbeit wird als Ernst des Lebens empfunden, sie strengt<br />
an und ist, von wenigen glücklichen Ausnahmen einmal abgesehen,<br />
eine Last. Spielen dagegen bedeutet Zerstreuung, Illusion, Willkür und<br />
findet in einer gewissen Scheinwelt statt. Bei näherem Hinsehen aber<br />
lässt sich dieser Gegensatz kaum aufrechterhalten. Denn zum einen ge-<br />
hört ja auch zum Spielen Konzentration, Einsatz und nicht zuletzt Ernst.<br />
Auch ein Spiel kann »geernstet« werden, wie Stefan Zweig in seiner<br />
Schachnovelle unübertroffen festgestellt hat; zum anderen gibt es<br />
zwischen Arbeiten und Spielen durchaus einige Gemeinsamkeiten und<br />
Übereinstimmungen. Beide sind uralte Kulturtechniken der Mensch-<br />
MAGAZIN//<br />
heit, und beide haben eine daseinshermeneutische Bedeutung für den<br />
Menschen, indem in ihnen eine Aneignung der Welt und ihrer Wirklich-<br />
keit stattfindet. Sowohl beim Arbeiten als auch beim Spielen wird auf die<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//04
2008//01<br />
biologische und soziale Lebenswirklichkeit zugegriffen und das Dasein<br />
erkundet, in Frage gestellt und geklärt. Letztlich wird beide Male – beim<br />
Arbeiten eher pragmatisch-praktisch, beim Spielen eher zeichenhaft-<br />
symbolisch und rituell – eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn,<br />
nach dem Woher und Wohin des Lebens gegeben. In beidem findet<br />
Wiederholung statt (diese wird im Spiel durch Regeln sogar angestrebt),<br />
beide bergen aber zugleich (im Idealfall) die reichen Möglichkeiten der<br />
Phantasie und der Kreativität zum Entdecken des ungeplanten Neuen<br />
und zur Erfindung neuer Techniken.<br />
So zeigt sich, dass der Mensch stets durch Arbeiten und Spielen zu-<br />
gleich (und nie ausschließlich nur durch eines von beiden) seine Bedürf-<br />
nisse, Wünsche und Fähigkeiten erfährt und verwirklicht.<br />
<strong>SPIEL</strong> UND LEBEN<br />
Durch Spielen eignet sich der Mensch die Welt und ihre Wirklichkeit<br />
an – ein Aspekt, der nähere Aufmerksamkeit verdient. Abgesehen von<br />
der hohen Bedeutung, die dem Spielen in der Pädagogik zukommt<br />
(spätestens seit der Reformpädagogik der Siebziger Jahre genießt das<br />
„spielerische Lernen“ höchste Wertschätzung), versuchen viele Spiele,<br />
das Leben oder zumindest einen bestimmten Lebensbereich abzubilden,<br />
so dass der spielende Mensch in eine Welt eintauchen kann, die der ge-<br />
wohnten, realen ähnlich ist. Gleichzeitig aber, da er ja spielt (und in der<br />
Regel darum weiß, auch wenn er es während des Spiels gelegentlich<br />
vergisst) kann er alles nur Mögliche – je nachdem was das Spiel hergibt<br />
– ausprobieren oder ganz anders machen, als er es im realen Leben je<br />
praktizieren würde. Der spielende Mensch schlüpft in neue Rollen mit<br />
ungeahnten Möglichkeiten und schier unerschöpflicher Bandbreite.<br />
So wird er etwa bei Monopoly erst zum Häuslebauer, dann zum<br />
Hotelier, und er erfährt ganz nebenbei etwas über den Umgang mit<br />
Geld, über Sparen oder Investieren zum rechten Zeitpunkt, über das<br />
Abzocken unschuldiger Gäste oder über den unaufhaltsam scheinenden<br />
Abstieg in die Armut mit einer Flut von Hypotheken, bis ihm das Wasser<br />
bis zum Hals steht. „Lasst die Kinder Monopoly spielen“, hat Heinrich<br />
Böll einmal gesagt, „da lernen sie den Kapitalismus kennen, wie er ist.“<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//05
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//06
2008//01<br />
In anderen Spielen werden die Spieler zu Schatzsuchern, Detektiven,<br />
Therapeuten oder Siedlern, sie schlüpfen in historische Rollen (wie<br />
Cäsar und Cleopatra), sie müssen sich als Strategen beweisen und<br />
Kriege gewinnen (oder zumindest den gegnerischen König fest- und<br />
mattsetzen), und sie können neuerdings sogar das erreichen, was im<br />
Märchen der Frau des Fischers noch versagt blieb: Der spielende Mensch<br />
kann Gott werden! In den extrem erfolgreichen Computerspielen Sim<br />
City und Die Sims kann er seine eigene Welt aufbauen und bewahren<br />
oder zerstören.<br />
Und im Strategiespiel Black & White schleudert man mit göttlicher<br />
Hand Blitze oder lässt Nahrung wachsen, heilt die Kranken oder brennt<br />
ihre Dörfer nieder. Die computeranimierten und insofern mit virtuellem<br />
Lebensodem beseelten Spielfiguren beten den Spieler an – aus Dankbar-<br />
keit oder aus Furcht, je nachdem, wie man sie behandelt. Etwas blasphe-<br />
misch und treffend zugleich heißt dieses Genre God Games. Spätestens<br />
hier scheint Einsteins Glaubensbekenntnis, dass Gott nicht würfelt,<br />
widerlegt (welch geniale Metapher im Übrigen), wobei selbst ein wür-<br />
felnder Gott noch ungleich berechenbarer wäre als manch einer dieser<br />
Gottspieler.<br />
Im Grunde ist jedes Spiel ein Gottspiel, bei dem ein kontrolliertes<br />
und verständliches Universum entsteht, das vollkommen vorhersagbar<br />
ist, solange sich die Teilnehmer an die Regeln halten. Tut man das nicht,<br />
wird man als Spielverderber ausgeschlossen oder mit dem ultimativen<br />
„Game over“ bestraft. Im Regelfall aber wird den Spielern ein übersicht-<br />
licher Kosmos geliefert, der eben durch das feste Regelwerk beliebig<br />
wiederholbar und zugleich durch den je neuen Spielverlauf einmalig,<br />
unverwechselbar und dadurch gerade unwiederholbar wird – wie das<br />
echte Leben auch!<br />
Kein Wunder, dass gerade jene Spiele am beliebtesten sind und zum<br />
Teil ihren Siegeszug durch die Jahrhunderte antreten, die im Rahmen<br />
klarer und nicht zu komplizierter Regeln größtmögliche Vielfalt, Variati-<br />
onsbreite und damit nie versiegende Überraschungen bereithalten,<br />
wie die Mutter aller Spiele überhaupt: das königliche Schach.<br />
Im Spielen eignet sich der Mensch die Welt und ihre Wirklichkeit<br />
an – das war die These; zuweilen werden Spiel und Leben gar parallel<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//07
gesetzt. So agiert der Mensch vom ersten bis zum letzten Atemzug auf<br />
seiner Lebensbühne. Er dreht seine Runden wie beim Mensch ärgere<br />
Dich nicht, er zieht den Kürzeren oder aber sein letztes Ass aus dem<br />
Ärmel. Zuweilen steht viel auf dem Spiel, dann wieder klinkt man sich<br />
aus demselben aus, man bringt ein Bauernopfer oder aber wird selbst<br />
zu einer Randfigur mit der einzigen Sehnsucht, noch einmal ins Spiel zu<br />
kommen – die Metaphern ließen sich mühelos fortsetzen.<br />
<strong>SPIEL</strong> UND TOD<br />
Spielerisch gelingt dabei auch mit geradezu unbefangener Leichtigkeit<br />
die Annäherung an das im echten Leben immer noch größte Tabu: Der<br />
mit aller Macht und Raffinesse verdrängte Tod betritt im Spiel so unbe-<br />
schwert und selbstverständlich die Bühne, dass die im gelebten Leben<br />
mit solch gewaltiger Anstrengung inszenierten Verleugnungsmecha-<br />
nismen geradezu irreal erscheinen. Und dies hat Geschichte: Ein Blick in<br />
die Kulturgeschichte des Spielens zeigt, dass der Mensch schon immer<br />
spielte, um die Götter gnädig zu stimmen und um mit dem Tod in Kon-<br />
takt zu kommen, ja ihn im simulierten Überlebenskampf nach Möglich-<br />
keit zu überlisten. Vielfältige Wechselbeziehungen zwischen Spiel, Tod<br />
und Jenseits gibt es von Anfang an. Wenn Spiele auf allegorische und<br />
metaphorische Weise den Lebenszyklus abbilden, dann steht spätestens<br />
am Ende das Aus, sprich: der Tod. Und der Tod siegt immer, zumindest<br />
für den oder die Verlierer. Lange Zeit war ja das Faktum des Lebensendes<br />
auch im realen Leben präsent, durch eine ars moriendi sollte auch die<br />
ars vivendi gefunden werden. Der Tod gehörte zum Leben, und das<br />
war gut so. Erst als in der Neuzeit die vielfältigen Verdrängungsmecha-<br />
nismen etabliert wurden, erst als der Machbarkeitsgedanke wuchs und<br />
der Tod mehr und mehr ein Betriebsunfall wurde, erst als der Mensch<br />
sein Leben für unendlich zu halten und Schmerz und Trauer zu ver-<br />
meiden begann, da nahm die Tabuisierung dessen, was doch neben der<br />
Geburt das existentiellste Ereignis in einer jeden Lebensgeschichte ist,<br />
ihren Lauf.<br />
MAGAZIN//<br />
Aber im Spiel bleibt der Tod präsent, das Unaussprechliche wird aus-<br />
gesprochen, spielerisch wird gestorben. Etwa wenn Kinder sich einen<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//08
2008//01<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//09
Ball zum Fangen zuwerfen und festlegen, dass das Kind, das den Ball<br />
immer wieder fallen lässt, erst krank (weil es „Kirschen gegessen und<br />
Wasser getrunken“ hat), dann ins Krankenhaus kommt und schließlich<br />
sterben muss! Die Spielfigur auf dem Brett wird geschlagen und ver-<br />
schwindet ganz oder darf wieder, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt<br />
sind, etwa eine Sechs gewürfelt wurde, am Start antreten (wie nach einer<br />
Reinkarnation). In unzähligen Regelwerken für Würfel-, Karten- oder<br />
Brettspiele wird der Tod ganz offen benannt und manchmal nur in einer<br />
Metapher versteckt (wie das Untergehen beim Kartenspiel Schwimmen ).<br />
Manche Modelleisenbahner bauen einen Friedhof auf die Platte – Trau-<br />
er in Miniaturformat. Geradezu massenhaft wird in Computerspielen<br />
gestorben. Aber auch lange vor Counter-Strike und Co zogen Ballerspiele<br />
auf dem Jahrmarkt oder in Kneipen schon immer die Heerscharen an<br />
(meist Männer). Virtuelles Töten, auf technisch einfachstem Niveau,<br />
ganz normal und selbstverständlich. Wer hatte als Kind keine Spielzeug-<br />
pistole mit Zündplättchen: „Peng, du bist tot!“ Kinder sind Feldherren am<br />
Küchentisch, Bomberpiloten an der Wohnzimmerdecke oder Panzerfah-<br />
rer im Spielzimmer.<br />
Wer mit Kriegsspielzeug hantiert, fühlt sich stark, wird aber nicht<br />
zwangsläufig zum Killer. Dennoch aber stellen Pädagogen und, wenn es<br />
ihnen von Vorteil erscheint, auch Politiker die Frage, wie gefährlich der<br />
gespielte Tod bzw. das virtuelle Töten sei. Zwar bleibt das Abdrücken<br />
abstrakt, ein Mausklick nur entscheidet über Sein oder Nichtsein.<br />
MAGAZIN//<br />
Je bewegter allerdings der Bildschirm, desto starrer werden die Augen der<br />
Spieler. Und je perfekter das Sterben auf dem Bildschirm inszeniert wird,<br />
desto weniger wird im Gemüt eine Betroffenheit über echte Tote, reales<br />
Sterben entwickelt. Computerspiele werden immer kälter, vielleicht weil<br />
wir das Trauern verlernt haben, das früher zum Alltag gehörte und dort<br />
auch von Kindesbeinen an eingeübt wurde. Hier also droht tatsächlich<br />
ein Verlust. Denn gerade das, was ja ansonsten pädagogisch gewollter<br />
Zweck des Spielens sein kann, sich mit den Dingen des Lebens und dem<br />
Leben selbst vertraut zu machen, geht auf diese Weise verloren. Gerade<br />
das Gegenteil wäre ja wünschenswert: Über das Spielen wieder in Kon-<br />
takt zu kommen mit dem letzten Geheimnis des Daseins und damit den<br />
Tod aus der Tabuecke herauszuholen. Eines nämlich bleibt klar: Echtes<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//10
2008//01<br />
Leben hat keine Reset-Taste – es kann nur einmal gelebt werden und<br />
erhält gerade durch das memento mori seine Spannkraft.<br />
Wozu spielt der Mensch? Die Frage bleibt so seltsam, wie die Antwort<br />
einfach ist: „Um Spaß zu haben“, ist nach wie vor die beste. Wenn aber<br />
spielerisch Zugänge entstehen zu den Dingen des Lebens, zu denen auch<br />
der Tod gehört – dann lasst uns spielen!<br />
THOMAS G<strong>ER</strong>N<strong>ER</strong> IST DIPLOM-THEOLOGE UND<br />
ETHIKDOZENT UND LEBT IN KASSEL.<br />
»<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//11
<strong>ER</strong> liest<br />
»<br />
Die Weltliteratur wird von Süchtigen bevölkert, von Opiumessern,<br />
Morphiumabhängigen, Haschischrauchern, vor allem aber von Säufern.<br />
Der große Aufklärer Georg Christoph Lichtenberg notierte Ende des 18.<br />
Jahrhunderts in einem seiner Sudelbücher: „Wenn man manchen großen<br />
Taten und Gedanken bis zu ihrer Quelle nachspüren könnte, so würde<br />
man finden, daß sie öfters gar nicht in der Welt sein würden, wenn die<br />
Bouteille verkorkt geblieben wäre, aus der sie geholt wurden. Man glaubt<br />
nicht, wie viel aus jener Öffnung hervorkommt.“ Schriftsteller aller<br />
Zeiten und Kulturkreise haben existenzielle Grenzerfahrungen gemacht,<br />
indem sie sich mit geistigen Drogen und Getränken abgefüllt und dabei<br />
die Literaturgeschichte sowie uns Leser mit geistreichen Elaboraten an-<br />
gefüllt haben. Die Literaturgeschichte ist ein Weinfass ohne Boden.<br />
Zu den weniger beachteten Stimulanzien neben Tabak, Kaffee,<br />
Tee, dem Alkohol und den vielen Rauschdrogen – Halluzinogenen,<br />
Opiaten und Narkotika – zählt das Spiel, besser gesagt, das Glücksspiel:<br />
Ungezügelte Leidenschaften, Versessenheit und Irrationalität, Entsitt-<br />
lichung und Habsucht, die Tragik des Verlierers und der Triumph des<br />
Gewinners, das dämonische Prinzip, die Herausforderung des Schicksals<br />
– das alles hat das Spiel und den Typus des Spielers zum festen Motivbe-<br />
stand der Weltliteratur werden lassen.<br />
Der bekennende Trinker Kurt Kusenberg, Schriftsteller und Begrün-<br />
MAGAZIN//<br />
DAS <strong>SPIEL</strong>, DIE SUCHT,<br />
DIE LIT<strong>ER</strong>ATUR<br />
DOSTOJEWSKI UND<br />
DIE FASZINATION AM<br />
ROULETTE<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//12
2008//01<br />
der von Rowohlts Bildmonografien, wusste es ebenfalls: „Wenn in den<br />
Werken eines Schriftstellers viel getrunken wird, kann man sicher<br />
sein, dass er selbst trinkt, denn“, so Kusenberg, „Literatur ist Selbster-<br />
fahrung“. So ist anzunehmen, dass Schriftsteller, wenn sie das Spiel<br />
thematisierten, auf eigene Spielerlebnisse zurückgriffen, abgesehen<br />
vielleicht von jenen, welche es von einer höheren moralischen Warte<br />
herab, also a priori, verurteilten. Wie will ein Autor die Abgründe des<br />
Hasards überzeugend schildern, ohne sie nicht wenigstens einmal am<br />
eigenen Leib durchlitten zu haben? Allein, in den meisten Fällen sind<br />
Erfahrungen dieser Art nicht bekannt. Während dem Suff noch immer<br />
eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz sicher ist, weil er der Stilisie-<br />
rung des Künstlertums Vorschub leistet, haftet dem Glücksspiel nach<br />
wie vor das Odeur des Verrufenen an. Kein Wunder also, wenn Autoren<br />
über ihre Aufenthalte am Spieltisch nur vereinzelt Auskünfte erteilen.<br />
Verbürgt ist immerhin, dass der Romantiker E.T.A. Hoffmann ein<br />
1798 in einem schlesischen Badeort gehabtes Spielerlebnis, bei dem er<br />
auf geheimnisvolle Weise viel Geld gewann, nicht nur in den Elixieren<br />
des Teufels (1815), sondern auch in der Novelle Spielerglück (1819) ver-<br />
arbeitete. Fürst Hermann von Pückler- Muskau, Dandy, Weltreisender,<br />
enthusiastischer Landschaftsgärtner, Schöpfer der beliebten Eiskreation<br />
und bekennender Trinker, besuchte 1826 Spielclubs in London. Der „Ra-<br />
sende Reporter“, Egon Erwin Kisch, berichtete aus dem Kasino in Monte<br />
Carlo. Nichts in diesen Berichten deutet darauf hin, dass sie im Leben<br />
ihrer Verfasser tiefe Spuren hinterließen; was auch in Bezug auf die bei-<br />
den russischen Romanciers Ivan Turgenew und Ivan Gontscharow gilt,<br />
obwohl sie in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts wiederholt an<br />
den Spieltischen deutscher Kurorte das Glück herausforderten.<br />
Ein anderer russischer Zeitgenosse – Fjodor Dostojewski – war dem<br />
Spiel mit der rotierenden Scheibe und der weißen Kugel allerdings über<br />
fast ein Jahrzehnt lang derart verfallen, dass er nicht nur sich und seine<br />
Familie mehrfach dramatisch an den Rand des Ruins manövrierte,<br />
sondern auch in dem Roman Der Spieler das Muster einer literarischen<br />
Zocker-Psychologie gestalten konnte. Wer die Abgründe des Roulettes<br />
kennenlernen möchte, ohne sich selbst gleich um Kopf und Kragen zu<br />
bringen, wird immer zum Spieler greifen. Oder zu Dostojewskis Briefen<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//13
an seine Frau Anna, worin er minutiös Rechenschaft über seine zwang-<br />
hafte Spielsucht ablegt, wie umgekehrt die Tagebücher und Erinne-<br />
rungen Annas diese aus der Innenperspektive ergänzen und absichern.<br />
Mit den beiden Letzteren lässt sich – obwohl erst nach Veröffentlichung<br />
des Spielers entstanden – genau belegen, dass Dostojewskis Roman kein<br />
ausschließliches Produkt genialer Einbildungskraft darstellt, sondern<br />
auf genauen Beobachtungen im Kasino und mehr noch auf der genauen<br />
Analyse der eigenen Faszination am Roulette beruht. Allerdings wäre es<br />
falsch, Dostojewski allein mit dem Ich-Erzähler Alexej Ivanowitsch zu<br />
identifizieren. Dostojewski war klug genug, die Pathologie der Spieler-<br />
seele auf eine weitere Romanfigur (nämlich auf die alte Erbtante) zu<br />
projizieren und so zunächst einmal von seiner Person abzulenken.<br />
Dostojewski verknüpft in dem Roman das Spielermotiv mit dem des<br />
verschmähten Liebhabers. Das Drama spielt sich in zwei Jahren ab und<br />
innerhalb dieser Zeitspanne an wenigen Tagen. Die Handlung ist in Ru-<br />
letenburg angesiedelt, Quintessenz einiger im 19. Jahrhundert beliebter<br />
deutscher Kurorte. Eine seltsame Reisegesellschaft hat sich eingefun-<br />
den, Alexej Ivanowitsch nennt sie „die Unseren“. An ihrer Spitze steht<br />
ein ehemaliger russischer General, bei dem der Erzähler als Hauslehrer<br />
angestellt ist. Über beide Ohren hat er sich in des Generals Stieftochter,<br />
Polina, verliebt. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass sie bereits dem<br />
»Marquis« de Grieux aufgesessen ist, einem undurchsichtigen Franzo-<br />
sen. Der General liebt seinerseits eine zwielichtige französische Kokotte<br />
namens Madame Blanche. Aber ohne Geld hat er keine Chancen bei ihr.<br />
Folglich wartet er nur auf den Tod seiner ebenso reichen wie exzentri-<br />
schen Erbtante. Nur mit dem erhofften Erbe wird er sich die Zuneigung<br />
der Madame Blanche erschleichen können, und für die junge Blanche ist<br />
der alternde General ja auch nur wegen dieses Geldes interessant.<br />
Aber anstatt zu sterben, kreuzt die putzmuntere Tante überraschend<br />
im Kurort auf, verspielt in kürzester Zeit nahezu ihr gesamtes Vermögen<br />
beim Roulette und ruiniert damit nicht nur sich, sondern durchkreuzt<br />
(was viel schlimmer ist) die schönsten Hoffnungen, die der General,<br />
seine Stieftochter und nicht zuletzt Madame Blanche an ihr Ableben<br />
geknüpft haben.<br />
Alexej Ivanowitsch wittert nun seine Chance: Für die Angebetete<br />
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//14
2008//01<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//15
gewinnt er beim Roulette 200.000 Francs (was übrigens immer ein from-<br />
mer Wunschtraum Dostojewskis geblieben ist...). Polina weist ihn – von<br />
seinem großspurigen Auftreten angewidert – zurück, woraufhin er mit<br />
Madame Blanche nach Paris durchbrennt. Dort verprasst sie in wenigen<br />
Wochen den größten Teil seines Gewinns. Fast mittellos, will er Polina<br />
nun erneut zurückerobern, und Ivanowitsch begibt sich abermals an<br />
den Spieltisch. Das Ende lässt Dostojewski offen, nicht ohne anzudeuten,<br />
dass der Held seinen Verstand am Roulette verloren hat und in Ruleten-<br />
burg ein Süchtiger geworden ist.<br />
Der Spieler entsteht an nur 26 Tagen im Oktober 1867 in Sankt Pe-<br />
tersburg. Dostojewski verarbeitet darin Erlebnisse zweier ausgedehnter<br />
Europareisen in den Jahren 1863 und 1865, die ihn unter anderem in die<br />
Spielerparadiese Baden-Baden, Bad Homburg und Wiesbaden führten.<br />
In diese Zeit fällt nicht nur der Beginn seiner exzessiven Spielleiden-<br />
schaft (die ihn in Wiesbaden erstmals ruinierte), sondern auch die Liebe<br />
zu Polina Suslova, einer typischen Vertreterin der russischen Frauen-<br />
emanzipation jener Jahre. Dass Dostojewski seiner Liebe zu ihr im Spieler<br />
Ausdruck verlieh (vielleicht auch bewältigte), gilt nicht nur wegen der<br />
Namensgleichheit bei allen Biografen als ausgemacht. Der im Roman<br />
geschilderte Versuch Alexej Ivanowitschs, sich Polinas Zuneigung zu<br />
erkaufen, darf darüber hinaus als pikanter Wunschtraum, als Allmachts-<br />
phantasie Dostojewskis gewertet werden – verspäteter Reflex auf den<br />
abgewiesenen Heiratsantrag, den ihr der Dichter 1865 gemacht hatte.<br />
Dostojewski diktierte den Spieler der jungen Stenotypistin Anna<br />
Grigorjewna Snitkina; wenig später heirateten die beiden. Seltsam,<br />
dass Anna die Auswüchse von Dostojewskis Spielsucht nicht zu deuten<br />
wusste, obwohl sich beide während des Diktats intensiv darüber aus-<br />
tauschten. In den Erinnerungen berichtet sie, von allen Romanfiguren<br />
hätten ihre Sympathien sogar am meisten der Tante gegolten, „die das<br />
Vermögen verspielte“, während sie dem Helden, „seinen Kleinmut und<br />
seine Spielleidenschaft nicht verzieh“.<br />
Dass beide Figuren nur zwei Seiten einer Medaille darstellen, sieht<br />
sie nicht. Aber: Hätte sie von der Heirat Abstand genommen, wenn sie<br />
geahnt hätte, was in den kommenden vier Jahren auf sie zukommen wür-<br />
de? Wir wissen es nicht. Und wir können sogar froh darüber sein.<br />
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//16
2008//01<br />
Denn ihren Aufzeichnungen verdanken wir ein mindestens ebenso<br />
schonungsloses Spieler-Psychogramm, wie es Dostojewski in seinem<br />
Roman entwirft.<br />
Russland müssen die Dostojewskis wegen der hohen Schulden des<br />
Dichters bei verschiedenen Gläubigern fluchtartig verlassen. Dostojewski,<br />
dessen schriftstellerische Bedeutung spätestens seit der Veröffentlichung<br />
von Schuld und Sühne (1866) von niemandem mehr angezweifelt wird,<br />
träumt davon, seinen Schuldenberg mit einem Schlag am Roulettetisch<br />
abbauen zu können. Erste längere Station der vierjährigen Reise, die sie<br />
unter anderem nach Genf, Mailand und Florenz führen wird, ist Dresden.<br />
Dostojewski lässt seine Frau hier im Mai 1867 während einer Expedition<br />
ins Homburger Kasino allein zurück. In zehn Tagen verspielt er im Ver-<br />
trauen auf ein ominöses „System“ mehrmals<br />
die gesamte Barschaft (von seiner Frau lässt er sich immer wieder pos-<br />
talisch Geld aus der Reisekasse anweisen). Am 22. Mai 1867 erläutert<br />
Dostojewski der 25 Jahre jüngeren Anna in einem Brief aus Homburg<br />
seine Strategie: „Da ich nun schon etwa zwanzigmal an den Spieltisch<br />
getreten bin, habe ich die Erfahrung gemacht, dass, wenn man kaltblütig<br />
spielt, ruhig und mit Berechnung, unmöglich verlieren kann!“ Woraus zu<br />
schließen ist, dass Dostojewski am Spieltisch niemals kaltblütig, ruhig<br />
und berechnend war, denn er verlor fast immer.<br />
Ist Dresden nur der Vorhof, begibt sich das Ehepaar anschließend<br />
mitten in den Glutofen der Spielhölle und reist am 3. Juli 1876 ohne<br />
Umweg nach Baden-Baden weiter, einem der mondänsten Kurorte der<br />
Zeit. Ihr eintöniges Leben spielt sich dort im Wesentlichen zwischen<br />
Kasino, Pfandleiher und der ärmlichen Behausung über einer lärmenden<br />
Werkstatt ab. „Wir haben überhaupt kein Geld mehr, außer 12 Kreuzern<br />
für den Dienstmann, der Zucker ist uns ausgegangen, weshalb ich heute<br />
morgen auch keinen Tee trank, weil es nichts dazu gab“, notiert Anna<br />
etwa am 12. August 1867 nach diversen Ausflügen Dostojewskis ins<br />
Kasino, um fortzufahren: „Eine schlimmere Lage kann man sich kaum<br />
denken. Der Herr verhüte, dass sie noch schlimmer wird, denn ich weiß<br />
nicht mehr, was wir tun sollen.“ Es ist einer ihrer ganz normalen, ja in<br />
stupender Regelmäßigkeit sich wiederholender Einträge, die die Gattin<br />
des Dichters ihrem Tagebuch anvertraut. Und: Es wird schlimmer.<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//17
Kurz darauf erhalten die Eheleute zwar von Annas Mutter eine lange<br />
erwartete Geldanweisung, womit sie endlich etliche verpfändete Klei-<br />
dungsstücke und nicht zuletzt die Eheringe auslösen können. Aber aus<br />
Furcht, den Pfandleiher daheim nicht anzutreffen (eine hübsche Ausre-<br />
de), geht Dostojewski mit dem Geld seiner Schwiegermutter kurzerhand<br />
ins Kasino. Anna notiert: „Heute war ein Unglückstag für uns. Fedja<br />
machte sich auf den Weg und nahm 20 Zweiguldenstücke mit.“<br />
Er verliert das Geld, aber das scheint ihn nur noch mehr anzustacheln.<br />
Wie üblich kehrte er in die Wohnung zurück, um seine wartende Frau<br />
und Finanzverwalterin um Nachschub zu bitten. Sie händigt ihm vier<br />
weitere Goldstücke aus. Auch dieser Obolus wird verspielt, und Dosto-<br />
jewski holt sich nochmals drei Goldstücke aus ihrer Reserve: „Schließ-<br />
lich kam er“, berichtet Anna weiter, „und wollte den letzten Friedrichs-<br />
dor, den ich noch hatte, und 30 Franken.“<br />
An diesem Tag scheint sich das Blatt am Spieltisch doch noch zu<br />
wenden: Dostojewski setzt zunächst lediglich die 30 Franken, gewinnt<br />
vier Napoleondor, 30 weitere Franken und – wie Anna berichtet –<br />
„10 oder zwanzig Zweigüldenstücke“. Für sie der rechte Moment zum<br />
Aufhören, für Dostojewski keinesfalls. Ruhelos stürzt er abermals ins<br />
Kasino, spielt va banque, verliert alles und lässt sich auch noch den<br />
allerletzten Friedrichsdor von seiner Frau aushändigen. Kurz darauf ste-<br />
hen sie ohne jede Barschaft da, denn auch diese letzte Münze ging an die<br />
Bank. Stets folgen auf derartige „Katertage“ erniedrigende Bittbriefe an<br />
Verleger, Freunde und Verwandte: Ein höllischer Kreislauf, der sich bis<br />
1871 wiederholen wird und es ist erstaunlich, wie die Eheleute irgend-<br />
wie immer wieder auf die Füße kommen und sich weiter durchschlagen.<br />
Dostojewskis fatalistisches Spielverhalten gleicht dem der Erbtante<br />
im Roman. Die Babuschka – wie sie liebevoll genannt wird – erliegt dem<br />
Spiel nicht zuletzt aufgrund seiner verführerischen Einfachheit. Nach<br />
einer anfänglichen Glückssträhne glaubt sie, es werde immer so weiter-<br />
gehen. Genau das Gegenteil tritt ein: Die Tante verliert, und da sie sich<br />
mit fortgesetzten Verlusten an die Bank nicht abfinden will, setzt sie<br />
immer weiter in dem Glauben, das Glück wieder auf ihre Seite zu ziehen.<br />
Der Strudel reißt sie unaufhörlich in Richtung Bankrott. Erst als fast<br />
alles verloren, erwacht sie wie aus einer Trance und begreift die<br />
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//18
2008//01<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//19
Tragweite ihres irrationalen Tuns.<br />
Dostojewski hatte seiner Frau beim Diktat des Romans versichert,<br />
„man könne sehr wohl einen starken Charakter besitzen, dies mit<br />
seinem Leben beweisen und dennoch nicht die Kraft aufbringen, die Lei-<br />
denschaft für das Roulettespiel zu bezwingen.“ In der Tat, jeden noch so<br />
kleinsten Gewinn setzt er sofort wieder ein. Nur der Verlust allen Geldes<br />
zwingt ihn zum Aufhören.<br />
Die Nerven liegen nicht selten blank nach solchen Tagen. Dosto-<br />
jewski – seit der perfiden Scheinhinrichtung im Dezember 1849 und der<br />
anschließenden vierjährigen Verbannung nach Sibirien – häufig von<br />
epileptischen Anfällen heimgesucht, ist oft aggressiv, beschimpft seine<br />
Frau, beleidigt sie. Anna – seit mehreren Monaten mit dem ersten Kind<br />
schwanger und ohnehin leicht reizbar und kränklich – reagiert ebenso<br />
impulsiv, schreit zurück, fordert Entschuldigungen. Nicht selten plagen<br />
ihn Schuldgefühle, und er schwört dem Roulette endgültig ab. Verblüf-<br />
fenderweise schickt sie ihn nie zum Teufel. Es geschieht sogar etwas<br />
gänzlich Unerwartetes: Sie erteilt ihm – obwohl oft der Verzweiflung<br />
nahe und das Roulette verfluchend – Absolution und verpfändet weiter-<br />
hin Sachen, wissend, dass Dostojewski auch dieses Geld an den Spiel-<br />
tisch tragen und verlieren wird.<br />
Bei Lektüre der Tagebücher drängt sich ein Eindruck förmlich auf:<br />
Der Dichter lädt Schuld auf sich, seine Frau gewährt ihm Erlösung.<br />
Er gesteht ihr regelmäßig seine unbändige Liebe, sie hebt seine Gutmü-<br />
tigkeit hervor, bewundert ihn aufrichtig trotz all seiner menschlichen<br />
Schwächen. Beide brauchen einander, und das schweißt sie zusammen.<br />
Sie geht immer mehr dazu über, ihn wie einen Kranken zu behandeln,<br />
ahnend, dass Vorwürfe sein Verhalten nie ändern würden. Nicht die<br />
Dämonisierung, sondern die Akzeptanz des Spiels als Suchtkrankheit<br />
durch seine Frau hilft dem Dichter 1871, seine Zwanghaftigkeit schließ-<br />
lich hinter sich zu lassen.<br />
Die Abhängigkeit vom Roulette hat Dostojewskis Schaffenskraft<br />
keineswegs gelähmt. Zwischen 1863 und 1871 erschienen nicht nur die<br />
Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, Schuld und Sühne und Der Spieler,<br />
sondern auch Der Idiot. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Dostojewski bei<br />
Beobachtung seiner eigenen seelischen Verfassung während und<br />
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//20
2008//01<br />
nach den Ausflügen zum Roulette sogar die Anregungen fand, die er zur<br />
Ausgestaltung seiner verschiedenen psychisch extrem disponierten Ro-<br />
manhelden brauchte: Das Spiel als Anregung, Stimulanz, Schreibdroge.<br />
Der Spieler belegt einmal mehr, dass die rationale Darstellung einer<br />
Sucht einen keineswegs davor bewahrt, ihr auch fernerhin ausgeliefert<br />
zu sein. Das verbindet – bei allen Unterschieden der Romanstruktur<br />
– Dostojewskis Spieler mit Hans Falladas Der Trinker. Mit vollkommen<br />
klarem Kopf schreibt der alkoholkranke und morphiumabhängige Fal-<br />
lada diese Fallstudie einer Sucht in der Heilanstalt von Altstettin 1944<br />
in nur zwei Wochen nieder. Fallada zeigt den unaufhaltsamen gesell-<br />
schaftlichen Abstieg eines ehrbaren Kleinbürgers zum großen Säufer<br />
aus der Ich-Perspektive auf (Der Trinker wurde übrigens 1995 mit Harald<br />
Juhnke in der Hauptrolle verfilmt – die größte Rolle seines Lebens...). Drei<br />
Monate bleibt Fallada in der Heilanstalt, und nach seiner Entlassung ist<br />
er keineswegs trocken. Ganz im Gegenteil. Mehrfach wird er noch im<br />
Vollrausch in die Berliner Charité eingewiesen. Dennoch verfasst er exakt<br />
80 Jahre nach Dostojewskis Spieler und ebenfalls in nur 26 Tagen im<br />
Oktober 1946 einen seiner besten Romane: Jeder stirbt für sich allein, die<br />
Geschichte des kleinen vergeblichen Widerstands eines Ehepaares gegen<br />
die Nazidiktatur. Wenig später stirbt Fallada im Alter von nur 54 Jahren an<br />
den Folgen seiner Sucht.<br />
Die autobiografischen Anteile sind bei Dostojewskis Spieler und Fal-<br />
ladas Trinker zwar evident. Aber beiden ging es nicht um die nach außen<br />
getragene Bewältigung privater Lebenskrisen, sondern um die litera-<br />
rische Gestaltung zeitunabhängiger Phänomene vor dem Hintergrund<br />
eigenen Erlebens.<br />
»<br />
DR. ANDREAS GEBHARDT IST G<strong>ER</strong>MANIST UND<br />
PUBLIZIST UND LEBT IN KASSEL.<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//21
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//22
2008//01<br />
<strong>ER</strong>//<br />
<strong>SIE</strong>//<br />
<strong>ES</strong>//<br />
LI<strong>ES</strong>T//<br />
<strong>SPIEL</strong><br />
» LIT<strong>ER</strong>ATUR UND <strong>SPIEL</strong><br />
LIT<strong>ER</strong>ATUR EIN „<strong>SPIEL</strong>“ ZU NENNEN IST<br />
NICHTS UNGEWÖHNLICH<strong>ES</strong><br />
VON THOMAS ANZ<br />
» WID<strong>ER</strong>STAND D<strong>ES</strong> GEIST<strong>ES</strong> GEGEN DIE BARBARISCHEN MÄCHTE<br />
H<strong>ER</strong>MANN H<strong>ES</strong>S<strong>ES</strong> UTOPISCH<strong>ER</strong> ROMAN<br />
DAS GLASP<strong>ER</strong>LEN<strong>SPIEL</strong> ALS METAPH<strong>ER</strong><br />
VON CLAUDIA BULUT<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//23
<strong>SIE</strong> liest<br />
»<br />
LIT<strong>ER</strong>ATUR UND <strong>SPIEL</strong><br />
LIT<strong>ER</strong>ATUR EIN „<strong>SPIEL</strong>“<br />
ZU NENNEN IST NICHTS<br />
UNGEWÖHNLICH<strong>ES</strong><br />
SCHON BEGRIFFE WIE „SCHAU<strong>SPIEL</strong>“, „LUST-“ OD<strong>ER</strong> „TRAU<strong>ER</strong><strong>SPIEL</strong>“ LEGEN DI<strong>ES</strong><br />
NAHE. ZUM HANDW<strong>ER</strong>K D<strong>ES</strong> „SPILMANS“ GEHÖRTEN IM MITTELALT<strong>ER</strong> AUCH DIE<br />
V<strong>ER</strong>S- UND REIMKUNST SOWIE D<strong>ER</strong> MUSIKALISCHE VORTRAG. WAS JOHAN HUIZIN-<br />
GA IN SEINEM B<strong>ER</strong>ÜHMTEN BUCH „HOMO LUDENS“ ÜB<strong>ER</strong> DEN <strong>SPIEL</strong>CHARAKT<strong>ER</strong><br />
D<strong>ER</strong> DICHTKUNST IN ARCHAISCHEN KULTUREN AUSFÜHRT, HAT SICH NOCH HEUTE<br />
IN R<strong>ES</strong>TEN <strong>ER</strong>HALTEN: „JEDE ALTE DICHTKUNST IST GLEICHZEITIG UND IN EINEM:<br />
KULT, F<strong>ES</strong>TBELUSTIGUNG, G<strong>ES</strong>ELLSCHAFTS<strong>SPIEL</strong>, KUNSTF<strong>ER</strong>TIGKEIT, PROB<strong>ES</strong>TÜCK<br />
OD<strong>ER</strong> RÄTSELAUFGABE, WEISE BELEHRUNG, ÜB<strong>ER</strong>REDUNG, BEZAUB<strong>ER</strong>UNG, WAHR-<br />
SAGEN, PROPHETIE UND WETTKAMPF.“<br />
DEFINITIONEN<br />
Um die große Bedeutungsvielfalt des oft sehr ungenau verwendeten<br />
Spiel-Begriffs einzuschränken, hat Huizinga versucht, den Begriff zu<br />
definieren. Seine Definition bleibt gewiss unzulänglich, doch ermöglicht<br />
sie es, eine ganze Reihe von Bedeutungsaspekten zu überprüfen, unter<br />
denen Literatur ein „Spiel“ genannt werden kann: „Spiel ist“, so Huizin-<br />
ga, „eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewis-<br />
ser festgesetzter Grenzen von Raum und Zeit nach freiwillig angenom-<br />
menen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in<br />
MAGAZIN//<br />
sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//24
2008//01<br />
Freude und einem Bewußtsein des ‚Andersseins‘ als das ‘gewöhnliche<br />
Leben‘.“ Nach Roger Caillois, der diese Begriffsexplikation zu modifizie-<br />
ren versuchte, doch sich im Ergebnis von Huizinga nicht stark unter-<br />
scheidet, ist das Spiel eine Betätigung mit folgenden Merkmalen:<br />
1. freiwillig, 2. abgetrennt in festgelegten Grenzen von Raum und Zeit,<br />
3. ungewiss in Ablauf und Ergebnis, 4. unproduktiv, 5. geregelt, 6. fiktiv.<br />
Literatur entspricht solchen Bestimmungen immerhin zum Teil.<br />
Sie im Sinne dieser Definitionen als spielerische „Beschäftigung“,<br />
„Betätigung“ oder „Handlung“ zu begreifen hat zunächst den Vorzug,<br />
dass nicht nur literarische Texte, sondern auch die mit ihnen verbun-<br />
denen sozialen Aktivitäten in den Blick geraten, vor allem das Schreiben<br />
und das Lesen.<br />
Dass das Spiel eine „freiwillige Handlung oder Beschäftigung“ ist,<br />
kennzeichnet, übertragen auf Literatur, zwar nicht unbedingt die Tätig-<br />
keit professioneller Autoren, Berufsleser oder Schüler im Literatur-<br />
unterricht, doch die ,normale‘ Lektüre von literarischen Texten durch-<br />
aus. Diese bleibt den von der Arbeit abgegrenzten Freiräumen und<br />
-zeiten vorbehalten und führt in imaginäre Welten, deren Zeit und Raum<br />
von der realen Welt der Autoren oder Leser deutlich unterschieden sind.<br />
Das literarische Lesen unterliegt auch nicht den Zwecksetzungen und<br />
Produktivitätsverpflichtungen der Arbeit, ist abgehoben vom gewöhn-<br />
lichen Leben, und zumindest gesucht werden dabei Lust und Spannung.<br />
Zu den Spannungselementen gehört es, dass Ablauf und Ergebnis der<br />
Texte oder ihrer Handlungen partiell ungewiss bleiben. Dass Literatur<br />
zwar nicht immer, aber oft fiktional ist, wissen wir. Die Regeln, denen<br />
das Schreiben und Lesen folgt, sind zwar, zumal seit der Genieästhetik,<br />
nicht „unbedingt bindend“, aber Literatur ohne alle Regeln gibt es wohl<br />
nicht. Definitionen des Spiels, wie sie Huizinga oder Caillois gegeben<br />
haben, sind im Blick auf Literatur zumindest von begrenzter Tauglich-<br />
keit. Ihre Grenzen finden sie in der Mannigfaltigkeit spielerischer und<br />
literarischer Tätigkeiten.<br />
Ludwig Wittgenstein hat nachdrücklich vor Begriffsfestlegungen<br />
gewarnt, die vorschnell von der Vielfalt konkreter Spiele abstrahieren.<br />
Das Begehren nach einem eindeutigen Begriff des Spiels verfalle den<br />
Verführungen unserer Sprache. Allen Spielen gemeinsame Merkmale<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//25
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//26
2008//01<br />
gebe es nicht, allenfalls Ähnlichkeiten zwischen einzelnen Gruppen von<br />
Spielen. „Es ist, als erklärte jemand: ‚Spielen besteht darin, daß man<br />
Dinge, gewissen Regeln gemäß, auf einer Fläche verschiebt ...‘ – und wir<br />
ihm antworten: Du scheinst an die Brettspiele zu denken; aber das sind<br />
nicht alle Spiele. Du kannst deine Erklärung richtigstellen, indem du sie<br />
ausdrücklich auf diese Spiele einschränkst.“ Wittgenstein hat eine<br />
ebenso plausible wie praktikable Anweisung zur Begriffsexplikation<br />
gegeben. Sie lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Betrachte und<br />
vergleiche eine Vielzahl konkreter Spielpraktiken auf Gemeinsamkeiten<br />
und Differenzen hin! „Schau z.B. die Brettspiele an, mit ihren mannig-<br />
fachen Verwandtschaften. Nun geh zu den Kartenspielen über: hier<br />
findest du viele Entsprechungen mit jener ersten Klasse, aber viele ge-<br />
meinsame Züge verschwinden, andere treten auf. Wenn wir nun zu den<br />
Ballspielen übergehen, so bleibt manches Gemeinsame erhalten, aber<br />
vieles geht verloren. – Sind sie alle ‚unterhaltend‘? Vergleiche Schach mit<br />
dem Mühlfahren. Oder gibt es überall ein Gewinnen und Verlieren oder<br />
eine Konkurrenz der Spielenden? Denk an die Patiencen. In den Ball-<br />
spielen gibt es Gewinnen und Verlieren; aber wenn ein Kind den Ball an<br />
die Wand wirft und wieder auffängt, so ist dieser Zug verschwunden.<br />
Schau, welche Rolle Geschick und Glück spielen. Und wie verschieden<br />
ist Geschick im Schachspiel und Geschick im Tennisspiel.“<br />
V<strong>ER</strong>GLEICHE ZWISCHEN LIT<strong>ER</strong>ATUR<br />
UND AND<strong>ER</strong>EN <strong>SPIEL</strong>EN<br />
Wer Literatur und Spiel vergleichen will, dem geben Wittgensteins<br />
Ratschläge viele Anregungen. Ergiebig ist zum Beispiel der Vergleich<br />
literarischer Tätigkeit mit kindlichen Spielen im Sand. Schon Friedrich<br />
Nietzsche hatte das angedacht, als er im Blick auf den ständigen Wech-<br />
sel von „Bauen und Zerstören“ das kindliche Spiel mit dem des Künstlers<br />
gleichsetzte. Literatur ist dekonstruktiv: Sie zerstört bestehende Muster<br />
des Denkens, Sprechens und Erlebens, baut neue auf, die, sobald sie sich<br />
verfestigt haben, wiederum zerstört werden. Weiter führt auch der von<br />
Italo Calvino und vielen anderen vorgenommene Vergleich von Literatur<br />
und Schachspiel. Er kann die Aufmerksamkeit auf Art und Bedeutung<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//27
von Spielregeln lenken. Zu unterscheiden ist dabei zwischen „Spiel“ als<br />
System von Regeln (game) und Spiel als Tätigkeit (play) oder, in Anleh-<br />
nung an linguistische Begriffe, zwischen Kompetenz (Beherrschung der<br />
Spielregeln) und Performanz (Ausführung der Regeln). Zu reflektieren ist<br />
in diesem Zusammenhang auch eine Gretchen-Frage neuerer Literatur-<br />
theorien: „Wie hältst du‘s mit dem Subjekt?“. Schon Hans-Georg<br />
Gadamer hat sie bei seiner Verwendung des Spiel-Begriffs gestellt und<br />
mit seiner Antwort einiges von der poststrukturalistischen Rede über<br />
den „Tod des Autors“ vorweggenommen: „Das eigentliche Subjekt des<br />
Spieles [...] ist nicht der Spieler, sondern das Spiel selbst. Das Spiel ist es,<br />
was den Spieler im Bann hält, was ihn ins Spiel verstrickt, im Spiel hält.“<br />
Oder: „Das Subjekt des Spieles sind nicht die Spieler, sondern das Spiel<br />
kommt durch die Spielenden lediglich zur Darstellung.“ Andererseits,<br />
so ließe sich dagegen einwenden, unterwirft sich ein Autor literarischen<br />
Spielregeln, beispielsweise denen des Sonetts, freiwillig, und es bleiben<br />
ihm, wie dem Schachspieler, Freiräume, die vorgegebenen Regeln indivi-<br />
duell auszugestalten oder sogar, anders als beim Schachspiel, von ihnen<br />
abzuweichen.<br />
ARTEN D<strong>ES</strong> <strong>SPIEL</strong>S UND D<strong>ER</strong> LIT<strong>ER</strong>ATUR<br />
In der Spielforschung haben Spieltypologien einen ähnlichen Stellen-<br />
wert und stehen vor ähnlichen Problemen wie Gattungstypologien in<br />
der Literaturwissenschaft. Das Schachspiel etwa lässt sich als „Regel-<br />
spiel“ von ungeregelten oder „freien“ Spielen unterscheiden. Sind auch<br />
im Blick auf Literatur solche Unterscheidungen angebracht? Welche<br />
MAGAZIN//<br />
Art von literarischer Tätigkeit gleicht eher dem ungeregelten Sandkas-<br />
tenspiel des Kindes, welche dem geregelten Schach- oder Kartenspiel?<br />
Das Schachspiel kann, im Unterschied zum Sandkastenspiel, auch dem<br />
Typus des „Wettkampf“- oder „Gewinnspiels“ zugeordnet werden. Doch<br />
wer spielt im Fall von Literatur mit wem oder gegen wen? Ist der Leser<br />
ein Mitspieler des Autors? Oder hat er eher den Status eines Zuschauers<br />
oder Jurors, der den Wettstreit zwischen Autoren beobachtet? Gibt es in<br />
diesem Wettstreit wie beim Schach einen Gewinner? Oder gleicht der<br />
Autor eher einem Solisten oder Geschicklichkeitsspieler und der Leser<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//28
2008//01<br />
dem Zuschauer, der gespannt darauf wartet, ob das Kunststück gelingt?<br />
Die Reihe solcher literaturtheoretisch wichtigen Fragen, die durch<br />
Vergleiche oder Gleichsetzungen von Literatur und Spiel zu stellen<br />
angeregt werden, sei hier nur noch um einige wenige Fragen erweitert.<br />
Folgt man etwa Caillois‘ Unterscheidung von Wettkampfspielen, Glücks-<br />
spielen, Verkleidungs- bzw. Nachahmungsspielen und Rauschspielen,<br />
hat Literatur wohl am wenigsten mit Glücksspielen, dagegen einiges mit<br />
Wettkampfspielen (Literaturwettbewerbe) und viel mit Verkleidungs-<br />
und Rauschspielen gemeinsam. Aber gleicht die hermeneutische Suche<br />
danach, wie sich die Teile eines Textes in ein sinnvolles Ganzes fügen,<br />
oder die strukturalistische Analyse der Ähnlichkeits- und Kontrastbe-<br />
ziehungen zwischen Textelementen nicht eher einem Puzzlespiel? Oder<br />
die Entschlüsselung hermetisch verdunkelter Texte nicht eher einem<br />
Rätselspiel, das Autoren für ihre Leser inszeniert haben?<br />
WARUM <strong>SPIEL</strong>EN UND L<strong>ES</strong>EN WIR?<br />
Eine von anthropologischen und psychologischen Spieltheorien stän-<br />
dig gestellte Frage, die zweifellos auch für die Literaturtheorie von<br />
eminenter, allerdings selten ganz ernst genommener Bedeutung ist,<br />
lautet: Warum spielen wir? Die Antworten, die darauf gegeben wurden,<br />
haben mittlerweile ihre eigene Geschichte. Sie zeigt einmal mehr, wie<br />
eng Literaturtheorie und Spieltheorie miteinander verbunden sind. Sie<br />
unterliegen ganz ähnlichen Argumentationsmustern und Wandlungen.<br />
Vor pathologischer Lesesucht wurde gewarnt wie vor der Spielsucht.<br />
Umgekehrt wurden sowohl dem Spiel als auch dem literarischen Schrei-<br />
ben oder Lesen therapeutische Qualitäten und andere Nützlichkeiten<br />
zugeschrieben. Die Vorlieben für bestimmte Lesestoffe wie Spielarten<br />
wurden unter entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten unter-<br />
sucht. Spiel wie Literatur wurden pädagogisch „wertvollen“ Zwecken<br />
untergeordnet oder aber für autonom erklärt.<br />
Nützlichkeits- und Fortschrittskonzepte aus der Tradition der<br />
Aufklärung erklärten seit dem 19. Jahrhundert mit zum Teil evolutions-<br />
biologisch fundierten „Einübungs-Theorien“ das dem Spiel zugrunde-<br />
liegende „Explorationsbedürfnis“ zur treibenden Kraft zivilisatorischer<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//29
Entwicklung. Literatur und Spiel sind in dieser Perspektive Vorschule<br />
intellektuellen und emotionalen Verhaltens für den Ernst der Lebens-<br />
praxis, simulatives Probehandeln in Phantasie- und Schonräumen<br />
künstlich herabgesetzten Risikos (so bei Karl Groos, Jurij Lotman, D.E.<br />
Berlyne oder auch noch Dieter Wellershoff), fiktive Konkretisierungen<br />
imaginierter Möglichkeiten (so bei Wolfgang Iser).<br />
Dass Spiele nützlich sein können, ist jedoch selten eine dominante<br />
Motivation zum Spielen. Insofern das Spielen (wie das Lesen) eine frei-<br />
willige Tätigkeit ist, die im Gegensatz zur Arbeit nicht den Zwängen der<br />
Lebenserhaltung unterworfen ist und nicht in erster Linie an irgendwel-<br />
chen Nutzeffekten orientiert ist, hat man es auch mit dem Kennzeichen<br />
„autotelisch“ versehen, oder in der Definition von Huizinga: Es hat sein<br />
„Ziel in sich selber“. Übertragen auf Kunst und Literatur, entspricht dies<br />
den Positionen der „Autonomieästhetik“. Die Autonomie, die in ästhe-<br />
tischen Theorien für Kunst geltend gemacht wird, wird in Spieltheorien<br />
für jedes Spiel reklamiert. Spiel und Kunst sind, in der Terminologie<br />
jüngerer psychologischer Forschung, „intrinsisch“ motiviert. Man spielt<br />
primär um des Spielens willen, höchstens sekundär aus „extrinsischen“<br />
Motiven, die von außen durch irgendwelche Gratifikationsangebote oder<br />
Sanktionsandrohungen veranlasst sind. Die Gratifikation, die das Spielen<br />
selbst bietet, ist die mit ihm verbundene Lust.<br />
<strong>SPIEL</strong>, LIT<strong>ER</strong>ATUR UND LUST<br />
„Spiel gibt es nur“, so heißt es in der spieltheoretischen Schrift von Roger<br />
Caillois, „wenn die Spieler Lust haben, zu spielen, und sei es auch das<br />
anstrengendste und erschöpfendste Spiel [...]. Vor allem aber müssen die<br />
Menschen aufhören können, wann es ihnen gefällt, müssen sagen<br />
können: Ich spiele nicht mehr.“ Wer Literatur als eine Art Spiel begreift,<br />
kann die Zusammenhänge von Literatur und Lust kaum übersehen.<br />
Der amerikanische Psychologe Victor Nell wählte dafür den treffenden<br />
Begriff „ludic reading“. Die lexikalische Bedeutung des lateinischen<br />
MAGAZIN//<br />
Wortes „ludus“ ist sowohl „Spiel“ als auch „Spaß“. „Ludic reading“ erin-<br />
nert daher daran, dass die Wurzeln lustvollen Lesens im Spiel liegen. Und<br />
in der Tat gerät die Lust am Text besonders bei solchen Reflexionen über<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//30
2008//01<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//31
Literatur in den Blick, die ihren Spielcharakter hervorheben.<br />
Psychologische Spieltheorien haben zur Beantwortung der Frage<br />
nach den Arten und Gründen dieser Lust mehr beigetragen als Literatur-<br />
theorien. Ihre Auskünfte über die Lustquellen spielerischer Tätigkeit fal-<br />
len allerdings verschieden aus: Lust beim Spiel gehe einher mit Abreak-<br />
tionen überschüssiger Energien (Herbert Spencer), mit Erholung von der<br />
Erschöpfung einseitig überbeanspruchter Kräfte (Moritz Lazarus), mit<br />
der Befriedigung über das Funktionieren der herausgeforderten Fähig-<br />
keiten (das meinte Karl Bühlers Begriff der „Funktionslust“), mit dem<br />
Stolz über die Bewältigung von Schwierigkeiten (Dietrich Dörner) oder<br />
mit der Befreiung bzw. Ablenkung von diversen Sorgen des Alltags im<br />
tranceartigen Zustand narkotischer Entrücktheit (Mihaly Csikszentmi-<br />
halyi).<br />
URSPRUNG D<strong>ER</strong> LIT<strong>ER</strong>ATUR<br />
IM KINDLICHEN <strong>SPIEL</strong><br />
Ein seinerzeit keineswegs singuläres, sondern symptomatisches Bei-<br />
spiel für eine unter dem dominanten Aspekt der Lust stehende psycho-<br />
logische Theorie, die Literatur als ein Spiel konzipierte, ist Sigmund<br />
Freuds 1907 gehaltener Vortrag: „Der Dichter und das Phantasieren“.<br />
Angeregt auch von den damals resonanzreichen Schriften des Spielthe-<br />
oretikers Karl Groos, versucht der Vortrag, „eine erste Aufklärung über<br />
das Schaffen des Dichters zu gewinnen“, und glaubt sie im Vergleich der<br />
dichterischen Tätigkeit mit dem Spiel des Kindes zu finden: „Sollten wir<br />
die ersten Spuren dichterischer Betätigung nicht schon beim Kinde su-<br />
chen? Die liebste und intensivste Beschäftigung des Kindes ist das Spiel.<br />
Vielleicht dürfen wir sagen: Jedes spielende Kind benimmt sich wie ein<br />
Dichter, indem es sich eine eigene Welt erschafft oder, richtiger gesagt,<br />
die Dinge seiner Welt in eine neue, ihm gefällige Ordnung versetzt.“<br />
Und umgekehrt: „Der Dichter tut nun dasselbe wie das spielende Kind;<br />
er erschafft eine Phantasiewelt, die er sehr ernst nimmt, d.h. mit großen<br />
Affektbeträgen ausstattet, während er sie von der Wirklichkeit scharf<br />
sondert.“ Wie der Tagtraum sei die Dichtung „Fortsetzung und Ersatz<br />
des einstigen kindlichen Spielens“. Der Erwachsene mag nach Freud<br />
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//32
2008//01<br />
nicht auf den Lustgewinn verzichten, den er als Kind aus dem Spielen<br />
bezogen hat. Er phantasiert, auch literarisch. Und er erfüllt sich wie das<br />
Kind beim Spiel in seinen Phantasien jene Wünsche, deren Befriedigung<br />
ihm in der Wirklichkeit versagt bleibt.<br />
<strong>SPIEL</strong>MAT<strong>ER</strong>IAL<br />
Die Bemerkung Freuds, das Kind versetze die „Dinge seiner Welt in eine<br />
neue, ihm gefällige Ordnung“, ist vielleicht erläuterungsbedürftig.<br />
Das Kind macht Dinge, die es in seiner Umwelt vorfindet, zu seinem<br />
Spielmaterial, benutzt einen Hocker als Pferd, einen Topf als Hut, baut<br />
aus Büchern einen Turm oder füttert mit Gras ein Stück Holz, das als<br />
Hamster fungiert.<br />
Etliche Spieltypologien erklären häufig gebrauchte Gegenstände oder<br />
Materialien, mit denen jeweils gespielt wird, zum dominanten Kriterium<br />
ihrer Unterscheidungen. Wenn in manchen Spielen mit Bällen oder in<br />
anderen mit Karten gespielt wird, womit spielt dann Literatur? Die na-<br />
heliegende Antwort lautet: mit den Materialien der Sprache. Ähnlich wie<br />
Kinder diverse Alltagsgegenstände zu Spielzeugen umfunktionieren,<br />
können Autoren vorgefundenes Sprachmaterial aus seinem gewöhn-<br />
lichen Funktionszusammenhang herauslösen und es in eine andere<br />
Ordnung integrieren. Der Dichter spiele „mit Worten wie mit Bauklötz-<br />
chen“, hatte Alfred Liede 1963 in seiner umfangreichen Monographie<br />
Literatur als Spiel erklärt und sich dabei auch auf Freud berufen. Über das<br />
bloße Spiel mit Worten, Lauten oder Buchstaben, das Liede in seinen<br />
Untersuchungen zur „Unsinnspoesie“ im Blick hatte, geht Literatur<br />
jedoch weit hinaus. Da die Materialien der Sprache zu einem hochentwickelten<br />
Symbolsystem von Zeichen gehören, die alle möglichen Dinge<br />
und auch Vorstellungen repräsentieren können, steht der Literatur im<br />
Medium der Sprache die ganze Welt als Spielmaterial zur Verfügung.<br />
PROF. DR. THOMAS ANZ IST PROF<strong>ES</strong>SOR FÜR<br />
NEU<strong>ER</strong>E DEUTSCHE LIT<strong>ER</strong>ATUR AN D<strong>ER</strong> PHILIPPS-UNIV<strong>ER</strong>SITÄT MARBURG<br />
»<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//33
<strong>SIE</strong> liest<br />
Hermann Hesse war bereits 54 Jahre alt, als er 1931 mit seinem großen<br />
Alterswerk begann. Er arbeitete genau elf Jahre am Glasperlenspiel,<br />
bevor der Roman 1943 in Zürich erschien. Das Buch entstand in einer<br />
Zeit, als sich Nazi-Deutschland in die Hölle auf Erden verwandelte. Mit<br />
Besorgnis beobachtet Hesse aus seinem 1912 selbst gewählten schwei-<br />
MAGAZIN//<br />
» WID<strong>ER</strong>STAND D<strong>ES</strong><br />
GEIST<strong>ES</strong> GEGEN DIE<br />
BARBARISCHEN MÄCHTE<br />
H<strong>ER</strong>MANN H<strong>ES</strong>S<strong>ES</strong><br />
UTOPISCH<strong>ER</strong> ROMAN<br />
DAS GLASP<strong>ER</strong>LEN<strong>SPIEL</strong><br />
ALS METAPH<strong>ER</strong><br />
zerischen Exil diese Entwicklung. An eine Veröffentlichung des Romans<br />
war in Nazi-Deutschland nicht zu denken, denn mit dem Glasperlen-<br />
spiel schuf Hesse einen literarischen Kontrapunkt zur Gewaltherrschaft<br />
des Hitler-Regimes. Erst nach dem Krieg und nachdem Hesse 1946 den<br />
Literaturnobelpreis erhielt, konnte Das Glasperlenspiel endlich auch in<br />
Deutschland publiziert werden.<br />
Im Mittelpunkt des Glasperlenspiels steht der im Untertitel angedeu-<br />
tete Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht.<br />
In zwölf Kapiteln werden die wichtigsten Lebensstationen Knechts in<br />
chronologischer Reihenfolge ausgebreitet. Der Erzähler gibt sich als<br />
Historiker aus, der aus Briefen, Aufzeichnungen und Archivalien die Le-<br />
bensgeschichte des Glasperlenspielmeisters Josef Knecht rekonstruiert.<br />
Der in die Zukunft 2300 verlegte, utopische Roman weist in der Mo-<br />
tivik und Komposition Bezüge zu Hesses früheren Werken (Steppenwolf,<br />
Siddartha, Narziß und Goldmund ) auf. Themen sind die Entwicklung<br />
und Erziehung eines Jugendlichen und das Suchen nach Einheit in einer<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//34
2008//01<br />
wirtschaftlich, politisch und moralisch zerrissenen Gesellschaft.<br />
Auffällige Verbindungen sind auch zu Hesses märchenhafter Erzählung<br />
Morgenlandfahrt evident, die als Vorarbeit zum Glasperlenspiel gilt.<br />
Denn schon hier geht es um einen Orden, der sich dem Gemeinwesen<br />
verpflichtet hat. Hesse hat das Glasperlenspiel dem geheimen Bund der<br />
Morgenlandfahrer gewidmet, einem Zusammenschluss von Literaten,<br />
Künstlern, Musikern, Philosophen, Forschern und Wissenschaftlern,<br />
deren Ziel es ist, sich mit Geduld, selbstständigem Denken und mit<br />
der Kraft der Phantasie handelnd für die Gemeinschaft einsetzen. Die<br />
Morgenlandfahrer bleiben als Vereinigung von Edlen über Generationen,<br />
Nationalitäten, Konfessionen und Weltanschauungen hinweg mitei-<br />
nander verbunden; sie bereichern sich nicht und ignorieren künstlich<br />
aufgerichtete Schranken.<br />
Das Glasperlenspiel schildert Josef Knechts Leben in Kastalien,<br />
einer an das Konzept Goethes angelehnten weltlich-pädagogischen<br />
Gelehrtenprovinz. In Kastalien gibt es einen Orden, der aber keine<br />
Zugehörigkeit zu irgendwelchen Konfessionen aufweist. Hier sammeln<br />
sich Eliteschüler, um ihr Wissen zu vermehren. In der allumfassenden<br />
Zusammenführung von Kunst und Wissenschaft werden politische<br />
oder wirtschaftliche Geschäfte ausgeschlossen. Kastalien wird von<br />
einem übergeordneten Staat materiell abgesichert und unterstützt,<br />
jedoch wirken die Kastalier unabhängig von staatlicher Manipulation<br />
und politischer Zweckentfremdung, ohne nationale und konfessionelle<br />
Einschränkungen, in einer in sich versunkenen, fast „virtuellen“ Welt.<br />
Eine hierarchische Ordnung strukturiert den Orden, in welchen dem<br />
Magister Ludi die Leitung und Weiterentwicklung des Glasperlenspiels,<br />
dem Herzstück Kastaliens, zukommt. Die Entstehung der Provinz und<br />
des Glasperlenspiels gehen auf das von dem fiktiven Literaturhistoriker<br />
Plinius Ziegenhals bezeichnete „feuilletonistische Zeitalter“ zurück, eine<br />
Epoche, die laut Ziegenhals dadurch gekennzeichnet war, dass die Men-<br />
schen sich vom Weltgeschehen abwandten, um sich dem Spiel und dem<br />
Kreuzworträtsel als Zeitvertreib zuzuwenden. Sie spielten um des<br />
„Amusements“ willen, flohen in das Spiel, um ihre Angst vor dem Hun-<br />
ger und dem Tod zu vergessen: Eine bürgerliche Epoche, die letztlich das<br />
Individuum über die Gemeinschaft stellte. Ursprünglich beschränkte<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//35
sich das populärwissenschaftliche Glasperlenspiel darauf, vorhandenes<br />
Kulturgut zu zitieren. Zwar wurde das Spiel durch das Hinzunehmen<br />
verschiedener Künste und Wissenschaften erweitert. Doch lag es den<br />
Spielern fern, neue wissenschaftliche Errungenschaften vorzuweisen<br />
und das Weltgeschehen zu gestalten. Mit steigender Komplexität wurde<br />
das Spiel schließlich auch für Intellektuelle interessant. Es entwickelte<br />
sich zu einem interdisziplinären Wissenschaftsspiel, das die verschie-<br />
denen Disziplinen befruchtete und miteinander korrespondieren ließ.<br />
So entstand das Glasperlenspiel mit eigenen Regeln und einer hoch-<br />
entwickelten geheimen Spielsprache. Das Spiel fußt auf Formeln und<br />
Abkürzungen, in denen jedes Symbol und jede Kombination von Sym-<br />
bolen neue Impulse geben. Alles Wissen der Welt wird symmetrisch und<br />
synoptisch auf ein Zentrum hin ausgerichtet, zusammengefasst und<br />
geordnet. Auf diese Weise existieren die Wissenschaften nicht mehr<br />
nebeneinander, sondern greifen interdisziplinär ineinander. Während<br />
die Weltgeschichte in den Spielstudien ausgespart bleibt, bilden die<br />
Musikwissenschaft und die Mathematik die Hauptdisziplinen. Ziel ist<br />
die Synthese der Wissenschaften zu einer geistigen Vollkommenheit.<br />
Ein Elitegrüppchen gründet die pädagogische Provinz Kastalien, um das<br />
Glasperlenspiel zu seiner Perfektion zu führen.<br />
Einer der zwölf Magister Kastaliens entdeckt das musikalische Talent<br />
des zwölfjährigen Josef Knechts und beruft den Jungen nach Kastalien.<br />
Knecht öffnet sich dem Spiel, das „auf der Harmonie zwischen Himmel<br />
und Erde“ beruht. Musik setzt bei Knecht Energie und Kreativität frei,<br />
die nicht an praktische Ziele gebunden ist. Knecht erlebt seine Leiden-<br />
schaft für die Musik, die er verknüpft mit einer spielerischen Heiterkeit.<br />
Das musikalische Spiel erhält für ihn, ähnlich wie die interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit, das Potential, verfestigte Strukturen zu durchbrechen<br />
und Innovationen hervorzubringen.<br />
Für Knecht ist die Aufnahme in den Kreis der privilegierten Kasta-<br />
lier eine Herausforderung. Und: Der mittellose Jüngling erweist seinem<br />
Namen alle Ehre. Er passt sich ohne Mühe dem asketischen Internats-<br />
leben an und widmet sich intensiv seinen schulischen Aufgaben. Denn<br />
von Knecht und seinen männlichen Mitschülern wird verlangt, dass der<br />
Einzelne dem Ganzen dient, sich gänzlich unterordnet. Zu dienen ist die<br />
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//36
2008//01<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//37
Basis in der kastalischen Hierarchie.<br />
Knecht entdeckt Kastalien als einen Ort der Wissenschaft und Spiri-<br />
tualität, der esoterischen, intellektuellen und künstlerischen Ausübung.<br />
Er verinnerlicht das Symbol Kastaliens und macht es zu seinem Lebensinhalt:<br />
„...dem sinnvoll sinnlosen Rundlauf von Meister und Schüler, dem<br />
Werben der Weisheit um die Jugend, der Jugend um die Weisheit“.<br />
Das vollendete Wirken im kastalischen System funktioniert jedoch nur,<br />
wenn der Einzelne sich den Studien hingibt, die auf ihn zugeschnitten<br />
sind, nur dann kann er „... im Dienen frei sein“.<br />
Als Knecht auf Plinio Designori trifft, einen Hospitanten Kastaliens,<br />
wird er auf eine Gewissensprobe gestellt. Designori stammt aus einer<br />
Familie außerhalb Kastaliens, die sich um die Provinz verdient gemacht<br />
hat. Im Gegensatz zu Knecht vertritt Designori ideologisch die Welt<br />
„draußen“. Sie liefern sich öffentliche Rededuelle. Es ist ein dialektisches<br />
Spiel zwischen zwei Geistern, in dem Knecht das Ideal der Wissenschaftlichkeit<br />
mit Bravour verteidigt. Innerlich kommt Knechts Gleichgewicht<br />
jedoch ins Wanken. Seinen Zweifeln versucht er durch Meditation und<br />
Konzentration auf das Glasperlenspiel zu begegnen.<br />
Alsbald wird Josef Knecht verpflichtet, den Benediktinern das Spiel zu<br />
lehren. Er trifft auf Pater Jacobus, einen bedeutenden Gelehrten. Während<br />
ihrer intensiven Gespräche wird ihm allmählich deutlich, wie sich Kastalien<br />
gegenüber den anderen Teilen der Welt abschottet.<br />
Er begreift, dass sein Tun und Handeln Auswirkungen auf das Weltgeschehen<br />
haben. Doch Knecht ist ein Musterschüler, der sich trotz aller Zweifel<br />
in Demut und Ergebenheit übt. Sein Aufstieg innerhalb der kastalischen<br />
Ordenselite ist deshalb vorbestimmt. Mit knapp 40 Jahren wird Knecht<br />
selbst zum Magister Ludi gewählt. Er bekleidet jetzt das höchste Amt, das<br />
ein Glasperlenspieler innehaben kann. Unter seiner Führung wird das<br />
einmal im Jahr stattfindende öffentliche Glasperlenspiel ausgerichtet.<br />
Obschon Knecht die Gabe hat, Menschen um sich zu versammeln,<br />
hat er kein Interesse an Machtausübung. Er weiß, dass Macht, ähnlich wie<br />
das Spiel, die Menschen süchtig machen kann. Außerdem ist ihm klar,<br />
dass die Begabung des Lehrers und die Berufung zum Meister auch eine<br />
große Verantwortung mit sich bringt. „Beruft dich die hohe Behörde in<br />
ein Amt, so wisse: Jede Stufe der Ämter ist nicht ein Schritt in die Freiheit,<br />
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//38
2008//01<br />
sondern in die Bindung. Je höher das Amt, desto tiefer die Bindung. Je<br />
größer die Amtsgewalt desto strenger der Dienst. Je stärker die Persön-<br />
lichkeit, desto verpönter die Willkür“.<br />
Knechts Lebensweg gestaltet sich als ein Durchschreiten von Räu-<br />
men. Räume, die auf dem Spielbrett des Lebens angeordnet sind, in<br />
denen das Durchleben und Fortschreiten Entwicklung bedeutet, Zug um<br />
Zug, immer Erfahrungen sammelnd, aber auch gespannt auf das Neue<br />
seiend. „Die Tendenz zum Bewahren, zur Treue, zum selbstlosen Dienst<br />
an der Hierarchie, und andererseits die Tendenz zum Erwachen, zum<br />
Vordringen, zum Begreifen der Wirklichkeit“ charakterisieren Knechts<br />
Lebensimpuls.<br />
Doch der kastalische Raum erweckt in Knecht zunehmend das Ge-<br />
fühl des Welkens, ein Stillstand, der in ihm den Wunsch auf neue Ufer<br />
reifen lässt. Das Bewusstsein, dass die Kastalier „eine Spezialität, ein<br />
aparter Züchtungsversuch“ sind, „eine künstlich hervorgebrachte Elite,<br />
ohne Salz, ohne Laster und Leidenschaft, ohne Frauen und Kinder“, wird<br />
immer stärker. Er erkennt, dass sie ihre wissenschaftliche Arbeit als<br />
Selbstzweck benutzen, um den Kampf des Lebens auszublenden. Knecht<br />
glaubt, dass die Welt Männer brauche, die „der Jugend die Fähigkeit des<br />
Messens und Urteilens beibringen und ihre Vorbilder sind, in der<br />
Ehrfurcht vor der Wahrheit, im Gehorsam gegen den Geist, im Dienst am<br />
Wort“. Er will mit gutem Beispiel vorangehen, will seinen Dienst der Welt<br />
opfern, will nicht länger in der Rolle eines Ersatzspielers verharren.<br />
Er möchte prägend wirken und das nicht nur als Kastalier, sondern als<br />
ein Mensch, den die ganze Welt etwas angeht und als solcher ein An-<br />
spruch auf ein Leben mit und in ihr hat.<br />
Knecht hat auf allen Ebenen versucht, die ihn bewegenden Gegensät-<br />
ze auszutarieren: Kastalien – Welt; Geistigkeit – Weltlichkeit; verschlos-<br />
sen – aufgeschlossen; das Innere – das Äußere; Dienst am Gemeinwesen<br />
– Dienst als Selbstzweck. Zu lange hat der Magister die ureigensten<br />
weltlichen Bedürfnisse nach Liebe, Lust und Trieben mit Meditation und<br />
anderen Spielarten (I Ging etc.) bezwingen müssen. Doch nun ist sein<br />
Aufbegehren ein Zusammenführen „zwischen Leib und Seele, zwischen<br />
Ideal und Wirklichkeit, ein Vermittler zwischen den Welten, ...ein Dol-<br />
metscher und Versöhner“.<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//39
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//40
2008//01<br />
Im Pendeln zwischen den gegensätzlichen Polen liegt für Knecht das<br />
Weltgeheimnis, das ewig Heilige. Es ist die Auseinandersetzung zwi-<br />
schen Leben und Tod, Macht und Geist, zwischen dem „Hin und Wider<br />
im Ein- und Ausatmen, dem Himmel und der Erde, dem Ying und Yang“.<br />
Hesses Held Knecht wird von seinem Autor zu einer Legende stilisiert,<br />
weil Knecht nach Vollkommenheit strebt.<br />
Dass das Leben kein Spiel ist und einige Hürden, Entbehrungen und<br />
Geduldsproben überwunden werden müssen, hat Knecht auf seinem<br />
Weg erfahren müssen. Doch Knecht hat jede Entwicklungsstufe seines<br />
Seins wie eine Glasperle gehütet. Und je nachdem, ob er Glück hatte oder<br />
sich ein Gönner für ihn einsetzte, wurde er mehr oder minder wie in<br />
einem Spiel durch das Leben gewürfelt. Er hat das passive Spiel mitge-<br />
spielt, sich dessen Regeln unterworfen und sich als Spielball benutzen<br />
lassen. Mit seinem Austritt möchte er das erste Mal selbst am „Spiel der<br />
Welten“ teilnehmen.<br />
Der Orden und das Glasperlenspiel waren für Knecht zwar wertvoll,<br />
doch da er sich über die Vergänglichkeit seines Bemühens im Klaren<br />
wird, muss er seinen Aufgaben entsagen. Und so richtet Knecht sein Ent-<br />
lassungsgesuch an die oberste Behörde Kastaliens. Er verbindet sie mit<br />
einer vorausschauenden Mahnung. Denn Knecht sieht Kastalien dem<br />
Untergang geweiht, weil es sich ausruht auf dem Sponsorentum seiner<br />
Gönner. Er fürchtet, jederzeit könnten weltliche Geschehen die Provinz<br />
zum Einsturz bringen.<br />
Da sein Gesuch abgelehnt wird, legt Knecht, ohne die Statuten des<br />
Ordens zu verletzen, sein Amt aus Gewissensgründen nieder. Kastali-<br />
ens „Abtrünniger“ nimmt nunmehr erstmals sein Leben in die eigenen<br />
Hände, entsagt dem Spiel, vertraut nicht mehr auf Schicksal und Chan-<br />
ce, sondern sucht seine Bestimmung in der Erziehung und Lehre von<br />
Kindern der Welt. Knechts Schritt ist weder von Untreue oder Willkür<br />
gekennzeichnet, noch ist es ein Rückfall in die Individualität, vielmehr<br />
ist es der Versuch, inmitten der Weltlichkeit ein Leben in kastalischem<br />
Sinne zu wagen. Knecht sucht die Synthese zwischen der Vergeistigung<br />
und dem Dienst am Menschen. Er widmet sich dieser Aufgabe mit In-<br />
brunst, geht aber – im Wortsinne – in ihr unter: Am Ende ertrinkt Knecht<br />
in einem See.<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//41
Hesse hat das Glasperlenspiel mit einer an die Musik angelehnten<br />
Tiefe und Komplexität komponiert. Durch die Form der Utopie schafft er<br />
eine kalkulierte kritische Distanz zur damaligen geschichtlichen Gegen-<br />
wart. Gleichzeitig aber – und das ist kein Widerspruch – entwirft er ein<br />
zwar in der Zukunft angesiedeltes, aber gleichermaßen rückwärtswei-<br />
sendes wie gegenwartsbezogenes und nicht zuletzt zukunftsweisendes<br />
Werk.<br />
Es hat über Grenzen und Generationen hinaus gewirkt. Für Hesse war<br />
es das letzte Hineinstürzen in eine idealisierte Welt, ein „letzter Wider-<br />
stand des Geistes gegen die barbarischen Mächte“. Letztlich ist Hesses<br />
Glasperlenspiel der literarische und geistige Höhepunkt seines Schaf-<br />
fens. Denn es umfasst sein bereits in den vorausgegangenen Werken<br />
zusammengetragenes Gedankengut und manifestiert Hesses eigenes<br />
Lebensideal. „Das Glasperlenspiel vereinigt drei Prinzipien: Die Wis-<br />
senschaft, die Verehrung des Schönen und die Meditation, und so sollte<br />
ein rechter Glasperlenspieler von Heiterkeit durchtränkt sein wie eine<br />
reife Frucht von ihrem süßen Saft, er sollte vor allem die Heiterkeit der<br />
Musik in sich haben, die ja nichts anderes ist als ein heiteres lächelndes<br />
Schreiten und Tanzen mitten durch die Schrecken und Flammen der<br />
Welt, festliches Darbringen des Opfers“.<br />
CLAUDIA BULUT IST G<strong>ER</strong>MANISTIN<br />
UND LEBT IN KÖLN<br />
»<br />
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//42
2008//01<br />
<strong>ER</strong>//<br />
<strong>SIE</strong>//<br />
<strong>ES</strong>//<br />
LI<strong>ES</strong>T//<br />
<strong>SPIEL</strong><br />
» <strong>SPIEL</strong>IDEEN AUF D<strong>ER</strong> STRASSE<br />
MATTHIAS HUNSTIG UND THOMAS HENZE<br />
ENTWICKELN G<strong>ES</strong>ELLSCHAFTS<strong>SPIEL</strong>E<br />
VON IRENE GRAEFE<br />
» <strong>SPIEL</strong>END DENKEN – IM MATHEMATIKUM IST’S MÖGLICH<br />
EIN INT<strong>ER</strong>VIEW<br />
VON LUZIA UND MARIAM<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//43
<strong>ES</strong> liest<br />
»<br />
<strong>SPIEL</strong>IDEEN AUF D<strong>ER</strong> STRASSE<br />
MATTHIAS HUNSTIG UND<br />
THOMAS HENZE ENTWICKELN<br />
G<strong>ES</strong>ELLSCHAFTS<strong>SPIEL</strong>E<br />
Wie sieht einer aus, der Spiele erfindet? Ein bunt angezogener, verrück-<br />
ter Typ, dem ständig etwas einfällt oder eher eine „graue Maus“, still,<br />
zurückgezogen, immer auf der Suche?<br />
Antwort: Ganz normal. Im Haus der Spiele in Paderborn sitzen<br />
Matthias Hunstig und Thomas Henze an einem einfachen Holztisch mit<br />
Hockern. Matthias in der blauen Sweat-Shirt-Jacke ist 22 Jahre alt und<br />
studiert Maschinenbau. Thomas im grauen Fleece-Pulli ist 39 Jahre alt<br />
und wird bald zum dritten Mal Papa. Neben seiner Arbeit als Familien-<br />
vater verkauft er im Keller seines Wohnhauses Spiele.<br />
Thomas ist sozusagen die rechte Hand von Matthias. Dem fallen<br />
nämlich an den gewöhnlichsten Orten – auf der Straße, im Auto, beim<br />
Fußballspielen – Ideen für neue Spiele ein. Thomas weiß blitzschnell, ob<br />
es so etwas schon gibt oder ob es wirklich neu ist. Der Mann besitzt 4000<br />
Gesellschaftsspiele. Der muss es wissen!<br />
Außerdem hilft er Matthias, Modelle für die Spiele zu bauen. Dann<br />
sieht es im Spielekeller aus wie im Bastelkreis: Schere, Pappe, Buntstifte<br />
und Kleber liegen auf dem Tisch.<br />
Das war zum Beispiel so, als Matthias den Einfall vom Turm des<br />
MAGAZIN//<br />
Glücks hatte. Eine alte Papprolle wurde zum Turm. Aus der Pappe einer<br />
Cornflakes-Schachtel schnitten die beiden die Teile, die durch den Turm<br />
rutschen sollen. Oder für Matthias‘ Kartenlegespiel Alles, was...: Da war<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//44
2008//01<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//45
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//46
2008//01<br />
es noch einfacher. Auf Papier wurden Rucksack, Igel, Mühle, Kleeblatt,<br />
Brezel oder Elch und andere Motive aufgedruckt und dann daraus Karten<br />
gemacht.<br />
Matthias’ Einfälle kommen nicht auf Knopfdruck: „Ich kann mich<br />
nicht hinsetzen und mir vornehmen, ich erfinde jetzt etwas.“ Hinsetzen<br />
nützt erst etwas, wenn er die Idee schon hatte. Meistens hat er erst mal<br />
ein Spielprinzip, also das, was die Spieler tun sollen, im Kopf. Bei Al-<br />
les, was... sollen sie Kategorien bilden. Das klingt erst mal ganz schön<br />
schwierig. Ist es aber nicht, denn der Mensch bildet ständig Kategorien.<br />
So verschafft sich das Gehirn einen Überblick über die vielen Dinge, die<br />
wir wahrnehmen. Wenn wir unser Zimmer aufräumen, werden ähnliche<br />
Dinge zusammengepackt: die Socken in die Sockenschublade, die Stifte<br />
in die Stiftebox, die Schuhe in den Schuhschrank.<br />
Schublade, Stifte und Schrank sind in diesem Fall die Kategorien, in<br />
die etwas eingeordnet wird. In der Schule gehört Sortieren ganz oft dazu:<br />
In Deutsch ordnen wir Wörter in Gruppen wie Haupt- und Tuwörter. In<br />
Mathematik machen wir einen Unterschied zwischen Zehnern, Hunder-<br />
tern oder Tausendern. Beim Spiel Alles, was... kann man sich ausden-<br />
ken, in welche „Schubladen“ die abgebildeten Gegenstände einsortiert<br />
werden können. „Alles, was lebt“ wäre zum Beispiel ein Ordnungsprin-<br />
zip: Da gehören Igel und Elch hinein oder „Alles, was man zum Wandern<br />
mitnimmt“: Da gehören Rucksack und eine Brezel dazu.<br />
Nachdem das Prinzip „Kategorien bilden“ klar war, ging es darum,<br />
was für ein Spiel Alles, was... werden sollte: Ein Brettspiel, ein Karten-<br />
spiel, ein Würfelspiel? Matthias Hunstig entschied sich für ein Karten-<br />
spiel mit 98 Karten, auf denen verschiedene Gegenstände abgebildet<br />
sind.<br />
„Es hätte genauso gut ein Spiel mit Fische fangen oder Raumschiffe<br />
jagen dabei herauskommen können“, beschreibt Thomas. Das ist die<br />
Freiheit der Gedanken eines Spielerfinders, solange nachzudenken und<br />
im Kopf herumzuprobieren, bis er für sein Spiel ein Thema gefunden hat.<br />
Ein paar Regeln gibt es aber doch für ein gutes Spiel: Die Handlung muss<br />
unterhaltend sein. Das Spiel darf nicht zu lange dauern. Schnell kann<br />
schnell ein halbes Jahr und mehr vergehen, bis all das fertig ausgedacht<br />
ist.<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//47
Wenn die Entscheidung gefallen ist, wie das Spiel funktionieren soll,<br />
sind Thomas’ und Matthias’ Freunde dran: Sie probieren aus, ob aus der<br />
Idee wirklich ein spannendes Spiel wurde. „Wir brauchen die sachliche<br />
Kritik von Leuten, die viel spielen“, sagt Thomas. Nur diese entdecken<br />
mit ihrer Erfahrung die Schwachstellen und sind so ehrlich, auch darü-<br />
ber zu sprechen.<br />
MAGAZIN//<br />
Meist werden in dieser Testphase die Spielregeln noch einmal verfei-<br />
nert. Oft entscheidet sich erst jetzt endgültig, für wen das Spiel geeignet<br />
ist, für welches Alter es passt. Natürlich hängt es auch vom jeweiligen<br />
Typ ab, der das Spiel ausprobiert, ob er es gern spielt. Die beiden Spielerfinder<br />
erinnern sich noch an einen Freund, der den Turm des Glücks<br />
total schrecklich fand. Er ist mehr so der Mensch, der mit viel Taktik<br />
rangeht. Für ihn ist ein Glücksspiel einfach nichts. Doch bei den meisten<br />
anderen Testern kam es gut an.<br />
Lob und Kritik der Testspieler sind längst noch nicht alles. Schließlich<br />
wollen Thomas und Matthias, dass ihre Spiele eines Tages wie<br />
Monopoly oder Siedler von Catan im Geschäft verkauft werden. „Dazu<br />
brauchen wir eine Visitenkarte“, erklärt Thomas. Und das ist die Spielanleitung.<br />
Diese so leicht verständlich zu schreiben, dass die Regeln sofort<br />
klar sind, ist noch mal richtig Arbeit.<br />
Bisher hatten Matthias und Thomas zwar das Glück, dass einige<br />
Verlage sich die Anleitung und den Turm des Glücks schicken ließen.<br />
Doch herausbringen wollte es noch niemand. „Wir werden uns noch mal<br />
ransetzen, noch mal unterschiedliche Varianten ausprobieren“, berichtet<br />
Thomas. Er gesteht: „Ich bin ganz ehrlich, das Tüpfelchen auf dem i<br />
fehlt noch.“<br />
Aber macht nichts, die beiden haben weiterhin ihren Spaß beim<br />
Spielausdenken. Und wenn Matthias noch mal so richtig lostüftelt, dann<br />
muss es doch was werden mit dem Turm und dem Glück, oder? Er selbst<br />
macht gar nicht viel Gerede darum: „Das ist wie Aufsatz schreiben: Grobe<br />
Idee, Notizen machen, weiterdenken, verbessern ... und irgendwann<br />
hat man‘s.“<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//48
2008//01<br />
W<strong>ER</strong> MEHR ÜB<strong>ER</strong> MATTHIAS HUNSTIG UND SEINEN FREUND THOMAS<br />
HENZE WISSEN MÖCHTE, B<strong>ES</strong>UCHT DIE BEIDEN IM INT<strong>ER</strong>NET UNT<strong>ER</strong><br />
WWW.SCHLOSS-<strong>SPIEL</strong>E.DE<br />
Von Irene Graefe<br />
»<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//49
<strong>ES</strong> liest<br />
„W<strong>ER</strong> WILL, KANN EINFACH <strong>SPIEL</strong>EN, MATHEMATIK SINNLICH <strong>ER</strong>LEBEN (...) UNS<strong>ER</strong><br />
ANSPRUCH IST NICHT, DEN GÄSTEN EIN ABFRAGBAR<strong>ES</strong> WISSEN MITZUGEBEN. <strong>SIE</strong><br />
KÖNNEN SICH AM MATHE-KNOBELTISCH ÜBEN OD<strong>ER</strong> IN DIE BEGEHBARE RI<strong>ES</strong>EN-<br />
SEIFENBLASE SCHLÜPFEN, OHNE DASS WIR DIE DAZUGEHÖRIGEN FORMELN <strong>ER</strong>-<br />
KLÄREN. (...) DURCH DAS <strong>SPIEL</strong>EN MIT DEN EXPONATEN BEWEGT SICH UNGLAUB-<br />
LICH VIEL IM KOPF. DIE LEUTE L<strong>ER</strong>NEN BEI<strong>SPIEL</strong>SWEISE, WIE DIE VON LEONARDO DA<br />
VINCI KONZIPI<strong>ER</strong>TE SELBSTTRAGENDE BRÜCKE FUNKTIONI<strong>ER</strong>T. WAS IM MATHEMA-<br />
TIKUM <strong>ER</strong>LEBT WIRD, BLEIBT VIEL LÄNG<strong>ER</strong> IM KOPF ALS D<strong>ER</strong> G<strong>ES</strong>AMTE MATHEMA-<br />
TIKUNT<strong>ER</strong>RICHT IN D<strong>ER</strong> SCHULE“, SAGT PROF. ALBRECHT BEUTELSPACH<strong>ER</strong> IN EINEM<br />
INT<strong>ER</strong>VIEW MIT D<strong>ER</strong> FRANKFURT<strong>ER</strong> RUNDSCHAU.<br />
Das Mathematikum in Gießen ist das erste mathematische Mitmach-<br />
Museum der Welt und er hat es gegründet. Über 100 Exponate öffnen eine<br />
neue Tür zur Mathematik. Besucher jeden Alters und jeder Vorbildung<br />
experimentieren: Sie legen Puzzles, bauen Brücken, zerbrechen sich den<br />
Kopf bei Knobelspielen, entdecken an sich selbst den goldenen Schnitt,<br />
schauen einem Kugelwettrennen zu und vieles mehr. Diese Denk-Spiele<br />
sind neben vielen anderen im Mathematikum zu finden:<br />
DIE LEONARDO-BRÜCKE<br />
MAGAZIN//<br />
» <strong>SPIEL</strong>END DENKEN –<br />
IM MATHEMATIKUM<br />
IST’S MÖGLICH<br />
EIN INT<strong>ER</strong>VIEW<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//50
2008//01<br />
Eine geniale Konstruktion. Aus einfachen Latten, längeren und kürze-<br />
ren, kann man eine Brücke bauen, die hält. Ohne Leim, ohne Nagel oder<br />
Schraube, ohne Schnur. Sie hält einfach so. Wer die transportable Brücke<br />
nachbaut, hantiert plötzlich mit Winkeln. Der geniale Erfinder dieser<br />
Brückenkonstruktion ist kein Geringerer als Leonardo da Vinci.<br />
DIE RI<strong>ES</strong>ENSEIFENHAUT<br />
Man stellt sich in die Mitte einer ringförmigen Wanne, zieht an einem<br />
Seil...<br />
...und wenn man das mit dem richtigen Gefühl, der richtigen<br />
Mischung aus Behutsamkeit und Schwung macht, dann zieht sich um<br />
einen herum eine Seifenhaut hoch – und man steht für einen Augenblick<br />
in einer in allen Farben funkelnden Fläche.<br />
D<strong>ER</strong> SEIFENHAUTTISCH<br />
Die Besucher können gar nicht genug von diesem Experiment bekom-<br />
men. Immer wieder tauchen sie die Metallgestelle (Würfel oder Tetrae-<br />
der) in die Seifenlauge, ziehen sie vorsichtig heraus – und sind begeistert<br />
von den Formen und Farben, die sie sehen.<br />
LUZIA UND MARIAM, 11 JAHRE ALT, HABEN DAS MATHEMATIKUM<br />
B<strong>ES</strong>UCHT UND PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong> INT<strong>ER</strong>VIEWT<br />
Zwei, die gerne spielend denken<br />
LUZIA UND MARIAM<br />
Von den Spielen und Experimenten im Gießener Mitmach-Museum<br />
Mathematikum sind Luzia und Mariam begeistert: Nur Multiplizieren<br />
und Dividieren finden die beiden Mädchen langweilig. Aber im<br />
Mathematikum können sie alles anfassen, ausprobieren, müssen nichts<br />
ausrechnen.<br />
Das Spielen soll das Denken anregen, hat ihnen Prof. Albrecht Beu-<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//51
telspacher, Leiter des Mathematikums, gesagt. Und die beiden Elfjährigen<br />
machen sich oft ihre eigenen Gedanken. Zum Beispiel denken sie sich<br />
aus, wie sie eine Modelllandschaft bauen können. Oder welche Bastel-<br />
ideen und Rätsel zu ihrem Interview mit Prof. Beutelspacher passen.<br />
Mathematik ist nicht gerade das Lieblingsfach von Luzia und Mariam.<br />
Die beiden gehen in Kassel in die 5. Klasse des Friedrichsgymnasiums<br />
und lieben Sport. Mariam mag Deutsch und liest gerne. Luzia findet Kunst<br />
gut, „weil ich da meine ganzen Ideen aufmalen kann“. Ganz vielleicht<br />
möchte sie Journalistin beim Radio werden oder aber Tierärztin,<br />
„denn Tiere werden manchmal schlechter behandelt als Menschen“.<br />
Mariam überlegt, ob Kinder-Psychologin etwas für sie wäre: „Ich könnte<br />
Kindern in schwierigen Situationen helfen.“<br />
Die beiden Freundinnen spielen gerne Carcassone und Alhambra<br />
(Mariam) oder Monopoly (Luzia). Wenn sie sich selbst etwas ausdenken,<br />
gehen sie nach draußen und bauen Höhlen oder bleiben drinnen und<br />
basteln.<br />
MIT MATHE GEGEN DAS CHAOS<br />
MATHEMATIK-PROF<strong>ES</strong>SOR ALBRECHT BEUTELSPACH<strong>ER</strong><br />
IST KEIN <strong>SPIEL</strong><strong>ER</strong>-TYP UND RECHNET LIEB<strong>ER</strong>.<br />
In Mathe hatte er in der Schule meistens eine Zwei. Wenn er mal eine<br />
Drei mit nach Hause brachte, „schimpfte mein Vater, weil er wusste, dass<br />
ich das eigentlich kann“, gesteht Prof. Albrecht Beutelspacher. Inzwischen<br />
ist er 53 Jahre alt und ein sehr bekannter Mathematiker. Er hat im Novem-<br />
ber 2002 in Gießen das erste deutsche Mitmach-Museum für Mathematik,<br />
das Mathematikum, gegründet.<br />
Auf 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind ungefähr 100<br />
Spiele und Experimente ausgestellt. Prof. Beutelspacher möchte zeigen,<br />
dass Mathematik Spaß machen kann. Er selbst hat sich immer gern mit<br />
Zahlen, Gleichungen und geometrischen Körpern beschäftigt. Deswe-<br />
gen war es für ihn auch logisch, dass er nach dem Abitur Mathematik<br />
studierte. „Ich finde Mathe so interessant, weil es die Gedanken so klar<br />
macht. Erst scheint es einem, da ist totales Chaos. Und wenn man‘s<br />
richtig anpackt, löst sich alles gut auf“, erzählt er.<br />
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//52
2008//01<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//53
Inzwischen ist er an der Universität in Gießen Mathematik-Professor.<br />
„Ich bringe Studenten – also den 20- bis 25-Jährigen – Mathematik bei“,<br />
erklärt er. In seinen Vorlesungen und Seminaren unterrichtet er sowohl<br />
reine Mathematik (Algebra, Geometrie) als auch angewandte Mathe-<br />
matik. Da kann er aus seiner Zeit in der Industrie berichten. Drei Jahre<br />
lang hat er bei Siemens in München Sicherheitssysteme für Telefon- und<br />
Kreditkarten mit entwickelt.<br />
Trotzdem programmiert er nur selten Computer. Er benutzt seinen<br />
PC zum Schreiben und fürs Internet. „Wenn ich einen Drucker einrichten<br />
soll, dann brauche ich schon jemanden dazu“, gesteht er.<br />
Und wie ist das beim Herrn Professor mit dem Spielen? Er lacht: „Ich<br />
spiele nicht gern, weil ich nicht gerne verliere.“<br />
„MIT SEIFENBLASEN KANN MAN B<strong>ER</strong>ÜHMT W<strong>ER</strong>DEN“<br />
WARUM HINT<strong>ER</strong> <strong>SPIEL</strong>EN MIT SEIFENHÄUTEN<br />
DIE SCHWI<strong>ER</strong>IGSTE MATHEMATIK STECKT<br />
MARIAM: Herr Professor Beutelspacher, warum haben Sie das<br />
Mathematikum erfunden?<br />
PROF. ALBRECHT BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Ich bin nicht eines Tages aufgewacht und<br />
habe gedacht: Ich erfinde das Mathematikum . Das hat sich mit der Zeit<br />
entwickelt. Angefangen hat es bei meiner Arbeit mit Studenten, die ein-<br />
fach Modelle bauen und ein bisschen Mathematik dazu erklären sollten.<br />
Dann haben wir das ausgestellt. Und das war so erfolgreich, dass wir<br />
noch bessere Experimente gebaut haben für eine Wanderausstellung.<br />
Die war dann so erfolgreich, dass ich irgendwann gedacht habe, das<br />
könnte auch ein Mathematik-Museum werden.<br />
LUZIA: Wer soll denn ins Mathematikum kommen?<br />
PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Ursprünglich haben wir gedacht, das ist für junge<br />
Leute, so zwischen 10 und 25 Jahren vielleicht. Es stellte sich aber heraus,<br />
dass es für alle ist. Dass sowohl noch Jüngere kommen, also Grundschü-<br />
ler, als auch Ältere. Manchmal kommen sogar Seniorengruppen. Es ist<br />
wirklich für jeden.<br />
Mariam: Wie viele Besucher hatte das Mathematikum bis jetzt?<br />
Ist es gut besucht?<br />
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//54
2008//01<br />
PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Das ist unglaublich gut besucht. Seit der Eröff-<br />
nung des Museums im November 2002 sind es über 180 000 Besucher<br />
gewesen. Das heißt 130 000 im ersten Jahr. Ich hatte vorher höchstens<br />
die Hälfte geschätzt.<br />
LUZIA: Wie kamen Sie auf die Kombination von<br />
Mathematik mit den Spielen?<br />
PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Die Spiele sind ein Einstieg in die Mathematik.<br />
Bei der Mathematik geht es um genaues Denken mit Fantasie und Logik.<br />
Und die Spiele regen das Denken an.<br />
LUZIA: Dann macht’s ja auch mehr Spaß.<br />
PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Genau.<br />
MARIAM: Wie sind Sie auf die eigentlichen Spielideen gekommen?<br />
PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Das ist schwierig und dauert manchmal lange.<br />
Jedes einzelne Spiel hat seine Lebensgeschichte. Da war irgendwann mal<br />
‘ne Idee, und ich hab’ was gesehen. Und dann haben wir’s ausprobiert im<br />
Kleinen, im Großen, in der Wanderausstellung. Ein paar von den Spielen<br />
gibt’s nur hier im Mathematikum .<br />
LUZIA: Wie lange haben Sie gebraucht, um die Spiele herzustellen?<br />
PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Die Hauptzeit, die wir brauchen, ist eigentlich fürs<br />
Nachdenken und vorher Testen – zum Beispiel in Modellen aus Papier.<br />
Manches dauert noch lange, weil man nicht das richtige Material hat<br />
oder weil es im täglichen Gebrauch immer wieder kaputt geht. Wenn<br />
man weiß, wie’s geht, geht alles ganz schnell. Das Herstellen dauert<br />
dann zwei Wochen oder so. Wie lange eben so eine Schreinerarbeit<br />
dauert.<br />
LUZIA: Haben Sie die Spiele alle selbst ausprobiert<br />
und die Lösungen geschafft?<br />
PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Ich habe alle Experimente, die es hier gibt, ganz<br />
häufig gemacht. Ein paar Dinge machen mich nicht an, die kann ich auch<br />
nicht richtig: Also etwa dieses Waben-Puzzle, wo man die Sechsecke im-<br />
mer zusammenlegen muss. Die Besucher lieben es, aber ich find’s blöd.<br />
Ich wollte es mal aus dem Museum rausnehmen. Aber da hat es solche<br />
Proteste gehagelt, dass ich es sofort wieder reingenommen habe.<br />
MARIAM: Was hat das Experiment mit der Riesenseifenblase mit Mathe-<br />
matik zu tun?<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//55
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//56
2008//01<br />
PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Unglaublich viel! So ein Gebilde aus Seifenhaut hat<br />
nur einen Wunsch, nämlich so lange wie möglich zu existieren. Dazu<br />
muss es so dick, so stabil wie möglich sein, das heißt: Es bildet sich im-<br />
mer so, dass die Fläche insgesamt so klein wie möglich ist. Die Mathe-<br />
matiker sprechen von einer sogenannten Minimalfläche. Und das ist was<br />
total Schwieriges! Da kann man heute noch die spannendsten, intelli-<br />
gentesten Doktorarbeiten drüber schreiben und kann berühmt werden.<br />
Obwohl man’s zunächst gar nicht glaubt, ist es eines der Experimente,<br />
wo die tiefste und schwierigste Mathematik dahinter steckt.<br />
LUZIA: Speziell die Puzzles in der Ausstellung:<br />
Woher kommen die Ideen dazu?<br />
PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Die allermeisten gab es in irgendeiner Form schon<br />
vorher. Was wir neu haben – wir haben’s nicht erfunden, das gab’s nur<br />
auf Papier beschrieben – ist der Conway-Würfel. Man hat drei rote kleine<br />
Würfel und sechs blaue Quader, die zu einem Würfel zusammengesetzt<br />
werden sollen – es gibt nur eine einzige Lösung. Für die braucht man ein<br />
wenig Grips.<br />
MARIAM: Können Sie eigentlich erklären, wie ein Computer rechnet?<br />
PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Ich kann es prinzipiell erklären – also wie der das<br />
mit den Nullen und den Einsen macht. Im Computer sind nur Zahlen.<br />
Jeder Buchstabe, jedes Bild wird in Zahlen übersetzt. Und die Zahlen sind<br />
nur 0 und 1. Und zwar geht das so: Eins ist 1, die Zwei ist 1 0, die Drei ist 1<br />
1, die Vier ist 1 0 0. Also in unserem Zehner-System habe ich die Einer-<br />
Stelle, die Zehner- Stelle, die Hunderter-Stelle. Und im Zweier-System,<br />
was unser Computer benutzt, habe ich die Einer-Stelle, die Zweier-Stelle,<br />
die Vierer-Stelle, die Achter-Stelle, die Sechzehner-Stelle. Und immer<br />
wenn eine 1 da steht, heißt das, die Zahl wird dazu gezählt. Und wenn<br />
eine 0 da steht, wird sie nicht dazu gezählt. So habe ich bei der Acht eine<br />
1 und dreimal die 0 (=1 0 0 0), bei der Neun ist an der Achter-Stelle eine 1<br />
(=1 0 0 1). Es gibt einen Trick. Bis 1023 des Zehner-Systems kann ich im<br />
Zweier-System mit den Fingern zählen: Wenn der Finger oben ist, bedeu-<br />
tet es 1, wenn der Finger unten ist, bedeutet es 0. Vier ist das. Fünf ist so.<br />
Sechs ist so. Sieben ist so. Acht ist so. ... (Zeigt die Zahlenzeichen bis 16).<br />
LUZIA: Warum rechnen wir Menschen nicht so,<br />
sondern nur der Computer?<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//57
PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Gute Frage! Im Prinzip rechnet der Computer ja<br />
gleich wie wir, nur wir machen das Zehner-System, der Computer macht<br />
das Zweier-System. Das System wäre für uns einfach zu anstrengend,<br />
weil die Zahlen zu lang wären. Für 32 brauche ich schon sechs Stellen.<br />
Die Menschen haben übrigens auch andere Systeme benutzt. Zum<br />
Beispiel die Maya vor etwa 4000 Jahren haben ein Zwanziger-System<br />
benutzt. Die Babylonier vor 5000 Jahren – also dort, wo jetzt Saddam<br />
Hussein herrschte im Irak –, die waren damals total clever und gut, die<br />
haben das Sechziger-System benutzt. Das haben wir heute noch in der<br />
Uhr mit 60 Minuten für eine Stunde.<br />
MARIAM: Woher kommt überhaupt das Wort Mathematik?<br />
Und was heißt es?<br />
PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Es kommt aus dem Griechischen. Es heißt eigent-<br />
lich: die Kunst des Lernens – mathesis. Bei den Griechen, bei Sokrates<br />
und Plato, vor ein paar tausend Jahren war die Mathematik unglaublich<br />
wichtig. Die Mathematik war – auch für die Philosophen – die Top-Wis-<br />
senschaft. Man dachte: Nach dem Modell der Mathematik ist die Welt<br />
gemacht und wird auch die Politik gemacht.<br />
LUZIA: Warum heißt das Mathematikum so und nicht anders?<br />
PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Das war die schwierigste Entscheidung, die wir<br />
überhaupt treffen mussten. Irgendwann habe ich gesagt: Schluss – es<br />
wird überhaupt nicht mehr über den Namen diskutiert.<br />
LUZIA: Was gab es denn für Vorschläge?<br />
PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Es gab Vorschläge, die sehr witzig waren, „Pi mal<br />
Daumen“ zum Beispiel. Es gab Vorschläge, die ins Fantastische gingen,<br />
wie „Mathlantis“. Oder so was wie auf Englisch „House of Mathematics“.<br />
Es gab sogar einen Wettbewerb in einer Zeitung bei uns in Gießen:<br />
„Mathemagikum“ war, glaube ich, der erste Preis.<br />
LUZIA: Das Wort Mathematikum ist im Logo des<br />
Museums ja auch witzig geschrieben.<br />
PROF. BEUTELSPACH<strong>ER</strong>: Genau – mit den versetzten Buchstaben. Darauf<br />
habe ich Wert gelegt.<br />
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//58
2008//01<br />
ALLE WEIT<strong>ER</strong>EN INFORMATIONEN ÜB<strong>ER</strong> DAS MATHEMATIKUM: LIEBIGSTR. 8,<br />
35390 GI<strong>ES</strong>SEN, TEL. 06 41 / 9 69 79 70, FINDET IHR IM INT<strong>ER</strong>NET UNT<strong>ER</strong><br />
WWW.MATHEMATIKUM.DE.<br />
»<br />
Das Interview führten Mariam Benachib und Luzia Rehborn ein Jahr nach Eröffnung des Mathematikums<br />
gemeinsam mit Irene Graefe. Sie ist selbständige Journalistin in Kassel.<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//59
MAGAZIN//<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//60
2008//01<br />
KÜNSTL<strong>ER</strong>//PORTRAIT//<br />
JANG//HYUK-DONG<br />
„Fremdsein als Chance auf der Suche nach einer künstlerischen<br />
Identität“<br />
„Weit öffnet sich mein Fenster“ drückt treffend meine Entwicklung<br />
hier in Deutschland aus, als ich nach dem Studienabschluss in Korea in<br />
dieses für mich fremde Land kam. Um hier zurechtzukommen, war ich<br />
gezwungen, bisherige Sichtweisen auf das Leben zu verändern, meinen<br />
Horizont zu erweitern. Natürlich gibt es auch in Korea ein mannigfal-<br />
tiges Kunstgeschehen. Dort habe ich allerdings eine eher akademisch<br />
geprägte Ausbildung absolviert, wobei mein Interesse besonders einer<br />
impressionistisch-realistischen Malweise galt.<br />
Immer ist die Figur mein Ausgangspunkt, sie wird jedoch zur abs-<br />
trakten Form, die dann wiederum sogar Ähnlichkeit mit koreanischen<br />
Schriftzeichen bekommen kann. Durch das Drehen des Bildes während<br />
des Arbeitsprozesses entstehen Spannung und Irritation: handelt es sich<br />
um Abstraktes oder Gegenständliches?<br />
Mit dunkler Acrylfarbe und einem breiten Pinsel entstehen in relativ<br />
kurzer Zeit malerisch-flächige Grundgerüste, in die ich dann mit Ölfarbe<br />
hellere Akzente setze, die zu einer Konzentration führen. Die Entschei-<br />
dung, wann ein Bild „fertig“ ist, kann dabei teilweise sehr früh fallen.<br />
So bleibt vieles nur angedeutet. Der Betrachter ist herausgefordert, die<br />
Bilder in sich weiterzudenken.<br />
Nun ist mein Fenster offen. Ich habe mit gestalterischen Mitteln<br />
einen Weg gefunden, um meine Identität als Exilkoreaner in meiner<br />
Wahlheimat Deutschland zu erkunden.<br />
Mein Fremdsein verstehe ich als Chance, gesellschaftliche Zusammen-<br />
hänge aus einem anderen Blickwinkel sehen zu können. Inwiefern ist<br />
nun meine Sozialisation in Korea hilfreich oder gegebenenfalls sogar<br />
hinderlich für die Entwicklung meiner künstlerischen Position in Aus-<br />
einandersetzung mit der abendländischen Bildtradition.<br />
MAIL: jhd419@yahoo.com<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//61
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T//<strong>SPIEL</strong><br />
LIT<strong>ER</strong>ATUR:<br />
DAS <strong>SPIEL</strong>, DIE SUCHT, DIE LIT<strong>ER</strong>ATUR<br />
VON ANDREAS GEBHARDT<br />
Fjodor M. Dostojewski: Der Spieler. Späte Romane und Novellen.Gesammelte Werke, Bd. 2. Übers.: E. K. Rahsin, Frankfurt/M. o. J. (1994).<br />
Fjodor M. Dostojewski, Anna Dostojewskaja: Briefwechsel 1866-1880. Übers.: Brigitta Schröder, Berlin (Ost) 1982.<br />
Anna G. Dostojewskaja: Erinnerungen. Übers.: Brigitta Schröder. Mit einem Nachwort von Gerhard Dudek. Berlin (Ost) 1976.<br />
Anna G. Dostojewskaja: Tagebücher. Die Reise in den Westen. Übers.: Barbara Conrad. Königstein/Ts. 1985.<br />
René Fuelop-Müller, Friedrich Eckstein (Hg.): Dostojewski am Roulette. München 1925.<br />
Janko Lavrin: Dostojewskij. Reinbeck 1986.<br />
Marbacher Magazin 72/1995: Vom Schreiben 3. Stimulanzien oder Wie sich zum Schreiben bringen. Mit einem Essay von Peter<br />
Rühmkorf: Durchgangsverkehr – Über das Verhältnis von Dichtkunst und Drogengenuß.<br />
LIT<strong>ER</strong>ATUR UND <strong>SPIEL</strong><br />
VON THOMAS ANZ<br />
Roger Callois: Die Spiele und die Menschen. Langen, 1964.<br />
Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Gesammelte Werke, Bd. 1. Mohr Siebeck Verlag, 1990.<br />
Johan Huizinga: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Rowohlts Enzyklopädie, überarb. Ausgabe, 1994.<br />
Alfred Liede: Dichtung als Spiel. Bde. 1 u. 2, de Gruyter Verlag, 2. Aufl. 1997.<br />
Joachim Schulte (Hrsg.): Ludwig Wittgenstein. Philosophische Untersuchungen. Frankfurt/M., 2001<br />
WID<strong>ER</strong>STAND D<strong>ES</strong> GEIST<strong>ES</strong> GEGEN DIE BARBARISCHEN MÄCHTE<br />
VON CLAUDIA BULUT<br />
Hermann Hesse: Das Glasperlenspiel. Frankfurt/M. 2002. (Alle Zitate im Text wurden dieser Ausgabe entnommen).<br />
Volker Michels (Hg.): Materialien zu Hermann Hesse Das Glasperlenspiel. Frankfurt/M. 1973.<br />
Marbacher Magazin 98/2002: Hermann Hesse – Diesseits des Glasperlenspiels. Bearb. V. Heike Gfrereis.
IMPR<strong>ES</strong>SUM<br />
<strong>ER</strong>//<strong>SIE</strong>//<strong>ES</strong>//LI<strong>ES</strong>T<br />
<strong>ER</strong>SCHEINT<br />
IM GEORGE V<strong>ER</strong>LAG,<br />
34317 HABICHTSWALD<br />
H<strong>ER</strong>AUSGEB<strong>ER</strong><br />
B<strong>ER</strong>ND OB<strong>ER</strong>BRUNN<strong>ER</strong><br />
V<strong>ER</strong>LAG UND SITZ D<strong>ER</strong> REDAKTION<br />
SOWIE ANZEIGENANNAHME<br />
GEORGE V<strong>ER</strong>LAG<br />
W<strong>ES</strong><strong>ER</strong>STRASSE 2-8<br />
34317 HABICHTSWALD-EHLEN<br />
TEL 0 56 06 / 5 99 99<br />
FAX 0 56 06 / 59 99 55<br />
INFO@OB<strong>ER</strong>BRUNN<strong>ER</strong>.DE<br />
WWW.OB<strong>ER</strong>BRUNN<strong>ER</strong>.DE<br />
G<strong>ES</strong>AMTH<strong>ER</strong>STELLUNG<br />
OB<strong>ER</strong>BRUNN<strong>ER</strong> D<strong>ES</strong>IGN & KOMMUNIKATION GMBH
OB<strong>ER</strong>BRUNN<strong>ER</strong>.D<strong>ES</strong>IGN.KOMMUNIKATION.