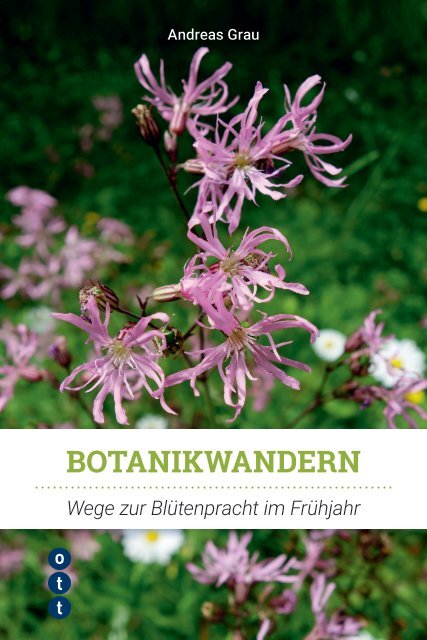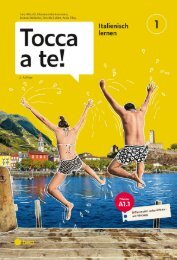Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Andreas Grau<br />
BOTANIKWANDERN<br />
Wege zur Blütenpracht im Frühjahr
Vorwort<br />
Ein Streifzug durch üppige Auenwälder, ein Spaziergang<br />
durch Blumenwiesen oder eine Bergwanderung inmitten<br />
von farbenfrohen Blüten wissen wir alle zu schätzen. Doch<br />
was war das eben für eine Pflanze? Hat sie eine Geschichte,<br />
und verbergen sich in ihren Wurzeln und Sprossen Geheimnisse,<br />
die darauf warten, entschlüsselt zu werden? Verrät<br />
uns ihr Vorhandensein eventuell sogar etwas über Bodenbeschaffenheit,<br />
Klima und Exposition ihres Standortes? Und<br />
sicher hat diese Pflanze einen Namen, aber welchen? Solche<br />
Fragen würden viel Raum für aufwendigste Studien bieten,<br />
aber es geht auch anders, ohne allzu weit in wissenschaftliches<br />
Terrain vorzudringen.<br />
Das vorliegende Buch soll ein handlicher Begleiter durch<br />
die Natur sein und möglichst einfache Antworten auf viele<br />
Fragen zur Pflanzenwelt geben. Leicht verständlich dargeboten,<br />
soll es aber wissenschaftlicher Prüfung dennoch genügen.<br />
Zweck des Buches ist es also, die Aufmerksamkeit auf<br />
verborgene Naturschätze am Wegrand und in der näheren<br />
Umgebung zu lenken, das Gesehene einzuordnen und Verständnis<br />
für viele Zusammenhänge der belebten und auch<br />
unbelebten Natur zu vermitteln. Ein trendiger, erfüllender und<br />
dazu noch gesunder Zeitvertrieb.<br />
Ein wichtiger Platz wurde bei der Tourenplanung auch der<br />
Sicherheit eingeräumt: Es empfiehlt sich, die Tour gut vorbereitet<br />
anzutreten, wenn nötig mit entsprechender Wanderausrüstung<br />
und vorgängiger Konsultation des Wetterberichts.<br />
Dann dürfen wir es sicher wagen, während der Tour den Blick<br />
auf botanische Schätze und weitere Sehenswürdigkeiten in<br />
der Umgebung zu richten! Botanische Schätze? Sicher! Wir<br />
lernen viele eindrückliche Pflanzen des Tieflandes, des Juras,<br />
der Voralpen und der Alpen kennen.<br />
Doch nebst den berühmten Seerosen, Edelweiss, Alpenrosen<br />
und Enzianen warten viele, auch weniger bekannte Pflanzen<br />
darauf, unser Auge zu erfreuen. Vorgestellt werden daher<br />
sowohl botanische Raritäten als auch häufig vorkommende<br />
Pflanzen. Denn einzigartig sind sie alle und verdienen Achtung,<br />
Beachtung und Schutz. Insgesamt kann die flächenmässig<br />
kleine Schweiz mit einer Vielzahl faszinierender Naturerlebnisse<br />
aufwarten.<br />
5
Der vorliegende Wanderführer soll als praktisches Werkzeug<br />
für die Tourenplanung, auf der Tour selbst und als<br />
Hilfsmittel zur Bestimmung von Pflanzen dienen. Dabei wird<br />
nicht nur auf die Pflanzenwelt eingegangen, obgleich diesem<br />
Aspekt natürlich erste Priorität eingeräumt wird. Lebensräume,<br />
Tiere, Geologie und Kulturelles werden im verfügbaren<br />
Rahmen ebenfalls kurz thematisiert.<br />
Der Trend «Zurück zur Natur, und zwar bewusst» erfreut<br />
sich heutzutage, in einem Zeitalter bedrohter Natur-Ressourcen,<br />
einer wachsenden Zahl von Anhängern. Die Natur ist allerdings<br />
alles andere als ein unendliches, uneingeschränktes<br />
Gemeingut. Ein zu unbekümmerter Umgang mit den fragilen<br />
Ressourcen schmerzt leider auf manchen Ausflügen Auge<br />
und Seele der Naturfreundin und des Naturfreundes. Wir<br />
aber können unseren Teil zur Erhaltung der Naturschätze beitragen,<br />
indem wir ihnen mit Sorgsamkeit und Achtung begegnen.<br />
Schön wäre es, wenn nach einer Tour das Gefühl zurückbleibt,<br />
draussen im Freien etwas Gutes für Körper, Geist und<br />
Seele getan zu haben, ohne einen «Fussabdruck» zurückzulassen.<br />
Wer die Natur liebt, schadet ihr nicht; nach unseren<br />
Wanderungen sollen noch ebenso viele Pflanzen den Weg<br />
säumen wie vor unserem Ankommen. Wir nehmen sie mit,<br />
aber nur als Fotografie und schöne Erinnerung im Herzen.<br />
Was Sammeln betrifft, so wartet dieses Buch übrigens noch<br />
mit einer spielerischen Idee auf, quasi ein «Sammeln von<br />
Punkten», ein wenig wie das beliebte «Geotagging». Mehr<br />
dazu im Kapitel «Big5».<br />
Zweck dieses Buches ist es, Leserinnen und Lesern mit<br />
oder ohne Vorkenntnissen, Tipps und Vorschläge für eindrückliche<br />
Botanikwanderungen aufzuzeigen, und bei ihrer<br />
Planung sowie auf der Tour selbst ein hilfreiches Werkzeug<br />
zu sein. Den breitgefächerten Ansprüchen einer Exkursion<br />
bestmöglich gerecht zu werden, ist nicht immer einfach und<br />
zu guter Letzt dürfen weder zu viel noch zu wenig Informationen<br />
in die Buchseiten verpackt werden. Aus diesem Grund<br />
wurden Fach- und Spezialbegriffe sowie wissenschaftliche<br />
Begriffe möglichst sparsam verwendet.<br />
Es war mir auch ein Anliegen, die Touren über die Schweiz<br />
so zu platzieren, dass sie auf verschiedenste Regionen verteilt<br />
sind. Das Niveau erstreckt sich vom einfachen Spaziergang<br />
bis zu anspruchsvollen Routen; die meisten sind leicht<br />
bis mittelschwer. Es ist mir wichtig, dass alle Botanikwan-<br />
6 |
derer unfallfrei von der Tour heimkehren, den Ausflug als<br />
persönliche Bereicherung erleben und nach jeder Tour sagen<br />
können: «Das war ein guter Tag». Sollte es mir mit diesem<br />
Buch gelungen sein, bei meinen verehrten Leserinnen und<br />
Lesern Freude und Verständnis für Natur und Umwelt zu wecken<br />
und zu stärken, dann ist mir (fast) mehr gelungen, als<br />
ich insgeheim zu hoffen wagte. Nun wünsche ich allen Naturund<br />
Botanikfreunden stets gutes Gelingen und viele blumige<br />
Erlebnisse.<br />
Hünibach, Sommer 2018<br />
Andreas Grau<br />
Ein paar Erklärungen<br />
••<br />
Allgemein sind die Texte reich bebildert, so dass anhand der Fotografien eine erwähnte<br />
Pflanze im Gelände wiedererkannt werden kann. Insgesamt werden in diesem Buch<br />
356 Pflanzenarten vorgestellt. Die Fotos sind soweit möglich vor Ort entstanden. Ausnahmen<br />
sind Habitusbilder von Bäumen, die im dichten Waldbestand nicht deutlich<br />
abgebildet werden können oder von Pflanzen, die in einem anderen saisonalen Zustand<br />
vorgestellt werden sollen.<br />
••<br />
Die Pflanzen sind im «Verzeichnis der Pflanzenarten und -familien» (Seite 181) aufgelistet.<br />
Die Angaben richten sich nach «Flora Helvetica» (FH), dem Standardwerk der<br />
Schweizer Feldbotanik.<br />
••<br />
Die Touren präsentieren eine bis vier Pflanzen, welche für die betreffende Wanderung<br />
charakteristisch sind.<br />
••<br />
Die Wanderziele können in der Regel stets mit ÖV erreicht werden. Für Reisende mit<br />
privaten Verkehrsmitteln wird auch die An-/Rückfahrt für Privatfahrzeuge beschrieben.<br />
Am Anfang jeder Tourenbeschreibung steht eine Empfehlung zu den Besuchszeiten:<br />
Gut Mässig gut Ungeeignet<br />
••<br />
Für alle Touren gilt, dass die erwähnenswerten Pflanzen, Landschaften und Lebensräume<br />
zu den angegebenen Zeiten vorzufinden sein sollten. Doch die Natur ist ein<br />
«Fliesssystem», 100-Prozent-Garantie gibt es da nicht.<br />
7
Günstigste Besuchszeiten<br />
Idealzeit/Blütezeit-Monat (*)<br />
Nr. Pflanzen-Name KT Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
1 Gemeine Küchenschelle AG Densbüren<br />
2 Gelber Lerchensporn BE Hünibach-Thun<br />
3 Flühblümchen BE Wimmis<br />
4 Grengjer-Tulpen VS Grengiols<br />
5 Fieberklee FR Düdingen<br />
6 Bocks-Riemenzunge BE Ligerz<br />
7 Frauenschuh SH Bargen<br />
8 Frauenhaar-Farn TI Balerna<br />
9 Brauner Storchenschnabel LU Waldemmen-Tal<br />
10 Rosmarinheide JU Étang de la Gruère<br />
11 Bergscharte GR Ramosch, Vnà<br />
12 Sibirische Schwertlilie AG Unterlunkhofen<br />
13 Pelz-Anemone BE Frutigen<br />
14 Schneeweisse Hainsimse VS Saas Almagell<br />
15 2 Steinbrecharten VS Saas-Fee<br />
Gut Mässig gut Ungeeignet (*) Die Empfehlung der günstigen Besuchszeiten richtet sich explizit nach dem im Buch angegebenen Standort<br />
8 |
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort 5<br />
Günstigste Besuchszeiten 8<br />
Karte und Tourenverzeichnis 10<br />
Big5 12<br />
Verzeichnis der Touren, in denen die «Big5»-Pflanzen vorzugsweise zu finden sind 14<br />
1 Gemeine Küchenschelle 18<br />
2 Gelber Lerchensporn, Karvinskis Berufskraut, Dalmatische Glockenblume 29<br />
3 Flühblümchen an der Simmenfluh 42<br />
4 Grengjer Tulpen 56<br />
5 Fieberklee, Weisse- und Hybrid-Seerose, Zypergras-Segge 68<br />
6 Bocks-Riemenzunge 79<br />
7 Frauenschuh, Fliegen- Ragwurz, Wilder Birn- und Wilder Apfelbaum 89<br />
8 Frauenhaar-Farn 98<br />
9 Brauner Storchschnabel 110<br />
10 Rosmarinheide, Blutauge und Teichenzian 121<br />
11 Alpen-Bergscharte, Heilglöckchen, Acker-Wachtelweizen 130<br />
12 Sibirische und Gelbe Schwertlilie, Sumpf-Helmkraut 138<br />
13 Pelz-Anemone 148<br />
14 Schneeweisse Hainsimse 157<br />
15 Gegenblättriger Steinbrech und Zweiblütiger Steinbrech 165<br />
Kleines Glossar (Alphabetisch) 177<br />
Verzeichnis Pflanzenarten und -familien 181<br />
Quellenangaben /Dank 201<br />
9
Karte und Tourenverzeichnis<br />
10 |
11
Big5<br />
«Big5», das ruft vielleicht Erinnerungen an eine Afrika-Safari<br />
wach. Kein Wunder – von dort stammt schliesslich dieser<br />
Begriff. Genau genommen spricht man dort von «The Big<br />
Five of Africa» und meint damit: Elefant, Nashorn, Kaffernbüffel,<br />
Löwe und Leopard. Irgendwie hat man sich auf diese<br />
fünf Tiere geeinigt, obschon andere sicher auch berechtigten<br />
Anspruch auf diesen Titel hätten. Nilpferd, Nilkrokodil und<br />
Tüpfel-Hyäne wären da zu nennen, aber dann wären es nicht<br />
mehr nur fünf, es sei denn, man würde einem der bisherigen<br />
Ranginhaber seinen Titel aberkennen. Nun, nicht jeder kann<br />
Platz finden auf dem Siegerpodest, so hat man wohl, nicht<br />
ganz frei von Sympathie, jene fünf Repräsentanten der afrikanischen<br />
Fauna auserkoren.<br />
Diese Idee fand bald Nachahmer. Nur ein Beispiel: Neuseeland<br />
wirbt mit verschiedenen Angeboten zu «Big Five», wobei<br />
das teils Landschaften, Treckings aber natürlich auch Tiere<br />
betrifft. Eine Trecking-Agentur wirbt beispielsweise für eine<br />
Tour, bei der es Vögel wie den Kiwi, den Tui oder den Neuseeland-Falken<br />
zu sehen gibt, mit einer guten Portion Selbstbewusstsein<br />
so:<br />
«Forget Africas‘ ‹Big5›, it’s been done! Here are the ‹Big5›<br />
feathered sights in New Zealand and which ‹Walking Legends›<br />
tour you should take in order to see them!»<br />
Was ungefähr bedeutet, dass man die afrikanischen Big<br />
Five vergessen soll – kalter Kaffee! Es gebe die «Big5» als<br />
gefiederte Sehenswürdigkeiten von Neuseeland.<br />
Die Beispiele zeigen: Es macht Spass, auf Wanderungen,<br />
Touren usw. etwas Originelles zu «sammeln». Geotagging<br />
verzeichnet seit seiner Einführung eine wachsende Zahl Anhänger;<br />
Ornithologen notieren ganz genau, was ihnen vors<br />
Okular flattert und welche Pilgerin oder welcher Pilger würde<br />
wohl an einem Pilgerstempel vorbeigehen, ohne ihn in den<br />
Pilgerpass zu drücken?<br />
Es liegt also nahe, auch unsere Botanik-Wanderungen mit<br />
etwas Spieleffekt und Sammelfieber aufzuwerten. Was also<br />
sollte uns davon abhalten, das Konzept «Big Five» auch auf<br />
die Schweizer Flora auszudehnen? So werden wir diese Idee<br />
adaptieren und in landestypischer Aufmachung vortragen.<br />
Ganz ähnlich wie in Afrika, gehen denn auch wir bei den Titelvergaben<br />
für die «Big5» der Schweizer Flora vor. Wobei wir<br />
vier verschiedene Regionen unterscheiden und für diese je<br />
«Fünf Grosse» auswählen. Wie die Afrikaner, so stehen auch<br />
wir vor dem gleichen «Problem»: Wem soll die Ehre gebühren?<br />
12 |
Nun, wir wählen unter den vielen Kandidaten je fünf aus, die<br />
die Pflanzenwelt der jeweiligen Region würdig repräsentieren.<br />
Dies natürlich im Wissen, dass andere dazu auch in der Lage<br />
wären. Die vier Regionen sind:<br />
Tiefland<br />
Voralpen/Jura<br />
Alpen<br />
Süd- & Ostalpen, Süd-CH<br />
Die Pflanzen halten sich natürlich nicht an unsere Territorialzuweisungen.<br />
Es wird daher nicht verwundern, dass einzelne<br />
unserer Big5 sowohl im einen wie im anderen Gebiet<br />
(z. B. Alpen und Voralpen/Jura) vorkommen.<br />
Unten also die Tabellen mit den Auserkorenen. Es gibt<br />
demzufolge insgesamt 20 Pflanzen in der Schweiz mit dem<br />
Titel «Big Five».<br />
Die jeweiligen Kapitel enthalten alle nötigen Informationen<br />
und das «Big5»-Signet der Region. Nach Begehung aller Touren<br />
sollten im Prinzip alle «Big5»-Pflanzen gefunden worden<br />
sein. Nachfolgend gibt es auch eine Tabelle zum Selbereintragen<br />
der Tour-Nr., des Datums (an dem wir einer «Big5»-Pflanze<br />
begegnet sind) und ein Feld pro Spalte für persönliche Anmerkungen.<br />
Da diese Idee für die Schweizer Botanik neu ist, könnte<br />
vielleicht sogar ein Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde<br />
beantragt werden, für diejenige Person, die zuerst alle 20<br />
«Big5»-Pflanzen der Schweiz als gefunden meldet. Tja, Probieren<br />
geht eben über Studieren – viel Spass!<br />
13
Verzeichnis der Touren, in denen die «Big5»-Pflanzen<br />
vorzugsweise zu finden sind<br />
Tiefland<br />
Nr. Name/D Name/Lat. Band 1<br />
Tour-Nr.<br />
Band 2<br />
Tour-Nr.<br />
1 Schwanenblume Butomus umbellatus 3<br />
2 Drachenwurz Calla palustris 5 1<br />
3 Frauenschuh Cypripedium calceolus 7, 11<br />
4 Weisse Seerose Nymphea alba 5 2<br />
5 Schwertlilie (Sibirische<br />
oder Gelbe)<br />
Iris (sibirica oder<br />
pseudacorus)<br />
5, 10, 12 2<br />
14 |
Voralpen/Jura<br />
Nr. Name/D Name/Lat. Band 1<br />
Tour-Nr.<br />
Band 2<br />
Tour-Nr.<br />
1 Alpenrose s.l. Rhododendron s.l. 7, 8, 9, 12<br />
2 Arnika Arnica montana 4, 6, 7, 12, 14<br />
3 Türkenbund Lilium martagon 6, 11 5, 7<br />
4 Feuerlilie Lilium bulbiferum s.l. 7<br />
5 Aurikel Primula auricula 3, 9<br />
15
Alpen<br />
Nr. Name/D Name/Lat. Band 1<br />
Tour-Nr.<br />
Band 2<br />
Tour-Nr.<br />
1 Edelweiss Leontopodium alpinum 15 6, 8, 9<br />
2 Alpen-Aster Aster alpinus 15 4, 6, 7, 8, 9<br />
3 Gegenblätt. Steinbrech,<br />
Zweiblütiger Steinbrech<br />
Saxifraga oppositifolia,<br />
Saxifraga bifolia s.l.<br />
1<br />
4 Alpen-Enzian Gentiana alpina 8<br />
5 Männertreu s.l. Nigritella nigra<br />
Nigritella rubra<br />
11, 15 4, 6, 8, 9, 13<br />
16 |
Süd- & Ostalpen, Süd-Schweiz<br />
Nr. Name/D Name/Lat. Band 1<br />
Tour-Nr.<br />
Band 2<br />
Tour-Nr.<br />
1 Himmelsherold Eritrichum nanum 15 11<br />
2 Alpen-Goldregen Laburnum alpinum 8 5, 13<br />
3 Alpen-Pech-Nelke Silene suecica 8<br />
4 Heilglöckchen Cortusa matthioli 11<br />
5 Frauenhaar-Farn Adiantum cappillus-veneris<br />
8<br />
17
1<br />
GEMEINE KÜCHENSCHELLE<br />
Einfache Frühlingswanderung über Wiesen und durch<br />
Wälder im nördlichen Aargauer Jura mit Abstecher auf den<br />
höchsten Aargauer Berg.<br />
Optimale Besuchszeit<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
18 | 1 Gemeine Küchenschelle
Allgemeine Beschreibung<br />
Name (D / wissenschaftl.)<br />
Weitere Namen<br />
Familie<br />
Gemeine Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris)<br />
Gemeine Kuhschelle<br />
Hahnenfussgewächse (Ranunculaceae)<br />
(FH-Nr.) / Häufigkeit 150 / 4 + 1,0 %<br />
Lebensraum<br />
Allgemeine Verbreitung<br />
Vorkommen CH<br />
Schutz, Gefährdung<br />
Besonderes<br />
Kollin-montan: trockene, steinige Magerrasen und lichte<br />
Kiefernwälder, meist in sonniger Hanglage; kalkliebend.<br />
Europa<br />
Mittelland, Jura, Graubünden (Rheintal)<br />
Gefährdet bis stark gefährdet! Schweizweit geschützt (CH)<br />
••<br />
Pflanze wird 10–20 (ausnahmsweise sogar 40) cm hoch.<br />
••<br />
Blüten innen violett; aussen zottig behaart. Zahlreiche Staub-<br />
und Fruchtblätter.<br />
••<br />
Halb geschlossene Blüten ähneln einer Kuhschelle. Die<br />
Verkleinerungsform «Kühchen» (kleine Kuh) führte zur<br />
Bezeichnung «Küchen»-Schelle.<br />
Weitere interessante Pflanzenvorkommen<br />
Name (D)<br />
Schwarzkätzchenweide<br />
Echter Seidelbast<br />
Lorbeer-Seidelbast<br />
Stinkende Nieswurz<br />
Stängellose Schlüsselblume<br />
Frühlings-Schlüsselblume<br />
Wald-Schlüsselblume<br />
Hagebuche<br />
Schwarzer Holunder<br />
Roter Holunder<br />
Name (Lat.)<br />
Salix melanostachys<br />
Daphne mezereum<br />
Daphne laureola<br />
Helleborus foetidus<br />
Primula acaulis<br />
Primula veris<br />
Primula elatior<br />
Carpinus betulus<br />
Sambucus nigra<br />
Sambucus racemosa<br />
19
Wegbeschreibung<br />
6,3 km<br />
3 h (ÖV)<br />
2,5 h (Privat-PW)<br />
363 m Aufstieg<br />
363 m Abstieg<br />
515 m / 867 m T2<br />
Anreise<br />
ÖV: Mit Zug bis Bahnhof Aarau, dann mit Bus<br />
(Richtung Frick) bis Haltestelle «Asp Abzw.»<br />
(vor Densbüren).<br />
Privat-PW: bis Asp, Parkplatz nahe «Oberi<br />
Langmatt».<br />
Route<br />
Reisende mit ÖV passieren die kleine Brücke<br />
gleich bei der Bushaltestelle «Asp Abzw.»<br />
und folgen dem Weglein neben der Strasse<br />
Richtung Asp. Nach ca. 80 m rechts 350 m<br />
auf der Dorfstrasse dann rechts abzweigen<br />
(gleich hinter Restaurant «Jura»). Am Parkplatz<br />
bei «Oberi Langmatt» vorbei. Auf demselben<br />
Weg geht es dann am Ende der Wanderung<br />
zurück zur Bushaltestelle. In unserem<br />
Plan mit grüner Farbe eingezeichnet.<br />
Nach 200 m biegt links der Weg nach «Hinterrebe»<br />
und Stockmatt ab. Wir bleiben noch<br />
für ca. 40 Meter auf dem Weg und nehmen<br />
dann den Pfad, der links in den Hang hineinführt.<br />
Dieses sehr schmale Weglein zieht<br />
sich fast parallel zum Talweg durch den Hinterreben-Hang<br />
dahin. In unserem Plan mit lila<br />
Pfeil.<br />
Bei Wegverzweigung Pt. 712 m<br />
Weg Richtung «Strihe» 867 m. In unserem<br />
Plan mit dunkelblauem Pfeil.<br />
Karten<br />
LK 1: 25‘000, Nr. 1069 | LK 1:50‘000, Nr. 214T<br />
Verpflegung, Übernachten<br />
Hotels, B&Bs und Restaurants usw. in Densbüren,<br />
Aarau und Umgebung.<br />
Informationen<br />
Gemeindeverwaltung, 5026 Densbüren<br />
T 062 867 87 67<br />
W www.densbueren.ch/de/portrait/<br />
willkommen<br />
Spezielles<br />
Pfad durch den Hinterrebe-Hang ist nach<br />
Regen rutschig, Ausrutschgefahr.<br />
20 | 1 Gemeine Küchenschelle
Wanderung<br />
Von der Strasse, die von Frick (AG) im Norden südlich über<br />
den Staffeleggpass nach Aarau führt, biegt in der Region<br />
Densbüren ein Strässchen ab, das uns ins beschauliche Dorf<br />
Asp führt. Am südwestlichen Ende des Dorfes liegt der Weiler<br />
«Oberi Langmatt», dort beginnt unsere heutige Botanikwanderung.<br />
Sofern die Anreise mit dem Privatfahrzeug erfolgte,<br />
ist zu beachten, dass ein eigentlicher Autoparkplatz zwar<br />
nicht ausgeschrieben wurde, am Wegrand aber normalerweise<br />
ein Abstellplatz zu finden ist. Bitte jedoch berücksichtigen,<br />
dass wir hier in der Landwirtschaftszone sind; ein Traktor<br />
sollte also noch ungehindert den Weg passieren können.<br />
Die Wanderung beginnt beim Weiler<br />
«Oberi Langmatt»<br />
Blick auf das Gebiet Hinterreben<br />
(unter dem Waldsaum)<br />
Nur ca. 50 m nach dem Start (Koordinaten 645‘800/<br />
254‘895) wächst links am Wegrand schon unser erstes botanisches<br />
Highlight: die Schwarzkätzchenweide. Eine sehr<br />
langsam wachsende Weidenart, die zwischen Fe bruar und<br />
April tatsächlich schwarze Blütenkätzchen hervorbringt. Später<br />
im Jahr spriessen an den Zweigen grüne, stark glänzende<br />
Blätter. Dieses, hier erstaunlicherweise natürlich wachsende,<br />
Ziergehölz hat Seltenheitswert und stammt ursprünglich aus<br />
Japan. Es wird selten höher als 3 m.<br />
Schwarzkätzchenweide:<br />
ungewöhnlich für Weiden, die pechschwarzen<br />
Blütenkätzchen<br />
21
Wegweiser Hinterreben<br />
Stängellose Primel<br />
Wir folgen nun dem gegen Nordwesten leicht ansteigenden<br />
Weg. Nach ca. 100 m führt dieser in einem Bogen an einem<br />
kleinen Rebberg entlang. Nach weiteren 50 m biegt links<br />
ein Talweg «Hinterrebenweg» ab (Wegweiser aus Holzlatten;<br />
auf dem Wegschild steht «Hinterreben» auf der Karte «Hinterrebe»).<br />
Wir bleiben aber noch auf der «Ringstrasse» und queren<br />
nach 60 m, kurz vor dem Waldrand, links steil aufwärts in<br />
den sehr schmalen Fusspfad, der uns parallel über dem Talweg<br />
durch den Hang führen wird (vgl. Luftaufnahme unten).<br />
Lorbeer-Seidelbast<br />
Gemeiner Aronstab<br />
Echter Seidelbast<br />
Um zum Standort der Küchenschellen zu gelangen, den<br />
Stars unserer heutigen Wanderung, ist es notwendig, diesen<br />
Fusspfad zu wählen. Doch gleich beim ersten Feldgehölz begegnet<br />
uns ein Vertreter der Schlüsselblumengewächse: die<br />
Stängellose Primel. Zwei weitere Schlüsselblumengewächse<br />
werden wir wenig später noch antreffen. Und gleich hinter<br />
diesem Feldgehölz warten schon drei weitere Pflanzenarten,<br />
typische Frühblüher, wie fast alles, was wir auf dieser Frühjahrswanderung<br />
zu Gesicht bekommen. Es sind dies zwei<br />
Seidelbastgewächse und der Gemeine Aronstab (Arum maculatum).<br />
Der Echte Seidelbast trägt pinkfarbene, wohlriechende<br />
Blüten, diejenigen des Lorbeer-Seidelbastes sind unauffällig<br />
gelbgrün. Giftig sind alle drei Arten. Bei den<br />
22 | 1 Gemeine Küchenschelle
Seidelbastgewächsen ist das Gift (Mezerein) hauptsächlich<br />
in Rinde und Samen enthalten. Der Kontakt mit menschlicher<br />
Haut kann diese schädigen, und es kann bereits dadurch zu<br />
einer Giftaufnahme kommen. Auch Schäden an Niere, Nerven<br />
und Kreislauf sind nicht auszuschliessen.<br />
Wald-Schlüsselblume<br />
Stinkender Nieswurz<br />
Frühlings-Schlüsselblume<br />
Der Pfad schlängelt sich in der ganzen Länge durch das Gebiet<br />
Hinterrebe und verläuft stets wenige Meter unterhalb des<br />
Waldsaums. Die Südexposition heizt den Hang schon früh im<br />
Jahr auf und bildet einen deutlichen Kontrast zum Nordhang<br />
der «Asperstrihe», einem hufeisenförmigen Hügel auf der anderen<br />
Seite des Tälchens zu unseren Füssen. Der Untergrund<br />
aus zerklüftetem Kalkgestein wird von einer dünnen, nicht<br />
stets zusammenhängenden Humusschicht bedeckt. Entsprechend<br />
trocken ist es hier am Südhang der «Strihe», dem<br />
höchsten Berg, der ganz im Kanton Aargau liegt.<br />
Wir werden bald oben stehen und die faszinierende Aussicht<br />
bewundern, doch bis dahin wollen wir noch die botanischen<br />
Kostbarkeiten auf dem Weg dorthin geniessen. Und<br />
die gibt es reichlich: Kaum sind wir ein paar Schritte weiter<br />
gewandert, heben sich vor dem Waldrand die Silhouetten des<br />
zahlreich vertretenen Stinkenden Nieswurz ab. Eine Pflanze,<br />
die vorwiegend im Altertum gegen verschiedene Gebrechen<br />
verwendet wurde, aber auch als Droge für Vergnügliches. So<br />
wurde aus ihrer getrockneten Wurzel ein Niespulver hergestellt<br />
(Name). Wegen unerwünschter Nebenwirkungen wird<br />
sie heute nicht mehr medizinisch verwendet.<br />
Anderes lässt sich von der Frühlings-Schlüsselblume<br />
sagen: Ihre Wurzeln, Blüten und Blätter finden auch heute<br />
noch in Hustentees und -sirups Verwendung. Auf der noch<br />
nicht ergrünten Weide leuchten überall gelbe Farbtupfer im<br />
ansonsten braunen, trockenen Gras. Das sind die Blüten der<br />
Frühlings-Schlüsselblume. Im Waldesinnern blühen, teils bereits<br />
gut sichtbar von unserem Weg aus, die etwas helleren<br />
Blüten der Wald-Schlüsselblume (auch «Hohe Schlüsselblume»<br />
genannt).<br />
23
Nachdem wir die Wegstrecke auf dem schmalen Pfad<br />
etwa zu drei Vierteln zurückgelegt haben, gelangen wir zu<br />
einem Weidestück, das über und über mit den Blüten des<br />
heutigen Hauptstars überzogen ist. So selten die Gemeine<br />
Küchenschelle sonst vorkommt, hier wachsen ein paar Dutzend<br />
dieser zottigen Kleinode auf engem Raum. Trotzdem<br />
sind sie in ihrem Fortbestand stark gefährdet!! Zwei Ausrufezeichen<br />
in Flora Helvetica (FH) heisst eben genau das. Und<br />
mit Nachdruck sei darauf hingewiesen, dass wir die letzte<br />
Generation sein könnten, die diese Blumen in freier Natur sehen,<br />
wenn wir nicht Sorge für den Schutz solcher Seltenheiten<br />
tragen. Sie ist übrigens im Blumenladen als ganze Pflanze<br />
zu moderatem Preis erhältlich. Im Besonderen soll also im<br />
Umgang mit dieser Pflanze gelten, was für alle Begegnungen<br />
mit Wildpflanzen selbstverständlich sein sollte:<br />
Anschauen,<br />
Fotografieren,<br />
Dokumentieren:<br />
Pflücken:<br />
Ausgraben:<br />
Hagebuche<br />
Geniessen wir also die Blütenpracht. Es gibt hier in nächster<br />
Nähe übrigens noch eine weitere Fläche, auf der diese<br />
Blumen vorkommen, aber die Wiese hier hat das reichste<br />
Vorkommen der Gemeinen Küchenschelle zu bieten.<br />
Nachdem wir uns sattgesehen haben, setzen wir den<br />
Weg fort – und werden mit weiteren Begegnungen wie dem<br />
Wald-Bingelkraut (Mercurialis perennis) belohnt. Bei einem<br />
nahen Feldgehölz treibt eine Hagebuche erste Blattknospen<br />
aus. Auf einer Hagebuche wachsen männliche und weibliche<br />
Blüten, sie ist somit einhäusig. Die Hagebuche gehört übrigens<br />
nicht zu den Buchen-, sondern zu den Birkengewächsen.<br />
Mittlerweile stehen wir am Waldrand, wo viele Herbstzeitlosen<br />
(Colchicum autumnale) ihre Blätter dem Frühlingshimmel<br />
entgegenstrecken. Im Herbst, wenn die blassvioletten<br />
Blüten erblühen, werden die Laubblätter bereits verwelkt sein.<br />
Die Blätter sollten übrigens nicht mit denen des Bärlauchs<br />
verwechselt werden. Die Herbstzeitlose heisst auf Latein:<br />
Colchium autumnale, was auf das Gift Colchizin verweist. Die<br />
Herbstzeitlose hat eine etwas komplizierte Systematik: Sie<br />
gehört zur Klasse der «Einkeimblättrigen». Solche Pflanzen<br />
treiben aus dem Samen nur mit einem Keimblatt. Sie ist eingereiht<br />
in die Ordnung «Lilienartige» und in die Familie der<br />
«Zeitlosengewächse», Gattung «Zeitlosen». So funktioniert<br />
übrigens die botanische Systematik in etwa. Für uns genügt<br />
in aller Regel die Kenntnis von Gattung und Art, eventuell noch<br />
die Familienzugehörigkeit. Das ist natürlich hervorragend,<br />
aber nicht absolut notwendig. Für Ambitionierte bietet sich<br />
24 | 1 Gemeine Küchenschelle
als Eselsbrücke Folgendes an: Die Anfangsbuchstaben der<br />
Begriffe (nach alter Systematik): Reich, Unterreich, Stamm,<br />
Klasse, Ordnung, Familie, Gattung, Art, Rasse (Unterart) ergeben<br />
den russischen Familiennamen RUSKOFGAR.<br />
Wir wandern den sanft ansteigenden Waldweg empor und<br />
folgen diesem, nachdem er den Wald für ein kurzes Wegstück<br />
verlässt, bis zum Punkt 712 m. Dort wählen wir den<br />
Weg rechts, Richtung Strihe, bis nach der zweiten Kurve ein<br />
mittelsteiler Grashang rechts an den Weg grenzt. Dort steigen<br />
wir über dieses Wiesenstück bis zur Krete empor, ca.<br />
120 m. Rechts haltend treffen wir dann wieder auf einen markierten<br />
Weg, der zur Strihe hochführt.<br />
Oben auf der Strihe (Wegweiserangabe: «Strihen») befinden<br />
sich ein paar Sitzbänke zum Ausruhen und natürlich um die<br />
Blütenpracht zahlreicher<br />
Küchenschellen<br />
Bärlauch (Allium ursinum)<br />
Herbstzeitlose<br />
Herbstzeitlose<br />
25
Aussicht zu geniessen. Bis zu den Alpen reicht der Blick,<br />
wenngleich oftmals Dunst und Staub die klare Sicht etwas<br />
einschränken; schön ist es hier allemal. Nachdem wir uns<br />
von dem Panorama losreissen konnten, nehmen wir den Weg<br />
wieder talwärts, und zwar in Nordostrichtung, dem Pfad entlang<br />
via «Oberloch». Dort mündet der Pfad in den Weg, auf<br />
dem wir hergekommen sind. Wir werden dem Weg, wieder<br />
über Punkt 712 m (Karte), zurückfolgen. Diesmal können wir<br />
den schmalen Pfad durch die Hinterrebe umgehen, indem<br />
wir einfach den bequemeren Talweg zu unserem Ausgangspunkt<br />
Oberi Langmatt respektive zur Bushaltestelle «Asp<br />
Abzw.» gehen. Dort endet unsere erste Botanik-Exkursion.<br />
Auf dem letzten Wegstück treffen wir noch mehrere interessante<br />
Pflanzen an, von denen hier wenigstens zwei vorgestellt<br />
werden sollen: Schwarzer und Roter Holunder.<br />
26 | 1 Gemeine Küchenschelle
Den frappantesten Unterschied zwischen den Holunder-<br />
Arten machen die Bilder sehr schön anschaulich. Sicherstes<br />
Unterscheidungsmerkmal ist die Farbe des Markes in ihren<br />
Zweigen.<br />
Schwarzer Holunder<br />
Roter Holunder<br />
Roter Holunder = Rotes Mark,<br />
Schwarzer Holunder = Weisses<br />
Mark<br />
27
Weitere Sehenswürdigkeiten<br />
in der Region<br />
http://www.densbueren.ch/de/portrait/<br />
sehenswuerdigkeiten/welcome.php<br />
Aussichtspunkt Asper Strihe<br />
Lage: Westlich von Asp auf 838 m ü. M.<br />
( Koord. 645‘005/254‘670).<br />
Aussichtspunkt Herzberg/<br />
Mittlisberg<br />
Oberhalb Reservoir Herzberg (Koord. 645‘836/254‘400)<br />
befinden sich die zwei Aussichtspunkte mit Blick Richtung<br />
Süden über Küttigen, Aarau und das Mittelland. Das Panorama<br />
erstreckt sich von den Glarner- über die Zentral- bis zu<br />
den Berner Alpen.<br />
Burgruine Urgiz<br />
Die Ruine befindet sich auf einem Felssporn am nördlichen<br />
Ende der Gemeinde Densbüren (Koord. 646‘240/256‘835).<br />
Dörfer Asp und Densbüren<br />
Bemerkenswerte Ortsbilder.<br />
28 | 1 Gemeine Küchenschelle