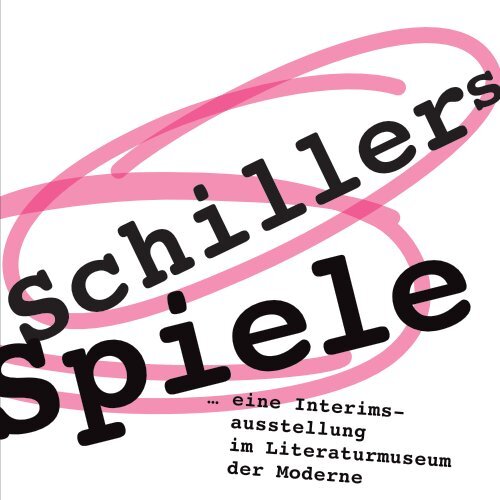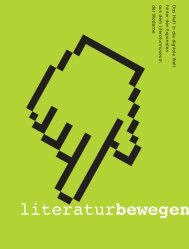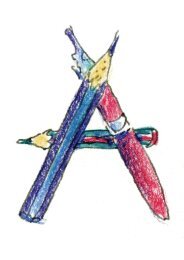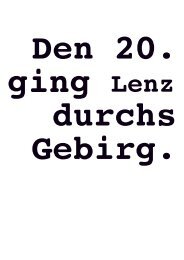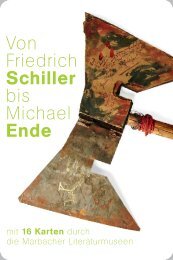Schillers Spiele ... eine Interimsausstellung im Literaturmuseum der Moderne
Schiller, Hölderlin, Kerner, Mörike ... Für das Schiller-Nationalmuseum erarbeiten wir zur Zeit ein neues Ausstellungskonzept. Daher sind kurz vor dem Corona-Lockdown im März 2020 vier Schriftsteller – Schwaben von Geburt und Autoren von Weltrang – vorläufig ins Literaturmuseum der Moderne umgezogen. Wir haben Dinge eingepackt, die ihre poetisch besonderen Seiten zeigen: Friedrich Schillers Spiele, Justinus Kerners Tintenklecksbilder und die eigenwilligen Aufschreibesysteme von Friedrich Hölderlin und Eduard Mörike. Einige dieser Dinge stecken im Museum noch in Umzugskisten und können von den Besucher*innen selbst entdeckt werden. Andere haben wir auf Werkstatt-Tischen ausgepackt, nach Themen sortiert und durch Kommentare vernetzt. Beides – den Inhalt von Schillers Umzugskisten und die vorübergehende Ordnung der Dinge aus seinem Nachlass – haben wir in ein Heft übersetzt, um neugierig auf das reale Museum zu machen und es zugleich für alle auch in den digitalen Raum hinein zu öffnen. #SchillerFreiSpiel Für unser Projekt Fehlt Ihnen / Dir Schiller? (gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Rahmen des Impulsprogramms „Kunst trotz Abstand“) suchen wir Ihre und Deine Lieblingsexponate. Über eine Mail an uns mit einer kurzen Begründung (museum@dla-marbach.de) freuen wir uns sehr.
Schiller, Hölderlin, Kerner, Mörike ...
Für das Schiller-Nationalmuseum erarbeiten wir zur Zeit ein neues Ausstellungskonzept. Daher sind kurz vor dem Corona-Lockdown im März 2020 vier Schriftsteller – Schwaben von Geburt und Autoren von Weltrang – vorläufig ins Literaturmuseum der Moderne umgezogen. Wir haben Dinge eingepackt, die ihre poetisch besonderen Seiten zeigen: Friedrich Schillers Spiele, Justinus Kerners Tintenklecksbilder und die eigenwilligen Aufschreibesysteme von Friedrich Hölderlin und Eduard Mörike.
Einige dieser Dinge stecken im Museum noch in Umzugskisten und können von den Besucher*innen selbst entdeckt werden. Andere haben wir auf Werkstatt-Tischen ausgepackt, nach Themen sortiert und durch Kommentare vernetzt. Beides – den Inhalt von Schillers Umzugskisten und die vorübergehende Ordnung der Dinge aus seinem Nachlass – haben wir in ein Heft übersetzt, um neugierig auf das reale Museum zu machen und es zugleich für alle auch in den digitalen Raum hinein zu öffnen.
#SchillerFreiSpiel
Für unser Projekt Fehlt Ihnen / Dir Schiller? (gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Rahmen des Impulsprogramms „Kunst trotz Abstand“) suchen wir Ihre und Deine Lieblingsexponate. Über eine Mail an uns mit einer kurzen Begründung (museum@dla-marbach.de) freuen wir uns sehr.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1<br />
Schiller s<br />
piele<br />
… <strong>eine</strong> <strong>Inter<strong>im</strong>sausstellung</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Literaturmuseum</strong><br />
<strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne
Vorab und<br />
zuerst
3<br />
Schiller, Höl<strong>der</strong>lin, Kerner, Mörike ...<br />
Für das Schiller-Nationalmuseum erarbeiten wir zur Zeit<br />
ein neues Ausstellungskonzept. Daher sind kurz vor dem<br />
Corona-Lockdown <strong>im</strong> März 2020 vier Schriftsteller –<br />
Schwaben von Geburt und Autoren von Weltrang – vorläufig<br />
ins <strong>Literaturmuseum</strong> <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne umgezogen. Wir haben Dinge<br />
eingepackt, die ihre poetisch beson<strong>der</strong>en Seiten zeigen:<br />
Friedrich <strong>Schillers</strong> <strong>Spiele</strong>, Justinus Kerners Tintenklecksbil<strong>der</strong><br />
und die eigenwilligen Aufschreibesysteme von<br />
Friedrich Höl<strong>der</strong>lin und Eduard Mörike.<br />
Einige dieser Dinge stecken <strong>im</strong> Museum noch in Umzugskisten<br />
und können von den Besucher*innen selbst entdeckt werden.<br />
An<strong>der</strong>e haben wir auf Werkstatt-Tischen ausgepackt, nach<br />
Themen sortiert und durch Kommentare vernetzt. Beides –<br />
den Inhalt von <strong>Schillers</strong> Umzugskisten und die vorübergehende<br />
Ordnung <strong>der</strong> Dinge aus s<strong>eine</strong>m Nachlass – haben wir<br />
nun in ein Heft übersetzt, um neugierig auf das reale<br />
Museum zu machen und es zugleich für alle Besucher*innen<br />
auch in den digitalen Raum hinein zu öffnen.<br />
#SchillerFreiSpiel<br />
Für unser Projekt Fehlt Ihnen / Dir Schiller? (geför<strong>der</strong>t<br />
vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst<br />
Baden-Württemberg <strong>im</strong> Rahmen des Impulsprogramms „Kunst<br />
trotz Abstand“) suchen wir Ihre und D<strong>eine</strong> Lieblingsexponate.<br />
Über <strong>eine</strong> Mail an uns mit <strong>eine</strong>r kurzen Begründung<br />
(museum@dla-marbach.de) freuen wir uns sehr.
5
7<br />
<strong>Spiele</strong><br />
Schiller s<br />
„Um es endlich auf einmal<br />
herauszusagen, <strong>der</strong> Mensch<br />
spielt nur, wo er in voller<br />
Bedeutung des Worts Mensch<br />
ist, und er ist nur da<br />
ganz Mensch, wo er spielt.“<br />
Eines <strong>der</strong> berühmtesten<br />
Schiller-Zitate stammt aus<br />
den 1794 veröffentlichten<br />
Briefen Über die ästhetische<br />
Erziehung des Menschen.<br />
Aus Friedrich <strong>Schillers</strong><br />
Sicht macht uns die Kunst<br />
frei, weil sie uns bewegt<br />
und verän<strong>der</strong>t, ohne dass<br />
wir die Balance verlieren.<br />
Sie lehrt uns Geist, Seele<br />
und Körper in Einklang<br />
zu bringen. Viele <strong>der</strong><br />
Objekte in <strong>Schillers</strong> Nachlass<br />
thematisieren solche<br />
Bewegungs- und Gleichgewichtsübungen.
Schiller sprach und spielte<br />
s<strong>eine</strong> Texte be<strong>im</strong> Schreiben:<br />
„Wenn er dichtete, brachte er<br />
s<strong>eine</strong> Gedanken unter Stampfen,<br />
Schnauben und Brausen zu<br />
Papier“, will ein Zeitgenosse<br />
beobachtet haben. Man sieht<br />
diesen Körpereinsatz <strong>Schillers</strong><br />
erhaltenen Handschriften an.<br />
Er korrigierte s<strong>eine</strong> Dramen<br />
so lange, bis sie für ihn<br />
gut spielbar waren.<br />
zwei Seiten aus <strong>eine</strong>r von <strong>eine</strong>m<br />
Schreiber schon ins R<strong>eine</strong> geschriebenen<br />
Fassung <strong>der</strong> Piccolomini,<br />
in <strong>der</strong> Schiller noch einmal heftig<br />
korrigierte. Das „Gut, daß Ihrs<br />
seid, daß wir Euch haben! Wußt ichs<br />
doch, / Graf Isolan bleibt nicht<br />
aus, wenn sein Chef / Auf ihn gerechnet<br />
hat“ ersetzte er durch das<br />
einprägsame und symmetrisch gebaute<br />
„Spät kommt Ihr – – Doch Ihr<br />
kommt! Der weite Weg, / Graf Isolan,<br />
entschuldigt Euer Säumen“. Eine<br />
Tisch-Szene spitzte er ebenfalls<br />
symmetrisch zu: „Alles ist in<br />
Bewegung, Spielleute und Terskys<br />
Reg<strong>im</strong>ent ziehen über den Schauplatz<br />
um die Tafel herum. Noch ehe sie<br />
sich ganz entfernt haben, erscheint<br />
Max Piccolomini, ihm kommt Terzky<br />
mit <strong>eine</strong>r Schrift, Isolani mit<br />
<strong>eine</strong>m Pokal entgegen. Beide haben<br />
die Servietten vor.“
9
<strong>der</strong> kleinste erhaltene Schiller-<br />
Manuskript-Schnipsel, kommascharf<br />
ausgeschnitten: „s<strong>eine</strong>s,“<br />
Weil Schiller s<strong>eine</strong> Manuskripte<br />
meist weggeworfen<br />
hat, sobald er <strong>eine</strong>n Text<br />
veröffentlicht hatte, sind<br />
sie selten und nach s<strong>eine</strong>m<br />
Tod begehrte Andenken.<br />
<strong>Schillers</strong> Familie<br />
zerschnitt sogar Blätter.<br />
… ebenso wie s<strong>eine</strong> Locken und<br />
Schreibfe<strong>der</strong>n …<br />
Heute geben diese Schnipsel<br />
Einblick in die Beson<strong>der</strong>heiten<br />
von <strong>Schillers</strong> Texten.<br />
Sie zeigen, wie er Material<br />
suchte, sammelte und ordnete.
11<br />
Für den Wilhelm Tell schrieb<br />
Schiller aus Büchern Stichworte<br />
zur Schweiz ab wie „weiße<br />
Berglilien und purpurfarbene<br />
Alprosen“, „Schneeberge verglichen<br />
mit <strong>eine</strong>r diamantenen Krone –<br />
Glas – grünblausch<strong>im</strong>mernd“, „Berge<br />
sind Erdwogen“ und „milchweißes<br />
Firnwasser“. Aus Letzterem<br />
machte er <strong>im</strong> fertigen Drama <strong>eine</strong><br />
synästhetische Wahrnehmung:<br />
„Sein Auge trinkt <strong>der</strong> Gletscher<br />
Milch“.<br />
Für Die Malteser (ein geplantes<br />
Drama über den Wi<strong>der</strong>stand <strong>der</strong><br />
Ordensritter von Malta gegen die<br />
osmanischen Belagerer) führte<br />
Schiller Listen mit Figuren, Handlungselementen<br />
und Motiven wie<br />
„21. Ein Chor von idealistischem,<br />
ein andrer von Realistischem<br />
Innhalt. Die Macht und Herrschaft<br />
des Gedankens“.
Schiller selbst sammelte<br />
Handschriften als Quellen für<br />
s<strong>eine</strong> Texte.<br />
Alte Handschriften dürften<br />
Schiller auch ästhetisch<br />
fasziniert haben: Sie zeigen<br />
halbe, ganze und ineinan<strong>der</strong><br />
verschlungene Schlangenlinien<br />
und damit jene Linienart, die<br />
er in <strong>eine</strong>m Brief an s<strong>eine</strong>n<br />
Freund Körner gezeichnet hat,<br />
um diesem zu demonstrieren,<br />
was er selbst als schön, weil<br />
frei empfinde. Für ihn sind<br />
Schönheit und Freiheit<br />
wie das Spiel „Verän<strong>der</strong>ung<br />
aus Bewegung“.<br />
für Das Lied von <strong>der</strong> Glocke<br />
historische Zeichnungen<br />
von Gussformen.<br />
<strong>Schillers</strong> Anmerkung in s<strong>eine</strong>m<br />
Exemplar von Immanuel Kants<br />
Kritik <strong>der</strong> Urteilskraft.
<strong>im</strong> Februar 1793: „Folgende Linie<br />
aber ist <strong>eine</strong> schöne Linie,<br />
o<strong>der</strong> könnte es doch sein, wenn<br />
m<strong>eine</strong> Fe<strong>der</strong> beßer wäre“<br />
13
Beson<strong>der</strong>e Manuskripte<br />
verschenkte Schiller<br />
an Freunde.<br />
an Christian Gottfried Körner<br />
den (wie in <strong>der</strong> Poetik des Aristoteles<br />
gefor<strong>der</strong>t) musterhaft<br />
in fünf Akte geglie<strong>der</strong>ten Plan des<br />
Don Carlos („Bauerbacher Plan“)<br />
Einige <strong>der</strong> Gegengeschenke<br />
haben sich ebenfalls erhalten<br />
und zeigen, wie<br />
<strong>Schillers</strong> Freundeskreis mit<br />
den Spannungen zwischen<br />
Geist und Körper, Poesie<br />
und Alltag spielte.
15<br />
Christian Gottfried Körner und s<strong>eine</strong><br />
Schwester Dora schenkten Schiller<br />
ein mit Terpsichore und Erato<br />
(den Musen des Tanzes und <strong>der</strong> Liebeslyrik)<br />
verziertes Behältnis für<br />
Zahnstocher und <strong>eine</strong>n mit Hygieia<br />
(<strong>der</strong> Göttin <strong>der</strong> Medizin) bemalten<br />
Schlafrockknopf.<br />
Klick<br />
zur<br />
Transkription<br />
an Johann Wolfgang Goethe das<br />
Rätselgedicht Das Berglied<br />
Johann Wolfgang Goethe schickte<br />
1795 per Post ein Briefchen mit<br />
Stecknadeln, die Schiller als „Symbole<br />
von Gewißensbißen“ interpretierte<br />
– Goethes Antwort: Er könne die<br />
„symbolischen Nadeln gesund brauchen<br />
und verlieren“.
17
Schiller selbst nutzte nicht<br />
nur in s<strong>eine</strong>n literarischen<br />
Texten und Briefen, son<strong>der</strong>n<br />
auch bei Schmuck-, Kleidungsund<br />
Einrichtungsstücken<br />
die Doppeldeutigkeiten von<br />
Gegenständen: Man kann<br />
sie als Zeichen symbolisch<br />
o<strong>der</strong> aber als Dinge konkret<br />
verwenden, sie haben ästhetische,<br />
aber auch wirkliche<br />
Folgen, lassen sich mit<br />
Bedeutungen extrem aufladen,<br />
aber auch als bloßes<br />
Spiel ironisch belächeln.<br />
Ring und Tintenfass mit dem Kopf<br />
des „Dichter-Urvaters“ Homer ...
19<br />
... Ring mit <strong>eine</strong>m Satyr, den Schiller<br />
auf <strong>der</strong> Flucht von Stuttgart nach<br />
Mannhe<strong>im</strong> getragen haben soll, wo er<br />
sich u.a. auf <strong>eine</strong>m Bücherleihschein<br />
als „Dr. Ritter“ ausgab ...<br />
... vermutlich eigenhändige Zeichnung<br />
<strong>eine</strong>s Pferdes, das sein Reiter am<br />
langen Zügel gehen lässt – Schiller<br />
soll <strong>im</strong>mer dann, wenn ihm nichts<br />
einfiel, „Rössel“ gemalt haben.<br />
Brief an s<strong>eine</strong>n Freund Körner, in<br />
dem Schiller zwölf Tage <strong>im</strong> Februar<br />
1782 mit zwölf Gedankenstrichen<br />
inszeniert hat: „diese 12 Tage ist<br />
<strong>eine</strong> Revolution mit mir und in<br />
mir vorgegangen, die dem gegenwärtigen<br />
Briefe mehr Wichtigkeit gibt,<br />
als ich mir habe träumen laßen –<br />
die Epoche in m<strong>eine</strong>m Leben macht“.<br />
Die Folge: „Ich kann nicht mehr<br />
in Mannhe<strong>im</strong> bleiben. In <strong>eine</strong>r unnennbaren<br />
Bedrängniß m<strong>eine</strong>s Herzens<br />
schreibe ich Ihnen m<strong>eine</strong> Besten.<br />
Ich kann nicht mehr hier bleiben.<br />
Zwölf Tage habe ichs in m<strong>eine</strong>m<br />
Herzen herumgetragen, wie den Entschluß<br />
aus <strong>der</strong> Welt zu gehn.<br />
Menschen, Verhältniße, Erdreich und<br />
H<strong>im</strong>mel sind mir zuwi<strong>der</strong>. Ich habe<br />
k<strong>eine</strong> Seele hier, k<strong>eine</strong> einzige<br />
die die Leere m<strong>eine</strong>s Herzens füllte,<br />
k<strong>eine</strong> Freundin, k<strong>eine</strong>n Freund.“
Die Spannungen zwischen Denken und<br />
Fühlen, Geist und Körper sind<br />
auf das Engste mit <strong>der</strong> literarischen<br />
Gattung verknüpft, die <strong>Schillers</strong><br />
Ruhm begründet hat: <strong>der</strong> Tragödie.<br />
Der antike Philosoph Aristoteles<br />
schrieb <strong>der</strong> Tragödie <strong>eine</strong> wichtige<br />
soziale Wirkung zu, weil sich<br />
die Zuschauer durch das ästhetische<br />
Durchleben von Gefühlen wie<br />
Trauer und Angst gerade von diesen<br />
Erregungszuständen reinigten. Der<br />
ausgebildete Mediziner Schiller<br />
interessierte sich beson<strong>der</strong>s für<br />
die körperlichen D<strong>im</strong>ensionen dieser<br />
„Katharsis“. Er promovierte über<br />
die heilende Wirkung des Fiebers,<br />
zeichnete als Schüler die eigene<br />
linke Hand mit roter Kreide, wärmte<br />
s<strong>eine</strong> Hände an Keramikstäben aus<br />
dem Ofen, kurierte sein Kopfweh mit
21<br />
einziges erhaltenes Rezept des<br />
Arztes Schiller – ein stark<br />
dosiertes Brechmittel: drei Gran<br />
Brechweinstein zu lösen in<br />
vier Unzen heißem Wasser, davon<br />
sogleich die Hälfte nehmen.<br />
In <strong>eine</strong>r Selbstrezension <strong>der</strong><br />
anonym erschienenen Räuber 1782<br />
schrieb Schiller über sich:<br />
„Er soll ein Arzt bei <strong>eine</strong>m wirtembergischen<br />
Grenadier-Bataillon<br />
sein […]. So gewiß ich sein<br />
Werk verstehe, so muss er starke<br />
Dosen in Emeticis [Brechreiz<br />
Erregendem] eben so lieben als<br />
in Aestheticis, und ich möchte<br />
ihm lieber zehen Pferde als<br />
m<strong>eine</strong> Frau zur Kur übergeben.“<br />
Hilfe <strong>eine</strong>s roten Tuchs, das er<br />
sich um den Kopf wickelte, damit<br />
<strong>der</strong> Druck und die Farbe die Durchblutung<br />
för<strong>der</strong>ten, wählte die<br />
Dose mit dem reinigenden Schnupftabak<br />
als sein Erkennungszeichen<br />
und kokettierte als junger Schriftsteller<br />
damit, dass s<strong>eine</strong> Texte<br />
ästhetische Rosskuren seien.
23
<strong>Schillers</strong> Texte und Dinge, die<br />
wir als bedruckte Plexiplatten<br />
in Umzugskistengepackt haben –<br />
auf den 47 Plattenhüllen finden<br />
sich jeweils die Kommentare. >>
Schiller<br />
erienedicht<br />
S 1<br />
25
Der 11-jährige Schiller bedankt sich 1771<br />
bei Georg Zilling, s<strong>eine</strong>m Lehrer an <strong>der</strong><br />
Ludwigsburger Lateinschule, für die<br />
Herbstferien auf Latein und mit <strong>eine</strong>r<br />
Pferde-Metapher:<br />
O mein Dekan, den ich wie k<strong>eine</strong>n jemals verehre,<br />
Höre mit heiterer Stirn nun auch den Dank noch von mir,<br />
Dass Du uns die Möglichkeit gabst, von Studium und Arbeit<br />
Auszuruhn […].<br />
Öfters pflegten die Musen, wenn Plektrum und Kithara ruhten,<br />
Blüten von Veilchen und Ros’ bunt zu vermengen <strong>im</strong> Spiel.<br />
[...]<br />
Recht <strong>der</strong> Natur, dass <strong>der</strong> Nacken vom Joch nach <strong>der</strong> Ernte befreit wird,<br />
So wie <strong>der</strong> Reiter dem Pferd lockert die Zügel <strong>im</strong> Sieg.
S1<br />
27
Schiller<br />
notenverwi<br />
cklung<br />
S 2<br />
29
Transkription <strong>eine</strong>r Doppelseite<br />
aus dem <strong>im</strong> April 1783 entworfenen<br />
„Bauerbacher Plan“ zu<br />
Don Carlos:<br />
II. Schritt. Der Knoten verwikelter. A. Karlos Liebe n<strong>im</strong>mt<br />
zu — Ursachen: 1. Die Hin<strong>der</strong>niße selbst. 2. Gegenliebe <strong>der</strong><br />
Königin, diese äußert sich, motivirt<br />
sich: a. Aus Ihrem zärtlichen Herzen<br />
dem ein Gegenstand mangelt. α Philipps<br />
Alter, Disharmonie mit ihrer<br />
Empfindung. β Zwang ihres Standes.<br />
b. Aus ihrer anfänglichen Best<strong>im</strong>mung<br />
und Neigung für den Prinzen. Sie<br />
nährt diese angenehme Erinnerungen<br />
gern. c. Aus ihren Äußerungen in Gegenwart<br />
des Prinzen. Inneres Leiden.<br />
Furchtsamkeit. Antheil. Verwirrung.<br />
d. Einer mehr als zu erwartenden Kälte<br />
gegen Dom Juan, <strong>der</strong> ihr einige Liebe<br />
zeigt. e. Einigen Funken von Eifersucht<br />
über Karlos Vertrauen zu <strong>der</strong><br />
Prinzeßin von Eboli. f. Einigen Äußerungen in gehe<strong>im</strong>. g.<br />
Einem Gespräch mit dem Marquis. h. Einer Szene mit<br />
Karlos. B. Die Hin<strong>der</strong>niße und Gefahren wachsen. Dieses<br />
erfährt man 1. Aus dem Ehrgeiz <strong>der</strong> Rachsucht des verschmähten<br />
Dom Juan. 2. — einigen Entdekungen die die<br />
Prinzeßin v. Eboli macht. 3. — ihrem Einverständniß mit<br />
jenem. 4. — <strong>der</strong> <strong>im</strong>mer wachsenden Furcht und Erbitterung<br />
<strong>der</strong> Grandes, die vom Prinzen bedroht<br />
und beleidigt werden. Complott<br />
<strong>der</strong>selben. 5. Aus des Königs Unwillen<br />
über s<strong>eine</strong>n Sohn, und Bestellung <strong>der</strong><br />
Spionen. III. Schritt. Ansch<strong>eine</strong>nde<br />
Auflösung, die den Knoten noch mehr<br />
verwikelt. A. Die Gefahren fangen an<br />
auszubrechen. 1. Der König bekömmt<br />
<strong>eine</strong>n Wink, und geräth in die heftigste<br />
Eifersucht. 2. Dom Karlos erbittert den<br />
König noch mehr. 3. Die Königin<br />
scheint den Verdacht zu rechtfertigen.<br />
4. Alles vereinigt sich den Prinzen und<br />
die Königin strafbar zu machen. 5. Der<br />
König beschließt s<strong>eine</strong>s Sohnes Ver<strong>der</strong>ben.<br />
B. Der Prinz scheint allen Gefahren zu entrinnen. 1.<br />
Sein Heldensinn erwacht wie<strong>der</strong> und fängt an über s<strong>eine</strong><br />
Liebe zu siegen. 2. Der Marquis wälzt den Verdacht auf<br />
sich, und verwirret den Knoten aufs neue.
S2<br />
31
33
Schiller<br />
Mehrfach-<br />
noten<br />
S 3<br />
35
Friedrich <strong>Schillers</strong> Plan zu Das Schiff, 1798<br />
o<strong>der</strong> 1803/04. Mit Überlegungen zum punctum<br />
saliens, zum ‚springenden Punkt‘ <strong>eine</strong>s Dramas.<br />
Die Aufgabe ist ein Drama, worinn alle interessante Motive <strong>der</strong><br />
Seereisen, <strong>der</strong> außereuropäischen Zustände und Sitten, <strong>der</strong><br />
damit verknüpften Schicksale und Zufälle geschickt verbunden<br />
werden. Aufzufinden ist also ein Punctum saliens (Landen und<br />
Absegeln. Sturm. Seetreffen. Meuterei auf dem Schiff. Schiffjustiz.<br />
Begegnung zweier Schiffe. Scheiterndes Schiff. Ausgesezte<br />
Mannschaft. Proviant. Waßereinnehmen. Handel. Seecarten,<br />
Compass, Längenuhr. Wilde Tiere, wilde Menschen.) aus dem alle<br />
sich entwickeln, um welches sich alle natürlich anknüpfen laßen,<br />
ein Punkt also, wo sich Europa, Indien, Handel, Seefahrten, Schiff<br />
und Land, Wildheit und Kultur, Kunst und Natur, etc darstellen<br />
läßt. Auch die Schiffsdisciplin und Schiffsregierung, <strong>der</strong> Charakter<br />
des Seemanns, des Kaufmanns, des Abentheurers, des Pflanzers,<br />
des Indianers, des Creolen, müssen best<strong>im</strong>mt und lebhaft<br />
ersch<strong>eine</strong>n.
Schiller<br />
3<br />
37<br />
S<br />
S3
Schiller<br />
Diese Brücke, die von Perlen sich erbaut,<br />
Sich glänzend hebt und in die Lüfte gründet,<br />
erlenrücke<br />
Die mit dem Strom erst wird und mit dem Strome schwindet<br />
Und über die kein Wandrer noch gezogen,<br />
Am H<strong>im</strong>mel siehst du sie, sie heißt - <strong>der</strong> Regenbogen.<br />
S 4<br />
39
Rätsel-Antwort aus <strong>Schillers</strong><br />
Bearbeitung von Carlo Gozzis<br />
Turandot von 1802/03.<br />
Diese Brücke, die von Perlen sich erbaut,<br />
Sich glänzend hebt und in die Lüfte gründet,<br />
Die mit dem Strom erst wird und mit dem Strome schwindet<br />
Und über die kein Wandrer noch gezogen,<br />
Am H<strong>im</strong>mel siehst du sie, sie heißt <strong>der</strong> Regenbogen.
Schiller<br />
4<br />
41<br />
Diese Brücke, die von Perlen sich erbaut,<br />
Sich glänzend hebt und in die Lüfte gründet,<br />
Die mit dem Strom erst wird und mit dem Strome schwindet<br />
Und über die kein Wandrer noch gezogen,<br />
Am H<strong>im</strong>mel siehst du sie, sie heißt - <strong>der</strong> Regenbogen.<br />
S<br />
S4
Schiller<br />
43<br />
S 5<br />
Luftschiff<br />
Dies leichte Schiff, das mit Gedankenschnelle<br />
Mich durch die Lüfte ruhig trägt,<br />
Sich selbst nicht von dem Ort bewegt,<br />
- Das Sehrohr ist’s, das in die Ferne<br />
Den Blick beflügelt bis ins Land <strong>der</strong> Sterne.
Rätsel-Antwort aus <strong>Schillers</strong><br />
Bearbeitung von Carlo Gozzis<br />
Turandot von 1802/03.<br />
Dies leichte Schiff, das mit Gedankenschnelle<br />
Mich durch die Lüfte ruhig trägt,<br />
Sich selbst nicht von dem Ort bewegt,<br />
— Das Sehrohr ist’s, das in die Ferne<br />
Den Blick beflügelt bis ins Land <strong>der</strong> Sterne.
Schiller<br />
5<br />
45<br />
Dies leichte Schiff, das mit Gedankenschnelle<br />
Mich durch die Lüfte ruhig trägt,<br />
Sich selbst nicht von dem Ort bewegt,<br />
- Das Sehrohr ist’s, das in die Ferne<br />
Den Blick beflügelt bis ins Land <strong>der</strong> Sterne.<br />
S<br />
S5
Schiller<br />
S 6<br />
Teufels-<br />
rücke
An dem Abgrund leitet <strong>der</strong> schwindlichte Steg,<br />
Er führt zwischen Leben und Sterben,<br />
Es sperren die Riesen den einsamen Weg<br />
Und drohen dir ewig Ver<strong>der</strong>ben,<br />
Und willst du die schlafende Löwinn nicht wecken,<br />
So wandle still durch die Straße <strong>der</strong> Schrecken,<br />
Es schwebt <strong>eine</strong> Brücke hoch über den Rand<br />
Der furchtbaren Tiefe gebogen,<br />
Sie ward nicht erbauet von Menschen Hand,<br />
Es hätte sichs k<strong>eine</strong>r verwogen,<br />
Der Strom braust unter ihr spat u: früh,<br />
Speit ewig hinauf und zertrümmert sie nie.<br />
Berglied, von Schiller an<br />
Goethe zum „Dechiffrieren“<br />
geschickt, <strong>der</strong> darin die<br />
Teufelsbrücke am<br />
Sankt-Gotthard-<br />
Pass erkannte.<br />
Zurück<br />
zum<br />
Werkstatttisch
Schiller<br />
6<br />
49<br />
S<br />
S6
Punkt-<br />
Schiller<br />
51<br />
os<br />
S 7
Die letzten Verse, die Schiller kurz vor s<strong>eine</strong>m<br />
Tod am 9. Mai 1805 geschrieben haben soll --<br />
ein Monolog <strong>der</strong> Marfa, <strong>der</strong> ins Kloster verbannten<br />
Mutter des Demetrius, <strong>der</strong> ohne Satzzeichen<br />
abbricht:<br />
Ich habe nichts als mein Gebet und Flehn,<br />
Das schöpf ich glühend aus <strong>der</strong> tiefsten Seele,<br />
Das send ich gläubig in die H<strong>im</strong>melshöhen,<br />
Wie <strong>eine</strong> Heerschaar send ich dirs entgegen,<br />
Heerschaaren send ichs mächtig dir entgegen,<br />
Der Mutter Thränen und <strong>der</strong> Mutter Seegen,<br />
Das send ich hinauf in alle H<strong>im</strong>mels Höhen<br />
Send ich wie <strong>eine</strong> Heerschaar dir entgegen!<br />
Die Thränen alle die ich nächtlich weinte
Schiller<br />
7<br />
53<br />
S<br />
S7
Schiller<br />
chwä<br />
bische<strong>im</strong>en<br />
55<br />
S 8
Lebensentwurf des 18-jährigen Schiller,<br />
<strong>der</strong> sich nur auf Schwäbisch re<strong>im</strong>t,<br />
eingetragen in das Stammbuch des Schulfreunds<br />
Johann Christian Weckherlin:<br />
Der Artzt, <strong>der</strong> Dichter, und dein Freund<br />
Auf ewig bleibt mit dir vereint
Schiller<br />
8<br />
57<br />
S<br />
S8
Schiller<br />
59<br />
Schreib<br />
S 9<br />
freiheit
Durchlauchtigster Herzog<br />
Gnädigster Herzog und<br />
Herr, Das Unglük <strong>eine</strong>s<br />
Unterthanen und <strong>eine</strong>s<br />
Sohns kann dem Fürsten<br />
und Vater niemals<br />
gleichgültig seyn. Ich habe<br />
<strong>eine</strong>n schröklichen Weg<br />
gefunden, das Herz m<strong>eine</strong>s<br />
gnädigsten Herrn zu<br />
rühren, da mir die<br />
natürlichen bei schwerer<br />
Ahndung untersagt worden<br />
sind. Höchstdieselbe<br />
haben mir auf das strengste<br />
verboten litterarische<br />
Schriften herauszugeben,<br />
noch weniger mich mit<br />
Auslän<strong>der</strong>n einzulaßen.<br />
Am 24. September 1782, zwei<br />
Tage nach s<strong>eine</strong>r Flucht<br />
von Stuttgart nach Mannhe<strong>im</strong>,<br />
entwarf Schiller <strong>eine</strong>n Brief<br />
an den württembergischen<br />
Herzog Carl Eugen.<br />
Ich habe mir geschmeichelt<br />
E.H.D. Gründe von Gewicht<br />
dagegen vorbringen zu<br />
können, und die gnädigste<br />
Erlaubniß erbeten,<br />
Höchstdenenselben m<strong>eine</strong><br />
unterthänigste Bitte in<br />
<strong>eine</strong>m Schreiben vortragen<br />
zu dörfen. Da mir diese Bitte<br />
bei Androhung des Arrests<br />
verwaigert ward, m<strong>eine</strong><br />
Umstände aber <strong>eine</strong><br />
gnädigste Mil<strong>der</strong>ung des<br />
mir gemachten Verbots<br />
höchst nothwendig<br />
machten, so zwang mich<br />
die Verzweiflung, den<br />
izigen Weg zu ergreifen.
Schiller<br />
9<br />
61<br />
S<br />
S9
Poesie-<br />
Schiller<br />
Ich bin Willens, bei m<strong>eine</strong>m neuen Etablissement in Leipzig<br />
<strong>eine</strong>m Fehler zuvorzukommen, <strong>der</strong> mir in Mannhe<strong>im</strong> bisher sehr<br />
viel Unannehmlichkeit machte. Es ist dieser, m<strong>eine</strong> eigne<br />
Oekonomie nicht mehr zu führen, und auch nicht mehr allein zu<br />
wohnen. Das erste ist schlechterdings m<strong>eine</strong> Sache nicht es<br />
kostet mich weniger Mühe, <strong>eine</strong> ganze Verschwörung und<br />
Staatsaktion durchzuführen, als m<strong>eine</strong> Wirthschaft, und<br />
Poësie, wißen Sie selbst, ist nirgends gefährlicher, als bei<br />
oekonomischen Rechnungen. M<strong>eine</strong> Seele wird getheilt,<br />
beunruhigt, ich stürze aus m<strong>eine</strong>n idealischen Welten, sobald<br />
mich ein zerrissner Strumpf an die wirkliche mahnt. Fürs<br />
an<strong>der</strong>e brauch ich zu m<strong>eine</strong>r gehe<strong>im</strong>ern Glükseligkeit <strong>eine</strong>n<br />
rechten wahren Herzensfreund, <strong>der</strong> mir stets an <strong>der</strong> Hand ist,<br />
wie mein Engel, dem ich m<strong>eine</strong> aufke<strong>im</strong>enden Ideen und<br />
Empfindungen in <strong>der</strong> Geburt mittheilen kann, nicht aber erst<br />
durch Briefe, o<strong>der</strong> lange Besuche erst zutragen muß. Schon <strong>der</strong><br />
nichtsbedeutende Umstand, daß ich, wenn dieser Freund außer<br />
m<strong>eine</strong>n Pfählen wohnt, die Straße passieren muß, ihn zu<br />
ech-<br />
nung<br />
S 10<br />
erreichen, daß ich mich umkleiden muß und <strong>der</strong>gleichen, tödet<br />
den Genuß des Augenbliks, und die Gedankenreihe kann<br />
zerrissen seyn, biß ich ihn habe. Sehen Sie mein Bester, das<br />
sind nur Kleinigkeiten, aber Kleinigkeiten tragen oft die<br />
schwerste Gewichte <strong>im</strong> Verlauf unsers Lebens.<br />
63
Am 25. März 1785<br />
schil<strong>der</strong>t Schiller<br />
dem Freund Ludwig<br />
Huber selbstkritisch<br />
sein Verhältnis<br />
zur Realität.<br />
Ich bin Willens, bei m<strong>eine</strong>m<br />
neuen Etablissement in Leipzig<br />
<strong>eine</strong>m Fehler zuvorzukommen,<br />
<strong>der</strong> mir in Mannhe<strong>im</strong> bisher<br />
sehr viel Unannehmlichkeit<br />
machte. Es ist dieser, m<strong>eine</strong><br />
eigne Oekonomie nicht mehr<br />
zu führen, und auch nicht<br />
mehr allein zu wohnen. Das<br />
erste ist schlechterdings m<strong>eine</strong><br />
Sache nicht – es kostet mich<br />
weniger Mühe, <strong>eine</strong> ganze<br />
Verschwörung und Staatsaktion<br />
durchzuführen, als m<strong>eine</strong><br />
Wirthschaft, und Poësie,<br />
wißen Sie selbst, ist nirgends<br />
gefährlicher, als bei oekonomischen<br />
Rechnungen.<br />
M<strong>eine</strong> Seele wird getheilt,<br />
beunruhigt, ich stürze aus<br />
m<strong>eine</strong>n idealischen Welten,<br />
sobald mich ein zerrissner<br />
Strumpf an die wirkliche<br />
mahnt. Fürs an<strong>der</strong>e brauch ich<br />
zu m<strong>eine</strong>r gehe<strong>im</strong>ern<br />
Glükseligkeit <strong>eine</strong>n rechten<br />
wahren Herzensfreund, <strong>der</strong><br />
mir stets an <strong>der</strong> Hand ist, wie<br />
mein Engel, dem ich m<strong>eine</strong><br />
aufke<strong>im</strong>enden Ideen und<br />
Empfindungen in <strong>der</strong> Geburt<br />
mittheilen kann, nicht aber erst<br />
durch Briefe, o<strong>der</strong> lange<br />
Besuche erst zutragen muß.<br />
Schon <strong>der</strong> nichtsbedeutende<br />
Umstand, daß ich, wenn dieser<br />
Freund außer m<strong>eine</strong>n 4 Pfählen<br />
wohnt, die Straße passieren<br />
muß, ihn zu erreichen, daß ich<br />
mich umkleiden muß und<br />
<strong>der</strong>gleichen, tödet den Genuß<br />
des Augenbliks, und die<br />
Gedankenreihe kann zerrissen<br />
seyn, biß ich ihn habe. Sehen<br />
Sie mein Bester, das sind nur<br />
Kleinigkeiten, aber<br />
Kleinigkeiten tragen oft die<br />
schwerste Gewichte <strong>im</strong> Verlauf<br />
unsers Lebens.
Schiller<br />
10<br />
65<br />
Ich bin Willens, bei m<strong>eine</strong>m neuen Etablissement in Leipzig<br />
<strong>eine</strong>m Fehler zuvorzukommen, <strong>der</strong> mir in Mannhe<strong>im</strong> bisher sehr<br />
viel Unannehmlichkeit machte. Es ist dieser, m<strong>eine</strong> eigne<br />
Oekonomie nicht mehr zu führen, und auch nicht mehr allein zu<br />
wohnen. Das erste ist schlechterdings m<strong>eine</strong> Sache nicht es<br />
kostet mich weniger Mühe, <strong>eine</strong> ganze Verschwörung und<br />
Staatsaktion durchzuführen, als m<strong>eine</strong> Wirthschaft, und<br />
Poësie, wißen Sie selbst, ist nirgends gefährlicher, als bei<br />
oekonomischen Rechnungen. M<strong>eine</strong> Seele wird getheilt,<br />
beunruhigt, ich stürze aus m<strong>eine</strong>n idealischen Welten, sobald<br />
mich ein zerrissner Strumpf an die wirkliche mahnt. Fürs<br />
an<strong>der</strong>e brauch ich zu m<strong>eine</strong>r gehe<strong>im</strong>ern Glükseligkeit <strong>eine</strong>n<br />
rechten wahren Herzensfreund, <strong>der</strong> mir stets an <strong>der</strong> Hand ist,<br />
wie mein Engel, dem ich m<strong>eine</strong> aufke<strong>im</strong>enden Ideen und<br />
Empfindungen in <strong>der</strong> Geburt mittheilen kann, nicht aber erst<br />
durch Briefe, o<strong>der</strong> lange Besuche erst zutragen muß. Schon <strong>der</strong><br />
nichtsbedeutende Umstand, daß ich, wenn dieser Freund außer<br />
m<strong>eine</strong>n Pfählen wohnt, die Straße passieren muß, ihn zu<br />
erreichen, daß ich mich umkleiden muß und <strong>der</strong>gleichen, tödet<br />
den Genuß des Augenbliks, und die Gedankenreihe kann<br />
zerrissen seyn, biß ich ihn habe. Sehen Sie mein Bester, das<br />
sind nur Kleinigkeiten, aber Kleinigkeiten tragen oft die<br />
schwerste Gewichte <strong>im</strong> Verlauf unsers Lebens.<br />
S<br />
S10
öße<br />
Schiller<br />
67<br />
Überett-<br />
Aber <strong>der</strong> Minna sage doch daß ich<br />
sie herzlich bedaure wegen ihrem<br />
Schlafen, denn wenn Du es in<br />
<strong>der</strong> Nacht machst wie Huber, so<br />
ligt Dein Kopf <strong>im</strong>mer in ihrem<br />
Bette, und das ist ein verfluchtes<br />
Schlafen, wie ich von mir weiß.<br />
Ueberhaupt bin ich für das Bette<br />
zu groß o<strong>der</strong> es ist für mich zu<br />
klein, denn eins m<strong>eine</strong>r Gliedmassen<br />
campiert <strong>im</strong>mer die Nacht<br />
über in <strong>der</strong> Luft.<br />
S 11
Schiller soll 181<br />
Zent<strong>im</strong>eter groß<br />
gewesen sein - am<br />
5. Januar 1787<br />
schrieb er s<strong>eine</strong>m<br />
Freund Körner:<br />
Aber <strong>der</strong> Minna<br />
sage doch daß<br />
ich sie herzlich<br />
bedaure wegen<br />
ihrem Schlafen,<br />
denn wenn Du<br />
es in <strong>der</strong> Nacht<br />
machst wie Huber,<br />
so ligt Dein Kopf<br />
<strong>im</strong>mer in ihrem<br />
Bette, und das ist<br />
ein verfluchtes<br />
Schlafen, wie ich<br />
von mir weiß.<br />
Ueberhaupt bin ich<br />
für das Bette zu<br />
groß o<strong>der</strong> es ist für<br />
mich zu klein,<br />
denn eins m<strong>eine</strong>r<br />
Gliedmassen<br />
campiert <strong>im</strong>mer<br />
die Nacht über in<br />
<strong>der</strong> Luft.
Schiller<br />
11<br />
69<br />
Aber <strong>der</strong> Minna sage doch daß ich<br />
sie herzlich bedaure wegen ihrem<br />
Schlafen, denn wenn Du es in<br />
<strong>der</strong> Nacht machst wie Huber, so<br />
ligt Dein Kopf <strong>im</strong>mer in ihrem<br />
Bette, und das ist ein verfluchtes<br />
Schlafen, wie ich von mir weiß.<br />
Ueberhaupt bin ich für das Bette<br />
zu groß o<strong>der</strong> es ist für mich zu<br />
klein, denn eins m<strong>eine</strong>r Gliedmassen<br />
campiert <strong>im</strong>mer die Nacht<br />
über in <strong>der</strong> Luft.<br />
S<br />
S11
Schiller<br />
Ich bin auf den Bergen, Dresden<br />
zu, herumgeschweift weil es da oben<br />
schon ganz trocken ist. Wirklich<br />
habe ich diese Bewegung höchst<br />
nöthig gehabt, denn diese paar Tage,<br />
auf dem Z<strong>im</strong>mer zugebracht haben mir,<br />
nebst dem Biertrinken, das ich aus<br />
wirklicher Desperation angefangen<br />
habe, dumme Geschichten <strong>im</strong> Unterleib<br />
zugezogen, die ich sonst nie verspürt<br />
habe. […] und wenn ich, Motion<br />
halber, in m<strong>eine</strong>m Z<strong>im</strong>mer springe, so<br />
zittert das Hauß und <strong>der</strong> Wirth<br />
fragt erschrocken, was ich befehle.<br />
S 12 Z<strong>im</strong>mer-<br />
gymnastik<br />
71
Schiller s<strong>eine</strong>m Freund Körner:<br />
Am 22. April 1787 schrieb<br />
Ich bin auf den Bergen, Dresden zu, herumgeschweift weil es da oben schon ganz<br />
trocken ist. Wirklich habe ich diese Bewegung höchst nöthig gehabt, denn diese paar<br />
Tage, auf dem Z<strong>im</strong>mer zugebracht haben mir, nebst dem Biertrinken, das ich aus<br />
wirklicher Desperation angefangen habe, dumme Geschichten <strong>im</strong> Unterleib zugezogen,<br />
die ich sonst nie verspürt habe. […] und wenn ich, Motion halber, in m<strong>eine</strong>m Z<strong>im</strong>mer<br />
springe, so zittert das Hauß und <strong>der</strong> Wirth fragt erschrocken, was ich befehle.
Schiller<br />
12<br />
73<br />
Ich bin auf den Bergen, Dresden<br />
zu, herumgeschweift weil es da oben<br />
schon ganz trocken ist. Wirklich<br />
habe ich diese Bewegung höchst<br />
nöthig gehabt, denn diese paar Tage,<br />
auf dem Z<strong>im</strong>mer zugebracht haben mir,<br />
nebst dem Biertrinken, das ich aus<br />
wirklicher Desperation angefangen<br />
habe, dumme Geschichten <strong>im</strong> Unterleib<br />
zugezogen, die ich sonst nie verspürt<br />
habe. […] und wenn ich, Motion<br />
halber, in m<strong>eine</strong>m Z<strong>im</strong>mer springe, so<br />
zittert das Hauß und <strong>der</strong> Wirth<br />
fragt erschrocken, was ich befehle.<br />
S<br />
S12
Schiller<br />
S 13<br />
Seelen-<br />
Nur zwey Worte m<strong>eine</strong> Lieben, es ist Posttag<br />
und ich kann ihn nicht vorübergehen<br />
laßen, ohne euch zu grüßen. Der H<strong>im</strong>mel<br />
ist heute so heiter, und m<strong>eine</strong> Seele ist<br />
es auch - eben dacht ich, wie schön es<br />
wäre, wenn ich nur von <strong>eine</strong>m Z<strong>im</strong>mer<br />
ins andre zu gehen brauchte, um bey euch<br />
zu seyn. Ach! wenn es erst so weit<br />
seyn wird! Wenn ich jedes aufgl<strong>im</strong>mende<br />
Gefühl m<strong>eine</strong>r Seele sogleich in euer Herz<br />
überströmen kann! Ich vermuthe euch jezt<br />
<strong>im</strong> Garten, <strong>der</strong> r<strong>eine</strong> H<strong>im</strong>mel über euch<br />
und in euch, vielleicht denkt ihr m<strong>eine</strong>r.<br />
Ja ihr denkt an mich - <strong>eine</strong> leise Ahndung<br />
sagt es mir - unsre Seelen sind einan<strong>der</strong><br />
gegenwärtig.<br />
iebes-<br />
75<br />
brief
Schiller war zunächst in zwei Schwestern<br />
gleichzeitig verliebt, Charlotte (s<strong>eine</strong><br />
spätere Frau) und Caroline von Lengefeld.<br />
Am 29. August 1789 schreibt er beiden:<br />
Nur zwey Worte m<strong>eine</strong> Lieben, es<br />
ist Posttag und ich kann ihn nicht<br />
vorübergehen laßen, ohne euch zu<br />
grüßen. Der H<strong>im</strong>mel ist heute so<br />
heiter, und m<strong>eine</strong> Seele ist es<br />
auch — eben dacht ich, wie schön<br />
es wäre, wenn ich nur von <strong>eine</strong>m<br />
Z<strong>im</strong>mer ins andre zu gehen<br />
brauchte, um bey euch zu seyn.<br />
Ach! wenn es erst so weit seyn wird!<br />
Wenn ich jedes aufgl<strong>im</strong>mende<br />
Gefühl m<strong>eine</strong>r Seele sogleich in euer<br />
Herz überströmen kann!<br />
Ich vermuthe euch jezt <strong>im</strong> Garten,<br />
<strong>der</strong> r<strong>eine</strong> H<strong>im</strong>mel über euch und in<br />
euch, vielleicht denkt ihr m<strong>eine</strong>r.<br />
Ja ihr denkt an mich — <strong>eine</strong> leise<br />
Ahndung sagt es mir — unsre Seelen<br />
sind einan<strong>der</strong> gegenwärtig.
Schiller<br />
13<br />
77<br />
Nur zwey Worte m<strong>eine</strong> Lieben, es ist Posttag<br />
und ich kann ihn nicht vorübergehen<br />
laßen, ohne euch zu grüßen. Der H<strong>im</strong>mel<br />
ist heute so heiter, und m<strong>eine</strong> Seele ist<br />
es auch - eben dacht ich, wie schön es<br />
wäre, wenn ich nur von <strong>eine</strong>m Z<strong>im</strong>mer<br />
ins andre zu gehen brauchte, um bey euch<br />
zu seyn. Ach! wenn es erst so weit<br />
seyn wird! Wenn ich jedes aufgl<strong>im</strong>mende<br />
Gefühl m<strong>eine</strong>r Seele sogleich in euer Herz<br />
überströmen kann! Ich vermuthe euch jezt<br />
<strong>im</strong> Garten, <strong>der</strong> r<strong>eine</strong> H<strong>im</strong>mel über euch<br />
und in euch, vielleicht denkt ihr m<strong>eine</strong>r.<br />
Ja ihr denkt an mich - <strong>eine</strong> leise Ahndung<br />
sagt es mir - unsre Seelen sind einan<strong>der</strong><br />
gegenwärtig.<br />
S<br />
S13
erz-<br />
Schiller<br />
S 14<br />
lumen-<br />
79<br />
schlangen-<br />
linien
<strong>Schillers</strong> Schreibmappe mit<br />
Kritzeleien, um 1795.
Schiller<br />
14<br />
81<br />
S<br />
S14
Schiller<br />
und-<br />
S 15<br />
Winterherz-<br />
So wie das Eis wie<strong>der</strong> anfängt<br />
aufzuthauen, geht auch mein Herz<br />
und mein Denkvermögen wie<strong>der</strong><br />
auf, welches beides in den harten<br />
Wintertagen ganz erstarret war.<br />
Solang <strong>der</strong> Winter nun dauert,<br />
bin ich unaufhörlich von <strong>eine</strong>m<br />
Catarrh geplagt, <strong>der</strong> mich in<br />
<strong>der</strong> That sehr angreift und fast<br />
allen Lebensmuth ertödet.<br />
83
Am 20. Januar 1805 (wenige Monate vor<br />
s<strong>eine</strong>m Tod am 8. Mai 1805) schrieb<br />
Schiller an s<strong>eine</strong>n Freund Körner:<br />
So wie das Eis wie<strong>der</strong> anfängt<br />
aufzuthauen, geht auch mein Herz<br />
und mein Denkvermögen wie<strong>der</strong><br />
auf, welches beides in den harten<br />
Wintertagen ganz erstarret war.<br />
Solang <strong>der</strong> Winter nun dauert, bin<br />
ich unaufhörlich von <strong>eine</strong>m Catarrh<br />
geplagt, <strong>der</strong> mich in <strong>der</strong> That sehr<br />
angreift und fast allen Lebensmuth<br />
ertödet.
Schiller<br />
15<br />
85<br />
So wie das Eis wie<strong>der</strong> anfängt<br />
aufzuthauen, geht auch mein Herz<br />
und mein Denkvermögen wie<strong>der</strong><br />
auf, welches beides in den harten<br />
Wintertagen ganz erstarret war.<br />
Solang <strong>der</strong> Winter nun dauert,<br />
bin ich unaufhörlich von <strong>eine</strong>m<br />
Catarrh geplagt, <strong>der</strong> mich in<br />
<strong>der</strong> That sehr angreift und fast<br />
allen Lebensmuth ertödet.<br />
S<br />
S15
Schiller<br />
87<br />
chillerschatten<br />
S 161
Zopf, Uniformkragen bis zum Haaransatz<br />
und Spitzenjabot waren Vorschrift:<br />
das früheste Porträt von Schiller, <strong>eine</strong><br />
um 1774 in <strong>der</strong> Karlsschule entstandene<br />
getuschte Silhouette.
Schiller<br />
16<br />
89<br />
S<br />
S16
ot<br />
Schiller<br />
91<br />
S 17<br />
chiller-
Feuerkopf mit<br />
rotblonden Haaren,<br />
geröteten Wangen,<br />
gebogener Nase und<br />
offenem, weit über<br />
die Jacke gelegten<br />
Hemdkragen: ein<br />
s<strong>eine</strong>m an <strong>der</strong> Karlsschule<br />
als Maler<br />
ausgebildeten<br />
Schulkameraden<br />
Jakob Friedrich<br />
Weckherlin<br />
zugeschriebenes<br />
Schiller-Porträt,<br />
auf 1780 datiert.<br />
Eventuell wurde<br />
das stark übermalte<br />
Gemälde erst <strong>im</strong><br />
Nachhinein zu <strong>eine</strong>m<br />
Schiller-Porträt<br />
umgedeutet.
Schiller<br />
17<br />
93<br />
S<br />
S17
Schiller<br />
äuber-<br />
95<br />
porträt<br />
S 18
1783/84 für den Verkauf in Buchhandlungen<br />
entstandene Radierung nach <strong>eine</strong>m Gemälde des<br />
Ludwigsburger Porzellanmalers Friedrich Kirschner,<br />
die Schiller mit Zopf, gebogener Nase und schwerem<br />
Kinn <strong>im</strong> Profil über <strong>eine</strong>r Szene aus den Räubern<br />
zeigt: „[...] <strong>der</strong> Kupferstecher hat mir fünfzehn<br />
Jahre mehr auf die Rechnung gesetzt,<br />
als ich mich erinnre, gelebt<br />
zu haben.“
Schiller<br />
18<br />
97<br />
S<br />
S18
Freund-<br />
chafts-<br />
Schiller<br />
S 19<br />
99<br />
eichnung
1787 kurz vor <strong>Schillers</strong> Abreise aus Dresden entstandene und<br />
als Geschenk für <strong>Schillers</strong> Schwiegermutter 1790/91 kopierte<br />
Silberstift-Zeichnung von Dora Stock.
Schiller<br />
19<br />
101<br />
S<br />
S19
Schiller<br />
ool<br />
Schiller-<br />
S 20<br />
103
Lässig, mit breitkrempigem Hut<br />
und langer Pfeife auf <strong>eine</strong>m Esel:<br />
Schiller, 1787 gezeichnet von<br />
s<strong>eine</strong>m Freund, dem Maler Johann<br />
Christian Reinhart.
Schiller<br />
20<br />
105<br />
S<br />
S20
Schiller<br />
107<br />
chillerschatten<br />
S 21
Schiller auf <strong>eine</strong>m wohl nach 1805 entstandenen<br />
Scherenschnitt von Luise Duttenhofer.<br />
Mit <strong>der</strong> rechten Hand hält <strong>der</strong> Dichter das Buch,<br />
mit <strong>der</strong> linken klopft er das Versmaß. Eine<br />
nächtlich-romantische Szene? Der Uhu in <strong>der</strong> Ruine<br />
hört jedenfalls aufmerksam und verwun<strong>der</strong>t zu.
Schiller<br />
21<br />
109<br />
S<br />
S21
Schiller<br />
111<br />
chillerschatten<br />
S 22
„Schiller’s Apotheose“<br />
-- Scherenschnitt von<br />
Luise Duttenhofer nach dem<br />
Vorbild von Danneckers<br />
Schillerbüste entstanden.<br />
Im Kahn wartet schon <strong>der</strong><br />
Fährmann Charon, um den<br />
Dichter über den Styx ins<br />
Jenseits überzusetzen,<br />
und die Lyra liegt bereit<br />
– das Instrument, das<br />
<strong>der</strong> Götterbote und<br />
Seelenbegleiter Hermes<br />
erfunden und s<strong>eine</strong>m<br />
Bru<strong>der</strong> Apollo, dem<br />
Gott <strong>der</strong> Poesie, geschenkt<br />
hat. Schiller<br />
liest dieweil noch in<br />
aller Seelenruhe. S<strong>eine</strong><br />
Jünger tragen auf dieser<br />
antikisch stilisierten<br />
H<strong>im</strong>melfahrt die Schleppe<br />
und halten ihm den<br />
Lorbeer über den Kopf.
Schiller<br />
22<br />
113<br />
S<br />
S22
Schiller-<br />
locken-<br />
Schiller<br />
S 23<br />
os<br />
115
Schiller, 1804 nach <strong>eine</strong>m Treffen mit<br />
Johann Gottfried Schadow in Berlin<br />
von diesem gezeichnet (hier von Horst<br />
Janssen 1975 in <strong>eine</strong> Radierung<br />
umgesetzt).
Schiller<br />
23<br />
117<br />
S<br />
S23
Schiller<br />
Haus-<br />
S 24<br />
bild<br />
119
Erstmals offenes Haar und die Hand auf<br />
<strong>der</strong> Tabaksdose: Ein von <strong>Schillers</strong><br />
Freund Christian Gottfried Körner bei<br />
dem Dresdner Porträtmaler Anton Graff<br />
1786 in Auftrag gegebenes Porträt in<br />
<strong>der</strong> Kopie von Dora Stock, die 1794/95<br />
das Bild in Pastell kopierte, damit<br />
Schiller ein Exemplar zu Hause hatte.
Schiller<br />
24<br />
121<br />
S<br />
S24
vorbild<br />
123<br />
Schiller<br />
chiller-<br />
S 25
Der Urvater aller Dichter, Homer,<br />
steht über allem <strong>im</strong> Hintergrund:<br />
Schiller auf <strong>eine</strong>m Gemälde, das<br />
die Ludwigsburger Jugendfreundin<br />
Ludovike S<strong>im</strong>anowiz 1793/94 malte.
Schiller<br />
25<br />
125<br />
S<br />
S25
Schiller<br />
127<br />
S 26<br />
Marmorchiller-<br />
locke
Marmorlocke, die Johann Heinrich von<br />
Dannecker angeblich in geistiger Umnachtung<br />
von s<strong>eine</strong>r Schiller-Büste abgeschlagen hat:<br />
„Mit herzlich [sic] Dank für die schöne<br />
Musik / Director v. Dannecker / Stuttgart<br />
d. 20ten Nov / 1838.“<br />
Vermutlich wollte<br />
Dannecker durch<br />
die Reduktion <strong>der</strong><br />
Lockenfülle das<br />
Porträt in <strong>eine</strong><br />
an<strong>der</strong>e Bildtradition<br />
stellen:<br />
vom lockenköpfigen<br />
Apoll hin zu<br />
Christus mit<br />
strähnigen Haaren.
Schiller<br />
26<br />
129<br />
S<br />
S26
Schiller<br />
131<br />
chillerschatten<br />
S 274
Scherenschnitt, den Dannecker<br />
1805 nach <strong>Schillers</strong> Totenmaske<br />
als Grundlage für die Arbeit<br />
an <strong>der</strong> Kolossalbüste fertigte.
Schiller<br />
27<br />
133<br />
S<br />
S27
Schiller<br />
135<br />
chillerschatten<br />
S 28
Schiller offiziell <strong>im</strong><br />
„frac à la française“<br />
auf <strong>eine</strong>m anonymen<br />
Scherenschnitt aus den<br />
1790er-Jahren.
Schiller<br />
28<br />
137<br />
S<br />
S28
Schiller<br />
chillereiche<br />
S 29<br />
139
Entfloh’n <strong>der</strong> Schule bangen Räumen<br />
Las Schiller unter Tannenbäumen<br />
Schiller trägt <strong>im</strong> Bopserwald bei Stuttgart<br />
den Mitschülern die Räuber vor. Der Mitschüler<br />
Victor Wilhelm Heideloff zeichnete die Szene<br />
zuerst, sein Sohn Karl Alexan<strong>der</strong> variierte sie<br />
dann Mitte des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts mehrfach, ein<br />
Exemplar wird von Justinus Kerner kommentiert:<br />
Sein erstes Schauspiel, das von Moor,<br />
Fünf ihm gefolgten Freunden vor.<br />
Bald bald doch unter deutschen Eichen<br />
Sah man ein ganzes Volk ihm reichen,<br />
Ihm, schon umstrahlt vom Dichterglanz<br />
<strong>der</strong> deutschen Eiche Siegerkranz.
Schiller<br />
29<br />
141<br />
S<br />
S29
Schiller<br />
S 30<br />
chillerut<br />
143
Le<strong>der</strong>ner Hut, mit herunterklappbaren Seiten<br />
gegen Wind und Regen. Schiller soll ihn<br />
als Karlsschüler getragen haben; bei s<strong>eine</strong>m<br />
Eintritt 1773 wird ein „ordentlicher Hut“<br />
aufgeführt.
Schiller<br />
30<br />
145<br />
S<br />
S30
Schiller<br />
S 31<br />
chilleranzug<br />
147
Zwei von drei in Marbach überlieferten Westen<br />
<strong>Schillers</strong> und zwei Hosen aus <strong>Schillers</strong> Besitz.
Schiller<br />
31<br />
149<br />
S<br />
S31
Schiller<br />
S 32<br />
chillersocken<br />
151
Seidene Strümpfe mit um 1800 hochmodischen<br />
Längsstreifen, aus <strong>Schillers</strong> Besitz.
Schiller<br />
32<br />
153<br />
S<br />
S32
Schiller<br />
S 33<br />
Kostümparty<br />
155
Schärpe, die Alexan<strong>der</strong> von Humboldt 1804 Schiller<br />
aus Brasilien mitgebracht haben soll, <strong>der</strong> sie<br />
dann -- so wird berichtet -- auf <strong>eine</strong>m Kostümfest,<br />
wohl in Manier <strong>der</strong> französischen Revolutionäre<br />
als bauschigen Gürtel um die Hüfte geschlungen,<br />
getragen hat.
Schiller<br />
33<br />
157<br />
S<br />
S33
Schiller<br />
S 34<br />
Farbenhantasie<br />
159
Wollschal aus dem Besitz von <strong>Schillers</strong> Schwester Christophine.<br />
Das auffällige Muster erinnert an ein Phänomen, das Schiller<br />
1797 Goethe schil<strong>der</strong>t: „Ich betrachtete damit [mit <strong>eine</strong>m gelben<br />
Glas] die Gegenstände vor m<strong>eine</strong>m Fenster, und hielt es so<br />
weit horizontal vor das Auge, daß es mir zu gleicher Zeit die<br />
Gegenstände unter demselben zeigte, und auf s<strong>eine</strong>r Fläche<br />
den blauen H<strong>im</strong>mel abspiegelte, und so erschienen mir an den<br />
hochgelb gefärbten Gegenständen alle die Stellen hell<br />
purpurfarbig [...].“
Schiller<br />
34<br />
161<br />
S<br />
S34
Schiller<br />
Räuber<br />
sein<br />
S 35<br />
Luft holen für<br />
<strong>eine</strong>n langen Atem<br />
– Schiller<br />
spielen<br />
Man nehme dieses Schauspiel für nichts An<strong>der</strong>es, als <strong>eine</strong><br />
dramatische Geschichte, die die Vortheile <strong>der</strong> dramatischen<br />
Methode, die Seele gleichsam bei ihren gehe<strong>im</strong>sten<br />
Operationen zu ertappen, benutzt, ohne sich übrigens in<br />
die Schranken <strong>eine</strong>s Theaterstücks einzuzäunen.<br />
Wer sich den Zweck vorgezeichnet hat, das Laster zu stürzen<br />
und Religion, Moral und bürgerliche Gesetze an ihren<br />
Feinden zu rächen, ein solcher muß das Laster in s<strong>eine</strong>r<br />
nackten Abscheulichkeit enthüllen und in s<strong>eine</strong>r kolossalischen<br />
Größe vor das Auge <strong>der</strong> Menschheit stellen, – er<br />
selbst muß augenblicklich s<strong>eine</strong> nächtlichen Labyrinthe<br />
durchwan<strong>der</strong>n, – er muß sich in Empfindungen hineinzuzwingen<br />
wissen, unter <strong>der</strong>en Wi<strong>der</strong>natürlichkeit sich s<strong>eine</strong><br />
Seele sträubt.<br />
163<br />
Ich habe versucht, von <strong>eine</strong>m Mißmenschen dieser Art ein<br />
treffendes, lebendiges Conterfei hinzuwerfen, die vollständige<br />
Mechanik s<strong>eine</strong>s Laster systems auseinan<strong>der</strong> zu<br />
glie<strong>der</strong>n – und ihre Kraft an <strong>der</strong> Wahrheit zu prüfen.<br />
Übung 1:<br />
Bauch und Lunge /<br />
Luft holen für<br />
<strong>eine</strong>n langen Atem
<strong>Schillers</strong> erstes und zu<br />
Lebzeiten erfolgreichstes Schauspiel<br />
wird in Gang gesetzt, indem <strong>der</strong><br />
hässliche Franz Moor s<strong>eine</strong>n älteren,<br />
schöneren Bru<strong>der</strong> Karl be<strong>im</strong> Vater durch<br />
<strong>eine</strong>n gefälschten Brief verleumdet:<br />
Sein Lieblingssohn werde nach <strong>eine</strong>m<br />
Mord steckbrieflich gesucht. Dem Bru<strong>der</strong><br />
schickt er ebenfalls <strong>eine</strong>n gefälschten<br />
Brief: Der Vater verstoße ihn. Karl,<br />
<strong>der</strong> für die Unterdrückten kämpfen will,<br />
schließt sich daraufhin <strong>eine</strong>r Räuberbande<br />
an; auch das edle Ziel ist auf<br />
schlechte Taten angewiesen: Raub und<br />
Totschlag. Am Ende tötet Franz sich<br />
selbst, Karl dagegen löst durch sein<br />
Geständnis, ein Räuber zu sein, den Tod<br />
des Vaters aus, ersticht s<strong>eine</strong> Geliebte<br />
Amalia und stellt sich, das Todesurteil<br />
vor Augen, freiwillig. An<strong>der</strong>s als <strong>im</strong><br />
Märchen gewinnt am Ende das Gute und<br />
Schöne nicht eindeutig gegen das Böse<br />
und Hässliche. Längst ist die Welt<br />
unter moralischen Gesichtspunkten nicht<br />
mehr so einfach zu fassen.<br />
Die Räuber waren bei ihrer Erstaufführung<br />
am 13. Januar 1782 in Mannhe<strong>im</strong><br />
ein Ereignis: „Das Theater glich <strong>eine</strong>m<br />
Irrenhause, rollende Augen, geballte<br />
Fäuste, stampfende Füße, heisere<br />
Aufschreie <strong>im</strong> Zuschauerraum! Fremde<br />
Menschen fielen einan<strong>der</strong> schluchzend in<br />
die Arme, Frauen wankten, <strong>eine</strong>r<br />
Ohnmacht nahe, zur Thüre. Es war <strong>eine</strong><br />
allgem<strong>eine</strong> Auflösung wie <strong>im</strong> Chaos, aus<br />
deßen Nebeln <strong>eine</strong> neue Schöpfung<br />
hervorbricht!“ Bertolt Brecht deutet<br />
sie an<strong>der</strong>thalb Jahrhun<strong>der</strong>te später<br />
als Sieg des Theatralischen über die<br />
abgebildete Wirklichkeit: „Schiller<br />
arbeitet die dramatischen Szenen aus,<br />
auch die Monologe, legt großen Wert auf<br />
die ›Schönheiten‹ und legt sorgfältig<br />
s<strong>eine</strong> Effekte an. Alles zielt darauf ab,<br />
Begeisterung zu erwecken, mitzureißen,<br />
zu entzücken, moralisch wie ästhetisch,<br />
hochgesinnte Charaktere, spannende<br />
Verwicklungen, rhetorische Explosionen,<br />
Ausstellungen starker Leidenschaften,<br />
Anzettelung atemrauben<strong>der</strong> Kontroversen.“<br />
Wie allein mit <strong>der</strong> Sprache so große<br />
Emotionen erzeugt und so starke Figuren<br />
zum Leben erweckt werden können, steht<br />
<strong>im</strong> Mittelpunkt dieses Ausstellungsexper<strong>im</strong>ents.<br />
<strong>Schillers</strong> Schreiben zielt<br />
auf die Bewegung <strong>der</strong> Seele wie des<br />
Körpers und verwickelt <strong>eine</strong>n von Kopf<br />
bis Fuß, dass <strong>eine</strong>m manchmal um ein<br />
Haar Hören und Sehen vergeht und nichts<br />
mehr zu sitzen scheint, wo es hingehört.<br />
Das prägt sein Leben wie sein<br />
Werk, ist an s<strong>eine</strong>m Nachlass wie an<br />
s<strong>eine</strong>n Texten sichtbar. Vom Satzzeichen<br />
und Wortklang über den Aufbau <strong>eine</strong>s<br />
Satzes hin zur Reihung in <strong>eine</strong>r<br />
längeren Passage, vom Tätigkeitswort<br />
hin zum Begriff provozieren diese,<br />
dass man sie sich m<strong>im</strong>isch vorstellt –<br />
mit Bauch und Lunge, Mund und Augen,<br />
Händen, Haltung, B<strong>eine</strong>n und Füßen.
Schiller<br />
Luft holen für<br />
<strong>eine</strong>n langen Atem<br />
35<br />
165<br />
Man nehme dieses Schauspiel für nichts An<strong>der</strong>es, als <strong>eine</strong><br />
dramatische Geschichte, die die Vortheile <strong>der</strong> dramatischen<br />
Methode, die Seele gleichsam bei ihren gehe<strong>im</strong>sten<br />
Operationen zu ertappen, benutzt, ohne sich übrigens in<br />
die Schranken <strong>eine</strong>s Theaterstücks einzuzäunen.<br />
Wer sich den Zweck vorgezeichnet hat, das Laster zu stürzen<br />
und Religion, Moral und bürgerliche Gesetze an ihren<br />
Feinden zu rächen, ein solcher muß das Laster in s<strong>eine</strong>r<br />
nackten Abscheulichkeit enthüllen und in s<strong>eine</strong>r kolossalischen<br />
Größe vor das Auge <strong>der</strong> Menschheit stellen, – er<br />
selbst muß augenblicklich s<strong>eine</strong> nächtlichen Labyrinthe<br />
durchwan<strong>der</strong>n, – er muß sich in Empfindungen hineinzuzwingen<br />
wissen, unter <strong>der</strong>en Wi<strong>der</strong>natürlichkeit sich s<strong>eine</strong><br />
Seele sträubt.<br />
Ich habe versucht, von <strong>eine</strong>m Mißmenschen dieser Art ein<br />
treffendes, lebendiges Conterfei hinzuwerfen, die vollständige<br />
Mechanik s<strong>eine</strong>s Laster systems auseinan<strong>der</strong> zu<br />
glie<strong>der</strong>n – und ihre Kraft an <strong>der</strong> Wahrheit zu prüfen.<br />
S<br />
S35
Schiller<br />
Räuber<br />
sein<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
GRIMM<br />
SCHWEIZER<br />
SCHWEIZER<br />
S 36<br />
An die Füße<br />
denken<br />
– Schiller<br />
spielen<br />
unruhig <strong>im</strong> Z<strong>im</strong>mer auf und ab gehend<br />
wild auf ihn losgehend<br />
fällt in <strong>eine</strong>n Stuhl<br />
aufgesprungen<br />
wirft sich in s<strong>eine</strong>m Sessel herum in schrecklichen Bewegungen<br />
umarmt ihn ungestüm<br />
auf den Knieen<br />
auf Brust und Stirn schlagend<br />
steht auf<br />
reißt s<strong>eine</strong> goldene Hutschnur ab und erdrosselt sich<br />
stößt an die Leiche<br />
rüttelt ihn<br />
tritt von ihm weg und schießt sich vor die Stirn<br />
167<br />
Übung 2:<br />
B<strong>eine</strong> und Füße /<br />
An die Füße denken /<br />
Umarmt auseinan<strong>der</strong>laufen
Schiller provoziert, dass<br />
man sich s<strong>eine</strong> Texte m<strong>im</strong>isch vorstellt<br />
– mit Bauch und Lunge, Mund und Augen,<br />
Händen, Haltung, B<strong>eine</strong>n und Füßen wie<br />
hier in Die Räuber.
Schiller<br />
36<br />
169<br />
An die Füße<br />
denken<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
FRANZ<br />
GRIMM<br />
SCHWEIZER<br />
SCHWEIZER<br />
unruhig <strong>im</strong> Z<strong>im</strong>mer auf und ab gehend<br />
wild auf ihn losgehend<br />
fällt in <strong>eine</strong>n Stuhl<br />
aufgesprungen<br />
wirft sich in s<strong>eine</strong>m Sessel herum in schrecklichen Bewegungen<br />
umarmt ihn ungestüm<br />
auf den Knieen<br />
auf Brust und Stirn schlagend<br />
steht auf<br />
reißt s<strong>eine</strong> goldene Hutschnur ab und erdrosselt sich<br />
stößt an die Leiche<br />
rüttelt ihn<br />
tritt von ihm weg und schießt sich vor die Stirn<br />
S<br />
S36
Schiller<br />
Räuber<br />
Umarmt<br />
auseinan<strong>der</strong>laufen<br />
sein<br />
DER ALTE<br />
MOOR<br />
KARL<br />
Amalia! M<strong>eine</strong> Tochter! Amalia!<br />
hält sie in s<strong>eine</strong>n Armen gepreßt<br />
zurückspringend<br />
Wer bringt dies Bild vor m<strong>eine</strong> Augen?<br />
– Schiller<br />
spielen<br />
AMALIA entspringt dem Alten, springt auf den Räuber<br />
zu und umschlingt ihn entzückt<br />
Ich hab’ ihn, o ihr Sterne! Ich hab’ ihn! –<br />
171<br />
S 37<br />
KARL<br />
sich losreißend, zu den Räubern<br />
Brecht auf, ihr! [...] Reißt sie von m<strong>eine</strong>m Halse!<br />
Tödtet sie! Tödtet ihn! mich! euch! Alles!<br />
Die ganze Welt geh zu Grunde! Er will davon<br />
AMALIA<br />
Wohin? was? Liebe – Ewigkeit!<br />
Wonn’ – Unendlichkeit! und du fliehst?<br />
KARL<br />
AMALIA<br />
Weg, weg! – Unglückseligste <strong>der</strong> Bräute! – Schau<br />
selbst, frage selbst, höre! – Unglückseligster<br />
<strong>der</strong> Väter! Laß mich <strong>im</strong>mer ewig davon rennen!<br />
Haltet mich! Um Gotteswillen, haltet mich! –<br />
Übung 3:<br />
B<strong>eine</strong> und Füße /<br />
Umarmt auseinan<strong>der</strong>laufen
Schiller provoziert,<br />
dass man sich s<strong>eine</strong> Texte mit<br />
dem ganzen Körper vorstellt – mit<br />
Bauch und Lunge, Mund und Augen,<br />
Händen, Haltung, B<strong>eine</strong>n und Füßen<br />
wie hier in Die Räuber.
Schiller<br />
37<br />
173<br />
Umarmt<br />
auseinan<strong>der</strong>laufen<br />
DER ALTE<br />
MOOR<br />
KARL<br />
AMALIA<br />
KARL<br />
AMALIA<br />
KARL<br />
AMALIA<br />
Amalia! M<strong>eine</strong> Tochter! Amalia!<br />
hält sie in s<strong>eine</strong>n Armen gepreßt<br />
zurückspringend<br />
Wer bringt dies Bild vor m<strong>eine</strong> Augen?<br />
entspringt dem Alten, springt auf den Räuber<br />
zu und umschlingt ihn entzückt<br />
Ich hab’ ihn, o ihr Sterne! Ich hab’ ihn! –<br />
sich losreißend, zu den Räubern<br />
Brecht auf, ihr! [...] Reißt sie von m<strong>eine</strong>m Halse!<br />
Tödtet sie! Tödtet ihn! mich! euch! Alles!<br />
Die ganze Welt geh zu Grunde! Er will davon<br />
Wohin? was? Liebe – Ewigkeit!<br />
Wonn’ – Unendlichkeit! und du fliehst?<br />
Weg, weg! – Unglückseligste <strong>der</strong> Bräute! – Schau<br />
selbst, frage selbst, höre! – Unglückseligster<br />
<strong>der</strong> Väter! Laß mich <strong>im</strong>mer ewig davon rennen!<br />
Haltet mich! Um Gotteswillen, haltet mich! –<br />
S<br />
S37
Schiller<br />
Räuber<br />
sein<br />
Sich be<strong>im</strong> Sprechen<br />
allmählich ansehen<br />
FRANZ Ich muß diese Papiere vollends<br />
aufheben, wie leicht könnte Jemand<br />
m<strong>eine</strong> Handschrift kennen?<br />
Er liest die zerrissenen Briefstücke<br />
zusammen.<br />
– Schiller<br />
spielen<br />
175<br />
S 38<br />
Und Gram wird auch den Alten bald<br />
fortschaffen, – und ihr muß ich diesen<br />
Karl aus dem Herzen reißen, wenn auch<br />
ihr halbes Leben dran hängen bleiben<br />
sollte. [...] - Warum bin ich nicht<br />
<strong>der</strong> Erste aus dem Mutterleib gekrochen?<br />
warum nicht <strong>der</strong> Einzige? Warum mußte<br />
sie mir diese Bürde von Häßlichkeit<br />
aufladen? gerade mir? Nicht an<strong>der</strong>s, als<br />
ob sie bei m<strong>eine</strong>r Geburt <strong>eine</strong>n Rest<br />
gesetzt hätte. Warum gerade mir die<br />
Lapplän<strong>der</strong>snase? gerade mir dieses<br />
Mohrenmaul? diese Hottentottenaugen?<br />
Übung 4:<br />
Augen und Mund /<br />
Sich be<strong>im</strong> Sprechen<br />
allmählich ansehen
Schiller provoziert,<br />
dass man sich s<strong>eine</strong> Texte mit<br />
dem ganzen Körper vorstellt – mit<br />
Bauch und Lunge, Mund und Augen,<br />
Händen, Haltung, B<strong>eine</strong>n und Füßen<br />
wie hier in Die Räuber.
Schiller<br />
38<br />
177<br />
Sich be<strong>im</strong> Sprechen<br />
allmählich ansehen<br />
FRANZ Ich muß diese Papiere vollends<br />
aufheben, wie leicht könnte Jemand<br />
m<strong>eine</strong> Handschrift kennen?<br />
Er liest die zerrissenen Briefstücke<br />
zusammen.<br />
Und Gram wird auch den Alten bald<br />
fortschaffen, – und ihr muß ich diesen<br />
Karl aus dem Herzen reißen, wenn auch<br />
ihr halbes Leben dran hängen bleiben<br />
sollte. [...] - Warum bin ich nicht<br />
<strong>der</strong> Erste aus dem Mutterleib gekrochen?<br />
warum nicht <strong>der</strong> Einzige? Warum mußte<br />
sie mir diese Bürde von Häßlichkeit<br />
aufladen? gerade mir? Nicht an<strong>der</strong>s, als<br />
ob sie bei m<strong>eine</strong>r Geburt <strong>eine</strong>n Rest<br />
gesetzt hätte. Warum gerade mir die<br />
Lapplän<strong>der</strong>snase? gerade mir dieses<br />
Mohrenmaul? diese Hottentottenaugen?<br />
S<br />
S38
Schiller<br />
Räuber<br />
DER ALTE<br />
MOOR<br />
AMALIA<br />
Anfassen<br />
sein<br />
DER ALTE<br />
MOOR<br />
AMALIA<br />
träumend<br />
Mein Sohn! mein Sohn! mein Sohn!<br />
ergreift s<strong>eine</strong> Hand Horch, horch! sein Sohn<br />
ist in s<strong>eine</strong>n Träumen.<br />
– Schiller<br />
spielen<br />
Bist du da? bist du wirklich? Ach wie siehst<br />
du so elend! Sieh mich nicht an mit diesem<br />
kummervollen Blick! ich bin elend genug.<br />
weckt ihn schnell Seht auf, lieber Greis! Ihr<br />
träumtet nur. Faßt Euch!<br />
179<br />
S 39<br />
DER ALTE<br />
MOOR<br />
halb wach Er war nicht da? drückt‘ ich nicht<br />
s<strong>eine</strong> Hände? [...] Wo ist er? wo? wo bin ich?<br />
Du da, Amalia? [...] Mir träumte von m<strong>eine</strong>m<br />
Sohn. Warum hab’ ich nicht fortgeträumt?<br />
Vielleicht hätt‘ ich Verzeihung erhalten aus<br />
s<strong>eine</strong>m Munde.<br />
AMALIA<br />
Engel grollen nicht – er verzeiht Euch.<br />
Faßt s<strong>eine</strong> Hand mit Wehmut<br />
Vater m<strong>eine</strong>s Karls! ich verzeih‘ Euch.<br />
DER ALTE<br />
MOOR<br />
Übung 5:<br />
AMALIA<br />
Nein, m<strong>eine</strong> Tochter! diese Todtenfarbe d<strong>eine</strong>s<br />
Angesichts verdammt den Vater. Armes Mädchen!<br />
Ich brachte dich um die Freuden d<strong>eine</strong>r<br />
Jugend – o fluche mir nicht!<br />
küßt s<strong>eine</strong> Hand mit Zärtlichkeit<br />
Hände /<br />
Anfassen
Schiller provoziert,<br />
dass man sich s<strong>eine</strong> Texte mit<br />
dem ganzen Körper vorstellt – mit<br />
Bauch und Lunge, Mund und Augen,<br />
Händen, Haltung, B<strong>eine</strong>n und Füßen<br />
wie hier in Die Räuber.
Schiller<br />
Anfassen<br />
39<br />
181<br />
DER ALTE<br />
MOOR<br />
AMALIA<br />
DER ALTE<br />
MOOR<br />
AMALIA<br />
DER ALTE<br />
MOOR<br />
AMALIA<br />
DER ALTE<br />
MOOR<br />
AMALIA<br />
träumend<br />
Mein Sohn! mein Sohn! mein Sohn!<br />
ergreift s<strong>eine</strong> Hand Horch, horch! sein Sohn<br />
ist in s<strong>eine</strong>n Träumen.<br />
Bist du da? bist du wirklich? Ach wie siehst<br />
du so elend! Sieh mich nicht an mit diesem<br />
kummervollen Blick! ich bin elend genug.<br />
weckt ihn schnell Seht auf, lieber Greis! Ihr<br />
träumtet nur. Faßt Euch!<br />
halb wach Er war nicht da? drückt‘ ich nicht<br />
s<strong>eine</strong> Hände? [...] Wo ist er? wo? wo bin ich?<br />
Du da, Amalia? [...] Mir träumte von m<strong>eine</strong>m<br />
Sohn. Warum hab’ ich nicht fortgeträumt?<br />
Vielleicht hätt‘ ich Verzeihung erhalten aus<br />
s<strong>eine</strong>m Munde.<br />
Engel grollen nicht – er verzeiht Euch.<br />
Faßt s<strong>eine</strong> Hand mit Wehmut<br />
Vater m<strong>eine</strong>s Karls! ich verzeih‘ Euch.<br />
Nein, m<strong>eine</strong> Tochter! diese Todtenfarbe d<strong>eine</strong>s<br />
Angesichts verdammt den Vater. Armes Mädchen!<br />
Ich brachte dich um die Freuden d<strong>eine</strong>r<br />
Jugend – o fluche mir nicht!<br />
küßt s<strong>eine</strong> Hand mit Zärtlichkeit<br />
S<br />
S39
Schiller<br />
Räuber<br />
sein<br />
KARL MOOR<br />
S 40<br />
Gegen die<br />
Wand rennen<br />
– Schiller<br />
spielen<br />
auffahrend aus <strong>eine</strong>r schrecklichen Pause<br />
Betrogen, betrogen! da fährt es<br />
über m<strong>eine</strong> Seele wie <strong>der</strong> Blitz! - [...]<br />
H<strong>im</strong>mel und Hölle! Nicht du, Vater!<br />
Spitzbübische Künste! Mör<strong>der</strong>,<br />
Räuber durch spitzbübische Künste!<br />
– voll Liebe sein Herz – oh ich<br />
Ungeheuer von <strong>eine</strong>m Thoren – voll<br />
Liebe sein Vaterherz – oh Schelmerei,<br />
Schelmerei! Es hätte mich <strong>eine</strong>n<br />
Fußfall gekostet – es hätte mich <strong>eine</strong><br />
Thräne gekostet – oh ich blö<strong>der</strong>,<br />
blö<strong>der</strong>, blö<strong>der</strong> Thor!<br />
wi<strong>der</strong> die Wand rennend<br />
183<br />
Übung 6:<br />
Der ganze Körper /<br />
Gegen die Wand rennen
Schiller provoziert,<br />
dass man sich s<strong>eine</strong> Texte mit<br />
dem ganzen Körper vorstellt – mit<br />
Bauch und Lunge, Mund und Augen,<br />
Händen, Haltung, B<strong>eine</strong>n und Füßen<br />
wie hier in Die Räuber.
Schiller<br />
40<br />
185<br />
Gegen die<br />
Wand rennen<br />
KARL MOOR<br />
auffahrend aus <strong>eine</strong>r schrecklichen Pause<br />
Betrogen, betrogen! da fährt es<br />
über m<strong>eine</strong> Seele wie <strong>der</strong> Blitz! - [...]<br />
H<strong>im</strong>mel und Hölle! Nicht du, Vater!<br />
Spitzbübische Künste! Mör<strong>der</strong>,<br />
Räuber durch spitzbübische Künste!<br />
– voll Liebe sein Herz – oh ich<br />
Ungeheuer von <strong>eine</strong>m Thoren – voll<br />
Liebe sein Vaterherz – oh Schelmerei,<br />
Schelmerei! Es hätte mich <strong>eine</strong>n<br />
Fußfall gekostet – es hätte mich <strong>eine</strong><br />
Thräne gekostet – oh ich blö<strong>der</strong>,<br />
blö<strong>der</strong>, blö<strong>der</strong> Thor!<br />
wi<strong>der</strong> die Wand rennend<br />
S<br />
S40
Schiller<br />
Räuber<br />
sein<br />
AMALIA<br />
S 41<br />
Wie<br />
angewurzelt<br />
Übung 7:<br />
– Schiller<br />
spielen<br />
<strong>im</strong> Garten<br />
Du weinst, Amalia? – und das sprach<br />
er mit <strong>eine</strong>r St<strong>im</strong>me, mit <strong>eine</strong>r St<strong>im</strong>me –<br />
mir war’s, als ob die Natur sich<br />
verjüngte – die genossenen Lenze <strong>der</strong><br />
Liebe dämmerten auf mit <strong>der</strong> St<strong>im</strong>me!<br />
Die Nachtigall schlug wie damals – die<br />
Blumen hauchten wie damals – und ich<br />
lag wonneberauscht an s<strong>eine</strong>m Hals - [...]<br />
Du weinst, Amalia? – Ha, ich will ihn<br />
fliehen! – fliehen! - [...]<br />
Räuber Moor öffnet die Gartenthüre.<br />
Amalia fährt zusammen. [...] Sie wird<br />
Karl gewahr und springt auf<br />
Er – wohin? – was? – da hat mich’s<br />
angewurzelt, daß ich nicht fliehen kann –<br />
Der ganze Körper /<br />
Wie angewurzelt<br />
187
Schiller provoziert,<br />
dass man sich s<strong>eine</strong> Texte mit<br />
dem ganzen Körper vorstellt – mit<br />
Bauch und Lunge, Mund und Augen,<br />
Händen, Haltung, B<strong>eine</strong>n und Füßen<br />
wie hier in Die Räuber.
Schiller<br />
41<br />
189<br />
Wie<br />
angewurzelt<br />
AMALIA<br />
<strong>im</strong> Garten<br />
Du weinst, Amalia? – und das sprach<br />
er mit <strong>eine</strong>r St<strong>im</strong>me, mit <strong>eine</strong>r St<strong>im</strong>me –<br />
mir war’s, als ob die Natur sich<br />
verjüngte – die genossenen Lenze <strong>der</strong><br />
Liebe dämmerten auf mit <strong>der</strong> St<strong>im</strong>me!<br />
Die Nachtigall schlug wie damals – die<br />
Blumen hauchten wie damals – und ich<br />
lag wonneberauscht an s<strong>eine</strong>m Hals - [...]<br />
Du weinst, Amalia? – Ha, ich will ihn<br />
fliehen! – fliehen! - [...]<br />
Räuber Moor öffnet die Gartenthüre.<br />
Amalia fährt zusammen. [...] Sie wird<br />
Karl gewahr und springt auf<br />
Er – wohin? – was? – da hat mich’s<br />
angewurzelt, daß ich nicht fliehen kann –<br />
S<br />
S41
Schiller<br />
sicht<br />
Welt-<br />
*<br />
¬<br />
¬<br />
¬<br />
¬<br />
S 42<br />
191
Schiller beurteilte den zehn Jahre jüngeren Alexan<strong>der</strong> von Humboldt<br />
zunächst skeptisch: „Über Alexan<strong>der</strong>n habe ich noch kein rechtes Urtheil;<br />
ich fürchte aber, trotz aller s<strong>eine</strong>r Talente und s<strong>eine</strong>r rastlosen<br />
Thätigkeit wird er in s<strong>eine</strong>r Wissenschaft nie etwas Großes leisten. […]<br />
Es ist <strong>der</strong> nackte, schneidende Verstand, <strong>der</strong> die Natur, die <strong>im</strong>mer<br />
unfaßlich und in allen ihren Punkten ehrwürdig und unergründlich ist,<br />
schamlos ausgemessen haben will und mit <strong>eine</strong>r Frechheit die ich<br />
nicht begreife, s<strong>eine</strong> Formeln, die oft nur leere Formeln und <strong>im</strong>mer nur<br />
enge Begriffe sind, zu ihrem Maßstabe macht.“<br />
*<br />
Wie sehr Humboldt die Welt auszumessen versucht hat (und wie poetisch<br />
und schön diese Vermessung <strong>der</strong> Welt aussehen kann), zeigt sein<br />
1805, <strong>im</strong> Todesjahr von Schiller, gezeichneter Querschnitt durch die<br />
Anden, in dem die gefundenen Pflanzen nach Höhenmetern verortet<br />
sind („Geographie <strong>der</strong> Pflanzen in den Tropenlän<strong>der</strong>n, ein Naturgemälde<br />
<strong>der</strong> Anden, gegründet auf Beobachtungen und Messungen, welche vom<br />
10. Grade nördlicher bis zum 10. Grade südlicher Breite angestellt<br />
worden sind, in den Jahren 1799 bis 1803“).<br />
¬<br />
Goethe übrigens hat auf diese Zeichnung<br />
mit <strong>eine</strong>m Strichmännchen reagiert und<br />
Humboldt in den „Höhen <strong>der</strong> alten und <strong>der</strong><br />
neuen Welt“ auf den Ch<strong>im</strong>borazo gestellt.<br />
[Bild: Klassik Stiftung We<strong>im</strong>ar]<br />
¬<br />
¬<br />
¬
Schiller<br />
42<br />
193<br />
S<br />
S42
Schiller<br />
ege195<br />
Flucht-<br />
S 43
Im Januar 1782 wurde <strong>Schillers</strong> erstes<br />
Theaterstück in Mannhe<strong>im</strong> aufgeführt<br />
– für den Herzog von Württemberg <strong>eine</strong><br />
Provokation. Ebenso wie <strong>Schillers</strong><br />
unerlaubte Reisen ins kurpfälzische<br />
Mannhe<strong>im</strong>. Der 22-jährige Militärarzt<br />
Schiller kam in Arrest, erhielt<br />
Schreibverbot, fürchtete Festungshaft<br />
und entschloss sich allen Gefahren<br />
zum Trotz zu fliehen. In <strong>der</strong> Nacht vom<br />
22. auf den 23. September 1782, während<br />
<strong>der</strong> Herzog zu Ehren des russischen<br />
Großfürsten Paul ein Fest mit Feuerwerk<br />
gab, verließ er mit s<strong>eine</strong>m Freund<br />
Andreas Streicher Stuttgart und reiste<br />
zunächst nach Mannhe<strong>im</strong>, dann aus <strong>der</strong><br />
Angst vor Verfolgung und Auslieferung<br />
weiter nach Frankfurt am Main,<br />
Oggershe<strong>im</strong> und dann <strong>im</strong> Dezember 1782<br />
nach Bauerbach in Thüringen. Er legte<br />
sich den Tarnnamen „Dr. Ritter“ zu und<br />
versuchte s<strong>eine</strong>n Weg zu verschleiern.<br />
Am 19.11.1782 schrieb er an s<strong>eine</strong><br />
Eltern: „Beste Eltern! Da ich gegenwärtig<br />
zu Mannhe<strong>im</strong> bin, und in 5 Tagen<br />
auf <strong>im</strong>mer weggehe, so wollte ich mir<br />
und Ihnen noch das Vergnügen bereiten,<br />
uns zu sprechen. Heute ist <strong>der</strong> 19. am<br />
21. bekommen Sie diesen Brief, wenn<br />
Sie also unverzüglich, (das müßte seyn)<br />
von Stuttgardt weggehen, so können<br />
Sie am 22. zu Bretten <strong>im</strong> Posthauß<br />
seyn, welches ohngefehr halb wegs von<br />
Mannhe<strong>im</strong> ist, und wo Sie mich antreffen.<br />
Ich denke Mama und die Christophine<br />
könnten am füglichsten, und zwar<br />
unter dem Vorwand nach Ludwigsburg<br />
zur Wohlzogen zu gehen, abreisen.<br />
Nehmen Sie die Vischerin und Wohlzogen<br />
auch mit, weil ich beide auch noch,<br />
vielleicht zum leztenmal, die Wohlzogen<br />
ausgenommen, spreche. Ich gebe<br />
Ihnen <strong>eine</strong> Carolin Reisgeld, aber<br />
nicht bäl<strong>der</strong>, als zu Bretten. An <strong>der</strong><br />
schnellen Befolgung m<strong>eine</strong>r Bitte will<br />
ich erkennen, ob Ihnen noch theuer<br />
ist Ihr ewig dankbarer Sohn Schiller.“
Schiller<br />
43<br />
197<br />
S<br />
S43
Schiller<br />
ege199<br />
Flucht-<br />
S 44
Am 6.11.1782 schreibt Schiller an<br />
den Schulfreund Christian Friedrich<br />
Jacobi mit erfundenen Ortsangaben<br />
(„E.“ wie Erfurt) und Reiseplänen<br />
(nach Sankt Petersburg in Russland):<br />
„Mein Schiksal sollst Du erfahren,<br />
sobald es <strong>eine</strong>n wichtigen Schritt<br />
gethan hat. Gegenwärtig bin ich auf<br />
dem Weeg nach Berlin. Gelegenheitlich<br />
bitte ich Dich, in diese Nachricht<br />
weniger Mistrauen als in die Vorige<br />
zu sezen. Ich gestehe Dir, Jene<br />
war Politik, weil ich weniger sicher<br />
war m<strong>eine</strong>n Aufenthalt anzugeben,<br />
als vielleicht izt. Die wirkliche<br />
Nachricht ist ächt. Je<strong>der</strong>mann, <strong>der</strong><br />
nur das geringste von m<strong>eine</strong>m Schiksal<br />
und Plan erfuhr, vereinigte sich<br />
in den Rath, nach Berlin zu gehen,<br />
wohin ich nicht nur vortrefliche<br />
Addressen habe, son<strong>der</strong>n auch mehrere<br />
bekommen werde, weil ich über Erfurt,<br />
Gotha, We<strong>im</strong>ar und Leipzig reise,<br />
an welchen Orten ich theils schon<br />
durch Schriften empfohlen bin, theils<br />
auch durch neue Empfehlungen sehr<br />
viele Freunde antreffen werde, die<br />
mir wie<strong>der</strong>um Berlinerbekanntschaften<br />
machen werden. Vielleicht daß ich<br />
in Berlin m<strong>eine</strong>n Plan verän<strong>der</strong>e, und<br />
durch Unterstüzung wichtiger Personen<br />
nach Petersburg gehe.“
Schiller<br />
44<br />
201<br />
S<br />
S44
Schiller<br />
hanta<br />
-<br />
sie-<br />
S 45<br />
203<br />
quelle
Für s<strong>eine</strong> Arbeit an Die Jungfrau von Orleans (uraufgeführt 1801)<br />
verwendete Schiller <strong>eine</strong> kl<strong>eine</strong> Frankreichkarte. Jede und je<strong>der</strong><br />
von uns kann damit ausprobieren: Was sehen wir auf <strong>eine</strong>r Landkarte<br />
wirklich, was macht unsere Phantasie daraus? Welche Plätze und<br />
Orte hat sich Schiller für sein Drama ausgesucht, das mit dieser<br />
Szenenbeschreibung beginnt: „Eine ländliche Gegend. Vorn zur<br />
Rechten ein Heiligenbild in <strong>eine</strong>r Kapelle; zur Linken <strong>eine</strong> hohe<br />
Eiche“, und so aufhört: „Ein wil<strong>der</strong> Wald, in <strong>der</strong> Ferne Köhlerhütten.<br />
Es ist ganz dunkel, heftiges Donnern und Blitzen,<br />
dazwischen Schießen“?
Schiller<br />
45<br />
205<br />
S<br />
S45
Schiller<br />
Enträtselungs-<br />
S 46<br />
207<br />
ü bung
Luftschiff ist gleich ...?<br />
Die Rätsel-Antwort aus<br />
<strong>Schillers</strong> Bearbeitung von<br />
Carlo Gozzis Turandot von<br />
1802/03 zum Selber-Entziffern<br />
in <strong>der</strong> Handschrift.
Schiller<br />
46<br />
209<br />
S<br />
S46
Schiller<br />
S 47<br />
Noch<br />
einmal:<br />
211<br />
Schiller<br />
pielen
In unserer<br />
<strong>Inter<strong>im</strong>sausstellung</strong> haben<br />
wir jedem Schriftsteller<br />
<strong>eine</strong>n Klang o<strong>der</strong> <strong>eine</strong><br />
Melodie zugeordnet: Mörike<br />
die Windharfe, Kerner<br />
die Maultrommel, Höl<strong>der</strong>lin<br />
s<strong>eine</strong> Lieblingsmelodie und<br />
Schiller? Naheliegend wäre<br />
Beethovens 9. Symphonie<br />
mit <strong>der</strong> „Ode an die<br />
Freude“. Nicht ganz so<br />
naheliegend: die Filmmusik*,<br />
die in den<br />
1960er Jahren Karl Mays<br />
„Winnetou“-Romanen<br />
ihre Wie<strong>der</strong>erkennungsmelodie<br />
schenkte.<br />
Thomas Mann hat an<br />
Schiller s<strong>eine</strong> „Lust am<br />
höheren Indianerspiel“<br />
gelobt. Karl May hat<br />
Schiller wie<strong>der</strong>holt in<br />
s<strong>eine</strong>n Werken zitiert<br />
und verdankt ihm sogar<br />
ein Gedicht – glaubt man<br />
<strong>eine</strong>m Brief, den er<br />
s<strong>eine</strong>r Frau Emma schickte:<br />
*https://www.youtube.com/watch?v=zyMEIHud3UQ<br />
Da gestand ich m<strong>eine</strong>n Lieben, daß<br />
ich ohne ihre Hülfe nicht dichten<br />
könne, und siehe da, mein Friedrich<br />
kam und antwortete: „Setz Dich,<br />
und schreib!“ Ich nahm das erste,<br />
beste Stückchen Papier und den<br />
Bleistift und schrieb. Er<br />
führte mir nicht etwa die Hand<br />
wie be<strong>im</strong> Schreiben <strong>eine</strong>s<br />
Mediums, son<strong>der</strong>n ich schrieb<br />
wie ganz gewöhnlich; er aber<br />
stand bei mir und dictirte mir<br />
jedes einzelne Wort mit<br />
deutlich vernehmbarer St<strong>im</strong>me.<br />
[...] Womit habe ich solche<br />
Engelnähe, solche Führung <strong>der</strong><br />
Hohen, H<strong>im</strong>mlischen, solche<br />
Liebe, Güte und Bereitwilligkeit<br />
<strong>der</strong> Seligen verdient?<br />
Ich habe den Zettel [mit diesem<br />
Gedicht] sofort auf besseres Papier<br />
gezogen und sende ihn Dir, m<strong>eine</strong><br />
Emma, damit er nicht den Zufälligkeiten<br />
<strong>der</strong> Reise unterworfen ist.<br />
Er ist mir ein köstliches,<br />
unbezahlbares Geschenk. Hebe ihn ja<br />
so heilig auf, als ob er mich 10,000<br />
Mark und noch mehr gekostet hätte!<br />
Du mußt nämlich bedenken, mein<br />
Friedrich schrieb in We<strong>im</strong>ar doch.
Schiller<br />
47<br />
213<br />
S<br />
S47
Impressum<br />
Ausgewählt haben die Umzugsstücke<br />
Julia Schnei<strong>der</strong>,<br />
Verena Staack und Heike<br />
Gfrereis, die sie auch<br />
kommentiert und zusammen<br />
mit Diethard Keppler und<br />
Andreas Jung <strong>im</strong> Raum angeordnet<br />
und gestalterisch<br />
gefasst hat. Die Exponatfotografien<br />
stammen von Chris<br />
Korner und Jens Tremmel,<br />
die restauratorische Betreuung<br />
oblag Enke Huhsmann,<br />
Susanne Bœhme und Anaïs Ott,<br />
die Redaktion und Organisation<br />
Vera Hildenbrandt,<br />
Dietmar Jaegle, Lea Kaiser,<br />
Martin Kuhn, Tamara Meyer<br />
und Janina Schindler.<br />
Die Aussttellung „Schiller,<br />
Höl<strong>der</strong>lin, Kerner, Mörike“<br />
wurde <strong>im</strong> Februar 2020 <strong>im</strong><br />
<strong>Literaturmuseum</strong> <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne<br />
eröffnet und ist dort bis<br />
zur Wie<strong>der</strong>eröffnung des<br />
<strong>Schillers</strong>-Nationalmuseums<br />
Anfang 2023 zu sehen.<br />
Gestaltung und<br />
Ausstellungsfotografie<br />
dieser Publikation:<br />
Diethard Keppler und<br />
Andreas Jung<br />
Text:<br />
Heike Gfrereis<br />
© 2020 Deutsches<br />
Literaturarchiv Marbach<br />
S