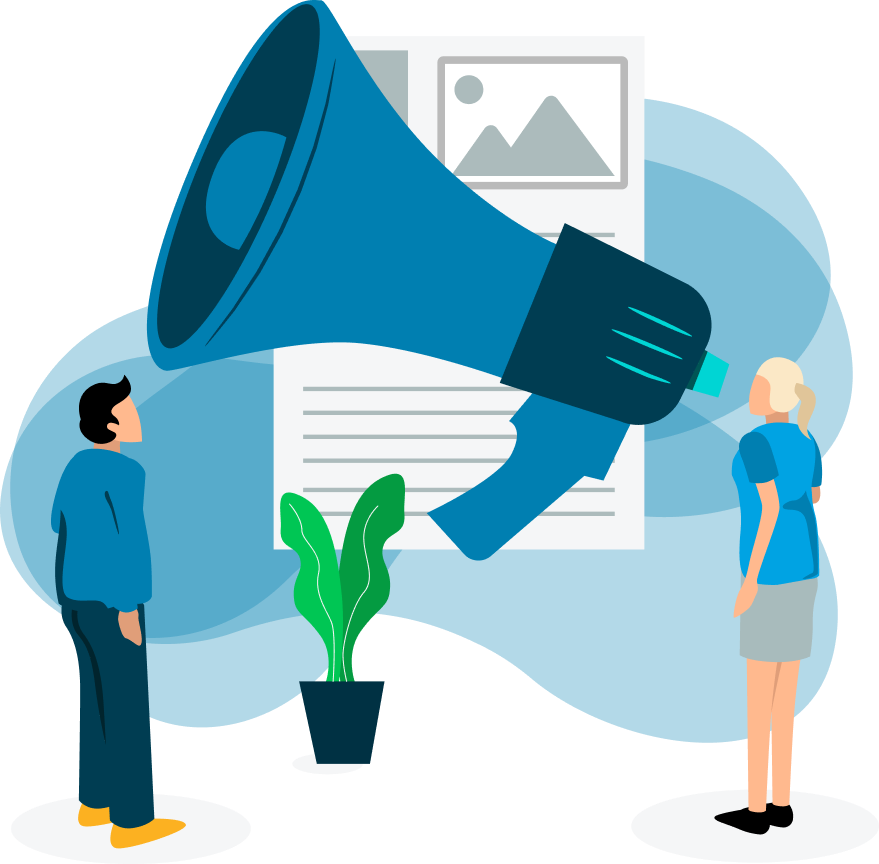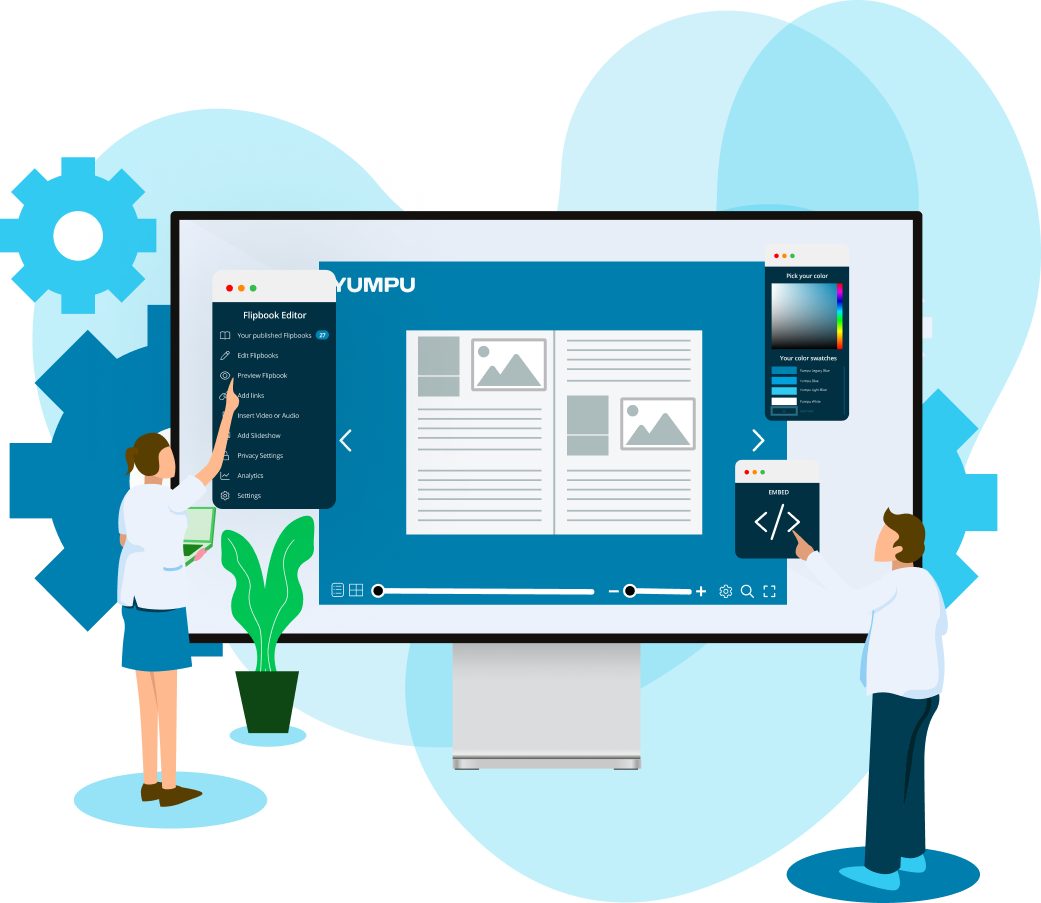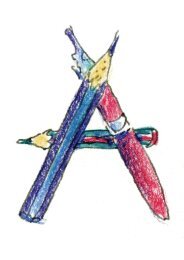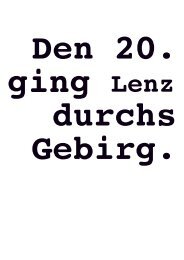Marbacher Magazin 148: Der Wert des Originals
Das 2014 erschienene Marbacher Magazin von Heike Gfrereis und Ulrich Raulff mit einem Essay von Gottfried Boehm ist leider vergriffen. Wer nichts verpassen möchte, der kann die Reihe der "Marbacher Magazine" abonnieren: https://www.dla-marbach.de/fileadmin/shop/Abo-Formular_2019.pdf
Das 2014 erschienene Marbacher Magazin von Heike Gfrereis und Ulrich Raulff mit einem Essay von Gottfried Boehm ist leider vergriffen. Wer nichts verpassen möchte, der kann die Reihe der "Marbacher Magazine" abonnieren: https://www.dla-marbach.de/fileadmin/shop/Abo-Formular_2019.pdf
- TAGS
- manuskript
- anfang
- originale
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
marbachermagazin <strong>148</strong> <strong>Der</strong> <strong>Wert</strong> <strong>des</strong> <strong>Originals</strong><br />
mit einem Essay von<br />
Gottfried Boehm<br />
Deutsche Schillergesellschaft<br />
Marbach am Neckar
Vorwort<br />
HEIKE GFREREIS UND ULRICH RAULFF
5<br />
Unwillkürlich beginnt man, nach Daten zu suchen, um sich die eigene<br />
Verblüffung zu erklären. Ein Jubiläum, ein Jahrestag, irgendein Kalendereintrag,<br />
der es zwingend notwendig machte, dass sich diese Ausstellung<br />
jetzt ereignet, in diesem besonderen Augenblick. Es ist, als liefe die Reihe<br />
der Ausstellungen, die wir seit Jahren in Marbach machen, und namentlich<br />
die Serie von ›Essay-Ausstellungen‹ – ›Ordnung‹, ›Autopsie Schiller‹,<br />
›Randzeichen‹, ›Schicksal‹ – geradezu unvermeidlich auf diese Ausstellung<br />
und ihr Thema hin. Aber es gibt diesen kalendarischen Anlass, diese<br />
äußerliche Begründung nicht, auch wenn sich 2015 die Gründung <strong>des</strong><br />
Deutschen Literaturarchivs zum 60. Mal jährt und absichtsvoll erscheint,<br />
was zufällig zusammenkommt. ›<strong>Der</strong> <strong>Wert</strong> <strong>des</strong> <strong>Originals</strong>‹ begründet sich<br />
ausschließlich aus sich selbst – und aus dem, was wir in Marbach seit<br />
langem tun und worin wir unsere Stärke, aber auch unsere Verpflichtung<br />
sehen: Originale zu sammeln, zu bewahren, zu erforschen und zu zeigen.<br />
Noch nie haben wir versucht, uns so konzentriert selbst in die Karten<br />
zu schauen und hartnäckig der Motivation auf die Spur zu kommen,<br />
warum wir alles für die Originale geben; noch nie kam uns eine Ausstellung<br />
so nah.<br />
Die Idee zu dieser Ausstellung entstand anlässlich von Gesprächen mit<br />
israelischen Kollegen, bei denen es um das künftige Geschick <strong>des</strong> Nachlasses<br />
von Max Brod ging. Irgendwann im Verlauf der Diskussionen kam<br />
der Gedanke auf, man könne die Originale auch gemeinsam erwerben und<br />
die Verantwortung für sie teilen und die Erwartungen der Forschung durch
6<br />
den Austausch von Scans befriedigen – jedenfalls bis zu einem gewissen<br />
Punkt. Doch wie lässt sich dieser Punkt bestimmen? Was liegt hinter ihm,<br />
jenseits oder auch diesseits <strong>des</strong> Scans? Schon einmal, im Juni 2011,<br />
haben wir diesen Punkt in einer gemeinsam mit der Universität Tübingen<br />
im Literaturmuseum der Moderne veranstalteten Werkstatt-Tagung am<br />
Beispiel »ästhetischer Unikate« zu bestimmen versucht und gesehen, dass<br />
wir über das Gegensatzpaar Original und Reproduktion hinaus denken<br />
müssen. Das Original – und nicht nur das ästhetische Unikat – ist mehr<br />
als seine austauschbaren, erforschbaren und vermittelbaren Teile. Es ist<br />
mehr als sein Bild, mehr als sein Material und mehr als seine Deutung und<br />
Bedeutung, mehr als sein kulturhistorischer, politischer und finanzieller<br />
<strong>Wert</strong>. Es ist das alles zusammen und noch ein wenig mehr. Es definiert<br />
Orte und Institutionen – ohne Originale keine Museen und Archive, keine<br />
Reisen zur Kunst und keine Wege durchs Hinterland.<br />
Das Original bringt uns dazu, bestimmte Plätze aufzusuchen und absolute<br />
Adjektive zu finden: echt, rein, wahr, einzigartig. Magisch und auratisch,<br />
ursprünglich, ein Stück aus einer anderen Welt. Auch Repliken<br />
können einem Ort seine Bedeutung verleihen: Im Mittelpunkt <strong>des</strong> Jerusalemer<br />
»Schrein <strong>des</strong> Buches« steht eine Nachbildung der Jesajarolle,<br />
jenes ältesten vollständigen Manuskripts eines Buchs der Bibel, das man<br />
in den Qumran-Höhlen am Toten Meer gefunden hat. Das Original ist<br />
weder der Gegensatz zur Reproduktion noch zur Fälschung. Bei<strong>des</strong> sind<br />
Formen seiner Überlieferung und Erscheinung, Stellvertreter seiner<br />
Funktionen, Verstärker seiner Macht.<br />
Doch was ›leisten‹ Originale, worin besteht ihr <strong>Wert</strong> für uns? Wozu benötigen<br />
wir sie, was ist ihr spezieller Gebrauchswert im Rahmen unserer<br />
alltäglichen Verständigungen und Festsetzungen von kulturellen und<br />
öko nomischen <strong>Wert</strong>en? Was schließlich ist ihr Tauschwert in unseren<br />
Marktökonomien, wer oder was bestimmt den Kurs von Objekten, die<br />
oftmals so unscheinbar oder gar verborgen sind wie ein paar Zettel vom<br />
Nachttisch eines verstorbenen Dichters oder das Turiner Grabtuch? Wie<br />
können einzelne Objekte in unserer Welt der kulturellen, symbolischen
und realen Güter den besonderen Status, die Macht und die Magie eines<br />
›<strong>Originals</strong>‹ erhalten? Offenbar gibt es in der Fülle der Dinge, mit deren<br />
Hilfe wir nicht nur unser materielles Leben bestreiten, sondern auch unser<br />
geistiges Leben führen, einige, die so etwas wie den Goldstandard setzen<br />
für <strong>Wert</strong> und Bedeutung aller anderen Dinge. Diese besonderen Dinge<br />
nennen wir ›Originale‹ – und tun, als ob wir selbstverständlich wüssten,<br />
was sie sind und wie sie wurden, was sie sind.<br />
Manches wurde zum Original durch den glühenden Wunsch, es zu besitzen,<br />
anderes durch den Akt seiner Zerstörung. Auch Dinge haben<br />
offenbar ihre rites de passage und verändern ihre Natur beim Eintritt ins<br />
Dasein und beim Verschwinden aus diesem. Es gibt Originale, die ›von<br />
alters her‹ existieren, und welche, die durch den Zufall oder Unfall der<br />
Benutzung dazu geworden sind. Wieder andere scheint erst der Markt zu<br />
machen, indem er ihren Preis hochtreibt. Originale sind abhängig von<br />
kulturellen Zusammenhängen, die es ihnen erlauben, als solche wahrgenommen<br />
zu werden und ihre spezielle Wirksamkeit zu entfalten. Wo keine<br />
Briefpost existiert, kann keine Blaue Mauritius vorkommen, wo keine<br />
literarische Kultur entstand, keine Dichterhandschrift Kultstatus erlangen.<br />
Es müssen mithin dichte politische, religiöse oder kulturelle Kontexte<br />
gegeben sein, damit Originale leisten können, was nur sie können:<br />
Anfänge schaffen, Geschichtszeichen setzen, Individualitäten begründen,<br />
Legitimität verschaffen. Wie in Fetischobjekten und Reliquien scheint sich<br />
in Originalen die geistige Energie ganzer Kulturen zu verdichten. Sie<br />
stehen am Beginn von Erzählungen und im Mittelpunkt von Verhandlungen,<br />
mit ihnen erklären wir uns die Welt und füllen die Leere, deren<br />
Gegenwart wir fürchten.<br />
Sind Originale im Plural denkbar? Von sich aus behauptet je<strong>des</strong> Original,<br />
ein Unikat zu sein: und darum unwiederbringlich. Sein Verlust würde<br />
ein Loch in die Welt reißen, das sich mit noch so viel Aufwand nicht mehr<br />
schließen ließe. Und doch verliert die Welt tagtäglich Originale, Denkmäler,<br />
Kultstätten, Monumente und lebendige Arten. Auch Menschen sind<br />
Originale und sterben, wie vor ihnen Tiere und Götter gestorben sind.<br />
7
8<br />
Solange sie aber leben, streben sie danach, sie selbst zu sein und sich<br />
zu verwirklichen. <strong>Der</strong> Weg zurück ins Paradies ist ein origineller. »Wir<br />
müssen die Reise um die Welt machen, und sehen, ob es vielleicht von<br />
hinten irgendwo wieder offen ist«, rät uns Kleist in seinen Gedanken Über<br />
das Marionettentheater. Das Original ist ein Zeuge dieses ›Irgendwo‹.<br />
Von ihm begehren wir zu erfahren, wie es dem Individuum gelingen kann,<br />
authentisch zu sein, ursprünglich und mit sich selbst im Reinen. Das<br />
18. Jahrhundert erfindet die Bezeichnung ›Originalgenie‹. Eine Website<br />
zum Urheberrecht wirbt heute mit dem Slogan »Original ist genial«. In<br />
einer Welt der unendlichen Teilbarkeit in Ansprüche, Geschäftsprozesse,<br />
Glaubensartikel, Halbwahrheiten und beschränkte Garantien erscheint das<br />
Original wie ein Versprechen auf Ganzheit und Unteilbarkeit: ein letzter<br />
verlässlicher Baustein der Lebens- und Kunstwelt.<br />
Die ›Ursubstanz‹ bietet Karl-Ernst Georges Lateinisch-deutsches Wörterbuch<br />
als eine unter vielen Bedeutungen <strong>des</strong> weiblichen Substantivs<br />
origo an – neben ›Ursprung‹, ›Geburt‹, ›Abstammung‹ und ›Stammvater‹.<br />
Samt und sonders sind dies Wunsch- und Suchkategorien von höchster<br />
Aufladung und Intensität. Mit Originalen verstopft man die Löcher der<br />
Welt gegen das Nichts, begründet Nationen und Hegemonien, lässt<br />
Geschichten beginnen, Herrschaften fallen, Werke entstehen und Künstler<br />
zu Göttern aufsteigen. Mit Originalen verklärt man die Welt und macht<br />
sie besonders. ›Aura‹ ist eine ihrer Wirkungen, eine seltsam spektrale<br />
Kraft, benannt nach der griechischen Göttin der Morgenbrise. Doch wie<br />
fasst man diese mit kühlem Kopf? Was ist und wozu dient ein Original?<br />
Was kann es, und wer gibt ihm seinen <strong>Wert</strong>? Kann man seine Macht in<br />
Begriffe und auch Zahlen fassen? Kann man mit Originalen anders und<br />
schärfer denken als ohne sie? Antworten auf diese Fragen zu finden,<br />
und hätten sie nur die Form neuer Fragen, dazu haben wir Wissenschaftler<br />
und Sammler eingeladen, Jäger der originellen Gedanken und der<br />
originalen Dinge, allen voran Gottfried Boehm, mit dem wir das Konzept<br />
der Ausstellung diskutiert und weiterentwickelt haben. Die Besucher<br />
der Ausstellung und die Leser ihres Katalogs sind miteingeladen: Wozu<br />
brauchen wir diese sonderbaren Dinge?
G OTTFRIED BOEHM<br />
Augenblicksgötter.<br />
Das Original: Ein Anfang
»21. Juli 2014«<br />
11<br />
D IE MUSE GEHT BARFUSS<br />
Wer die Räume dieser <strong>Marbacher</strong> Ausstellung durchstreift, die den<br />
›<strong>Wert</strong> <strong>des</strong> <strong>Originals</strong>‹ abzuwägen unternimmt, lernt ein ungewöhnlich weites<br />
und wohl auch befremdliches Feld <strong>des</strong> Originalen kennen. Es manifestiert<br />
sich nicht vorrangig in Werken der ›schönen Künste‹ – man hat z. B.<br />
Leonardo da Vincis Mona Lisa als den Prototyp <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> schlechthin<br />
identifiziert – sondern in einer Vielzahl an Relikten, Abgüssen, Briefen,<br />
Fotos, Skizzen bzw. Notizen, in exponierten Dingen <strong>des</strong> Gebrauchs, in<br />
politischen Dokumenten und selbst in ärmlichen Überbleibseln.<br />
Wo tatsächlich auf originale Werke verwiesen wird, geschieht auch dies<br />
auf merkwürdig unoriginale Art – in Gestalt von Reproduktionen oder<br />
Wiederholungen bzw. Vorstufen und stets vielfach gebrochen. <strong>Der</strong> Umriss<br />
<strong>des</strong> großen Ernüchterers und Ikonoklasten Marcel Duchamp steht<br />
unwillkürlich im Raum. Die Dämmerung <strong>des</strong> emphatischen <strong>Originals</strong>, das<br />
womöglich durch einen Urheber geschaffen wurde, den u. a. Immanuel<br />
Kant ein »Original-Genie« genannt hat, zeitigt auch Folgen für den Diskurs,<br />
d. h. für die Bestimmung der Sache. Zu jenen Folgen gehört es,<br />
den alten Begriff <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> – der so alt übrigens gar nicht ist, nämlich<br />
auf das späte 18. Jahrhundert zurückgeht – einer Prüfung, Erprobung und<br />
Erneuerung zu unterziehen. Zumal sich jenes überkommene Verständnis<br />
<strong>des</strong> <strong>Originals</strong>, oft undurchschaut, bis heute in Umlauf befindet.<br />
Das Schauvergnügen an den vorgezeigten Dingen bietet uns die Chance,<br />
mit frischen Augen, der ebenso prominenten wie wenig reflektierten<br />
Größe <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> nachzufragen. Was zeichnet sie aus? Was macht sie
12<br />
vermutlich unverzichtbar? Lässt sie sich begrifflich umschreiben? Folgt<br />
sie einer eigenen, sinnlichen Logik? Warum floriert sie, ausgerechnet im<br />
vielberedeten Zeitalter der digitalen Reproduzierbarkeit?<br />
<strong>Der</strong> Titel dieses Essays deutet schon an, welche Vermutung wir hegen.<br />
Das Original – so die These – kennzeichnet ein spezifisches Verhältnis<br />
zur Zeit, das durch ein Vermögen realisiert wird, das man anthropologisch<br />
nennen kann. Sich nämlich der bloßen Abfolge der Sekunden, Minuten<br />
und Stunden – der Ordnung <strong>des</strong> Ziffernblattes – nicht einfach auszuliefern,<br />
sie vielmehr zu durchbrechen. Und dies durch die Fähigkeit immer<br />
wieder und ab ovo anzufangen. Dafür wird – wie wir zeigen wollen –<br />
die Regie <strong>des</strong> dichten Augenblicks, seine materielle Verkörperung als<br />
Original, wichtig werden. So sehr sich Menschen ihrer Endlichkeit ausgeliefert<br />
finden: Sie sind Wesen, die vornehmlich gestaltend, aber auch<br />
denkend und handelnd, einen Anfang zu setzen vermögen. Ein Anfang,<br />
der auch sein Ende bedenkt, beide zu einem Kreis zusammen schließt und<br />
so zum Ursprung neuer Erfahrungen wird. Gerade weil diese Art von<br />
Setzungen möglich sind, gibt es immer wieder Neues, d. h. solches das<br />
ohne Vorbild ist, das nichts nachmacht, sondern vorgibt, zum Exempel<br />
wird. Es erweist sich dem Vergehen der Zeit nicht ausgesetzt, sondern ist<br />
Herr über einen Kairos – solange jedenfalls als dieses Original nachlebt<br />
und nachwirkt. Davon dann mehr.<br />
Was aus den Schachteln <strong>des</strong> Archivs in die Vitrinen geschlüpft ist und<br />
sich an den Wänden ausbreitet, beansprucht unsere Aufmerksamkeit und<br />
ist gewiss dazu angetan, den einen oder anderen Besucher zu verwirren.<br />
Worauf reimen sich diese so verschiedenen, diese verstreuten Dinge?<br />
Verweisen sie schließlich doch auf eine verborgene Ordnung? Und worin<br />
könnte sie bestehen? Was ist, beispielsweise, ›original‹ an Hölderlins<br />
Schreibtisch oder an Schillers Schädel (und eben nicht am Manuskript <strong>des</strong><br />
Wallenstein)? Was an Abgüssen von Gesichtern und Händen, was an<br />
anderen Relikten gewesenen Lebens oder von Schreibprozessen? Was an<br />
ephemeren Notizen, an Dokumenten oder Briefschaften? Repräsentieren<br />
sie nicht primär, was man authentische Zeugenschaft nennen kann, mit
anderen Worten nichts als Mittel, Zwecke und Wege, die nirgendwo den<br />
erinnerungswürdigen Status eines in sich gefügten Werkes erreichen?<br />
Wenn man aber so weit geht, wie die Kuratoren dieser Ausstellung –<br />
verliert der Begriff <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> dann nicht jede Schärfe und Aufschlusskraft?<br />
Verwenden wir das Wort nicht lediglich dazu, die späten Effekte<br />
jenes gefräßigen Historismus zu benennen, der vor nichts Halt macht,<br />
alles aufsammelt, musealisiert und ausstellt? Ja: Ist die gegenwärtige<br />
Konjunktur der Originale nicht einfach eine Emanation <strong>des</strong> Musealen und<br />
seiner unverdrossenen Betriebsamkeit? Oder gibt es, jenseits <strong>des</strong>sen<br />
doch so etwas, wie ›die‹ Originale? Und was haben sie mit den Dingen<br />
dieser Ausstellung zu tun?<br />
So rudimentär und vielleicht auch rätselhaft sich manche Exponate auch<br />
darbieten, sie stammen aus den Händen von Autoren oder aus deren<br />
Arbeitsprozessen. Es sind eben die Goethes, Hölderlins, Mörikes, Kafkas,<br />
Benns und all die anderen, die diese sichtbaren Sachen nobilitieren,<br />
sie über die Schwelle der Bedeutsamkeit heben. Und doch beeindrucken<br />
uns nicht primär eminente Werke von Autorinnen oder Autoren, sondern<br />
gerade deren Umschweife und Umwege, die Mühen der Ebene, die<br />
Verstrickung in Arbeitsprozesse und Umstände und nicht eben selten die<br />
Intervention banaler Realitäten. Die Muse geht barfuß und querfeldein.<br />
Sie scheut steiniges und dürftiges Terrain keineswegs.<br />
13<br />
V ERKÖ RPERUNGEN<br />
So werden uns die ausgestellten Dinge durch die Namen kostbar, die sie<br />
tragen. Verkörperungen ereignen sich, die Orte, Zeiten, Atmosphären,<br />
Temperamente und Individualitäten miteinander verschränken. Weswegen<br />
es auch eines kundigen Betrachters bedarf, dem diese Namen etwas<br />
sagen, <strong>des</strong>sen Imaginationskraft angeregt wird und der sich auf das<br />
Dargebotene einzulassen bereit ist. Es nutzt nichts: Originale, schon gar<br />
nicht diese, sind keineswegs selbsterklärend. Wer ohne den inneren
14<br />
Resonanzraum einer gewissen Bildung durch diese Räume streift, der wird<br />
kaum fündig werden und wohl bald zum Ausgang streben.<br />
Wer aber die Verkörperungen als solche erkennt, der entdeckt in ihnen<br />
einen gewissen Überschuss, der ihre krude Materialität übertrifft. Darauf<br />
verweist bereits der alte, auf die Antike zurückverweisende, lateinische<br />
Wortstamm origo, von dem ausgehend die europäischen Sprachen<br />
und Kulturen eine reiche Metaphorik der Quellen und Flüsse, <strong>des</strong> Ursprungs<br />
und der Urheberschaft, der creatio und ihrer Personalisierung in<br />
Gestalt schöpferischer Autoren, <strong>des</strong> ingeniums, Genies und endlich<br />
<strong>des</strong> Originalgenies, entfaltet haben. Wer immer mit Originalen umgeht und<br />
sich selbst dabei beobachtet, der entdeckt eine Merkwürdigkeit. Was<br />
faktisch und materiell ist, was es ist – und gerade <strong>des</strong>halb auch als echt<br />
und nicht als ein Falsifikat eingeschätzt wird –, das erscheint als das<br />
Gleiche immer wieder in einem anderen Licht, erweist sich als ausdrucksstark<br />
und sinnträchtig. <strong>Der</strong> Reichtum und die Unverzichtbarkeit der Originale<br />
resultieren aus dieser unerschöpflichen Vieldeutigkeit. Mit anderen<br />
Worten: Dem selbigen Ding ist ein Gran Disidentität beigefügt.<br />
Wenn es um die erwähnten und gewiss um manche andere Qualitäten von<br />
Originalen kaum Streit geben dürfte, dann bleibt doch ganz offen, wie<br />
sie zustande kommen und warum? Schon der ominöse Kuss der Musen<br />
erweist sich als eine unverfügbare Gabe, die seit Hesiod oder Pindar<br />
herbeigerufen wurde und die ihrer Kunst den Nimbus <strong>des</strong> Originalen<br />
verliehen hat – ohne dass unser Wort dafür schon existiert hätte. Gemeint<br />
war aber stets das gelungene, in sich gefügte Kunstwerk: Lieder,<br />
Gesänge, Epen usw. Noch Kant reservierte die Bezeichnung »Original«<br />
für das vollendete Werk der schönen Künste, das ihm allein als Produkt<br />
eines ingeniums oder Genies galt. Es wäre ihm – dem Protagonisten<br />
einer Theorie der starken Originale – nicht im Traum eingefallen, die<br />
Vorprodukte und Vorstufen, die verworfenen Formulierungen und Proben,<br />
oder auch die persönlichen Zeugnisse der Autorschaft – die wir hier vor<br />
uns sehen – mit dem Ausdruck <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> zu belegen. In den Vordergrund<br />
treten bei ihm nicht Situationen oder Umstände der Produktivität,
sondern das daraus ermöglichte Gelingen, das sich keiner, auch nicht<br />
handwerklichen, Regel verdankt. Das alteuropäische Geschwisterpaar<br />
von Kunstfertigkeit (ars) und Kunstgebilde (opus), das sich wechselseitig<br />
brauchte, verbindet bzw. bekrönt jetzt, was sich weder planen noch<br />
rational ableiten lässt: die regellose Logik und intuitive Gestaltungskonsequenz<br />
<strong>des</strong> ingeniums. Für Kant ist Originalität erklärtermaßen das Gegenteil<br />
von handwerklichem Können oder selbst von Virtuosität – die allesamt<br />
auf Regelfolgen rekurrieren. Die Debatte über das Original, wie sie dann<br />
seit dem späten 18. Jahrhundert und der Romantik geführt wurde, basiert<br />
dagegen auf dieser wohlkalkulierten Regellosigkeit. Darauf beruft sich<br />
auch noch das heutige Alltagsverständnis, das in Originalen vornehmlich<br />
Hervorbringungen eines außerhalb <strong>des</strong> Gewöhnlichen stehenden, eines<br />
exzeptionellen und enormen Subjekts, genannt Genie, erkennt. Achtet<br />
man auf die umgangssprachliche Rede von den Picassos, Goethes oder<br />
Einsteins – die sich selbst schon als außerordentliche Größen präsentiert<br />
haben – dann scheint unsere Kultur von einem Völkchen von Riesen<br />
erbaut worden zu sein, die Fundamente gelegt haben und weithin aufragende<br />
und leuchtende Monumente zu errichten imstande waren. Aller<br />
heute dominierenden, egalitären Befindlichkeit zum Trotz, niemand dürfte<br />
zögern, die Rolle jener genialen Figuren und ihrer Produkte anzuerkennen.<br />
Wobei die zwischenzeitlich erfolgte Historisierung der Naturwissenschaften<br />
– wir nennen als Symptom lediglich die Einführung <strong>des</strong> historischen<br />
Paradigmas durch Thomas S. Kuhn – ermöglicht hat, auch<br />
von Werken <strong>des</strong> Wissens und der Technik zu sprechen, sie ins Feld der<br />
Originale einzubeziehen.<br />
15<br />
O PTISCHE TÄUSCHUNGEN?<br />
Wie weit jene theoretische Basis trägt und ob sie nach den Erfahrungen<br />
<strong>des</strong> 20. Jahrhunderts noch tragfähig ist, sind wir dabei zu bespre-<br />
chen. Zuvor aber möchten wir kurz eine ideologiekritische Auffassung, die
16<br />
vielleicht auch manchem Besucher dieser Ausstellung in den Sinn kommt,<br />
kritisch beleuchten. Entstehen Originale nicht einfach aus Projektionswünschen<br />
von Individuen oder Kollektiven, deren Bedürfnislage dazu führt,<br />
etwelche Dinge, die sich dazu eignen, mit überschießenden Bedeutungen<br />
und Wirkungen aufzuladen, sie zu idolisieren? Und wie diese Ausstellung<br />
zeigt, genügen dazu bereits Relikte, wenn sie nur auf heilige – manchmal<br />
auch scheinheilige – Namen getauft sind. Man schreibt ihnen dichte<br />
Qualitäten zu, sieht sie von einer Aura umglänzt und holt damit doch nur<br />
aus ihnen heraus, was man zuvor in sie hineingelegt hatte – getrieben<br />
durch ein unbewusstes Begehren. Spricht die ansteigende Konjunktur<br />
der Originale, zu der auch eine entsprechende Marktbewertung gehört<br />
und die unter Vorzeichen fortschreitender gesellschaftlicher Ausdifferenzierung<br />
und Spezialisierung erfolgt, nicht für derartige dialektische Volten<br />
und Gegenbewegungen? Sie holen – so betrachtet – zurück, was das<br />
Gesetz der Rationalität und der Aufklärung zuvor verdrängt hat: das<br />
Singuläre, das Authentische, die magischen Substanzen. Folgt man einem<br />
derart reduktionistischen Argument, dann erscheint das Original als eine<br />
Fata Morgana, die im wüstenhaften Klima der Zivilisation ebenso zwangsläufig,<br />
wie unbeherrschbar entsteht. Wer sie greifen oder auf ihren<br />
Sachgehalt hin festlegen möchte, dem entschwindet sie, um an anderer<br />
Stelle erneut aufzutauchen. Aber auch bei dieser Position sieht es so aus,<br />
als hätten wir – von Bedürfnissen getriebene Wesen, die wir sind –<br />
Originale nötig.<br />
I M ZWIESPALT<br />
<strong>Der</strong> konsequenteste Philosoph der Erkenntniskritik und der Aufklärung,<br />
Immanuel Kant, hätte die zuletzt skizzierte Auffassung gewiss nicht geteilt,<br />
so sehr er der Unentbehrlichkeit der Originale Argumente geliefert hat.<br />
Gerade <strong>des</strong>halb lohnt es, seine Gründe und Ideen kennenzulernen. Selbst<br />
dann, wenn man sich den Schlüssen zu denen er gelangte, nicht länger
anschließen möchte. Was er auf wenigen Seiten seiner Kritik der Urteilskraft<br />
und der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht über das Original<br />
ausgeführt hat, ist das bedeutende Nebenprodukt einer weit ausgreifenden<br />
systematischen Erörterung, die an dieser Stelle auf sich beruhen<br />
bleibt. Nur soviel: Kant war nach der Erledigung seines erkenntniskritischen<br />
Geschäfts in den beiden ersten Kritiken – für ihn selbst überraschend<br />
– zur Einsicht gelangt, dass sich die Möglichkeiten der Vernunft im<br />
logischen Urteil, das er an den exakten Wissenschaften herausgearbeitet<br />
hatte, nicht erschöpfen. Er entdeckte das Terrain einer anderen, sinnlichen<br />
Art zu denken, die er »Urteilskraft« nannte und deren theoretisches<br />
Zentrum in der Analyse der ästhetischen Erfahrung und ihrer Urteile<br />
bestand. In diesem Zusammenhang, in dem er die argumentative Tragfähigkeit<br />
der Einbildungskraft ausgelotet hat, stieß er auf das Phänomen<br />
<strong>des</strong> <strong>Originals</strong> und gab ihm erstmals auch einen theoretischen Ort, der<br />
sich freilich als ein Nicht-Ort erweisen sollte. Jedenfalls gemessen an der<br />
von ihm zuvor dargelegten kritischen Argumentation. Denn das Original<br />
nistet in einem theoretischen Zwiespalt: Es führt einerseits die Forderung<br />
mit sich, in seinen Evidenzen allgemein anerkannt zu werden, d. h. zu<br />
gelten, und ist andererseits doch das Produkt einer kalkulierten Regellosigkeit,<br />
die sich begriffsfern und sinnlich organisiert. Seine Erscheinungsweise<br />
kennzeichnet eine Oszillation zwischen diesen beiden Polen,<br />
die aber auch dafür sorgt, dass es sich immer wieder mit Lebendigkeit<br />
auflädt, mit dem, was wir Wirkung bzw. Nachleben genannt haben. Eben<br />
diese Lebendigkeit, entstanden aus einer Reibung zwischen Begriffsverlangen<br />
und Empfindungsintensität, ist zeitlich verfasst und sie gibt dem<br />
Augenblick ein dauerhaftes Gesicht.<br />
Für Kants ungemein kühnen Denkweg in seiner dritten Kritik war das<br />
Original ein unverzichtbarer und prominenter Zeuge, allein schon durch<br />
seine schiere Existenz. Denn dieser Zeuge stellte sicher, dass die abenteuerliche<br />
Suche nach einer anderen Vernunft möglich ist und nicht in<br />
die Irre führt, den Zwiespalt, in den sie unwillkürlich gerät, zu bewältigen<br />
vermag, ohne daran zu scheitern.<br />
17
18<br />
Kant dachte die das Original kennzeichnende Abweichung von der Regel,<br />
naheliegenderweise, innerhalb seiner Philosophie <strong>des</strong> Bewusstseins bzw.<br />
der Subjektivität. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Struktur seiner<br />
Theorie, in der ein sehr spezifisches Subjekt die Hauptrolle spielt, wenn es<br />
darum geht, Originalität zu verstehen. Dieses Subjekt ein Genie zu nennen,<br />
heißt von Versatzstücken der alten ingenium-Lehre Gebrauch zu machen,<br />
zu der neben den Musen auch Platos Daimonion zählt, gibt ihnen jetzt<br />
aber einen ganz neuen Stellenwert. <strong>Der</strong> Sachgehalt ›Original‹ lässt sich aus<br />
dem Faktum eines originalen Subjektes nicht <strong>des</strong>halb erklären, weil es dank<br />
seiner Hände sein Verursacher ist. Um eine mechanische Kausalität von<br />
Ursache und Resultat handelt es sich nicht. Was dieses Subjekt statt<strong>des</strong>sen<br />
auszeichnet, ist mehr: Es erweist sich als das Sprachrohr der Natur. Es ist<br />
das Genie, das es ist von Geburt an, und keine Erziehung wäre imstande es<br />
ihrerseits hervorzubringen. Die Natur manifestiert sich jetzt als ein inneres<br />
Organ, auf das der Künstler hört, ohne dass das, was er tut, ihm selbst<br />
zugänglich und beschreibbar wäre. Natur ist auch nicht jene äußere Folie,<br />
auf deren Vorbildlichkeit sich die alte Nachahmungslehre, während Jahrhunderten,<br />
gestützt hatte. Natur ist statt<strong>des</strong>sen ein eingeborenes Potenzial,<br />
das sich poietisch ausagiert. Sicheres Zeichen der Präsenz jener außerordentlichen<br />
Gabe ist das Original, das zwischen Regel und Abweichung die<br />
Mitte hält. Kant kämpfte mit dem beunruhigenden Problem <strong>des</strong> »originalen<br />
Unsinns« und er gedachte es zu bewältigen, indem er auf der Exemplarität<br />
<strong>des</strong> Originalwerkes beharrte, seiner Zugehörigkeit zu einem Horizont gesellschaftlicher<br />
Verbindlichkeiten, den er Geschmack nannte und als Ausdruck<br />
eines allen zugänglichen Gemeinsinns definierte.<br />
Kants Theorie <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> ist auch <strong>des</strong>halb bemerkenswert, weil er sich<br />
damit selbst ins Wort fällt. Denn zuvor hatte er, in der Kritik der reinen<br />
Vernunft, gerade ausführlich dargetan, dass man von jener Natur, einem<br />
wesenlosen und erkenntnisfernen »Ding an sich«, nichts wissen kann.<br />
Jetzt aber tritt die Natur aus ihrer theoretischen Reserve und gewinnt in den<br />
Originalen eine Stimme, die im kulturellen und historischen Raum geformt<br />
und gehört wird.
D AS GEHEIMNIS DES ANFANGS<br />
<strong>Der</strong> kleine Umweg über Kant erlaubt uns, Distanz zu schaffen, das Ungenügen<br />
an einer herkömmlichen Bewertung <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> zu durchschauen.<br />
Nicht zuletzt lehrt der Spiegel dieser Ausstellung, dass die theoretischen<br />
Reflexionen einer grundlegend veränderten Empirie anzupassen sind.<br />
Es scheint nicht länger sinnvoll die Konturen <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> mit denjenigen<br />
<strong>des</strong> autonomen Kunstwerks gleichzusetzen, wenn die wissenschaftliche,<br />
kulturelle, gesellschaftliche und politische Sphäre ihrerseits unter Vorzeichen<br />
<strong>des</strong> <strong>Originals</strong> gerückt ist. Wir erinnern nur an ein einziges Beispiel<br />
innerhalb der Ausstellung: an Dieter Grimms Bezugnahme auf das Ur-<br />
Exemplar <strong>des</strong> deutschen Grundgesetzes von 1949, <strong>des</strong>sen materielle<br />
Identität und Beschaffenheit zum Ausgangspunkt einer Betrachtung wird,<br />
in der das Original-Originäre dieses Textes an seiner Wirkungs- und<br />
Geltungsgeschichte verdeutlicht wird, zu der eine Fülle von Änderungen<br />
gehört, welche der Identität <strong>des</strong> Textes und der Kraft seines Anfangs<br />
nichts genommen haben. Im Gegenteil: Erst die Existenz <strong>des</strong> Sohnes oder<br />
der Tochter macht den Vater zum Vater.<br />
Originale werden darüber keineswegs zeitlose Größen. Ganz im Gegenteil:<br />
Zu ihrer Auszeichnung gehört es, bestimmten historischen Momenten<br />
(oft aus dem Kontext oder Untergrund ihrer Entstehung) Gesicht und<br />
Gestalt zu geben. Anzeichen <strong>des</strong> Zeitgeistes, der Atmosphäre oder eines<br />
genius loci, der kulturellen oder persönlichen Herkunft kommen ins Spiel,<br />
nicht weniger Spuren <strong>des</strong> Alters. Auch Originale können ermüden, ja sie<br />
sind sterblich (Angela Matyssek). Viele von ihnen sind entschwunden und<br />
gewiss allein ist die ungewisse Zahl jener, die existiert haben, ohne dass<br />
irgendeine Kunde auf uns gekommen wäre.<br />
Wenn man das Original von anthropologischen und historischen Voraussetzungen<br />
her refiguriert, dann darf man getrost annehmen, dass es<br />
die Entwicklung der Menschen seit ihren kulturellen Anfängen begleitet<br />
hat. Allein schon <strong>des</strong>halb, weil sich in ihm das Agens <strong>des</strong> Neuen und <strong>des</strong><br />
Anderen verkörpert. Einer genauen Analyse bedürfte auch die Begriffs-<br />
19
20<br />
geschichte, samt verwandter Namen und Synonyma. Als aufschlussreich<br />
dürfte sich auch ein Blick in andere Weltkulturen erweisen, der die Scheuklappen<br />
unserer europäischen Auffassung erkennbar machen könnte.<br />
All dies gehört zum laufenden Programm einer Differenzierung <strong>des</strong> Originalitäts-Konzeptes.<br />
Die Liste der Erfordernisse, die einer revidierten Theorie zugrunde liegen<br />
sollten, ist lang. Nicht zuletzt zählt der schwere Abschied von jener<br />
vertrauten Idee dazu, die im genialen Subjekt die Quelle und den Erklärungsgrund<br />
<strong>des</strong> <strong>Originals</strong> erkannt hat. Er wird freilich befördert durch<br />
die vehemente Kritik, die das souveräne Subjekt seit Darwin, Nietzsche<br />
oder Freud erfahren hat. Die Vertreibung aus seinem eigenen Haus<br />
signalisierte später auch die ebenso radikale wie missverständliche Parole<br />
vom »Tod <strong>des</strong> Autors«, die allerdings dazu verhilft, den Blick auf all die<br />
Bedingtheiten zu lenken, auf denen Autorschaft tatsächlich beruht. Sie<br />
reichen von psychischen, ethnischen, historisch-gesellschaftlichen bis<br />
zu ideologischen und zahlreichen anderen Konditionen. Die Pointe dieses<br />
Hinweises besteht nun freilich nicht darin, den Autor und seine Rolle<br />
überhaupt in Frage zu stellen. Es geht vielmehr darum, ein anderes Modell<br />
jener feinen Wechselwirkungen zu entwerfen, die den Prozess produktiver<br />
Gestaltung lenken. Dabei wird auch deutlich, welche aktive Rolle Medium,<br />
Syntax, Materialität oder Verfahren in Literatur, Bildnerei, Musik oder in<br />
den Bewegungskünsten gespielt haben. Nicht zu reden von der Neigung<br />
zum Fragmentarischen oder zum offenen Kunstwerk, zur Anerkennung<br />
<strong>des</strong> Zufalls als eines inspirierten oder auch missgünstigen Mitspielers,<br />
zur Inszenierung reproduktiver bzw. serieller Techniken. Sie alle haben<br />
Autorschaft nicht gemindert, sondern ihrer Komplexität neue Spielräume<br />
geschenkt, der großartigen Idee der origo einmal mehr strahlenden Glanz<br />
verliehen. Es bedarf der abgründigen Innerlichkeit <strong>des</strong> Genies nicht – aus<br />
dem auf dunkle Weise Natur spricht – um zu verstehen, was Originale<br />
selbst ermöglicht und was sie in der Kultur möglich machen.<br />
In diesem Kontext kommt der Gedanke einer Verschwisterung von Original<br />
und Anfänglichkeit zum Tragen. Er bezieht sich nicht nur auf Kunstwerke,
sondern auf die skizzierte Sphäre materieller Hinterlassenschaften. Ist<br />
damit alles, was sich an Überbleibseln in Archivschachteln oder sonst wo<br />
findet auch originalitätsträchtig? Mitnichten. Es bedarf einer Bestimmung<br />
unterschiedlicher Intensitätsgrade. Mit der materiellen Identität, die etwas<br />
als authentisch oder echt ausweist, ist es nicht getan. Was es braucht,<br />
ist die Möglichkeit <strong>des</strong> Scheiterns produktiver Prozesse. Sie ermöglicht<br />
nämlich zugleich auch das Gelingen – in seiner jeweiligen Eigenart und<br />
Dichte. Solche Zeugnisse, die keinerlei Zugang zur Psychomachie der<br />
Gestaltung eröffnen, fallen auf die Seite <strong>des</strong> lediglich Antiquarischen. Ihr<br />
Originalitätscharakter ist schwach oder abwesend. Originale sind, kurz<br />
gesagt, nicht nur gemacht, sondern auch gewagt.<br />
In der Linie dieser Argumentation geht es darum, die Rolle <strong>des</strong> souveränen<br />
und geschichtsfernen Subjekts durch die <strong>des</strong> gestaltenden, handelnden<br />
und bewegten Menschen zu ersetzen – durch ein Körperwesen,<br />
das stets in Situationen verstrickt ist und in Spielräumen agiert. Damit<br />
aber gewinnt Zeit eine konstitutive Dimension.<br />
Jeder Anfang hat sein Geheimnis. Dann jedenfalls, wenn man ihn<br />
nicht als den ersten, abstrakten Punkt einer Zeitreihe begreift, als bloßes<br />
Startsignal eines zeitlichen Verlaufs, sondern als Quellpunkt sich<br />
entfaltender Möglichkeiten.<br />
Dazu bedarf es stets einer Konkordanz mit dem Ende, das seinerseits<br />
gesetzt ist. Beide zu verknüpfen ist eine Auszeichnung <strong>des</strong> Menschen,<br />
der im Übrigen sehr genau weiß, dass er dem Vergehen ausgeliefert ist.<br />
<strong>Der</strong> Autor eröffnet die temporalen Spielräume einer jeweiligen, gestalteten<br />
Welt, der Leser, Hörer oder Beschauer verwandelt sie in Erfahrungen,<br />
er legt sie aus.<br />
Originale, davon war viel die Rede, sind in die materielle Welt eingelassen.<br />
Das zeichnet sie gegenüber Begriffen, Ideen, Algorithmen oder Konzepten<br />
aus: Sie verkörpern sich. Und zwar im Augenblick, genau gesagt:<br />
als ein stehender Augenblick, der durch die Geschichte hindurch Stand<br />
hält. In diesem originären Augenblick verschränken sich ganz gegensätzliche<br />
Qualitäten zu einer wirksamen Größe: momentum und moment,<br />
21
22<br />
d. h. Antrieb und aufscheinende Zeit, das Plötzliche und die Dauer. Es ist<br />
diese unvergleichliche Steigerung, der Zuwachs an Präsenz, die eines<br />
Körpers bedarf und den Namen rechtfertigt, der diesen Zeilen voransteht:<br />
Augenblicksgötter.<br />
Im Pantheon dieser Ausstellung versammeln sie sich: ganz unterschiedliche<br />
Kandidaten für das Originale. Sie warten darauf, von Besuchern<br />
erprobt, aber auch verworfen zu werden, ins Licht der Aufmerksamkeit zu<br />
treten.
Vorspiel
25<br />
Indirekt mit dem Original in Berührung: Gipsabguss <strong>des</strong> Bruchstücks<br />
eines römischen Abgusses der heute nicht mehr erhaltenen bronzenen<br />
Statuengruppe, die die beiden Tyrannentöter Aristogeiton und Harmodios<br />
zeigt und 477/76 v. Chr. auf dem Marktplatz von Athen aufgestellt worden<br />
ist. – Leihgabe: Archäologische Sammlung Freiburg.<br />
L UCA GIULIANI<br />
Das vorliegende Fragment eines bärtigen Kopfes ist kein auratisches<br />
Original, sondern nur der Abguss eines Abgusses, gewissermaßen ein<br />
Abguss hoch zwei. Genauer: Es handelt sich um einen modernen Abguss<br />
vom Bruchstück <strong>des</strong> antiken Abgusses einer griechischen Bronzestatue<br />
<strong>des</strong> frühen 5. Jahrhunderts v. Chr.<br />
Um die Mitte der 50er-Jahre <strong>des</strong> vergangenen Jahrhunderts wurde in<br />
Baia am Golf von Neapel bei der Ausgrabung einer römischen Thermenanlage<br />
auch eine große Anzahl von Gipsfragmenten gefunden. Sie lagen<br />
mit Erde und Schutt vermischt in einem Kellerraum, der irgendwann außer<br />
Gebrauch geraten und aufgefüllt worden war: Dabei hatte man unter<br />
anderem auch Gipsstatuen zerschlagen und als Füllmaterial verwendet.<br />
Die Bruchstücke wurden gereinigt und kamen in einen Schrank, wo sie<br />
zunächst nicht weiter beachtet wurden. Erst allmählich wurde klar, dass es<br />
sich bei den Gipsstatuen um Abgüsse griechischer Originale gehandelt<br />
hatte.
26<br />
Lebensgroße Statuen aus Bronze waren eine zentrale Gattung der griechischen<br />
Plastik <strong>des</strong> 5. und 4. Jahrhunderts gewesen; sie wurden von<br />
römischen Sammlern und Kunstkennern hoch geschätzt. Nur ein winziger<br />
Teil von ihnen hat sich erhalten; der ganze Rest ist in der Spätantike oder<br />
im Mittelalter eingeschmolzen worden, um daraus wiederverwendbares<br />
Material zu gewinnen. Die wenigen originalen griechischen Bronzestatuen,<br />
die wir heute besitzen, stammen größtenteils aus dem Meer, wo sie vor<br />
dem Zugriff der Recycler geschützt waren; sie gehörten zur Ladung von<br />
Schiffen, die in der Antike gesunken waren. Von den Bronzestatuen<br />
berühmter griechischer Künstler hat man in römischer Zeit Marmorkopien<br />
hergestellt. Die besten darunter sind Meisterwerke von seltener Virtuosität:<br />
Sie richteten sich an vermögende Connaisseurs, die den Schmelz<br />
zeitgenössischer Meißelarbeit ebenso schätzten wie eine möglichst weitgehende<br />
Treue zum Original. Aus diesem Grund arbeiteten römische<br />
Kopisten vielfach nach Abgüssen der bronzenen Vorbilder, weil diese es<br />
erlaubten, Maß zu nehmen und je<strong>des</strong> Detail zu kontrollieren. Von solchen<br />
Abgüssen stammten die in Baia gefundenen Fragmente. In mühseliger<br />
Forschung ist es gelungen, viele davon auf bekannte, durch Marmorkopien<br />
überlieferte Werke griechischer Meister zurückzuführen. Unser<br />
bärtiger Kopf war dabei das erste Stück, das identifiziert werden konnte.<br />
Es handelt sich um den Kopf <strong>des</strong> Aristogeiton aus der so genannten<br />
Tyrannenmördergruppe der Bildhauer Kritios und Nesiotes aus dem Jahr<br />
477/76. Im Jahr 514 war in Athen bei einer Festversammlung mitten auf<br />
der Agora Hipparch, der Bruder <strong>des</strong> Tyrannen Hippias, dem Anschlag<br />
zweier Aristokraten zum Opfer gefallen. Die beiden Attentäter – Aristogeiton<br />
und sein jüngerer Freund Harmodios – büßten dafür mit ihrem Leben.<br />
Wenige Jahre später, nach dem Sturz <strong>des</strong> Hippias, wurden sie in<strong>des</strong> als<br />
Befreier <strong>des</strong> Vaterlan<strong>des</strong> gefeiert. Man errichtete ihnen unweit vom Ort<br />
<strong>des</strong> Attentates eine Statuengruppe, die sie im Augenblick der Tat darstellte:<br />
das erste politische Denkmal der abendländischen Geschichte.<br />
Diese Gruppe der Tyrannenmörder muss weithin als politisches Wahrzeichen<br />
empfunden worden sein; nicht zufällig wurde sie von den Persern,
als diese im Jahr 480 vorübergehend die Stadt eroberten, als Kriegsbeute<br />
entführt und nach Persepolis verschleppt. Die Athener wiederum<br />
gaben als Ersatz sofort eine zweite Gruppe in Auftrag, die wenige Jahre<br />
später am selben Ort aufgestellt wurde – und auf diese geht unser Fragment<br />
zurück. Es zeigt die lebendige Modellierung der Bronzeoberfläche,<br />
die feine Ziselierung der einzelnen Bartlocken, den offenen Mund und den<br />
geblähten Nasenflügel als Ausdruck höchster Erregung. Beim Original<br />
müssen die Augenlider mit feinen, aus Bronzeblech gearbeiteten Wimpern<br />
versehen gewesen sein; um diese nicht zu beschädigen, wurden sie<br />
vor dem Abguss mit einer schützenden Masse verklebt; bei den unteren<br />
Wimpern ist dieser Schutzkragen deutlich zu sehen; bei den oberen<br />
Wimpern hingegen scheint die entsprechende Partie in der Negativform<br />
mit Gips aufgefüllt worden zu sein, wohl um eine störende Überschattung<br />
<strong>des</strong> Auges zu vermeiden. Nicht zuletzt in solchen Details und in seiner<br />
ganzen mechanischen Zuverlässigkeit kommt der Gipsabguss der Gestaltung<br />
<strong>des</strong> Bronzeoriginals näher als jede Marmorkopie. Die technische<br />
Reproduktion mag die Aura zerstören, erweist sich aber als unbestechliches<br />
Konservierungsmittel. – Lit.: Christa Landwehr, Die antiken Gipsabgüsse<br />
aus Baiae, Berlin 1985.<br />
27<br />
Neuerfindung eines <strong>Originals</strong>: Dreirad, das Karl Valentin 1939 als<br />
Bühnenrequisit für seinen Auftritt als »Wrdlbrmpfd« in Eduard Künnekes<br />
Operette Glückliche Reise zusammengebastelt hat – nach einem<br />
alten Foto, das er in seiner ›Lichtbilderserie von Münchener Originalen,<br />
stadtbekannten Persönlichkeiten und Sonderlingen‹ kommentiert hat:<br />
»1895 baute er (›der fahrende Sägfeiler von der Au‹) sich selbst ein<br />
Dreirad und das war eine Sensation, als er mit seiner Maschine im 5-Kilometer-Tempo<br />
durch die Münchner Straßen fuhr. Er hatte außer einem<br />
chronischen Schnapsrausch auch einen ebensolchen Schnupftabakrausch,<br />
denn er schnupfte nicht weniger als täglich 1 /4 Pfund ›Schmalzler‹«. –<br />
Leihgabe: Theaterwissenschaftliche Sammlung, Universität zu Köln.
28<br />
M ICHAEL GLASMEIER<br />
Im Sommer 1939 war es München schon nach Ausland zumute, als im<br />
Theater am Gärtnerplatz Karl Valentin in einer Einlage zur Eduard Künnekes<br />
Operette Glückliche Reise Variationen seines »Radfahrer«-Dialogs<br />
improvisierte. Beteiligt waren der Komiker selbst, ein Schutzmanndarsteller<br />
und jenes Fahrrad, das sich als eine der wenigen Requisiten eines<br />
ansonsten reichen Bühnenlebens erhalten hat. Zwischen den Operettenohrwürmern<br />
vom Leben als Karussell und der Liebe ohne Grenzen treten<br />
drei Wesen auf, um einen realistischeren Unsinn aufzuführen, der mit<br />
vorschriftsmäßiger Beleuchtung, mit Hupen und Klingeln und dem tollen<br />
Namen »Wrdlbrmpfd« glänzt. Im Mittelpunkt also dieses Dreirad als<br />
dünnes, vom Komiker selbst gebasteltes Gestänge, fragil wie eine frühe<br />
Tinguely-Skulptur. Wenn Wrdlbrmpfd auf diesem fährt, stoßen die Knie<br />
fast an den Lenker, und die »lebende Karikatur« Valentin verdoppelt sich in<br />
der Mechanik einer Junggesellenmaschine, die im Kurzfilm Nur nicht<br />
drängeln (1937/38) zudem durch eine Glühbirne in Fassung und eine<br />
Hupe zur wahrer Größe aufläuft. Mager wie Wrdlbrmpfd drohte das Rad<br />
mit seinen nun abgerissenen Reifen schon damals davonzufliegen und<br />
musste mit Steinen beschwert werden, was Valentin in Anwesenheit<br />
Hitlers zur vom Publikum bejubelten Kritik an <strong>des</strong>sen Baupolitik nutzte (ein<br />
Verbot der Einlage folgte). Schließlich ist dieses »Transportrad« weniger<br />
Requisit, sondern wie bei Jarry und Duchamp autonomes Gegenüber,<br />
»Bilder fahrzeug«, von dem Valentin auch ein Gegenteil mit sich führte:<br />
kleines Rad vorn und zwei große hinten.
Anfang und Wiederholung
B EGINNEN<br />
Originale führen uns an den Anfang. Sie sind Plätze, an denen etwas<br />
auftaucht oder über uns hereinbricht, Orte der Schöpfung, Zeugen der<br />
Erfindung, Spuren der Entstehung, Räume einer neuen Welt. Sie zeigen<br />
uns den Augenblick, in dem aus nichts etwas und aus Chaos Ordnung<br />
wird. Manchmal ist es ein Wort, das den Anfang setzt, ein halber Satz, ein<br />
poetisches Bild oder der hergewehte Klang eines kaum verständlichen<br />
Lieds.<br />
<strong>Der</strong> Entwurf gibt uns die Idee <strong>des</strong> Ganzen in die Hand. Wir begreifen,<br />
wie etwas geworden ist, und sehen das, was als Erstes da war und<br />
manchmal auch als Einziges übrig geblieben ist. <strong>Der</strong> Anfang kann<br />
auch nur ein erster Einfall ohne Folge sein. Das Original ist dann ein<br />
utopisches Überbleibsel, der Rest von etwas, was nur als Ahnung<br />
da war.
1/I
1<br />
Hölderlins erster Entwurf der Hymne Tinian, 1800/01.
5<br />
Blatt aus Benns Rezeptblock mit dem Text <strong>des</strong> Schlagers Because of you, 1953.<br />
Ausgangspunkt für das Gedicht Bar.
Zwei der Teebeutelverpackungen, die Peter Kurzeck für Entwürfe verwendet hat.<br />
9
2 3<br />
4<br />
BEGINNEN<br />
6<br />
7<br />
2 Mörike: »Frühling<br />
läßt sein blaues<br />
Band ...«<br />
3 Fontane:<br />
<strong>Der</strong> Schmied<br />
von Lipinka<br />
4 Schnitzler: Erster<br />
Einfall zu Professor<br />
Bernhardi<br />
6 Celan: »Windstoß«<br />
und »Marderstern«<br />
7 Jünger: Einziges<br />
beschriebenes Blatt<br />
in einem Notizblock<br />
8 Sebald: Satzbruchstück<br />
im<br />
Ausgewanderten-<br />
Manuskript<br />
8
34<br />
1<br />
Wortinseln aus dem Nichts: Friedrich Hölderlins erster Entwurf der<br />
Hymne Tinian (1800/01), in dem er mit fertigen und halbfertigen Versen<br />
so wie einzelnen »Keimwörtern« (so hat der Hölderlin-Forscher Friedrich<br />
Beißner Wörter genannt, die am Anfang für sich stehen und aus denen<br />
dann Hölderlin ganze Texte entfaltet) den inhaltlichen und formalen Umriss<br />
<strong>des</strong> Gedichts absteckt:<br />
Tinian.<br />
Süß ists zu irren<br />
In heiliger Wildniß,<br />
Und an der Wölfin, Euter, o guter Geist,<br />
<strong>Der</strong> Wasser, die<br />
Durchs heimatliche Land<br />
Durchirren Mir irren,<br />
, wilder sonst,<br />
Und jezt gewöhnt, zu trinken, Findlingen gleich;<br />
Und Des Frühlings, wenn im warmen Grunde<br />
Des Haines wieder kehrend fremde Fittige.<br />
tags aus ruhend in Einsamkeit,<br />
Und an Palmen; staude<br />
Wohlduftend<br />
Mit Sommervögeln<br />
Zusammenkommen die, Bienen,<br />
Und deinen Alpen<br />
von Gott getheilet<br />
<strong>Der</strong> Welttheil,<br />
z[w]ar sie stehen<br />
Gewapnet,<br />
A NFANG UND WIEDERHOLUNG
2<br />
Scheinbar von Anfang an fertig: Eduard Mörikes Gedicht Er ist’s, das<br />
am 22. Februar 1846 in Löffelstelzen bei Bad Mergentheim wie zugefallen<br />
scheint:<br />
Frühling läßt sein blaues Band<br />
Wieder flattern durch die Lüfte.<br />
Süße wohlbekannte Düfte<br />
Streifen ahnungsvoll das Land;<br />
Veilchen träumen schon,<br />
Wollen balde kommen.<br />
Horch von fern ein leiser Harfenton!<br />
Frühling ja du bists!<br />
Dich hab ich vernommen!<br />
35<br />
Entstanden ist das Gedicht, das hier auf dem Blatt eines kleinen Taschenkalenders<br />
Platz findet, der Mörikes Frau Margarethe gehörte, und als<br />
Erlebnis eines bestimmten Tages und Orts ausgegeben wird, viel früher:<br />
am 9. März 1829 im oberschwäbischen Pflummern. 1832 hat Mörike<br />
es veröffentlicht: In seinem Roman Maler Nolten singt es die Tochter<br />
eines Gefängniswärters bei der Gartenarbeit. 1846 ist es ihm ›wieder<br />
eingefallen‹. Und schon 1829 ist es Erinnerung an ein anderes Frühlingsgedicht<br />
und <strong>des</strong>sen luftiges Himmelsreich: Im Mai 1828 hatte Mörike<br />
einen »Vers, der erst diesen Morgen ausgeschlüpft ist«, dem Freund<br />
Johannes Mährlein geschickt:<br />
Da lieg ich auf dem Frühlingshügel,<br />
Die Wolke wird mein Flügel,<br />
Ein Vogel fliegt mir voraus!<br />
Ach, sag’ mir, alleinzige Liebe,<br />
Wo Du bleibst, daß ich bei Dir bliebe!<br />
Doch, Du und die Lüfte – haben kein Haus.<br />
BEGINNE N
36<br />
3<br />
Anfänge, im Gespräch aufgeschnappt oder aus der Zeitung<br />
ausgeschnitten: Theodor Fontanes unvollendete Erzählung <strong>Der</strong> Schmied<br />
von Lipinka, die mit einer Meldung aus der Neuen Preußischen Zeitung<br />
vom 15. Juni 1880 beginnt, und sein Entwurf zu Effi Briest, in dem die<br />
berühmte, immer wieder fallende Redewendung <strong>des</strong> alten Briest schon<br />
das letzte Wort hat – rund sechs Jahre, bevor der Roman 1896 erscheint:<br />
35. Kapitel.<br />
1. Effi trifft in Hohen-Cremmen ein.<br />
2. Instetten avancirt, Wüllersdorf kommt, ihm zu gratulieren.<br />
Zwiegespräch.<br />
36. Kapitel.<br />
1. Effis Gesundheitszustand. Rollo trifft ein.<br />
2. Krankheit. Gespräch zwischen Mutter & Tochter.<br />
3. Effis Tod.<br />
4. Gespräch zwischen Briest & Frau. ›… ach Luise, das ist ein<br />
weites Feld‹.<br />
A NFANG UND WIEDERHOLUNG
4<br />
Anfangen als Anzetteln: Arthur Schnitzlers erster Einfall zu Professor<br />
Bernhardi 1899, den er mit Maschine festhält und von Hand ergänzt:<br />
Intrigen gegen den Professor werden angezettelt. Es kommt endlich<br />
so weit, daß B. [wegen] Rel[igions-]Stö[run]g gestellt wird – u[nd]<br />
3 Mon[ate] Kerker erhält … Nach der Verhandlung kommt er nach<br />
Hause; s[eine] Freunde versammelt bei ihm, während bei ihm Beratung<br />
gepflogen wird – läßt sich der Priester melden, derselbe ein Besuch<br />
melden – der Freund [<strong>des</strong> Arztes].<br />
37<br />
Erst zehn Jahre später, 1909, arbeitet Schnitzler den Einfall zu einem<br />
Theaterstück aus.<br />
BEGINNE N
5<br />
Inspiration aus der Jukebox? Blatt aus Gottfried Benns Rezeptblock<br />
mit dem Text eines durch Louis Armstrong und Tony Bennett bekannt<br />
gewordenen Ohrwurms und Filmtitelsongs:<br />
38<br />
Because of you<br />
There’s a song in my heart<br />
Because of you my<br />
romance had it’s start<br />
Because of you the sun will shine<br />
The moon and stars<br />
will say you’re mine.<br />
Auf der Rückseite beginnt Benn im Januar 1953 »mit einer ersten fahrigen<br />
Niederschrift eines veritablen Gedichts« (Robert Gernhardt):<br />
Flieder in Silbr Vasen<br />
Ampeln gedämpftes Licht<br />
U die Amis rasen<br />
Wen[n] die Sänger[in] spricht<br />
in den großen Stunden<br />
Berlin –<br />
U in die Geige schwellen<br />
Jokohama, Bronx u Wien<br />
U die Wildlederschuhe stellen<br />
das Universum hin.<br />
Benn lässt sich den Song von seiner Frau Ilse übersetzen und macht sich<br />
dann im fertigen Gedicht Bar seinen eigenen Reim darauf:<br />
A NFANG UND WIEDERHOLUNG
Because of you (ich denke)<br />
Romance had its start (ich dein)<br />
because of you (ich lenke<br />
zu dir und du bist mein).<br />
6<br />
Poetisches Initial: Zwei Verspaare, von denen Paul Celan das erste<br />
(»<strong>Der</strong> Windstoß, geharnischt, er durchs Meer. / Kein Marderstern mehr«)<br />
als Wortmaterial für zwei verschiedene Gedichte verwendet hat. 1948<br />
taucht ein Teil in seinem Gedicht Spät und tief am Ende auf:<br />
39<br />
Es komme die Schuld über uns aller warnenden Zeichen,<br />
es komme das gurgelnde Meer,<br />
der geharnischte Windstoß der Umkehr,<br />
der mitternächtige Tag,<br />
es komme, was niemals noch war!<br />
Die Wortschöpfung »Marderstern« wird in Die Silbe Schmerz 1963<br />
veröffentlicht, wieder am Ende:<br />
[…] ein<br />
Knoten<br />
(und Wider- und Gegen- und Aber- und Zwillings- und Tausendknoten),<br />
an dem<br />
die fastnachtsäugige Brut<br />
der Mardersterne im Abgrund<br />
buch-, buch-, buchstabierte,<br />
stabierte.<br />
BEGINNE N
40<br />
7<br />
Anfang und Ende: Das Chaos als Schicksalsmacht hat Jünger schon<br />
früh fasziniert. 1929 schreibt er in seinem Aufsatz ›Nationalismus‹ und<br />
Nationalismus lapidar: »Das Chaos ist dem Werdenden günstiger als die<br />
Form«. 1963 heißt es in einem neuen Vorwort zu seinem Buch <strong>Der</strong> Arbeiter<br />
(1932): »Unerschütterlich, stets wirksamer aus dem Chaos hervortretend,<br />
bleibt allein die Gestalt <strong>des</strong> Arbeiters«. Auf der einzigen beschriebenen<br />
Seite in einem Notizblock, wohl von 1968 hat Jünger nur dieses<br />
Wortpaar nicht überschrieben: »Chaos und Schicksal«.<br />
8<br />
Mittendrin beginnen: Blatt aus W. G. Sebalds Manuskript zu Die Ausgewanderten<br />
mit dem Bruckstück zweier Sätze:<br />
Bergen kommt der Tag herauf mit rotgoldenem Schein. Ein Abglanz<br />
davon überzie<br />
Sebald ergänzt diese Sätze später: »Jenseits der Wasserstraße, hinter den<br />
schwarzblauen albanischen Bergen, kommt der Tag herauf, breitet seinen<br />
Flammenschein über die noch lichtlose Welt.«<br />
A NFANG UND WIEDERHOLUNG
9<br />
Wort-, Szenen- und Umfangsanfänge: Teebeutelpapierverpackung,<br />
auf die Peter Kurzeck in Stichworten eine Szene zu einem seiner nicht<br />
realisierten Projekte über seine Heimatstadt Staufenberg entworfen hat:<br />
Stfbg 2<br />
die dunklen<br />
Holzscheunen.<br />
Heiß in der<br />
Sonne.<br />
Holzstapel<br />
+ wie das Holz in der Sonne riecht<br />
–––<br />
scheunen +<br />
Holzschuppen<br />
Das Brennholz.<br />
alte<br />
Zäune<br />
41<br />
BEGINNE N
Daneben ausgestellt: Umfangsberechnung zu Kurzecks als Fragment<br />
hinterlassenem Roman Bis er kommt sowie vier weitere für die Arbeit<br />
an diesem Roman bestimmte, aber noch unbeschriftete Teebeutelverpackungen.<br />
– Leihgabe: KD Wolff, Frankfurt a. M.<br />
42<br />
A LEX ANDER LOSSE<br />
Um den Umfang seiner Manuskripte besser abschätzen zu können,<br />
notierte Peter Kurzeck Seitenanzahlen geschriebener Kapitel auf separate<br />
Zettel und Papiere, meist Briefumschläge – oder eben auch auf die<br />
Rückseiten jener kleinen Papierhüllen, in welche Teebeutel verpackt sind.<br />
Dem Manuskript zum Romanfragment Bis er kommt obenauf liegt ein von<br />
mehreren Büroklammern zusammengehaltenes Konvolut, die maschinenschriftliche<br />
Abschrift noch nicht verwendeter Notizen für weitere Kapitel,<br />
nach Motiven sortiert (z. B. Nacht, Jürgen, Menschen, Sonntag, Sorgen,<br />
Carina, Weg) und mit Textmarkern in verschiedenen Farben angestrichen.<br />
Auf diesen Blättern prangt das Teebeutelpapier. Weitere, noch unbeschriebene<br />
Teebeutelpapiere fanden sich in einem Briefumschlag neben<br />
einem kleinen grünen Notizheft zu dem geplanten Roman. Kurzecks<br />
Gewohnheit, mit dem Material Papier derart sparsam umzugehen, mag auf<br />
die ärmlichen Lebensumstände seiner Flüchtlingskindheit in Staufenberg<br />
zurückzuführen sein.<br />
Ein leerer Briefumschlag, auf <strong>des</strong>sen Rückseite die Seitenanzahlen<br />
einzelner Kapitel <strong>des</strong> Romans Vorabend gezählt sind, erhellt den Sinn<br />
der kryptischen Zählung auf dem Teebeutelpapier. »3 x 7« heißt: 3 Kapitel<br />
mit je 7 Seiten. <strong>Der</strong> Briefumschlag liegt einem Konvolut von Kopien von<br />
Vorabend-Kapiteln bei. Solche Kopien bildeten die Grundlage der Texterfassung<br />
der Romane im Stroemfeld Verlag. Originalmanuskripte behielt<br />
Peter Kurzeck stets in Uzès oder trug sie bei sich.<br />
Kurzeck hat Teebeutelpapiere auch für literarische Notizen verwendet,<br />
die er später in Notizhefte übertrug. Nur wenige solcher ›literarischen‹<br />
Teebeutelpapiere haben sich erhalten – viele andere hat Kurzeck vermutlich<br />
vernichtet, sobald er die Notizen übertragen hatte. Das seltene<br />
A NFANG UND WIEDERHOLUNG
Beispiel für eine literarische Notiz auf einem Teebeutelpapier gibt<br />
ein Papier in einem der Konvolute zum Projekt »Staufenberg 2«, Kurzecks<br />
Arbeitstitel zu einer geplanten Fortsetzung von Kein Frühling. Für den<br />
Roman Vorabend und für das frei erzählte Hörwerk Ein Sommer, der<br />
bleibt schöpfte Kurzeck aus diesem Fundus von Entwürfen und Notizen.<br />
43<br />
BEGINNE N
N OCH EINMAL<br />
Originale sind einzigartig. Sie sind nur einmal da. Dazu gehört auch,<br />
dass sie viele Anfänge und Ursprünge besitzen können. Von vorne, aufs<br />
Neue, noch einmal. Das Ältere ist dabei nicht mehr Original als das<br />
Jüngere, das Verworfene nicht weniger als das Letztgültige. Allerhöchstens<br />
scheint uns ein wenig originaler, was Spuren der Entstehung<br />
trägt und so mehr als nur einen Wortsinn einschließt. Einer der berühmtesten<br />
Texte der deutschen Literatur, Goethes Faust, setzt das in einem<br />
Studierzimmer in Szene. Übersetzt wird dort »das heilige Original« <strong>des</strong><br />
Johannesevangeliums:<br />
Geschrieben steht: ›Im Anfang war das Wort!‹<br />
Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort?<br />
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,<br />
Ich muss es anders übersetzen,<br />
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.<br />
Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn.<br />
Bedenke wohl die erste Zeile,<br />
Dass deine Feder sich nicht übereile!<br />
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?<br />
Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft!<br />
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,<br />
Schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe.<br />
Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rat<br />
Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat!
1/II
3<br />
Mehrfach aufgeschrieben, hier auf Birkenrinde, später von Mörike<br />
zum Gedicht Gebet zusammengefügt.
8<br />
Blatt, auf dem Sebald Ambros Adelwarths Schrift übt ...
... und die so entstandene Visitenkarte, die er dann in Die Ausgewanderten (1992)<br />
als Abbildung übernimmt.<br />
8
1<br />
10<br />
2<br />
4<br />
N OCH EINMAL<br />
7<br />
5<br />
9<br />
1 Goethe: Urfaust<br />
von 1775, nur in der<br />
Abschrift einer Hofdame<br />
erhalten<br />
2 Schiller: Korrektur<br />
zu Beginn der<br />
Piccolomini<br />
4 Hegel: Kommentarspalte<br />
zur<br />
»Urtheilskraft«<br />
5 Bethmann Hollweg:<br />
Korrekturen in einem<br />
Telegramm, das den<br />
Ersten Weltkrieg<br />
mitausgelöst hat<br />
6 Schwitters: einer<br />
von vielen Vertonungsversuchen<br />
der Ursonate<br />
7 Broch: »Ur-Ur-<br />
Vergil«<br />
9 Geier: wiederholte<br />
Arbeit an einem ihrer<br />
fünf »großen Elefanten«,<br />
hier Dostojewskis<br />
Verbrechen<br />
und Strafe<br />
10 Esterházy: einer<br />
der ersten Sätze für<br />
Harmonia caelestis<br />
6
46<br />
1<br />
Die einzige Kopie: Das Manuskript von Johann Wolfgang Goethes<br />
Urfaust (1775) ist nur in der Abschrift einer Weimarer Hofdame erhalten,<br />
Luise von Göchhausen. Das Original, so erzählt er Eckermann, war auf<br />
feines Papier geschrieben und »nichts daran gestrichen; denn ich hütete<br />
mich, eine Zeile niederzuschreiben, die nicht gut war.« Er hat es später<br />
vernichtet, kein Projekt hat ihn so lange beschäftigt: Die 12 111 Verse,<br />
die wir heute kennen, sind in einem Zeitraum von 60 Jahren entstanden.<br />
Die verloren geglaubte Abschrift fand man 1887 wieder und gab ihr den<br />
Titel »Urfaust«. Sie ist aus Gründen <strong>des</strong> <strong>Wert</strong>s nicht ausleihbar und wurde<br />
schon einmal für einen unbekannten Zweck nachgestaltet, allerdings<br />
nur mit zwei faksimilierten Seiten der Gartenszene, in der Faust das erste<br />
Mal Gretchens Hand küsst:<br />
Faust<br />
Ein Blick von dir, ein Wort mehr unterhält<br />
Als alle Weisheit dieser Welt. /: er küsst ihre Hand :/<br />
Margr:<br />
Inkomodirt euch nicht! Wie könnt ihr sie nur küssen,<br />
Sie ist so garstig, ist so rauh<br />
Was hab ich nicht schon alles schaffen müssen,<br />
Die Mutter ist gar zu genau. /: Gehn vorüber :/<br />
Leihgabe: Goethe- und Schiller-Archiv Weimar, Klassik Stiftung Weimar.<br />
2<br />
Starker Auftritt: Erste Seite der Piccolomini, die Friedrich Schiller in<br />
der sauberen Abschrift seines Dieners Georg Gottfried Rudolph für<br />
verschiedene Zwecke (den Erstdruck bei Cotta 1800 sowie unterschiedliche<br />
Aufführungen) immer wieder überarbeitet hat und dabei auch den<br />
berühmten Anfangsvers fand:<br />
Spät kommt Ihr – – Doch Ihr kommt! <strong>Der</strong> weite Weg,<br />
Graf Isolan, entschuldigt Euer Säumen<br />
A NFANG UND WIEDERHOLUNG
(zuvor: »Gut, daß Ihrs seid, daß wir Euch haben! Wußt ichs doch, / Graf<br />
Isolan bleibt nicht aus, wenn sein Feldherr Chef / Auf ihn gerechnet hat.<br />
– Willkommen Oberst Buttler«).<br />
Depositum: Württembergische Lan<strong>des</strong>bibliothek Stuttgart.<br />
47<br />
3<br />
Über 35 Jahre hinweg in immer wieder neuen Zusammenhängen:<br />
Wollest mit Leiden<br />
Und wollest mit Freuden<br />
Mich nicht überschütten!<br />
Doch in der Mitten<br />
Liegt hol<strong>des</strong> Bescheiden.<br />
Die zweite Strophe von Mörikes Gedicht Gebet erscheint zum ersten Mal<br />
1832 im Maler Nolten, wo die wahnsinnige Agnes sie als Morgengebet<br />
spricht: »Ja, nichts geht über die Zufriedenheit. Gottlob, diese hab ich;<br />
fehlt nur noch eins, fehlt leider nur noch eins!«<br />
Später schreibt Mörike die selben Verse auf das ›Naturendlospapier‹<br />
Birkenrinde (1839) und stellt 1846 in der ersten Ausgabe seiner gesammelten<br />
Gedichte eine erste Strophe voran, die sich auch in seiner Bibliothek<br />
findet – in einem alten Gesangbuch (Neue Rothenburgische Seelen-Harfe,<br />
1767) aus Clara Mörikes Besitz, über Johann Agricolas<br />
»Ich ruf zu Dir Herr Jesu Christ / Ich bitt, erhör mein Klagen! / Verleih mir<br />
Gnad zu dieser Frist / Laß mich doch nicht verzagen«:<br />
Herr! schicke, was du willt,<br />
Ein Liebes oder Lei<strong>des</strong>!<br />
Ich bin vergnügt, daß bei<strong>des</strong><br />
Aus Deinen Händen quillt.<br />
Ohne trennende Ziffern, d. h. als ein Gedicht erscheinen die beiden<br />
Strophen erst 1867 in der 4. Auflage seiner Gedichte.<br />
N O CH EINMAL
48<br />
4<br />
Schreiben, Lesen, Schreiben: Georg Wilhelm Friedrich Hegels eigenhändige<br />
Ausarbeitung <strong>des</strong> Para grafen »Urtheilskrafft« für den Unterricht<br />
an der Universität Nürnberg, wo er den Unterrichtsstoff diktiert hat<br />
und dann diskutieren ließ. Sein um 1810 entstandener Entwurf nimmt<br />
dieses Verfahren auf und ist von vornherein auf Wiederlesen und Überarbeiten<br />
angelegt – die zunächst leere linke Spalte lässt Raum für den<br />
Dialog mit sich selber und provoziert das Hin- und Herdenken: »Das<br />
Urtheil ist die Beziehung zweyer Begriffsbestimmungen aufeinander, da<br />
die eine sich als Einzelnes zu einer anderen als dem Besonderen oder<br />
dem Allgemeinen oder als Besondere zu dem Allgemeinen verhält. […]«.<br />
5<br />
Korrekturen bis zuletzt: Entwurf <strong>des</strong> Telegramms, das der deutsche<br />
Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg am 31. Juli 1914 an den<br />
deutschen Botschafter in Petersburg geschickt hat, um Russland ein<br />
Ultimatum zu stellen. Auch er wechselt wie Hegel zwischen der rechten<br />
Haupt- und der linken Korrekturspalte hin und her, um so klar wie möglich<br />
Russland die Schuld am Kriegsausbruch zuzuschreiben, den er schon<br />
für unvermeidbar hält, wie die Korrekturen verraten:<br />
Dringend.<br />
(Nachdem) trotz noch schwebender Vermittlungsverhandlungen, und<br />
obwohl wir selbst bis zur Stunde keinerlei Kriegsvorbereitungen<br />
Mobilmachungsmaßnahmen getroffen hatten, hat Rußland ganze<br />
Armee und Flotte, also auch gegen uns, mobilisiert. Zur Sicherung<br />
unseres Reiches, infolge Durch diese russischen Maßnahmen haben<br />
sind wir gezwungen worden, zur Sicherung <strong>des</strong> Reiches die drohende<br />
Kriegsgefahr auszusprechen müssen, der Mobilmachung, die Krieg<br />
bedeutet, folgen muß, die noch nicht Mobilisierung bedeutet. Die<br />
Mobilisierung muß aber folgen, falls uns nicht Rußland binnen 24 12<br />
Stunden die jede Kriegsmaßnahmen gegen uns und Österreich Ungarn<br />
einstellt und uns hierüber bestimmte Erklärung abgibt. Bitte das sofort<br />
A NFANG UND WIEDERHOLUNG
Herrn Gassonow mitteilen und Stunde der Mitteilung drahten. BH<br />
Lediglich zu Ew. PP. vertraulichen Information. Ich habe Grund zu der<br />
Annahme weiß, daß Swerbejew gestern Nachm. nach Petersburg<br />
telegrafiert hat, wir hätten mobil gemacht, was selbst bis zur Stunde<br />
nicht der Fall ist. Wir hatten bis gestern keinerlei militärische Maßnahmen<br />
getroffen. BH<br />
49<br />
Leihgabe: Politisches Archiv <strong>des</strong> Auswärtigen Amts, Berlin. Aufgrund<br />
der zentralen historischen Bedeutung nur als Faksimile ausstellbar.<br />
6<br />
Urlaute, immer wieder neu: Einige der Varianten der Ursonate von Kurt<br />
Schwitters. Am 5. Mai 1932 wurde das dadaistische Lautgedicht, das<br />
Schwitters »nach den Regeln eines Musikstücks konstruierte«, das erste<br />
Mal aufgezeichnet und in Schwitters Merz-Heft 24 als typografische<br />
Partitur von Jan Tschichold auch erstmals vollständig gedruckt. »Als Geburtsstunde<br />
der Ursonate gilt der Prager Merz-Antidada-Präsentismus-<br />
Auftritt von Kurt Schwitters und Raoul Hausmann im September 1921.<br />
Hausmann rezitierte dort seine Lautgedichte OFFEAH und fmsbw. Hausmanns<br />
Buchstabenfolge »fmsbwtözäu« soll dabei Schwitters zu seinem<br />
»Fümms bö wö tää zää Uu« inspiriert haben, und das »qjyE« aus OFFEAH<br />
war demnach das Vorbild <strong>des</strong> »kwiiEe« seiner Ursonate«. (Helge Schmid)<br />
Schwitters hat die an das Ereignis der Aufführung gebundene Ursonate<br />
in Ansätzen auch immer wieder in Noten gesetzt, u. a. am 5. Februar 1927,<br />
12. Oktober 1938, 18. Oktober 1938, 28. Januar 1939, und 2. Februar<br />
1939. – Leihgabe: Kurt Schwitters Archiv im Sprengel Museum Hannover.<br />
I SABEL SCHULZ<br />
»Die Sonate ist meine umfassendste und wichtigste dichterische Arbeit«,<br />
konstatierte Kurt Schwitters 1926, als er der amerikanischen Sammlerin<br />
Katherine S. Dreier ein vollständiges Typoskript in der Erwartung<br />
schickte, sie würde es als Buch drucken. Zwei Jahrzehnte später bewertete<br />
N O CH EINMAL
50<br />
er die Ursonate neben dem Merzbau in Hannover als eines seiner zwei<br />
»Lebenswerke«, an dem er über zwanzig Jahre lang ununterbrochen<br />
gearbeitet hätte, − auch nach der Drucklegung (Merz 24, 1932), welche<br />
zudem »nicht das letzte Wort« sei, denn nur die Hälfte davon sei »sehr<br />
gut«. Nach wie vor feilte er auch im Londoner Exil weiter an seinem<br />
Lautgedicht, nun an einer vom Englischen beeinflussten Version. In der<br />
Nachkriegszeit hoffte er auf einen Geldgeber, der eine erstmals vollständige<br />
Tonaufnahme seines 35-minütigen Vortrags ermöglichen sollte. Denn<br />
die beiden Aufnahmen von 1925 und 1932 präsentieren nur kurze Ausschnitte,<br />
und durch die Schrift allein sei, wie der Autor feststellte, nur<br />
»eine sehr lückenhafte angabe der gesprochenen sonate zu geben«. Die<br />
Empfehlung, es sei besser, das Werk zu hören als es zu lesen, unterstreicht<br />
<strong>des</strong>sen performativen Charakter. Nicht zuletzt Schwitters’ früher<br />
Tod vereitelte jedoch das Ziel, der Nachwelt einen authentischen klanglichen<br />
Eindruck <strong>des</strong> kompletten Stücks, noch dazu in einer damals aktuellen<br />
(aus heutiger Sicht ›letzten‹) Fassung, zu überliefern.<br />
Umso bedeutender sind die wenigen erhaltenen (Noten-)Autographen und<br />
autorisierten Druckschriften von diesem Hauptwerk an der Grenze zwischen<br />
Literatur und Musik, <strong>des</strong>sen Genese und genaue Überlieferungsgeschichte<br />
noch geschrieben werden muss. Bekanntlich stellte Raoul<br />
Hausmanns Buchstabengedicht fmsbwtözäu, das Schwitters zum Hauptthema<br />
<strong>des</strong> ersten Satzes machte, spätestens 1921 die Initialzündung dar<br />
für den weiteren, von Experimentierlust wie von formaler Konsequenz<br />
geprägten Entstehungsprozess. Waren die drei anderen Sätze auch relativ<br />
rasch ergänzt, so wurde die Sonate anschließend auf der Suche nach<br />
der geschliffensten Version beständig weiter ausgearbeitet. Dieser Prozess<br />
ging auswendig dichtend im Kopf vonstatten, die Form entstand<br />
durch wiederholte Vorträge. Eine Sonate in FMS (Dauer 15 Minuten)<br />
plante Schwitters bereits 1923 für einen Merz-Abend im Deutschen Haus<br />
in Braunschweig, allerdings außer Programm nur für die »gutwilligen und<br />
musikalischen Besucher«. Im selben Jahr erschien ebenfalls die früheste<br />
Publikation der Sonate: Das Presto aus dem vierten Teil (»Grim glim gnim<br />
A NFANG UND WIEDERHOLUNG
imbim tata tata tui«) wurde in Theo van Doesburgs Zeitschrift Mécano<br />
abgedruckt. Andere Passagen, wie das Scherzo (»Lanke trt gll pe pe pe<br />
pe pe ooka, ooka«) und die Kadenz (»Priimiititii«) folgten 1927 in diversen<br />
internationalen Avantgarde-Zeitschriften, was darauf schließen lässt,<br />
dass Schwitters zu diesem Zeitpunkt die schriftliche Niederlegung <strong>des</strong><br />
Werks als abgeschlossen angesehen hat. In der Serie i 10 gab er erstmals<br />
Erläuterungen zu seiner Sonate in Urlauten und ließ die Buchstabenfolgen<br />
in einem neuen Typ von Partitur, einheitlich in einem vertikal verlaufenden<br />
Textband, setzen, − wie sie schließlich nahezu identisch vom Typografen<br />
Jan Tschichold in der letzten vollständigen Druckfassung in Merz 24<br />
ebenfalls präsentiert ist.<br />
Da die Ursonate sich an der klassischen Sonatenform orientiert, komponierte<br />
Schwitters ein Klanggebilde mit einem festgelegten Ablauf, schuf<br />
aus Sprachelementen quasi ein Musikstück. Mit der Begründung, die<br />
Ursonate sei »doch bereits Musik«, lehnte der amerikanische Komponist<br />
Charles Ives folgerichtig den Vorschlag Dreiers ab, das Stück zu vertonen.<br />
Ihr Ansinnen beruhte vermutlich auf der von Schwitters mehrfach bekannten<br />
eigenen Unzulänglichkeit als Musiker und Komponist. Seine diversen<br />
Kompositionen zur Ursonate zwischen 1927 bis 1940 blieben sämtlich<br />
unveröffentlichte Fragmente. Sie bezeugen, dass er unmittelbar im<br />
Anschluss an die Fertigstellung der schriftlichen Fassung mit Versuchen<br />
begann, ein musikalisches Äquivalent zu schaffen mit dem Ziel, die<br />
angestrebten Klänge, den Rhythmus, die Lautstärke und Tonhöhe in einer<br />
präziseren Weise festzuhalten, als es Buchstabenfolgen mit erläuternden<br />
Hinweisen – wie auf den mal »lammhaft zart«, mal »männlich« klingenden<br />
»streng militärischen rhythmus« – bis dahin vermochten. Insbesondere<br />
nachdem ihm in Norwegen 1938 sein Flügel wieder zur Verfügung stand,<br />
begann Schwitters erneut, sich mit Harmonielehre zu beschäftigen; im<br />
Dezember 1939 nahm er sich vor, »entsprechend meiner Lautsonate<br />
auch für Klavier zu komponieren«. Die überlieferten Notenautographen<br />
bekunden, wenn auch äußerst bruchstückhaft, das fortgesetzte Streben<br />
<strong>des</strong> Merzkünstlers nach einer künstlerischen Einheit aller Kunstarten.<br />
51<br />
N O CH EINMAL
Bei der Ursonate begnügte er sich nicht mit der aus sprachlichen Mitteln<br />
erzeugten Komposition für eine Stimme, sondern versuchte in einem<br />
folgerichtigen (und für die Literatur- wie Musikgeschichte wegweisend<br />
grenzüberschreitenden) weiteren Schritt, die gesprochenen Laute durch<br />
musikalische Notationen auch klanglich festzulegen.<br />
52<br />
7<br />
Am anfänglichsten: Erste Seite von Die Heimkehr <strong>des</strong> Vergil, einer von<br />
Hermann Broch 1936 in Österreich begonnenen Erzählung, die er mehrfach<br />
überarbeitet und 1940 im amerikanischen Exil in der dritten Fassung<br />
von 1938 als »Ur-Ur-Vergil« einem Freund gewidmet hat – fünf Jahre,<br />
bevor sie dann als Teil <strong>des</strong> Romans <strong>Der</strong> Tod <strong>des</strong> Vergil veröffentlicht<br />
worden ist.<br />
8<br />
Allmählich auf echt gemacht: Visitenkarte, auf der Ambros Adelwarth<br />
in W. G. Sebalds langer Erzählung Die Ausgewanderten (1992) einen<br />
Abschiedsgruß hinterlässt, als er freiwillig eine Nervenheilanstalt aufsucht:<br />
»Have gone to Ithaca – Yours, Ambrose«. Sebald stellt das vermeintliche<br />
Originaldokument eigens her und übt zuvor die Schrift <strong>des</strong> Ambros Adelwarth<br />
auf einem Papier, das er bis auf das Wort »Seufzer« ohne Farbband<br />
betippt hat.<br />
9<br />
Wiederholen als Programm: Swetlana Geier hat ihre Übersetzungen der<br />
fünf großen Romane von Dostojewski jeweils zwei Mal formuliert (das erste<br />
Mal als mündliches Diktat, das zweite Mal in der schriftlichen Überarbeitung<br />
<strong>des</strong> Diktats), bevor sie diese veröffentlichen ließ. Hier ausgestellt<br />
sind zwei Blätter aus dem Typoskript zu Verbrechen und Strafe (1994<br />
veröffentlicht, ihre ältere eigene Übersetzung hatte noch den bekannteren<br />
Titel Schuld und Sühne). – Leihgabe: Universitätsbibliothek Freiburg /<br />
Historische Sammlungen.<br />
A NFANG UND WIEDERHOLUNG
F RANZ-J. L EITHOLD<br />
Swetlana Geier übersetzte mehr als 50 Werke der russischen Literatur<br />
ins Deutsche. Viel beachtet und durch zahlreiche Preise ausgezeichnet<br />
waren ihre Neuübersetzungen der großen Romane Fjodor Dostojewskis,<br />
denen sie ihre Schaffenskraft seit 1993 bis zu ihrem Tod im Jahr 2010<br />
widmete.<br />
Für Swetlana Geier bestand eine wesentliche Voraussetzung <strong>des</strong> Übersetzens<br />
darin, »den Atem eines Textes« zu spüren, um so die sprachlichen<br />
und stilistischen Eigenarten eines Autors adäquat wiedergeben zu können.<br />
Eine gelungene Übertragung sei diejenige, die man als solche nicht<br />
wahrnehme. Damit argumentierte sie ganz im Sinne Wilhelm von Humboldts:<br />
»Solange nicht die Fremdheit, sondern das Fremde gefühlt wird,<br />
hat die Uebersetzung ihre höchsten Zwecke erreicht«.<br />
Eine Übersetzung ist immer der Versuch einer größtmöglichen Annäherung<br />
an das Original, eine Vermittlung zwischen Autor und Leser.<br />
Andrej Sinjavskij konstatierte bei der Verleihung <strong>des</strong> Leipziger Buchpreises<br />
zur Europäischen Verständigung in seiner Laudatio auf Swetlana Geier<br />
im Jahr 1995: »<strong>Der</strong> Übersetzer ist uns allen als guter Engel geschickt.<br />
In unserer zerklitterten Welt stellt er Einvernehmen und gegenseitiges<br />
Verständnis zwischen Schriftstellern und Lesern her, er vermittelt zwischen<br />
Kulturen und Völkern.«<br />
Swetlana Geier entwickelte eine ganz eigene Art zu übersetzen. Nachdem<br />
sie mehrfach das Original gelesen und beinahe auswendig gelernt hatte,<br />
diktierte sie ihrer Sekretärin eine erste Fassung in die mechanische<br />
Reiseschreibmaschine. Gemeinsam mit einem Freund überarbeitete sie<br />
diese Version, feilte am Text, korrigierte mit Bleistift, grünem und rotem<br />
Farbstift. Die Korrekturen wurden dann in einem Schreibbüro ins Reine<br />
übertragen, nochmals von der Übersetzerin geprüft und dem Verlag zum<br />
Erstellen der Korrekturfahnen zugeschickt.<br />
Die Manuskriptseiten aus der Erstfassung von Verbrechen und Strafe<br />
lassen den Schaffensprozess Swetlana Geiers eindrücklich nachvollziehen,<br />
ihr Bemühen um einen zeitgemäßen Sprachstil und den beharrlichen<br />
53<br />
N O CH EINMAL
54<br />
Versuch, sich dem russischen Original so weit wie nur möglich anzunähern.<br />
Die Manuskripte Swetlana Geiers sind nicht nur Dokumente ihrer<br />
beharr lichen Übersetzungstätigkeit, sondern – indem sie die besondere<br />
Arbeitsweise der Übersetzerin widerspiegeln – selbst Originale.<br />
Lit.: Die Frau mit den 5 Elefanten, Dokumentarfilm D/CH 2009, Regie:<br />
Vadim Jendreyko.<br />
10<br />
Immer wieder erste Sätze: Einige der Anfänge, die Péter Esterházy<br />
für seinen Roman Harmonia caelestis (2000) in seinen Notizheften und<br />
dann im Lose-Blatt-Manuskript gefunden hat. Am Ende weicht der dort<br />
erste der »nummerierten Sätze aus dem Leben der Familie Esterhazy«<br />
einem anderen ersten Satz (»Es ist elend schwer zu lügen, wenn man die<br />
Wahrheit nicht kennt«) und wird der dritte: »Mein Vater, ich glaube, mein<br />
Vater war es, der mit der Palette ins Museum ging, sich zurückschlich,<br />
um die eigenen Bilder, die schon dort hingen, zu korrigieren, oder zumin<strong>des</strong>t<br />
Verbesserungen an ihnen vorzunehmen.« – Daneben zwei Hefte<br />
zu Esterházys im Frühjahr 2014 fertiggestellten Einfache Geschichte<br />
Komma Hundert Seiten, mit der er am 7. November 2013 begonnen hat,<br />
mit »einen viel versprechenden Anfang, er ist 39 Seiten lang, dann sah<br />
ich erst, dass es doch nicht geht. Wieder dieser selbstbestärkende,<br />
einführende Satz: ›Ha kezdjük, akkor kezdjük.› (Wenn wir es anfangen,<br />
dann fangen wir es an.)« Dann: »nach 39 Seiten und guten zwei Monaten,<br />
am 19. Januar 2014 wieder neu, in Tagebuch-Form. ›Nehéz reggel.‹<br />
(Ein schwerer Morgen.) Nach vier Seiten futsch. Am 14. Februar habe<br />
ich wieder angefangen – und schrieb jetzt bis zum Ende. Aber ich wusste,<br />
ich muss min<strong>des</strong>tens noch einmal schreiben. ›Imádkozni hamarabb<br />
tudtam, mint beszélni. De titkoltam.‹ (Etwa: Ich konnte zuerst beten, erst<br />
dann sprechen. Aber ich verheimlichte es.)« Ab dem 30. März kam dann<br />
die Endfassung zustande. Wie sie anfängt, steht es auch im Buch:<br />
›Ez a kezdés. Imádkozni hamarabb tudtam, mint beszélni. De titkoltam<br />
A NFANG UND WIEDERHOLUNG
mind a kettőt.‹ (Das ist der Anfang. Ich konnte zuerst beten, erst dann<br />
sprechen. Aber ich verheimlichte bei<strong>des</strong>.)« – Leihgabe: Péter Esterházy,<br />
Budapest.<br />
PÉTER ESTERHÁ ZY<br />
Ich habe nicht geahnt, dass mir die Einladung aus Marbach zeigen<br />
würde, welch ein Chaos in meiner schriftstellerischen Vergangenheit<br />
herrscht. Auf jeden Fall in der Manuskripte-Vergangenheit. Habe nämlich<br />
nicht (alles) gefunden, was ich wollte und wusste nicht (ganz), was ich<br />
will. Also versuche ich, die Anfänge meines Romans Harmonia caelestis<br />
zu zeigen. Oder bescheidener: Schauen wir an, was ich gefunden habe –<br />
und was zu zeigen wäre.<br />
Am Anfang war nicht das Wort, nicht einmal das Wort ›Vater‹ oder<br />
›mein Vater‹, sondern: Herzog Blaubart. Und nicht ich (»ich«), sondern:<br />
Herzog Blaubarts Sohn. Das schien eine ausgesprochen gute Idee zu<br />
sein, Blaubart-Assoziationen gibt es wirklich reich. Bartók hilft mit,<br />
auch das Blaubart-Erotische und dann noch ein Herzog – damit ist außerdem<br />
eine aristokratische Familie im Spiel.<br />
All das funktionierte über eine lange Strecke, es kamen etwa 300 Seiten<br />
zusammen (viel hab’ ich nachgelesen, manchmal sogar recherchiert und<br />
das Gefundene als Blaubart-Geschichte umgeschrieben). Aber dann<br />
wurde es sozusagen zu viel, besser: zu wenig, zu umständlich – beispielsweise<br />
immer Blaubarts Sohn sprechen zu lassen und nicht einfach »ich«<br />
schreiben zu können, zu dürfen. (Das ist immer wieder ein Problem:<br />
Wenn die Struktur nicht optimal ist, endet die Geschichte zu früh, ist aber<br />
noch nicht alles gesagt, läuft die Geschichte noch weiter, will noch weiter<br />
laufen, aber es gibt keinen Platz mehr – falls es eine Geschichte gibt,<br />
eine autobiografische [nicht unbedingt selbstkritische Bemerkung].)<br />
Also heißt es, alles wegwerfen (aber nicht richtig wegwerfen, weil man<br />
einerseits vieles neu verwenden kann, andererseits aber durch die geschriebenen<br />
300 Seiten ›klüger‹, erfahrener geworden ist). Also heißt es<br />
neu anfangen.<br />
55<br />
N O CH EINMAL
56<br />
Heft 1<br />
Die Doppelseite zeigt gleich zwei Anfänge.<br />
Links, oben, geschrieben am 2. August 1994 (ach! gerade ist es 20 Jahre<br />
her ...), durchgestrichen, weil es gleich umgeschrieben wurde, siehe unten.<br />
(Und dann auch auf der rechten Seite, Zeile 7.)<br />
A kékszakállú herceg fia – aki persze én vagyok …<br />
(In meiner unakzeptablen Übersetzung:) Herzog Blaubarts Sohn – der natürlich<br />
ich bin …<br />
Nach zwei Tagen später, am 4. August noch einmal von vorne (rechte Seite):<br />
Úgy kezdo˝ dnék, hogy a kékszakállú herceg fia, ki maga is kékszakállú<br />
herceg …<br />
Es würde so anfangen, dass der Sohn <strong>des</strong> Herzog Blaubarts, der auch<br />
selbst ein Herzog Blaubart ist …<br />
Man sieht, der Autor will sich verstärken, möchte unbedingt, dass sein<br />
Buch endlich anfängt und <strong>des</strong>wegen betont er diesen erhofften Anfang.<br />
Er erteilt quasi einen Wortsegen, was natürlich nicht nur legitim, sondern<br />
völlig selbstverständlich ist. Ob es hilft – ist fraglich.<br />
Heft 2<br />
Wieder ein neuer Anfang. Hier wurde schon das Wort »mein Vater« gefunden.<br />
Geschrieben am 10. Juli 1996.<br />
(1.) Mein Vater: das Anfangswort. Na ja. Was zum Teufel wäre da<br />
hinzuzufügen?<br />
(2.) Mein Vater begeisterte sich für Palisanderholz …<br />
<strong>Der</strong> zweite Satz ist schon Terézia Moras Übersetzung. Im Buch wurde das dann<br />
nicht der zweite, sondern der 252. Satz (siehe Harmonia caelestis, 1. Teil:<br />
Numerierte Sätze aus dem Leben der Familie Esterházy, T’buch, p. 321).<br />
›Heft‹ 3<br />
Kein Heft, eine Mappe. Das zeigt meine damalige Unsicherheit bezüglich<br />
der Reihenfolge. Es hätte mich gestört, in ein Heft zu schreiben, bei dem<br />
die Seiten »naturgemäß« (Thomas Bernhard) eine Reihenfolge vorgeben.<br />
A NFANG UND WIEDERHOLUNG
Den Text habe ich ab Januar 1997 geschrieben, im Wissenschaftskolleg<br />
zu Berlin, an dem ich damals ein Stipendium hatte. Das war für den<br />
Roman ein großes Glück, einerseits die so genannten ruhigen Arbeitsverhältnisse<br />
(die in der Tat ruhig waren), anderseits die imaginäre Bibliothek,<br />
das heißt, es gab ein Service, der dafür sorgte, dass man Bücher,<br />
die man brauchte (oder nur glaubte, ahnte, vermutete, bluffte zu brauchen),<br />
in zwei Tagen auf den Arbeitstisch bekam (gelobt sei Gesine<br />
Bottomley!). Das war fantastisch und hat mir viel geholfen. Zum Beispiel<br />
habe ich unzählige Bücher durchgeblättert, die im Titel das Wort »Vater«<br />
trugen (von Erika Manns Mein Vater, der Zauberer bis zu Gedanken<br />
über das Vaterunser – so etwa. Siehe Marginalienheft).<br />
Geschrieben habe ich schon mit Füllfeder, also nicht mit Kugelschreiber,<br />
es entstand also ein Text in (sehr) gutem Zustand, eigentlich eine Endfassung.<br />
Die erste Seite ist eine Kopie, das Original habe ich am 26. Januar<br />
1997 Wolf Lepenies, dem damaligen Rektor <strong>des</strong> Wissenschaftskolleg<br />
geschenkt (steht dort unten geschrieben).<br />
Die Reihenfolge hat sich sehr geändert. Im schon erwähnten Marginalien-<br />
Heft gibt es eine »Kapiteleinrichtung«, S. 58/59. (Das Original finde<br />
ich jetzt nicht, aber ich habe es! ich habe es! – hoffe ich.) Sie zeigt, wie<br />
eine Reihenfolge sich dadurch geändert hat, dass ich den Satz, der jetzt<br />
der erste ist, gefunden habe. (Es ist elend schwer zu lügen, wenn man die<br />
Wahrheit nicht kennt.) Übrigens ziemlich spät, also musste ich ganz am<br />
Ende wieder alles auseinander nehmen, wieder nachdenken, was, wo –<br />
dann jetzt aber wirklich – stehen wird. Ich erinnere mich, es war, milde<br />
gesagt, stressig.<br />
Das vorhandene Manuskript änderte sich in der Reihenfolge folgendermaßen:<br />
<strong>Der</strong> erste Satz (das heißt: Einheit, Kapitel) wurde am Ende<br />
der dritte. <strong>Der</strong> Text änderte sich auch ein wenig, beispielsweise wurde<br />
aus »azt hiszem« (ich glaube) »vélhet en« (vermutlich); interessanterweise<br />
heißt es in der Übersetzung dann ›wieder‹: ich glaube.<br />
Also: 1 ~ 3; 2 ~ 332; 3 ~ 4; 4 ~ 22; 5 ~ 8; 6 ~ 23; 7 ~ 112; 8 ~ 14;<br />
9 ~ 17; 10 ~ 19<br />
57<br />
N O CH EINMAL
Ich schrieb auch die Quellen auf, am Anfang noch auf die letzte Seite,<br />
wie bei S. 1. Dort steht dann: Eine Renoir-Anekdote, aus dem Gespräch<br />
mit G. Tabori, in Spectaculum 46, S. 323.<br />
58<br />
Heft 4 und das kleine Heft<br />
Sie gehören zu meinem neuesten Buch, das im Juni in Ungarn erschienen<br />
ist und wahrscheinlich 2016 bei Hanser Berlin auf Deutsch herauskommt.<br />
Einfache Geschichte Komma Hundert Seiten ist der Titel, mit dem<br />
Untertitel: Die Markus-Variation. Voriges Jahr gab es schon eine Mantelund-Degen-Version<br />
mit demselben Titel (geplant auf Deutsch für 2015).<br />
Heft 4 zeigt einen viel versprechenden Anfang, er ist 39 Seiten lang, dann<br />
sah ich erst, dass es doch nicht geht. Wieder dieser selbst bestärkende,<br />
einführende Satz: »Ha kezdjük, akkor kezdjük.« (Wenn wir es anfangen,<br />
dann fangen wir es an.) Angefangen wurde am 7. November 2013.<br />
Dann, nach 39 Seiten und guten zwei Monaten, am 19. Januar 2014<br />
wieder neu, in Tagebuch-Form. »Nehéz reggel.« (Ein schwerer Morgen.)<br />
Nach vier Seiten futsch.<br />
Kleines Heft, Heft 5<br />
Mit Bleistift. Früher habe ich nie damit geschrieben, aber, vielleicht nicht<br />
unabhängig von dem ›unorthodoxen‹ Heft, jetzt öfters.<br />
Am 14. Februar habe ich wieder angefangen – und schrieb jetzt bis zum<br />
Ende. Aber ich wusste, ich muss min<strong>des</strong>tens noch einmal schreiben.<br />
»Imádkozni hamarabb tudtam, mint beszélni. De titkoltam.« (Etwa: Ich<br />
konnte zuerst beten, erst dann sprechen. Aber ich verheimlichte es.)<br />
Ab dem 30. März kam dann die Endfassung zustande. Wie sie anfängt,<br />
steht es auch im Buch: »Ez a kezdés. Imádkozni hamarabb tudtam, mint<br />
beszélni. De titkoltam mind a kettő t.« (Das ist der Anfang. Ich konnte<br />
zuerst beten, erst dann sprechen. Aber ich verheimlichte bei<strong>des</strong>.) <strong>Der</strong><br />
Satz »Ez a kezdés« (das ist der Anfang) ist ein János Pilinszky-Zitat.<br />
Wer suchet, der findet, könnte ich hinzufügen …<br />
A NFANG UND WIEDERHOLUNG
Genie und ich
SIGNATUR<br />
Originale werden gemacht. Hinter ihnen steht ein Urheber. Ein Genie ist<br />
in der ursprünglichen Wortbedeutung eine ›erzeugende Kraft‹. Die Gabe,<br />
mögliche Welten zu erfinden, verdankt es guten Geistern oder auch ganz<br />
allein sich selbst. Das Original ist so immer auch Folge einer Ekstase:<br />
Hier ist jemand aus sich herausgetreten, findet und erfindet und verwirklicht<br />
sich selbst.<br />
Für Autographenjäger heißt Originale sammeln daher oft: Unterschriften<br />
sammeln. Die Signatur ist das Originellste am Original. Sie authentifiziert,<br />
zeichnet aus und wertet auf. Sie tritt auf dem Papier ein für den Schreiber,<br />
Schriftsteller und Künstler als Urheber und gehört spätestens seit<br />
der Renaissance fest zu einem Kunstwerk. Oft steht sie am Anfang aller<br />
Kunst: Wer schreiben will, übt oft zunächst die eigene Unterschrift.<br />
Die Signatur ist Stempel, Symbol, Logo, Porträt. Auch bei den Künstlern,<br />
die lieber ihre Signaturen den Kräften <strong>des</strong> Unbewussten überlassen.<br />
Das Urhebergesetz sieht für die Unterschriftenfälschung im § 107 (»unzulässiges<br />
Anbringen der Urheberbezeichnung«) eine Freiheitsstrafe von<br />
bis zu drei Jahren vor.
2/I
1<br />
Goethes ausgeschnittene Unterschrift.
8<br />
Kafkas Brief an Milena, in dem er sich schrittweise ausstreicht, 29. Juli 1920.
Undatierter Umschlag an Franz Marc, auf dem Else Lasker-Schüler sich<br />
nur durch eine Profilzeichnung als Absender zu erkennen gibt.<br />
9
3<br />
2<br />
7<br />
SIGNATUR<br />
4<br />
2 Nietzsche: Initialen<br />
auf einem<br />
Kleinstbrief an Lou<br />
Andreas-Salomé<br />
3 Rilke: Letzte Unterschrift<br />
mit seinem<br />
Taufnamen »René«<br />
5<br />
6<br />
4 Jünger: Initial-Entwürfe<br />
<strong>des</strong> 14-jährigen<br />
5 Jakob van Hoddis:<br />
Initial-Entwürfe <strong>des</strong><br />
15-jährigen<br />
6 Le Fort: Initialen<br />
auf einem Löschblatt<br />
7 Mörike: Ast mit<br />
»ausgemalten Wurmgängen«<br />
10 Rühmkorf: eines<br />
der Selbstporträts im<br />
Manuskript Selbst<br />
III/88<br />
11 Kittler: Disketten<br />
»usr/ich«<br />
11<br />
10
62<br />
1<br />
Schattenriss: Johann Wolfgang Goethes Unterschrift, ausgeschnitten<br />
und aufbewahrt in einem an ihn adressierten versiegelten Umschlag mit<br />
zahlreichen bunten Fäden, sowie sein Eintrag mit einem Zitat aus der<br />
Dichtkunst <strong>des</strong> Horaz samt dazugeklebter Scherenschnitt-Silhouette von<br />
1776 im Stammbuch von Wilhelm Ludwig Rodowé, der zusammen mit ihm<br />
in Leipzig Jura studiert hat: »Decipimur specie recti« (›Wir werden vom<br />
Schein <strong>des</strong> Rechten getäuscht‹).‹<br />
Goethe sammelte von 1805/06 an selbst Originalhandschriften, oft auch<br />
nur Umschläge und Unterschriften wie hier und im Winter 1813/14 sogar<br />
einmal die Vorlesungsankündigungen, die an der Berliner Universität die<br />
Professoren ans Schwarze Brett geheftet hatten. Für Eckermann machte<br />
er ein physiognomisches Rätsel daraus: »Sehen Sie sich einmal um,<br />
fuhr Goethe fort, ›hinter Ihnen auf dem Pult liegt ein Blatt, welches ich<br />
zu betrachten bitte.‹ Dieses blaue Briefcouvert? sagte ich. ›Ja, sagte<br />
Goethe. – Nun, was sagen Sie zu der Handschrift? Ist das nicht ein<br />
Mensch, dem es groß und frei zu Sinne war, als er die Adresse schrieb? –<br />
Wem möchten Sie die Hand zutrauen?« – Lit.: Sebastian Böhmer,<br />
»Die Magie der Handschrift. Warum Goethe Autographe sammelte«, in:<br />
Zeitschrift für Ideengeschichte (2011), H. 4. S. 97 – 110.<br />
G ENIE UND ICH
2<br />
Abkürzungszauber: Von Friedrich Nietzsche im August 1882 für Lou<br />
Andreas-Salomé bestimmt: »Zu Bett. Heftigster Anfall. Ich verachte das<br />
Leben. F N.«<br />
Nietzsche sagt so oft wie kaum ein anderer Philosoph ›Ich‹. In seinem<br />
Ecce Homo, entstanden sechs Jahre nach diesem Zettel, findet sich<br />
neben Kapitelüberschriften wie »Warum ich so weise bin«, »Warum ich so<br />
gute Bücher schreibe«, »Warum ich so klug bin« auch dieses Gedicht:<br />
63<br />
Ja, ich weiß, woher ich stamme:<br />
Ungesättigt gleich der Flamme<br />
glühe und verzehr ich mich.<br />
Licht wird alles, was ich fasse,<br />
Kohle, alles, was ich lasse<br />
– Flamme bin ich sicherlich.<br />
Für Lou Andreas-Salomé, die er erst im Frühjahr kennengelernt hat, setzt<br />
er seine Signatur unter das mit dem ›ich‹ lautverwandte Wort »verachten«.<br />
Ein Jahr später wird er in Rom »Ich« und »Ach« für Also sprach Zarathustra<br />
noch einmal zusammenbringen: »Licht bin ich: ach, dass ich Nacht<br />
wäre! Aber dies ist meine Einsamkeit, dass ich von Licht umgürtet bin. /<br />
Ach, dass ich dunkel wäre und nächtig! Wie wollte ich an den Brüsten <strong>des</strong><br />
Lichts saugen!«<br />
Im August 1882 entschuldigt er sich einen Tag nach seinem Migräneanfall<br />
wieder mit einer signierten Kurznachricht bei Lou: »Pardon für gestern!<br />
Ein heftiger Anfall meines dummen Kopfleidens – heute vorbei«. Als<br />
befürchte er, dass seine Verachtung ihr Mitleid auslöse. »Die Verachtung<br />
durch Andere ist dem Menschen empfindlicher, als die durch sich selbst«,<br />
hatte er vier Jahre zuvor in Menschliches, Allzumenschliches geschrieben.<br />
SIG NAT UR
64<br />
3<br />
Umtaufe und Relaunch: <strong>Der</strong> Brief, den der 22-jährige Rainer Maria<br />
Rilke am 9. Juni 1897 an die 14 Jahre ältere Lou Andreas-Salomé<br />
schreibt, ist der letzte, den er in kleiner feiner Schrift mit »Réné« unterzeichnet<br />
hat – nach beinahe zwei Monaten, in denen er nur drei unsignierte<br />
Karten schickt, folgt am 5. September ein neuer Name in neuer Schrift<br />
auf neuem Briefpapier: »Rainer«. Entsprechend sachlicher ist der Ton.<br />
Aus dem unterwürfigen Marien-Ritter (»Und ich kniee und halte die Arme<br />
auf um Deine Gnade zu empfangen«) ist ein Beschützer geworden<br />
(»Du, meine Liebe ist wie ein Mantel um Dich, schirmend und wärmend!«).<br />
Ausgelöst wurde die Metamorphose, die zu den berühmtesten der deutschen<br />
Literaturgeschichte gehört, durch die Kritik der erfahrenen Geliebten,<br />
die sich in Signaturen, Namensänderungen und Neuerfindungen<br />
auskannte. Lou hatte ihren eigenen Namen »Louise« burschikos abgekürzt<br />
und störte sich an dem geschlechtlich so unbestimmten ›Réné Maria‹,<br />
der zarten Handschrift und der »Überschwenglichkeit« in den täglichen<br />
»Briefen mit den blaßblauen Siegeln«. <strong>Der</strong> Mutter erklärt Rilke den eigenmächtigen<br />
Akt der Umtaufe als literarisches Kalkül: Sein Taufname<br />
wirke unnatürlich und gekünstelt, ›Rainer‹ hingegen schön, einfach und<br />
deutsch.<br />
G ENIE UND ICH
4<br />
Die Signatur als Bild: Namenszug aus der Autographensammlung<br />
von Ernst Jünger mit dem ›Logo‹ <strong>des</strong> Münchener Malerfürsten Franz<br />
Lenbach und zwei seiner eigenen Versuche, seine Initialen E und J zum<br />
ebenso schmückenden wie sinnträchtigen Bild auszugestalten – ein<br />
Heft mit »kleinen Erzählungen« <strong>des</strong> 14-jährigen (1909) und ein Blatt aus<br />
dem Manuskript <strong>des</strong> Dramenfragments Prinzessin Tarakanowa (1953).<br />
65<br />
5<br />
Traum vom Dichter: Gedichtentwurf <strong>des</strong> 15-jährigen Hans Davidsohn,<br />
den er auf den 16. August 1902 datiert:<br />
Juchei<br />
Ich bin frei.<br />
Du schmucker Bursche nicht rühme dich<br />
Ein Mägdlein wartet am Strand<br />
Das hat dich gefangen munter und frisch<br />
Und hält dich mit wonnigem Band<br />
Nahezu so viel Raum wie das Gedicht beansprucht die Signatur:<br />
C, Abkürzung <strong>des</strong> von Hans Davidsohn in dieser Zeit als Pseudonym<br />
verwendeten »Centella« (spanisch für ›Funke‹), und H, Initial seines<br />
Geburtsnamens, den er 1909 zum Künstlernamen umordnet: Jakob van<br />
Hoddis. Als bei ihm wenige Jahre später eine Schizophrenie ausbricht,<br />
wird er beim H bleiben und als »Professor von Hohenzollern« unterschreiben.<br />
Darüber: Signatur- und Selbstbetrachtungsübungen von Erwin Loewenson,<br />
dem Freund von Jakob van Hoddis, mit dem dieser 1909 den ›Neuen<br />
Club‹ gegründet und auch zusammen Verse wie diesen geschrieben hat:<br />
»Meine Augen besehen mein Gehirn / Nach innen gekehrt.«<br />
SIG NAT UR
6<br />
Sich in Buchstaben verlieren: Löschblatt aus einem Schulheft von<br />
Gertrud von Le Fort, um 1890.<br />
66<br />
7<br />
Schrift der Natur: Holzstück mit den Gängen der Holzwürmer, die<br />
Eduard Mörike mit roter und grüner Farbe nachgemalt hat. Sein Fundstück<br />
hat er später auch noch gezeichnet: »Ein Stück Baum-Ast mit<br />
ausgemalten Wurmgängen. Zum Andenken an Clara Pfäfflin, die beim<br />
Holztragen am 30. Okt. 1868 mithalf«.<br />
8<br />
Bilderrätsel: Franz Kafkas geschriebene und gezeichnete Namens-,<br />
Buchstaben- und Figurensignaturen in drei Briefen an Milena Jesenská<br />
vom Sommer 1920 und auf einem Notizblock, auf dem er im Juli 1912<br />
die wohl im Gästebuch <strong>des</strong> Weimarer Goethe-Hauses entdeckte Unterschrift<br />
von Thomas Mann imitiert – und konsequenterweise durchstreicht,<br />
so dass sie wieder stimmt: Nicht-Ich.<br />
<strong>Der</strong> obsessive Umgang mit der Initiale K ist jedem Kafka-Leser bekannt.<br />
Als Josef K. wird ihr im gleichnamigen Roman der Prozess gemacht.<br />
Auch in Kafkas Korrespondenz mit Milena ist sie ebenso wie das F seines<br />
Vornamens analytisches Objekt – Gegenstand der Konstruktion und<br />
Dekonstruktion: »ein schweres Bilderrätsel« und dann, gespiegelt und<br />
verdoppelt zum X, ein Folterwerkzeug:<br />
Es sind 4 Pfähle, durch die zwei mittleren werden Stangen geschoben<br />
an denen die Hände <strong>des</strong> ›Delinquenten‹ befestigt werden; durch die<br />
zwei äußern schiebt man Stangen für die Füße. Ist der Mann so<br />
befestigt, werden die Stangen langsam weiter hinausgeschoben, bis<br />
der Mann in der Mitte zerreißt. An der Säule lehnt der Erfinder und tut<br />
mit übereinandergeschlagenen Armen und Beinen sehr groß, so als ob<br />
das Ganze eine Originalerfindung wäre, während er es doch nur dem<br />
G ENIE UND ICH
Fleischhauer abgeschaut hat, der das ausgeweidete Schwein vor<br />
seinem Laden ausspannt.<br />
Leihgabe: The Bodleian Libraries, University of Oxford (Notizblock, fol. 1<br />
verso MS. Kafka 5)<br />
67<br />
9<br />
Verwandlung: Umschlag an Franz Marc, auf dem Else Lasker-Schüler<br />
sich nur durch eine Profilzeichnung als Absender zu erkennen gibt.<br />
Daneben: ein Selbstporträt von 1900 (»Die lÿrische Mißgeburt«) und<br />
zwei weitere Briefe an Marc, die das 1913 betriebene Ineinssetzen von<br />
Namenssignatur und Fantasiefigur begleiten.<br />
»Sterne leuchten über Erden und fragen nicht ob Menschen darauf leben<br />
die minderwertig oder wertvoll sind. Jedenfalls liebe ich nach meiner<br />
Sehnsucht die Leute alle zu kleiden, damit ein Spiel zu Stande kommt«,<br />
bekennt Else Lasker-Schüler in einem ihrer Briefe an Karl Kraus und<br />
nennt ihn: »Verehrter Dalai Lama«, »Priesterkönig von Wien«, »<strong>Wert</strong>er,<br />
lieber, blauäugiger Cardinal«. 1919 resümiert sie ihre Rollenautobiografie:<br />
»Ich bin in Theben (Ägypten) geboren, wenn ich auch in Elberfeld zur Welt<br />
kam im Rheinland. Ich ging bis elf Jahre zur Schule, wurde Robinson,<br />
lebte fünf Jahre im Morgenlande, und seitdem vegetiere ich«.<br />
SIG NAT UR
10<br />
»Wenn ich mal richtig ICH sag«: Peter Rühmkorfs Selbstporträts von<br />
1988 im Manuskript zu Selbst III/88.<br />
68<br />
J AN BÜRGER<br />
Über 700 Blatt für ein Gedicht, immer wieder neue Ansätze, Partikel,<br />
Skizzen, entstanden in Restaurants, in Kneipen, im Intercity, vor allem<br />
aber zu Hause in Hamburg-Oevelgönne. Unten flanieren Touristen,<br />
Rentner, Studenten. Er aber sitzt ein paar Meter über ihnen in der Dachkammer<br />
eines alten Kapitänshäuschens, um endlich einmal wieder richtig<br />
ich zu sagen. Richtig, ichtig, originell. Tagein, tagaus sitzt der Dichter,<br />
der Ichter Peter Rühmkorf da – Blick über die Elbe, das Wummern der<br />
Hafenkräne als Orgelpunkt – an der Schreibmaschine, ein paar Becher<br />
mit Füllern und Filzern daneben, Tinten in allen Farben, um herauszufinden,<br />
wie man als Dichter richtig ich sagen kann. Leben – ein Entblößungsversuch.<br />
Endlich, zu seinem 60. Geburtstag will er allen zeigen,<br />
welche Fülle an ›Originalen‹ die Voraussetzung ist für die Originalität<br />
seiner ›Artistik‹. Selbst III/88 heißt das Gedicht, in bewusster Anlehnung<br />
an alle Rembrandts und Beckmanns dieser Welt, an die Großmeister <strong>des</strong><br />
gemalten Selbstporträts. In noch nie dagewesener Weise lässt Rühmkorf<br />
alle Vorstufen reproduzieren und zwischen zwei Buchdeckel binden: mehr<br />
als 700 Seiten Faksimiles. Diesem Ungetüm von einem Buch versieht<br />
er schließlich mit dem vieldeutigen Untertitel Aus der Fassung.<br />
Rühmkorf schrieb mehrere Selbstporträts, und keines von ihnen kam<br />
ohne Selbstironie aus, was allein schon daraus folgte, dass er sich stets<br />
als multipel empfand: Auf den Spuren von Gottfried Benn übte er sich als<br />
Dichter im Doppel- und Mehrfachleben. Die Pseudonyme bildeten eine<br />
kleine Familie: Schon als Student betrieb Rühmkorf alias ›Leslie Meier‹<br />
seinen gefürchteten »Lyrik-Schlachthof«, und im Gewand <strong>des</strong> stets etwas<br />
melancholischen ›Leo Doletzki‹ feierte er 1989 noch ein spätes Comeback<br />
– in dem Gedicht Selbst III/88 (wo sonst?), das man getrost als eines<br />
seiner Hauptwerke betrachten kann. Auch <strong>des</strong>halb ließ er <strong>des</strong>sen Vorstufen<br />
reproduzieren, vervielfältigen und in die Buchhandlungen ausliefern.<br />
G ENIE UND ICH
Aber nur in schwarz-weiß. Die zum Teil farbigen Originale waren fürs<br />
Archiv vorgesehen. Und als wollte er deren Bedeutung, den <strong>Wert</strong> dieser<br />
Unikate noch ein wenig steigern, zeichnete er sich selbst hier und da<br />
zwischen und über die Zeilen. Vielleicht fiel ihm das mitunter sogar<br />
leichter als das Ich-Schreiben. Vielleicht machte es ihm auch einfach nur<br />
Spaß, mit flüchtigem Strich Vertrautes zu karikieren. So warf er nicht<br />
nur das eigene Konterfei gleich mehrfach aufs Papier, sondern mitunter<br />
auch Katzen. Und mitten im Text findet sich unter der später verworfenen<br />
Zeile »Die Reaktion geht heute vom Feuilleton aus –« sogar ein Bildnis<br />
<strong>des</strong> Großkritikers Marcel Reich-Ranicki, unmittelbar über dem selbstzufrieden<br />
grinsenden Antlitz von Ludwig Erhard. Originale der alten Bun<strong>des</strong>republik,<br />
einer wie der andere.<br />
69<br />
11<br />
»usr/ich«: Disketten von Friedrich Kittler, der seine selbstgeschriebenen<br />
Programme 1991 im Ordner »/usr/bin/ich« abgelegt hat und seinen<br />
Computer später nach seinem eigenen Kosenamen benannte: »Azzo«.<br />
H EINZ-WERNER KRAMSKI<br />
»/usr/bin/ich« – das ist keine leicht verschlüsselte Selbstbeschreibung<br />
<strong>des</strong> Computerbenutzers Friedrich Kittler, sondern der Name <strong>des</strong> Ordners,<br />
in dem er um 1991 unter SCO Unix seine selbstgeschriebenen ausführbaren<br />
Programme abgelegt hat.<br />
Kenntnis davon gibt uns die Datei komm.sco, die als eine Art technisches<br />
Tagebuch seine Erkenntnisse und Probleme bei der Erkundung <strong>des</strong> für<br />
ihn neuen Mehrbenutzersystems (in der Nachfolge <strong>des</strong> bis dahin verwendeten<br />
MS-DOS) kommentierend beschreibt.<br />
Aus der SCO-Zeit sind nur wenige Datenträger und keine Festplatten<br />
erhalten, und komm.sco findet sich – binäridentisch – nur auf zwei<br />
Backup-CD-Rs.<br />
Die Datei komm.sco verrät noch mehr: Die unkonventionelle Art, mit der<br />
Kittler später unter Linux seine Daten, sein Home Directory ich mitten<br />
SIG NAT UR
70<br />
unter die Systemordner im Verzeichnis /usr platziert, ist kein selbstbewusster<br />
Verstoß gegen die Linux Filesystem Structure v1.0 von 1994.<br />
Vielmehr war /usr/ unter SCO und noch früheren Unix-<br />
Versionen durchaus üblich, und er ist einfach dabei geblieben, wenn auch<br />
die Benennung ausdrückt, dass keine weiteren Benutzer vorgesehen<br />
waren.<br />
Die zunehmende Beherrschung seiner späteren Linux-Rechner zeigt sich<br />
auch hier: Neben dem Superuser root, den Kittler stets und ungeachtet<br />
der Risiken für ein stabiles System auch für die tägliche Arbeit nutzte,<br />
gab es gar keinen ›bürgerlichen‹ Account für ihn mehr. Rang unter SCO<br />
noch der User azzo um Superuser-Rechte (»30. 1. 92: Auf azzos Wunsch<br />
›su‹ antwortet System mit ›Sorry‹. Das muss noch geaendert werden«),<br />
war azzo später gleich der Name der ganzen Maschine.<br />
Von »usr bin ich« zu »hostname bin ich«, könnte man sagen.<br />
G ENIE UND ICH
L ETZE DINGE<br />
Originale sind Zeugen und Zeugnisse <strong>des</strong> Übergangs. Schwellen,<br />
die aus der Welt der unsicht baren Dinge in die der sichtbaren führen und<br />
von dieser auch wieder in jene zurück. Sie stehen für eine Überschreitung<br />
und begleiten sie, sind oft genug auch ihre Ursache. Den letzten Dingen<br />
wohnt dabei ein ebensolcher Zauber inne wie den ersten, nur dass es<br />
nach ihnen nichts mehr gibt. Sie sind mit Leben übervoll. Meist Relikte<br />
eines Selbstentwurfs. Reliquien <strong>des</strong> allerletzten Ich-Sagens. Oft schon<br />
nicht mehr ganz von dieser Welt. Verrückt. Außerhalb der Ordnung und<br />
manches Mal gefährlich doppeldeutig.<br />
Wolfgang Herrndorf schrieb über sein letztes Ding, den Revolver, mit dem<br />
er sich dann am 26. August 2013 erschossen hat: »Ich schlafe mit der<br />
Waffe in der Faust, ein sicherer Halt, als habe jemand einen Griff an die<br />
Realität geschraubt. Das Gewicht, das feine Holz, das brünierte Metall.<br />
Mit dem MacBook zusammen der schönste Gegenstand, den ich in<br />
meinem Leben besessen habe.«
2/II
4<br />
Modell der Waffe, mit der Kleist am 21. November 1811<br />
Henriette Vogel am Wannsee erschossen hat.
3<br />
Eine von Nietzsches letzten schriftlichen Äußerungen, 23. April 1899.
Peter Szondis Notiz- und Adressbuch, das nach seinem Selbstmord am<br />
18. Oktober 1971 im Halensee bei ihm gefunden worden ist.<br />
8
9<br />
1<br />
2<br />
L ETZT E DINGE<br />
10<br />
6<br />
7<br />
1 Kant: Haare,<br />
Tabaksdose und<br />
Pfeifenstopfbesteck<br />
2 Lenau: »Vielleicht<br />
letzte Schriftzüge«<br />
5 Zweig: Abschiedsbrief<br />
6 Speer: Aktennotiz<br />
zur Rüstungslage<br />
1945<br />
7 Susmann: »Letzte<br />
Worte«<br />
9 Bachmann:<br />
Aschenbecher<br />
10 Pastior: Letzte<br />
Zigaretten<br />
5
74<br />
1<br />
Zurückgelassenes: Kästchen mit Reliquien <strong>des</strong> 1804 mit 80 Jahren in<br />
Königsberg gestorbenen Philosophen Immanuel Kant: Haare, Schnupftabakdose<br />
und das Besteck, mit dem er sich seine Morgenpfeife stopfte.<br />
»Die glücklichste Stunde in jedem Tag heißt Kant diejenige«, berichtet der<br />
Heidelberger Theologe Johann Friedrich Abegg von seinen Besuchen, »in<br />
welcher er sich – sc. gleich nach dem Aufstehen, noch vor 5 Uhr früh –<br />
seinen Tee ansetzt, die Pfeife zurecht macht, stopfet, anstecket, raucht<br />
und trinkt. Dies ist die Zeit der Visionen, wo er in einer wohltuenden<br />
Abspannung von ernsten Geschäften und leicht bewegt lebt.«<br />
2<br />
»Vielleicht letzte Schriftzüge« drei Jahre vor dem Tod: Blatt, auf das<br />
1847 der 45-jährige Dichter Nikolaus Lenau – nach einem Schlaganfall<br />
zunehmend geisteskrank – in einer Nervenheilanstalt bei Wien einen<br />
Kopf gezeichnet und sich wohl an sein Versepos Die Albigenser (1842)<br />
erinnert hat:<br />
Dass alles Schöne muss vergehen,<br />
Und auch das Herrlichste verwehen,<br />
Die Klage stets auf Erden klingt;<br />
Doch Totes noch lebendig wähnen,<br />
Verwirrt das Weltgeschick und bringt<br />
Das tiefste Leid, die herbsten Tränen.<br />
3<br />
Eine der letzten schriftlichen Äußerungen elf Jahre vor dem Tod:<br />
Zettel, den Friedrich Nietzsche am 23. April 1899 in der Lan<strong>des</strong>-Irrenanstalt<br />
Jena beschrieben hat. – Leihgabe: Nietzsche-Haus, Sils Maria.<br />
G ENIE UND ICH
V OLKER WAHL<br />
Das ist schon ein erstaunliches Schriftstück, nicht zu vergleichen mit<br />
Friedrich Nietzsches ›Wahnsinnszetteln‹, in denen man immerhin noch<br />
einen Sinn entdecken kann. Ist es wirklich Nietzsches letzter Wille, der als<br />
Autograph in der privaten Sammlung Rosenthal-Levy, nunmehr im Nietzsche-Haus<br />
in Sils Maria, überliefert ist? Hier figurierte es bisher als<br />
<strong>des</strong>sen »Testament«.<br />
Nach allgemeiner Kenntnis von Nietzsches ›Umnachtung‹ muss es<br />
immerhin als seine allerletzte schriftliche Äußerung angesehen werden.<br />
In einer Veröffentlichung über diese bedeutende Nietzsche-Sammlung in<br />
Sils Maria ist zu lesen: »Nietzsche war nach seinem Aufenthalt in der<br />
Basler Irrenanstalt Friedmatt vom 18. Januar 1889 bis zum 24. März 1890<br />
Patient der Großherzoglich-Sächsischen Lan<strong>des</strong>-Irrenanstalt Jena. In<br />
der Jenaer Klinik ›las‹ er oft in Büchern der Bibliothek und machte Aufzeichnungen<br />
in Notizbücher. Das Jenaer Krankenjournal verzeichnet am<br />
5. Mai 1889: ›Gibt dem Arzt einen schmutzigen, unleserlichen Zettel<br />
als sein Testament.‹ Beim doppelseitigen, zerrissen überlieferten Zettel in<br />
der Sammlung Rosenthal-Levy handelt es sich vermutlich um dieses<br />
»Testament«, der wohl um dieser Bemerkung willen besonders aufbewahrt<br />
worden ist.«<br />
Wann allerdings dieses »Original« mit seinen zum Teil schwer entzifferbaren<br />
Kritzeleien, musikalischen Passagen und Textfragmenten Nietzsches<br />
entstanden ist, wer es in der Jenaer Irrenklinik an sich genommen und<br />
weitergegeben hat, bevor es ein halbes Jahrhundert danach der Nietzsche-Sammler<br />
erwarb, ist erst vor wenigen Jahren aufgedeckt worden.<br />
<strong>Der</strong> aus Breslau stammende Psychiater Richard Sandberg (1861 – 1912),<br />
der in den 1890er-Jahren bei dem Jenaer Klinikdirektor Otto Binswanger<br />
(1852 – 1929) assistierte, hatte von diesem 1895 nicht nur als Erster<br />
die Genehmigung zur Einsicht in Nietzsches Krankenakte, sondern auch<br />
»diesen Zettel von der Hand Nietzsche’s« erhalten. Auf dem Briefumschlag,<br />
in dem er den ursprünglich nur gefalteten und noch nicht getrennten<br />
Bogen, aufbewahrte, hatte er notiert, dass diese Aufzeichnungen<br />
75<br />
L ETZ E DINGE
76<br />
»vom 23. April 1889« stammen, »aus einer Zeit, wo Nietzsche (wie auch<br />
aus dem Jenenser Krankenjournal ersichtlich) sehr erregt, verwirrt,<br />
unreinlich (vielleicht auch hallucinirt) war«. Es ist also nicht identisch mit<br />
dem als »Testament« bezeichneten Zettel vom 5. Mai 1889, der in<strong>des</strong>sen<br />
nicht überliefert ist. Sandbergs Sohn, der Kapellmeister in Stockholm war,<br />
hat das doppelseitig beschriebene Blatt als »Dokumente aus der Krankheitsgeschichte<br />
Friedrich Nietzsches« zum ersten Mal veröffentlicht<br />
(Gravesaner Blätter, Bd. 2, Mainz 1956), bevor er es in den Autographenhandel<br />
gab, wo als <strong>des</strong>sen Käufer schließlich Albi und Maud Rosenthal-<br />
Levy in Oxford auftraten.<br />
So haben wir hier ein Original <strong>des</strong> kranken Philosophen Friedrich Nietzsche<br />
vom 23. April 1889 als letzten Willen zur Macht, sich schriftlich<br />
zu äußern, vor uns, wahrlich ein »document humain«. – Lit.: Friedrich<br />
Nietzsche – Handschriften, Erstausgaben und Widmungsexemplare.<br />
Die Sammlung Rosenthal-Levy im Nietzsche-Haus in Sils Maria,<br />
Basel 2009.<br />
4<br />
Modell einer letzten Waffe: Steinschloss-Pistole, Kaliber 13 mm,<br />
um 1730, zumin<strong>des</strong>t vorgeblich aus der berühmten Werkstatt von Lazarino<br />
Cominazzo aus Brescia – mit einer solchen Waffe erschoss am 21. November<br />
1811 der 34-jährige Heinrich von Kleist seine drei Jahre jüngere<br />
Bekannte Henriette Vogel, danach sich selbst mit einer kleinen Vorde r-<br />
laderpistole. Beide knieten. Ein auf Effekt berechneter und wohl nach<br />
einem französischen Gemälde, das Kleist 1807 in Frankreich gesehen hat,<br />
inszenierter Tod: Die Haupt figur dort »liegt mit Blässe <strong>des</strong> To<strong>des</strong> übergossen<br />
auf den Knien, der Leib sterbend in die Arme der Engel zurückgesunken.«<br />
– Leihgabe: Kleist-Museum Frankfurt (Oder).<br />
G ENIE UND ICH
M ANUELA KALK<br />
Am 21. November 1811 erschoss Heinrich von Kleist gegen 16 Uhr am<br />
kleinen Wannsee bei Potsdam auf deren eigenes Verlangen zunächst die<br />
krebskranke Henriette Vogel und danach sich selbst. Er hatte am To<strong>des</strong>tag<br />
drei Waffen bereitgelegt: eine Cominazzo und zwei kleine Terzerolen.<br />
Als Erstes nahm er die Cominazzo, mit der er Henriette Vogel in die Brust<br />
schoss, danach schoss er sich mit einer der beiden Terzerolen in den<br />
Mund. Aus der dritten Pistole wurde kein Schuss abgefeuert. In den<br />
Polizeiprotokollen sind der Tathergang und die folgenden Stunden (Fund<br />
der Leichen und die Autopsien) nachzulesen. Die originalen Tatwaffen<br />
sind verschollen. Das Kleist-Museum besitzt aber die entsprechenden<br />
Modelle aus der Zeit. An seine Schwester Ulrike hat Kleist am Tag seines<br />
To<strong>des</strong> aus »Stimmigs Krug« den wohl berühmtesten Abschiedsbrief eines<br />
›Selbstmörders‹ geschrieben: »Ich kann nicht sterben, ohne mich, zufrieden<br />
und heiter, wie ich bin, mit der ganzen Welt, und somit auch, vor allen<br />
Anderen, meine teuerste Ulrike, mit Dir versöhnt zu haben. […] du hast<br />
an mir getan, ich sage nicht, was in Kräften einer Schwester, sondern<br />
in Kräften eines Menschen stand, um mich zu retten: die Wahrheit ist,<br />
dass mir auf Erden nicht zu helfen war.«<br />
77<br />
5<br />
<strong>Der</strong> letzte Brief: Stefan Zweigs Entwurf eines Abschiedsbriefs am<br />
22. Februar 1942.<br />
Declaracão (Abschrift, Copia)<br />
Ehe ich aus freiem Willen und mit klaren Sinnen aus dem Leben<br />
scheide, drängt es mich, eine letzte Pflicht zu erfüllen: diesem wundervollen<br />
Lande Brasilien innig zu danken, das mir und meiner Arbeit so<br />
gute und gastliche Rast gewährt. Mit jedem Tage habe ich dieses<br />
Land mehr lieben gelernt und nirgends hätte ich mir lieber mein Leben<br />
vom Grunde aus neu aufgebaut, nachdem die Welt meiner eigenen<br />
L ETZ E DINGE
78<br />
Sprache für mich untergegangen ist und meine geistige Heimat Europa<br />
sich selbst vernichtet.<br />
Aber nach dem sechzigsten Jahre bedürfte es besonderer Kräfte,<br />
um noch einmal völlig neu zu beginnen. Und die meinen sind durch die<br />
langen Jahre heimatlosen Wanderns erschöpft. So halte ich es für<br />
besser, rechtzeitig und in aufrechter Haltung ein Leben abzuschliessen,<br />
dem geistige Arbeit die lauterste Freude und persönliche Freiheit<br />
das höchste Gut dieser Erde gewesen.<br />
Ich grüsse alle meine Freunde! Mögen sie die Morgenröte noch sehen<br />
nach der langen Nacht! Ich, allzu Ungeduldiger, gehe ihnen voraus.<br />
Stefan Zweig<br />
Petropolis 22. II 1942<br />
N ICOLA HERWEG<br />
»[N]ach dem sechzigsten Jahr bedürfte es besonderer Kräfte, um<br />
noch einmal völlig neu zu beginnen«, schrieb Stefan Zweig am 22. Februar<br />
1942 im brasilianischen Exil. In der folgenden Nacht nahm er gemeinsam<br />
mit seiner zweiten Frau Lotte Gift. Die Leichen der beiden wurden am<br />
nächsten Tag gefunden und mit einem Staatsbegräbnis in Petrópolis<br />
beigesetzt.<br />
Neben etlichen in englischer und französischer Sprache abgefassten<br />
Abschiedsbriefen an Freunde und Verwandte hinterließ Zweig auch eine<br />
Declaracão – portugiesisch für ›Erklärung‹ – in deutscher Sprache.<br />
Dass der Stilwille <strong>des</strong> österreichischen Großschriftstellers in den letzten<br />
Stunden vor seinem freiwilligen Tod ungebrochen war, beweist diese<br />
»Abschrift, Copia«, die freilich keine Abschrift ist, sondern ein Entwurf.<br />
Selber handschriftenaffin – bereits als Gymnasiast erwarb Zweig mit<br />
einem Manuskript von Friedrich Hebbel das erste Stück seiner berühmten<br />
Autographensammlung – war er sich <strong>des</strong> <strong>Wert</strong>es einer Entwurfsfassung<br />
durchaus bewusst. Autographen, befand der Sammler Zweig, seien »die<br />
Urform, die unvollendete, in der noch die Schöpfung gärt«. Und so zeigt<br />
diese Fassung, wie der Autor Zweig seine Sätze formte und straffte,<br />
G ENIE UND ICH
was er zu Papier brachte und wieder verwarf: »Ich habe das Leben zu<br />
sehr geliebt«.<br />
Unverändert blieb, was in den ersten Veröffentlichungen der Declaracão<br />
unterschlagen wurde – der Wunsch <strong>des</strong> Autors von Werken wie Sternstunden<br />
der Menschheit und Ungeduld <strong>des</strong> Herzens für seine Zeitgenossen:<br />
»Mögen sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht.<br />
Ich, allzu Ungeduldiger, gehe ihnen voraus!«<br />
79<br />
6<br />
Errechnetes unausweichliches Ende: Nach dem Verlust von Oberschlesien<br />
bilanziert Hitlers Rüstungsminister Albert Speer für diesen am<br />
30. Januar 1945 eindrücklich die aussichtslose »Rüstungslage Februar –<br />
März 1945«:<br />
[…] Die deutsche Rüstung wird nach dem Verlust von Oberschlesien<br />
nicht mehr in der Lage sein, auch nur im entferntesten die Bedürfnisse<br />
der Front an Munition, Waffen und Panzern, die Verluste an der Front<br />
und den Bedarf für die Neuaufstellungen zu decken. // Das materielle<br />
Übergewicht <strong>des</strong> Gegners ist danach auch nicht mehr durch die<br />
Tapferkeit unserer Soldaten auszugleichen.<br />
Hitler hat die »Geheime Reichssache«, von der sich eine von sieben<br />
Abschriften im Archiv von Speers Verleger Wolf Jobst Siedler findet, laut<br />
Albert Speers Erinnerungen so kommentiert: »›Was aber Ihren letzten<br />
Absatz betrifft‹ – hier wurde seine Stimme schneidend und kühl – ›so<br />
etwas können Sie auch mir nicht schreiben. Diese Schlußfolgerungen<br />
hätten Sie sich sparen können. Sie haben mir zu überlassen, welche<br />
Konsequenzen ich aus der Rüstungslage ziehe.‹«<br />
L ETZ E DINGE
7<br />
»Letzte Worte von Margarete Susman, gesprochen am Spätnachmittag<br />
<strong>des</strong> 15. Januar 1966, ehe sie einschlief. Aufnotiert von<br />
Frau Rietli Hartmaier«<br />
80<br />
8<br />
Aus dem Wasser: Das letzte Notiz- und Adressbuch <strong>des</strong> Literaturwissenschaftlers<br />
Peter Szondi, das er bei sich hatte, als er sich am 18. Oktober<br />
1971 mit 42 Jahren im Berliner Halensee ertränkt hat. Die Leiche wurde<br />
eine Woche später geborgen.<br />
9<br />
Symbolisches letztes Ding: Einer der Aschenbecher aus dem Besitz<br />
von Ingeborg Bachmann, die am 25. September 1973 über einer Zigarette<br />
eingeschlafen war und nach ihren schweren Brandverletzungen am<br />
17. Oktober gestorben ist. – Leihgabe: Sammlung Isolde Moser,<br />
Kötschach-Mauthen.<br />
10<br />
»Die letzten Zigaretten«: Nachdem Oskar Pastior 2006 mit 78 Jahren<br />
gestorben war, haben seine Testamentsvollstrecker in seiner Berliner<br />
Wohnung unter anderem eine Kiste beschriftet und weiter gefüllt, in der<br />
er seine Zigaretten aufbewahrt hat.<br />
Nicht erst seit Orhan Pamuks Museum der Unschuld (2008), wo unter<br />
anderem die 4213 Kippen ausgestellt werden, die der schöne Mund der<br />
Romanheldin berührt hat, sind Zigaretten ein literarisches Material. Pastior<br />
hat die leeren Zigarettenpapier-Heftchen in Streifen geschnitten und<br />
einzelne Buchstaben darauf geschrieben, um mit diesen Kärtchen leichter<br />
Anagramme bilden zu können. In der Schachtel eines Filterzigarettenstopfgerätes<br />
»King Size« sammelte er »Mini-Bücher«.<br />
G ENIE UND ICH
Magie und Material
L ETZTER HAND<br />
Originale sind eigenhändig entstanden oder durch Handanlegen einzig.<br />
Von der Hand, der sie ihre Existenz verdanken, sind sie nicht zu trennen.<br />
Die Hand <strong>des</strong> Künstlers ist nicht nur sein wichtigstes Arbeitsinstrument.<br />
Sie ist sein originäres, unveränderbares Merkmal und zeigt auf ihn selbst<br />
als Urheber und Schöpfer. In ihr spiegeln sich die Bewegungen seiner<br />
Seele. Sie bringt die Ideen <strong>des</strong> Geistes zum Vorschein oder setzt sie auch<br />
erst in Gang, ist Motor und Widerstand. Man redet mit den Händen, weil<br />
man mit ihnen besser denken kann, und man nutzt sie, um zu begreifen,<br />
was man noch nicht fassen kann.<br />
Die einfachste, nicht immer freiwillige Form der Signatur ist der Fingerabdruck.<br />
Wer sich an einem Ort unabänderlich verewigen will, der hinterlässt<br />
den Abdruck seiner Hände – nicht nur auf dem walk of fame.<br />
In der Geschichte der deutschen Literatur spielt die Hand metaphorisch<br />
eine große Rolle, seitdem Wieland und Goethe mit »Ausgaben letzter<br />
Hand« auch ihre gedruckten Werke als Originale stempeln: <strong>Der</strong> Text und<br />
das, was man als Leser in der Hand hat, soll sich im idealen Fall nicht<br />
mehr verändern.
3 /I
1<br />
Handabguss von Goethe, abgenommen 1820.
2<br />
Kurt Tucholskys Hände, fotografiert um 1930.
Die zweite eiserne Hand <strong>des</strong> »Götz« von Berlichingen.<br />
3
L ETZTER HAND<br />
1 Handabgüsse von<br />
Sophie von Adelung,<br />
Ludwig Klages,<br />
Max Stirner, Samuel<br />
Fischer, Ina Seidel,<br />
Richard Scheibe,<br />
Rudolf Alexaner<br />
Schröder, Hermann<br />
Kasack und Günther<br />
Weisen born
1<br />
Handabgüsse: Von links nach rechts: Johann Wolfgang Goethe (abgenommen<br />
1820), Sophie von Adelung (1898), Ludwig Klages, Max Stirner (1926),<br />
Samuel Fischer (1934), Ina Seidel, Rudolf Alexander Agricola, Rudolf Alexander<br />
Schröder (1962), Hermann Kasack (1966) und Günther Weisenborn (1969).<br />
86<br />
F RANK DRUFFNER<br />
Es war Johann Caspar Lavater, der den Handabguss zum probaten<br />
Instrument der Physiognomie erhob, da sich an Händen (und der Handschrift)<br />
wie an Gesichtszügen Spuren <strong>des</strong> Charakters ablesen ließen. »Eine Sammlung<br />
von nachgegoßenen Händen von Wachs oder Gips – samt einer genauen<br />
Beschreibung von dem Charakter der Person, von welcher sie abgegossen<br />
sind – […]. Welch eine Schule – für den Physiognomisten!«, schrieb er 1777 in<br />
den Physiognomischen Fragmenten. Den Zusammenhang zwischen Handform,<br />
Intelligenz und Charakter hat dann Carl Gustav Carus 1846 ausformuliert.<br />
Carus’ chirognomische Typologie reicht von der »elementaren« bis zur<br />
»seelischen Hand«. Für die Individualität, der diese höchste Handform angehört,<br />
besäßen die Deutschen die sehr zutreffende Bezeichnung »schöne Seele«.<br />
Was schöne Seelen ersannen, verwirklichten ihre »seelischen« Hände. Die Hand<br />
<strong>des</strong> Verlegers Samuel Fischer unterzeichnete ungezählte Autorenverträge.<br />
Die Hand <strong>des</strong> Malers Karl Stirner schuf nicht nur Gemälde, sondern illustrierte<br />
auch die Werke von Hermann Hesse. Die Hand <strong>des</strong> Bildhauers Richard Scheibe<br />
formte den Ton. Dass die Hand von Sophie von Adelung zwei Mal im Archiv<br />
liegt, mag ein Zufall sein, passt jedoch zu ihrer Doppelbegabung: Sie schrieb<br />
und malte. Bei den Autoren stellt die Hand das originale, körpereigene Schreibwerkzeug<br />
dar. Ihr Abguss war verehrungswürdig, weil er im Medium der Skulptur<br />
das Instrument kreativer Tätigkeit für die Nachwelt festhielt. Wie bei einer<br />
Lebend- oder Totenmaske versicherte man sich durch die Präsenz <strong>des</strong> authentisch<br />
abgeformten Körperteils der Schöpferkraft einer »schönen Seele«.<br />
2<br />
Fotografierte Hände: <strong>Der</strong> Schreibmaschinentipper Kurt Tucholsky um 1930<br />
(»Hände auf der Schreibmaschine / Meine Schrift kann niemand lesen, / nicht<br />
mal ich«), der hier einen Frauenring trägt, so wie er es für seine große Liebe<br />
Mary einmal gedichtet hat (»Ring einer Frau, du funkelst an meiner Hand, /<br />
grüßt du herüber, von ihr, aus dem weiten Land?«); der blinde Dichter Jorge<br />
M AGIE UND MATERIAL
Luis Borges, für den die Hände und Ohren die Augen ersetzen, fotografiert<br />
von Victor Canicio bei Borges’ Besuch 1982 in Ernst Jüngers Wilflinger<br />
Oberförsterei, und der von Uhren und Motten faszinierte, sich mit einem<br />
Bastler vergleichende W. G. Sebald (vermutlich um 2000 von ihm selbst<br />
fotografiert); in Austerlitz geben die Uhren den Takt vor und in der Wohnung<br />
der Titelfigur findet man sorgsam aufbewahrt tote Motten: »wer weiß, sagte<br />
Austerlitz, vielleicht träumen auch die Motten oder der Kopfsalat im Garten,<br />
wenn er zum Mond hinaufblickt in der Nacht«.<br />
87<br />
3<br />
Prothese: Die zweite eiserne Hand <strong>des</strong> Gottfried »Götz« von Berlichingen<br />
zu Hornberg in einer Kopie aus dem 20. Jahrhundert.<br />
1773 machte Goethes Drama den Ritter mit der eisernen Hand, der<br />
seine echte rechte Hand 1504 durch eine Kugel verloren hat, zum Inbegriff<br />
<strong>des</strong> Freiheitskämpfers. Am Ende der Napoleonischen Kriege hat man die<br />
1530 angefertigte »Zweithand«, mit der Götz – anders als mit seiner ersten<br />
Prothese – sogar schreiben und schießen konnte, zerlegt und als Attribut<br />
einer Figur beschrieben, die einer Neuordnung der Grenzen eine Ursprungslegende<br />
liefern konnte. Pünktlich zum Wiener Kongress erschien in Berlin<br />
Christian von Mechels Dokumentation: Die eiserne Hand <strong>des</strong> tapfern deutschen<br />
Ritters Götz von Berlichingen, wie selbige noch bey seiner Familie in<br />
Franken aufbewahrt wird, sowohl von Außen als von Innen dargestellt,<br />
nebst der Erklärung ihres für jene Zeiten vor fast dreyhundert Jahren<br />
sehr merkwürdigen Mechanismus; ferner eine kurze Lebensgeschichte <strong>des</strong><br />
Ritters, besonders in Bezug auf die Hand, und endlich der Denkschrift, die<br />
bey der Hand verwahrt wird, theils in Versen, theils in Prosa, zu Ehren<br />
der Hand von den besten Dichtern verfasst. Den in den Jahren 1814 und<br />
1815 zum Friedens-Congreß in Wien versammelten gekrönten Befreyern<br />
Europen’s ehrerbietigst zugeeignet von Christian von Mechel, k. Hofrath<br />
und Mitglied der königl. und anderer Akademien. Heute sind beide Prothesen<br />
in der Dauerausstellung im Museum der Götzenburg in Jagsthausen<br />
ausgestellt und werden als zentrale Elemente der Götz-Geschichte im Original<br />
nicht verliehen. – Leihgabe: Götz Freiherr von Berlichingen, Schöntal.<br />
L ETZ TER HAND
B ERÜHRUNG<br />
Originale sind Berührungsreliquien. Nichts vermittelt so sehr die Gewissheit<br />
körperlicher Gegenwart, nichts gewährt eine so starke Evidenz wie<br />
die Berührung: »Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite.« Das<br />
Abschreiben, Abklatschen, Durchpausen erstellt Zweitformen und bewahrt<br />
doch die Gewissheit <strong>des</strong> <strong>Originals</strong>, aus <strong>des</strong>sen Berührung jene hervorgegangen<br />
sind. Was solche taktilen Übertragungen entstehen lassen, sind<br />
weniger abgelöste und für sich existierende Kopien als vielmehr Verdoppelungen<br />
<strong>des</strong> <strong>Originals</strong>.<br />
Die Totenmaske bewahrt die Form eines Lebens, das schon vergangen<br />
und ins Präteritum gewechselt ist und macht sie unvergänglich. Ein<br />
belang loses Stück Holz, das Schiller berührt haben mag, wird zum Kreuzessplitter<br />
eines weltlichen Kults, der sich darin seines Numinosen versichert.<br />
Eine abgepauste Handschrift kann uns zurück an den Ursprung<br />
führen: Wir schreiben sie noch einmal.
3 /II
1<br />
Papierabklatsch einer Weiheinschrift, um 116/115 v. Chr.,<br />
in Unterägypten in einen Kalkstein geritzt.
Pfotenabdruck <strong>des</strong> Affen »Pinkel«, um 1890, aus der Sammlung von Gabriel von Max.<br />
9
Arno Schmidts Daumenabdruck in einem Brief an Max Bense, 23. Januar 1958.<br />
8
3<br />
2<br />
4<br />
5<br />
B ERÜHRUNG<br />
6<br />
7<br />
10<br />
11<br />
2 Schiller: Abgepaustes<br />
Faksimile<br />
3 Mörike: Kopie<br />
von Hölderlins Ode<br />
Heidelberg<br />
4 Goethe:<br />
Lebendmaske<br />
5 Kessler:<br />
Totenmaske<br />
6 Kästner:<br />
Röntgenaufnahme<br />
7 Holzlatte aus<br />
Schillers Geburtshaus<br />
10 Doré: Handkolorierter<br />
und signierter<br />
Druckstock<br />
11 Christo und<br />
Jeanne-Claude:<br />
Stoffprobe für<br />
den »Verhüllten<br />
Reichstag«
1<br />
Papierabklatsch einer Weiheinschrift, die eine militärische Einheit<br />
um 116/115 v. Chr. in Unterägypten in einen Kalkstein hat ritzen<br />
lassen:<br />
90<br />
Für die Königin Kleopatra und den König Ptolemaios, die Theoi Philometores<br />
und Soteres, (weihen) die in Schedia stationierten Soldaten,<br />
deren Hegemon und Chiliarch Sosipatros ist, das Kleopatreion.<br />
Leihgabe: Antikensammlung, Universität Tübingen, Sammlung Sieglin<br />
(Inv. S./13 3955).<br />
K ATHRIN B. Z IMMER<br />
Die ersten beiden Zeilen sind aufgrund <strong>des</strong> folgenden Textes zu<br />
rekon struieren, und die erste erhaltene Zeile datiert den Text in die<br />
Regierungszeit von Ptolemaios IX. Soter II. und seiner Mutter Kleopatra III.<br />
Die Inschrift gibt Aufschluss darüber, dass in der durch innere Unruhen<br />
geprägten Zeit in Schedia Soldaten stationiert waren. Die Loyalität dieser<br />
militärischen Einheit kam in der Einrichtung einer Kultstätte für Kleopatra<br />
III., Mutter und Mitregentin von Ptolemaios IX., zum Ausdruck. Die<br />
wenigen Zeilen in griechischer Sprache dokumentieren damit die strategisch<br />
wichtige Rolle <strong>des</strong> Ortes. Diese lässt sich zum einen mit seiner<br />
Funktion als Zollstation begründen, zum anderen dürfte sie auf den<br />
Umstand zurückgehen, dass zeitgleich ein für die Frischwasserversorgung<br />
Alexandrias sowie den Transport und Handel bedeutender Wasserkanal<br />
an diesem Ort seinen Anfang nahm.<br />
Ein Abklatsch wie der vorliegende bildet auch kleinste Unebenheiten der<br />
Steinoberfläche ab. Er hilft, infolge von Verwitterung nur noch schwer<br />
lesbare Inschriften zu entziffern, und bildet eine Möglichkeit, Inschriften<br />
von statischen Monumenten möglichst getreu abbilden und an einem Ort,<br />
beispielsweise einem Museum oder einer Forschungseinrichtung sammeln,<br />
auswerten und präsentieren zu können. Bei der Herstellung <strong>des</strong><br />
Abklatsches wird ein Bogen dicken, saugfähigen Papiers auf der Inschrift<br />
M AGIE UND MATERIAL
platziert, mit einem Schwamm angefeuchtet und mittels einer Bürste in<br />
die Vertiefungen <strong>des</strong> Steins eingeklopft. Nach einer Trocknungsphase<br />
kann das Papier, das die Inschrift nun dreidimensional abbildet, vorsichtig<br />
abgenommen werden.<br />
2<br />
Abgepaust vom Faksimile:<br />
91<br />
Mein Unrecht kenn ich, es steht ganz vor mir.<br />
Schon seh ich diese Mauern, diese Bogen<br />
Sprache bekommen, und, mich anzuklagen<br />
Bereit, <strong>des</strong> Gatten Ankunft nur erwarten,<br />
Furchtbares Zeugnis gegen mich zu geben!<br />
– Nein laß mich sterben! diesen Schrecknissen<br />
Entziehe mich der Tod – er schreckt mich nicht!<br />
<strong>Der</strong> unbekannte Schreiber weist die Quelle nach, die er seiner bis in<br />
jeden Federzug genauen Kopie von Versen Friedrich Schillers aus <strong>des</strong>sen<br />
Übersetzung von Racines Phädra zugrunde gelegt hat: »Nach dem von<br />
der Tochter Schiller’s, Freifrau Emilie von Gleichen-Rußwurm, herausgegebenen<br />
›Schiller’s Kalender‹ Stuttgart 1865«. Mit Bleistift hat ein anderer<br />
vermerkt: »Faksimile!«<br />
BERÜH RUNG
3<br />
»Aus dem Concept mit sämtlichen Correcturen abgeschrieben von<br />
E. Mörike«:<br />
92<br />
Aber Mit dem Schicksaal vertraut sah das gigantische<br />
Bergschloß schaurig herab mahnend ins Thal, luftig, bis auf den<br />
Grund<br />
Von den Wettern zerrissen,<br />
Doch die ewige Sonne schien goß<br />
(<strong>Der</strong> Schluß <strong>des</strong> Stückes fehlt, indem das 2te Blatt <strong>des</strong> foliobogens,<br />
worauf es stand und das ich nicht gesehen habe, abgerissen und<br />
verloren ist) M.<br />
Von Friedrich Hölderlins Ode Heidelberg hat Mörike eine späte, hier noch<br />
unvollständige Fassung besessen, die er 1846 für seinen Freund Wilhelm<br />
Hartlaub abschreibt: »Es wird Dich unterhalten in die Entstehung dieses<br />
Stücks hineinzusehn, wie es sich nach u. nach gereinigt hat, Gedanke u.<br />
Ausdruck immer klarer u. kräftiger wurde. Es ist theils mit der Feder theils<br />
mit dem Bleistift geschrieben; die halbverwischten Züge <strong>des</strong> letzten sind<br />
nur eben noch lesbar.«<br />
4<br />
<strong>Der</strong> einzige Abdruck: Lebendmaske von Johann Wolfgang Goethe,<br />
im Oktober 1807 auf Wunsch <strong>des</strong> Schädelforschers Franz Joseph Gall<br />
vom Weimarer Hofbildhauer Karl Gottlieb Weißer abgenommen. <strong>Der</strong><br />
Originalabdruck blieb in Goethes Besitz.<br />
M AGIE UND MATERIAL
5<br />
Letzte Gesichter: Am 27. August 1900 in Gegenwart von Harry Graf<br />
Kessler abgenommene Totenmaske <strong>des</strong> zwei Tage zuvor mit 56 Jahren in<br />
Weimar gestorbenen Friedrich Nietzsche. Daneben Kesslers Totenmaske,<br />
die <strong>des</strong>sen Liebhaber abnehmen ließ, nachdem Kessler am 30. November<br />
1937 mit 69 Jahren in Lyon gestorben war.<br />
F RANK DRUFFNER<br />
Bei der Anfertigung von Totenmasken wird mit dem Verfahren der<br />
ver lorenen Form gearbeitet. Eine vom Gesicht abgenommene Negativform<br />
wird in Gips, Bronze oder Wachs ausgegossen und damit zur Matrix<br />
<strong>des</strong> rekonstituierten ›letzten Gesichts‹. Harry Graf Kessler war anwesend,<br />
als am Montag, den 27. August 1900 in Weimar die Totenmaske Friedrich<br />
Nietzsches von Curt Stöving genommen wurde. Sie stieß bei Nietzsches<br />
Schwester aufgrund der schiefen Nase – »die ganz dünn zusammengekniffene<br />
Nase vom Schmerz sprechend« (Kessler) auf Ablehnung. Max<br />
Klinger korrigierte darauf hin das Original, das in der Tat Mängel aufwies,<br />
doch auch seine Maske galt nicht als angemessen. Erst 1910 entstand<br />
eine heroisierende, an Bildnisskulpturen orientierte Fassung, die ihrerseits<br />
mehrfach variiert werden sollte.<br />
Als Kessler, der Zeuge von 1900, im Jahr 1937 in Lyon starb, veranlasste<br />
sein Sekretär und Liebhaber Max Goertz die Anfertigung einer in Wachs<br />
gegossenen Totenmaske: »Die Totenmaske, die ich formen ließ, trägt<br />
noch die Spuren seiner Leiden, doch auch die Kraft <strong>des</strong> Ausdrucks und<br />
die Reinheit seiner Züge.« Ihre Blessuren zeigen, dass sie einst in irgendeiner<br />
Form ›benutzt‹, berührt oder gezeigt worden war. Als sie 2014<br />
ins Deutsche Literaturarchiv Marbach gelangte, lag sie, in Watte gepackt,<br />
in einem ramponierten Karton. Jemand aus der Familie <strong>des</strong> Verstorbenen<br />
muss nachträglich die To<strong>des</strong>anzeige und eine noch zu Lebzeiten an<br />
Kessler gerichtete Postkarte dazu gelegt haben. Sie zeigt die Totenmaske<br />
Napoleons, auf <strong>des</strong>sen physiognomische Ähnlichkeit mit dem Grafen<br />
die rückseitige Beschriftung hinweist.<br />
93<br />
BERÜH RUNG
6<br />
Durchleuchtet: Erich Kästners durch das Zurücklegen <strong>des</strong> Kopfes<br />
sichtbaren Nebenhöhlen in einer Röntgenaufnahme, die am 13. Februar<br />
1956, zehn Tage vor seinem 57. Geburtstag, gemacht worden ist.<br />
94<br />
7<br />
Kontakt mit dem Ursprungsort: Teil einer Holzlatte aus Friedrich<br />
Schillers Geburtshaus, am 25. August 1889 vom <strong>Marbacher</strong> Bürger meister<br />
mit Stempel und Unterschrift beglaubigt.<br />
T HOMAS SCHMIDT<br />
Es sei nicht gewiss, schrieb die in Marbach aufgewachsene Schriftstellerin<br />
Ottilie Wildermuth im Jahr 1857, »ob die vielen Splitter, die von<br />
Schillerverehrern aus den Balken geschnitten werden, noch lauter echte<br />
Schillersplitter« seien. Zwei Jahre später, zum 100. Geburtstag Friedrich<br />
Schillers, wurde sein Geburtshaus als Gedenkstätte eröffnet. Zuvor hatte<br />
man allerdings nicht nur die Holzschäden beseitigt: Um als bedeutender<br />
Ort strahlen zu können, wurde das kleine Handwerkerhaus, in dem lange<br />
eine Bäckerei betrieben worden war, grundlegend umgebaut. So traute<br />
man diesem Holzstück, das wie die »Schillersplitter« in der christlichen<br />
Reliquientradition steht, offensichtlich keine eigene Aura mehr zu. Am<br />
25. August 1889 wurde es durch einen amtlichen Stempel und die Unterschrift<br />
<strong>des</strong> <strong>Marbacher</strong> Bürgermeisters und »Vorstands <strong>des</strong> Schillervereins«<br />
Traugott Haffner beglaubigt. Doch auch die Bedeutung <strong>des</strong> Gebäu<strong>des</strong>,<br />
aus dem später das Schiller-Museum und -Archiv hervorgehen sollte,<br />
stützt sich auf eine solche Beglaubigung: 1812, sieben Jahre nach Schillers<br />
Tod, wurde es nach einer Befragung alter <strong>Marbacher</strong> durch einen<br />
Notar als Ort seiner Geburt identifiziert. Schiller hatte in der Neckarstadt<br />
nur die ersten vier Jahre seines Lebens verbracht.<br />
M AGIE UND MATERIAL
8<br />
»Das hier ist der »schmutzige Daumen«: Arno Schmidt als »Hilfsheizer<br />
am hiesigen Hausvulkan« am 23. Januar 1958 an Max Bense.<br />
9<br />
Spuren der Evolution: Einer der Pfotenabdrücke, die der Maler Gabriel<br />
von Max auf berußtem Papier von den Affen machen ließ, mit denen er<br />
in seiner Münchner Villa lebte – hier der um 1890 entstandene Abdruck<br />
<strong>des</strong> Affen ›Pinkel‹. – Leihgabe: Deutsches Kunstarchiv im Germanischen<br />
Nationalmuseum, Nürnberg (DKA, NL Max, Gabriel von, I,B-399).<br />
95<br />
B IRGIT JOOSS<br />
Betrachtet man die vorliegenden Rußabdrücke von Affenpfoten, so<br />
fragt man sich unweigerlich nach ihrem Entstehungszusammenhang.<br />
Handelt es sich um eine frühe Form abstrakter Kunst, die Überreste eines<br />
Spiels, einen anthropologischen Nachweis oder die Materialisation einer<br />
spiritistischen Séance? Im Nachlass von Gabriel von Max, einem der<br />
ungewöhnlichsten Künstler <strong>des</strong> späten 19. Jahrhunderts, haben sich<br />
einige dieser Rußabdrücke überliefert, die Gesichter, Hände oder eben<br />
Affenpfoten wiedergeben.<br />
Betrachtet man das Blatt, so beeindruckt die ausgewogene und gleichzeitig<br />
dynamische Komposition, die sich aus mehreren Pfotenabdrücken<br />
und schwungvollen Verwischungen zusammensetzt und ein bisschen<br />
an einen Blumenstrauß erinnert. <strong>Der</strong> Affe scheint eine leichte Pirouette<br />
gedreht zu haben, bevor er das Blatt nach rechts verließ. So entstand<br />
eine Grafik, die – wäre sie in den Nachkriegsjahren entstanden – ohne<br />
weiteres als abstraktes Werk in die Kunstgeschichte hätte eingehen<br />
können.<br />
Doch das vorliegende Blatt stammt bereits aus dem Jahre 1885 und ist<br />
ursprünglich eher einem (pseudo-)wissenschaftlichen Kontext zuzurechnen.<br />
Denn Max war nicht nur Künstler, sondern ebenso Anthropologe und<br />
Anhänger <strong>des</strong> damals weitverbreiteten Spiritismus, der sich häufig der<br />
Technik <strong>des</strong> Abdrucks bediente, um Nichtsichtbares sichtbar zu machen.<br />
BERÜH RUNG
96<br />
Seit 1869 züchtete er Affen, mit denen er lebte und die er erforschte. Er<br />
untersuchte ihr Verhalten, sezierte sie nach ihrem Tod und dokumentierte<br />
genauestens seine Beobachtungen. Zahlreiche Fotografien, Zeichnungen<br />
und wissenschaftliche Notizen im Nachlass geben hiervon Zeugnis. So<br />
ist der Abdruck, der die Spuren seines Affen Pinkel auf einem durch eine<br />
stark rußende Petroleumlampe geschwärzten Papier festhält, ein ungewöhnliches<br />
Relikt, das seine Interessen für Kunst, Anthropologie und<br />
Spiritismus kongenial vereint.<br />
10<br />
Original-Klischee: Geweißter, signierter und handkolorierter und so zum<br />
wertvollen Original erklärter Druckstock von Gustave Doré aus der Reihe<br />
seiner 1873 erschienenen Illustrationen zu Gargantua et Pantagruel von<br />
François Rabelais.<br />
Gewöhnlich werden Holz-, Kupfer- und Stahlstiche signiert, indem der<br />
Künstler auf ihnen mit Bleistift unterzeichnet oder seinen Namen in den<br />
Druckstock als Negativ sticht und mitdruckt. Druckstöcke, sog. Klischees,<br />
sind nur die Vorstufe eines Kunstwerks und werden oft nach dem Gebrauch<br />
zerstört, obwohl sie der Hand <strong>des</strong> Künstlers näher waren, ihre<br />
Spuren tragen und das Original hinter der Reproduktion sind. Albrecht<br />
Dürer hat das als einer der Ersten erkannt: Als Malergeselle signiert er<br />
1492 einen Druckstock auf der Rückseite »Albrecht Dürer von nörmergk«.<br />
<strong>Der</strong> »Hl. Hieronymus im Gemach« sieht Dürer ähnlich und trägt so die<br />
Signatur doppeldeutig, als Verweis auf den Künstler wie den Dargestellten.<br />
– Leihgabe: Heribert Tenschert, Ramsen.<br />
H ERIBERT TENSCHERT<br />
Es handelt sich um den Original-Holzstock für die ganzseitige Abbildung<br />
der Zeichnung von Gustave Doré in: François Rabelais, Œuvres<br />
(Gargantua und Pantagruel), Paris 1873, auf S. 60 von Band 2, mit der<br />
Legende: »Et tous accouroient à la foule, à qui serait premier en date,<br />
M AGIE UND MATERIAL
pour estre tant précieusement battu.« Die Stelle steht im Buch IV (Quart<br />
Livre), Kapitel XVI und lautet auf Deutsch: »Und rannten haufenweise um<br />
die Wette, nur ja als erste so teure Prügel zu beziehen.«<br />
Die schöne Zeichnung von Gustave Doré wurde eventuell von ihm direkt<br />
auf den Holzstock appliziert und dann von einem Stecher (Mulot) in<br />
Hirnholz gestochen. <strong>Der</strong> Stock ist aufgrund der Qualität der Darstellung<br />
und <strong>des</strong> Nachruhms <strong>des</strong> Malers dem normalen Schicksal einer Druckvorlage<br />
(der Vernichtung oder dem Abschleifen) entgangen und liegt hier<br />
›geweißt‹ (blanchi) vor, eine Maßnahme, mit der die Darstellung auf<br />
dem Stock selbst erst sichtbar wird und gleichzeitig dieser unbrauchbar<br />
für die Weiterverwendung.<br />
97<br />
11<br />
Berührt, aber nie verwendet: Weiße Stoffproben, die das Künstlerehepaar<br />
Christo und Jeanne-Claude in den 70er-Jahren für ihr Kunstprojekt<br />
»Verhüllter Reichstag« (»Wrapped Reichstag«) bemustert hat. Als<br />
die Verhüllung im Sommer 1995 realisiert worden ist, wurden 109 400 m 2<br />
aluminiumbedampftes Polypropylengewebe verwendet. – Leihgabe:<br />
Deutsches Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg<br />
(DKA, NL Christo und Jeanne-Claude, II,B-18).<br />
B IRGIT JOOSS<br />
Jeder der 1995 Zeuge der Verhüllung <strong>des</strong> Reichstagsgebäu<strong>des</strong> in<br />
Berlin war, wird dieses faszinierende Ereignis niemals vergessen. <strong>Der</strong><br />
schwere Bau von Paul Wallot war in eine schwebende, leichte Skulptur<br />
verwandelt worden, die eine unbeschreibliche Strahlkraft besaß. Das<br />
schöne Wetter, die großartige Stimmung und die Prägnanz der Installation<br />
vermittelten den Eindruck von Mühelosigkeit und Eleganz.<br />
Doch die Realisierung war alles andere als mühelos gewesen, es war<br />
vielmehr ein jahrzehntelanger, mühevoller Gang durch die deutsche<br />
Bürokratie. Erst nach zähen Verhandlungen war es Christo und Jeanne-<br />
Claude gelungen, dieses Projekt zu realisieren. 13 laufende Meter Akten-<br />
BERÜH RUNG
98<br />
bestand nur zu diesem einen Projekt geben davon Zeugnis. Es sind<br />
un endliche Korrespondenzen, Protokolle, Drucksachen und Presseberichte,<br />
die zusammengetragen wurden und offenbaren, dass Christo und<br />
Jeanne-Claude bereits 1971 mit ihrer Arbeit begonnen hatten.<br />
Aus den Jahren 1976 und 1977 liegen Materialproben vor. Eindeutig<br />
stellten die Künstler intensive Überlegungen an, welcher Stoff sich für die<br />
Verhüllung am Besten eignete. Jeder Besucher, der damals in Berlin war,<br />
hatte Stücke <strong>des</strong> verwendeten Stoffs geschenkt bekommen. Es waren<br />
kleine, silbrig leuchtende Quadrate aus grobem Textil, die man stolz als<br />
Beweisstück seiner Teilnahme an der Performance zur Erinnerung mit<br />
nach Hause nahm. Die im Archiv vorhandenen Materialproben sind jedoch<br />
ganz anderer Natur. Es sind verschiedene Trevira- und Nomex-Gewebe,<br />
die sich in den Werbemappen zweier Firmen erhalten haben. Alle Stoffe<br />
sind wesentlich dünner und feinmaschiger, haben eine hellere Farbe und<br />
vor allem keinen magischen, silbrigen Glanz. Auch wenn sie nicht zum<br />
Einsatz kamen, sind sie heute Manifestationen <strong>des</strong> frühen Planens von<br />
Christo und Jeanne-Claude, die durch ihre bewundernswerte Beharrlichkeit<br />
Berlin eine der faszinierendsten Installationen geschenkt haben.<br />
M AGIE UND MATERIAL
D IE BESESSENEN<br />
Originale sind mehr als sie selbst. Sie reichen in graue Vorzeiten zurück<br />
und in unsichtbare Welten hinüber. Wir können uns ihrer nie ganz sicher<br />
sein. Leicht wird aus Besitz Besessenheit, aus Nähe Unheimlichkeit.<br />
In den Besessenen haben Geister ihren Wohnsitz genommen, die sie zu<br />
ihrem Sprachrohr oder zum Instrument ihres Willens machen. Um sich<br />
von ihnen zu befreien, muss man sein Inneres nach außen stülpen.<br />
Umgekehrt lehrt die Etymologie, dass körperliche Berührung ein Eigentum<br />
begründen kann: Besitz kann auch ersessen werden. Zwischen Körpern<br />
und Objekten können Geheimbeziehungen entstehen, die das Unbeseelte<br />
beseelen und das Unscheinbare zum kostbarsten Besitz werden lassen.<br />
Manche dieser Originale drängen in die Sichtbarkeit; sie wollen bewundert<br />
und verehrt werden. Doch nicht alle Objekte kultischer Praxis wollen<br />
betrachtet sein: <strong>Der</strong> Blick <strong>des</strong> Uneingeweihten würde sie profanieren,<br />
entzaubern und schänden. Von seiner Kamera ganz zu schweigen.
3 /III
10<br />
Nur verhüllt ausstellbar: eine Tjurunga der Aborigines.
Ausgedienter Turmhahn der Kirche in Cleversulzbach, den Mörike aufbewahrt hat.<br />
8
Gespielt, um die Insassen <strong>des</strong> Irrenhauses in Ludwigsburg zu besänftigen –<br />
Justinus Kerners Maultrommel.<br />
3
1<br />
4<br />
2<br />
D IE BESESSENEN<br />
7<br />
1 Hölderlin: Schreibtisch<br />
aus dem Tübinger<br />
Turm<br />
2 Hölderlin:<br />
eines der Scardanelli-Gedichte<br />
4 Schiller: Rezept für<br />
ein Brechmittel<br />
7 Arnim: Stammbuch<br />
9 Benjamin: Papier<br />
mit Stern für eine<br />
Definition von »Aura«<br />
9
102<br />
1<br />
Aus Hölderlins Besitz: Ein kleiner Schreibtisch ist das einzige erhaltene<br />
Möbelstück aus dem Tübinger Turm, in dem Friedrich Hölderlin in seinen<br />
letzten 36 Lebensjahren von der Familie Zimmer gepflegt worden ist.<br />
Er soll, so berichten es die Zimmers und seine Besucher, unablässig mit<br />
sich selbst geredet haben und hat auf die Schreibtischplatte geklopft,<br />
wenn er Verse skandierte oder einen Streit mit sich austrug.<br />
Wilhelm Waiblinger hat Hölderlin im Winter 1827/28 bis in die Finger<br />
beschrieben: »Man bewundert das Profil, die hohe gedankenschwere<br />
Stirne, das freundliche freylich erloschene, aber noch nicht seelenlose<br />
liebe Auge; man sieht die verwüstenden Spuren der geistigen Krankheit in<br />
den Wangen, am Mund, an der Nase, über dem Auge, wo ein drückender<br />
schmerzlicher Zug liegt, und gewahrt mit Bedauren und Trauer die convulsivische<br />
Bewegung, die durch das ganze Gesicht sich zuweilen vorbereitet,<br />
die ihm die Schultern in die Höhe treibt, und besonders die Hände<br />
und Finger zucken macht.«<br />
Leihgabe: Dietrich Wurm, Lindau.<br />
G REGOR WITTKOP<br />
»Daß ich ja den Tisch vor meinem Sopha solle in Ehren halten;<br />
da habe der Dichter Hölderlin mit d. Hand geschlagen, wenn er Streit<br />
gehabt – mit seinen Gedanken!« So hatte Lotte Zimmer 1859 ihren<br />
Untermieter Ernst Friedrich Wyneken zur Achtsamkeit ermahnt: »Und<br />
wenn sie fort ziehen müsse – sie nähme den Tisch mit!« Es lässt sich nicht<br />
erzählen, für welche monologischen Dispute der kleine Nussbaumtisch<br />
mit seiner Eichenplatte den Resonanzboden abgab. Erzählen lässt sich<br />
dagegen, was sich mit ihm zutrug.<br />
Als Lotte Zimmer im November 1813 zur Welt kam, lebte der faktisch<br />
entmündigte Friedrich Hölderlin bereits seit sechs Jahren im Haus ihrer<br />
Eltern Ernst und Elisabethe am Tübinger Neckar, streifte durch Werkstatt<br />
und Zwinger (den schmalen Uferstreifen zwischen Stadtmauer und<br />
M AGIE UND MATERIAL
Fluss), wehrte mit seinen bizarr höfischen Umgangsformen Visiten mehr<br />
ab, als dass er sie empfing, improvisierte auf dem Tafelklavier und schrieb<br />
Verse (die man ihm fortnahm). Was flüchtige Besucher zu Legenden vom<br />
gefallenen Götterliebling inspirierte, war für sie Alltag, und als Herangewachsene,<br />
die von ihrem verstorbenen Vater die Sorge für den hilfsbedürftigen<br />
Hausgenossen übernommen hatte, beobachtete sie ihn genau:<br />
mit den Blicken einer Verantwortlichen. Ihre regelmäßigen Berichte an<br />
den amtlichen Vormund gehören zu den wenigen zuverlässigen Quellen für<br />
Hölderlins Leben bis zu seinem Tod am 7. Juni 1843 im Tübinger Turmzimmer.<br />
Hölderlins persönliche Gegenstände gingen an seine Geschwister und<br />
haben sich nicht erhalten. Aber den Tisch hat Lotte Zimmer bewahrt und<br />
ihrer Familie anvertraut, die ihn seit vier Generationen »in Ehren« hält<br />
wie seinerzeit den unruhigen Gast.<br />
103<br />
2<br />
Von Hölderlins Schreibtisch: <strong>Der</strong> Sommer, geschrieben am 13. Juli<br />
1842, unterzeichnet mit »Scardanelli« und datiert auf den 24. Mai 1758.<br />
<strong>Der</strong> Sommer<br />
Im Thale rinnt der Bach, die Berg’ an hoher Seite,<br />
Sie grünen weit umher an dieses Thales Breite,<br />
Und Bäume mit dem Laub stehn gebreitet,<br />
Daß fast verborgen dort der Bach hinunter gleitet.<br />
So glänzt darob <strong>des</strong> schönen Sommers Sonne,<br />
Daß fast zu eilen scheint <strong>des</strong> hellen Tages Wonne,<br />
<strong>Der</strong> Abend mit der Frische kommt zu Ende,<br />
Und trachtet, wie er das dem Menschen noch vollende.<br />
mit Unterthänigkeit<br />
Scardanelli.<br />
D I E BES E SSE N E N
104<br />
Am unteren Rand der Handschrift schildert der Theologiestudent Ferdinand<br />
Schimpf die Situation der Niederschrift: »Stud. Habermaaß, der in<br />
Schreiner Zimmers Haus wohnte, machte mir u. Freund Keller Gelegenheit,<br />
den wahnsinnigen Dichter H. zu sehen u. zu sprechen, indem er<br />
denselben einlud, in Habermaaß Zimmer eines Nachmittags einen Kaffee<br />
mit uns zu trinken. Bei dieser Gelegenheit schrieb uns auf Ersuchen der<br />
unglückliche Dichter obige Verse ex tempore nieder«.<br />
3<br />
Geisterberuhigung: Maultrommel aus dem Besitz von Justinus Kerner<br />
– auf einem solchen Instrument spielte er in seiner Jugend, um die<br />
Insassen <strong>des</strong> Irrenhauses in Ludwigsburg zu besänftigen:<br />
Das Irrenhaus […] war meinem Schlafgemache so nahe, dass ich oft<br />
vor dem Singen, Lachen, Fluchen und Toben seiner armen Bewohner<br />
nicht in den Schlaf kommen konnte […]. Ich besuchte die Unglücklichen<br />
auch oftmals in ihren Zellen und wurde ihnen bald bekannt<br />
und freundlich. Das Spiel meiner Maultrommel machte bei vielen<br />
einen guten Eindruck, ich vermochte oft Tobende durch Worte und<br />
Anschauen zu besänftigen.<br />
Glaubt man Kerners Versen, dann hat die Maultrommel auch jenes Instrument<br />
ersetzt, mit dem David König Saul tröstete, wenn der »böse Geist«<br />
über ihn kam – die Harfe:<br />
War die Leier mir zersprungen,<br />
Hab’ ich mit dem kleinen Eisen<br />
<strong>Der</strong> Natur oft nachgesungen<br />
Ihre schmerzlich süßen Weisen.<br />
In die Töne, die es spielte,<br />
Hört’ ich oftmals übertragen,<br />
Was ich tief im Busen fühlte<br />
Und nicht konnt’ in Liedern sagen.<br />
M AGIE UND MATERIAL
4<br />
Austreibung: Das einzig erhaltene Rezept, das der Arzt Friedrich Schiller<br />
ausgestellt hat – ein hoch dosiertes Brechmittel. Schiller schreibt in einer<br />
Selbstrezension der Räuber, die er 1782 anonym und mit einem Motto<br />
von Hippokrates (»Was Medikamente nicht heilen, heilt das Eisen. / Was<br />
das Eisen nicht heilt, heilt das Feuer.«) veröffentlicht hat, über sich selbst:<br />
»Er soll ein Arzt bei einem wirtembergischen Grenadier-Bataillon sein […].<br />
So gewiss ich sein Werk verstehe, so muss er starke Dosen in Emeticis<br />
[Brechreiz Erregendem] eben so lieben als in Aestheticis, und ich möchte<br />
ihm lieber zehen Pferde als meine Frau zur Kur übergeben.«<br />
105<br />
5<br />
Ersessen: Buch, das Johann Kaspar Hagen, ein Schreiber im Gefolge<br />
<strong>des</strong> Prinzen Eugen, in seiner Satteltasche bei sich trug und mit zahlreichen<br />
Einträgen und Einlagen füllte, darunter das Calendarium Naturale<br />
Magicum, ein von Johann Baptista Großschedel 1614 zusammengestellten<br />
magischen Kalender. – Leihgabe: Werner Oechslin, Einsiedeln.<br />
W ERNER OECHSLIN<br />
Schon allein wegen <strong>des</strong> ungewöhnlichen Formates musste das Buch<br />
auffallen. Es fand sich – vor langer Zeit – inmitten der Beliebigkeiten<br />
eines Trödelmarktes, ein ›Satteltaschenbuch‹, weil es in das Gepäck<br />
<strong>des</strong>sen passt, der sich zu Pferd durch die Welt bewegt. Soweit die materiellen<br />
Bedingungen!<br />
Darin befindet sich handgeschrieben alles Nützliche und Notwendige, was<br />
im weitesten Sinne, geistig wie körperlich, den Lebensunterhalt garantiert<br />
– gerade dann, wenn man sich ein Leben lang in kriegerische Tätigkeit<br />
verstrickt zwischen Italien und dem Balkan bewegt, nur weil gerade Kaiser<br />
Karl VI. seinen Minister und Feldherrn Prinz Eugen zurückerobern lässt,<br />
was da so verloren gegangen war.<br />
Also beginnt das Buch mit den »Sententiae Morales«, »Historiae Sacrae«,<br />
»Flosculi Sacri« und »Epitaphia«. Denkwürdiges und Bedenkenswertes!<br />
Vom »tristo mondo« ist die Rede; und moralisierend steht da: »La morte è<br />
D I E BES E SSE N E N
106<br />
un vero rifugio«. Bei Seneca und natürlich bei der christlichen<br />
Glaubenslehre holt man Trost, was umgehend in der »Historia Sacra«<br />
beglaubigt wird.<br />
Doch dann folgt die äußere Wirklichkeit; das Itinerar beginnt mit<br />
der Geburt <strong>des</strong> »Joannes Casparus Hagen natus in Tegernsee« am<br />
23. Februar 1685, im gleichen Jahr wie Kaiser Karl VI., wie der Autor<br />
selbst andernorts betont. Nach Studien in München in den »Rudimenta«,<br />
der Grammatik und Syntax und danach in Salzburg in »Humanitas« und<br />
Rhetorik, Logik, Physik und Recht tritt er 1705 in Graz eine Stelle als<br />
»Musterschreiber« an. Und in dieser Funktion begleitet er nun die in Italien<br />
stehenden österreichischen Truppen, erlebt so die ersten Kampfhandlungen<br />
in Calcinato, dann im Mai 1706 die Belagerung von Carpi und Reggio<br />
und am 7. September die Schlacht von Turin. Danach geht es der Adriaküste<br />
und der alten Via Flaminia entlang bis nach Tivoli (»alla vista di<br />
Roma«). Johann Kaspar Hagen erlebt die Belagerungen von Gaeta und<br />
Capua und gelangt nach Neapel, von wo aus ihn dann die Unternehmungen<br />
nach Albanien und Dalmatien und bis nach Temeschwar im heutigen<br />
Rumänien führen und 1717 an der Eroberung der Festung von Belgrad<br />
teilnehmen lassen. Das Itinerar endet am 25. Juli 1728.<br />
Nein, das Tagesgeschäft im Kriegsgewimmel vertraut Hagen seiner Bibliothek<br />
nicht an. Es ist schon eher eine Ausnahme, wenn er die Heeresstärke<br />
– 23 460 Spanier gegen 26 000 Kaiserliche – für die für seine<br />
Seite wenig erfolgreichen Auseinandersetzungen in Sizilien in den Jahren<br />
1718 – 20 auflistet. In das Satteltaschenbuch gehören die gültigen Dinge.<br />
Man agiert im Rahmen einer Weltgeschichte. Geografie, Inschriften<br />
und Merkwürdigkeiten aller Art werden registriert und europaweit die<br />
Fürsten zwecks Übersicht von der Verteilung der Macht aufgelistet. Alles,<br />
was erhält und stärkt, das – u. a. aus Knoblauch gewonnene – »Balsamum<br />
mirabile« und was man bei drohender Pest zu sich nehmen soll, findet<br />
Berücksichtigung. Es fügt sich ein in jene Universalgeschichte, die mit<br />
Hinweisen illustriert wird, wonach der salomonische Tempel in 46 Jahren<br />
erbaut wurde und alle Götzenbilder beim Besuch Christi in Ägypten vom<br />
Sockel gestürzt seien.<br />
M AGIE UND MATERIAL
Wer so umfassend die Weltgeschichte angeht, wird auch darüber hinausgreifen<br />
wollen. Er muss das kleine menschliche Geschäft um die<br />
gültigen Einsichten und Erkenntnisse erweitern, wie sie kompakt und auf<br />
einen Blick erfassbar das Calendarium Naturale Magicum Perpetuum<br />
von Johann Baptista Großschedel wiedergibt – ein in drei Teile zerlegter<br />
ebenso berühmter wie seltener Stich, <strong>des</strong>sen 1614 verfasstes Original<br />
jüngst Carlos Gilly in der British Library wieder aufgefunden hat, der 1618<br />
von Johann Theodor de Bry gedruckt wurde. Lange mit Tycho Brahe<br />
direkt in Verbindung gebracht, ist dieses Calendarium das Werk <strong>des</strong><br />
durch anderweitige hermetische und alchemistische Schriften bekannten<br />
Großschedel. Es fasst das ›kabbalistische‹ Wissen der Zeit zusammen und<br />
bringt es in Figuren und Siegeln, Namenlisten und dergleichen zur Darstellung.<br />
Nur in wenigen Exemplaren bekannt ist diese »ancienne carte<br />
de Tycho Brahe« knapp 200 Jahre später in Brüssel auf Grund einer bei<br />
»van den Zande apoticaire« aufgefundenen Kopie neu bearbeitet und unter<br />
dem Titel Figure Théosophique et Cabalistique représentant la Création<br />
entière de l’Univers avec celle de tous les Etres, abgekürzt auch<br />
als Carte Philosophique, ediert und neu in eine Reihe von Moses und<br />
Zoroaster über Roger Bacon, Fludd und Kircher bis zu Boulainvilliers (!)<br />
gestellt worden.<br />
Göttliche und planetarische Vorstellungen und Engelshierarchien in einem,<br />
die geistigen Welten mit Albumasar (»Spiritus Sapientiae«), Pythagoras<br />
(»Spiritus Intelligentiae«), Plato (»Spiritus Scientiae«) und anderes mehr,<br />
fein zerlegt nach Archetyp, »mundus intelligibilis«, »mundus coelestis« und<br />
»mundus elementalis«, in Namen und Zeichen dargestellt, sollen den<br />
Menschen mit der größeren Welt zusammenbringen und dienen gleichzeitig<br />
der »contemplatio« und »cognitio«. Großschedel bedient sich der<br />
»compilatio« und »investigatio«, um die »magia naturalis« und deren Geheimnisse<br />
in kompakte Form zu bringen, so dass auch Schreiber Hagen in<br />
seinem unsteten Leben zwischen Italien und dem Balkan die gültige<br />
Weltsicht jederzeit zur Verfügung steht.<br />
107<br />
D I E BES E SSE N E N
108<br />
6<br />
Inbesitznahme: Ein 1505 in Frankreich gedrucktes Stundenbuch mit<br />
technisch reproduzierten Metallschnitt-lluminationen und eine nach dieser<br />
Vorlage um 1525 von Oudot Matuchet vermutlich in Dijon angefertigte<br />
Pergament-Handschrift. – Leihgabe: Heribert Tenschert, Ramsen. Die<br />
Handschrift wird aus Gründen der Marktpräsenz im Laufe der Ausstellung<br />
gegen eine Kopie ausgetauscht.<br />
H ERIBERT TENSCHERT<br />
Es handelt sich hier um den sehr seltenen Fall einer Übernahme (oder<br />
Kopie) der Formulierungen in einem jüngeren Medium (nämlich einem<br />
Druck bzw. in diesem Fall einem Metallschnitt) durch ein älteres Medium<br />
(nämlich die Gouache-Malereien in einer Handschrift) – normalerweise ist<br />
die umgekehrte Reihenfolge der Fall. Hier aber greift ein uns bekannter<br />
Buchmaler aus dem französischen Burgund, wohl Dijon, namens Oudot<br />
Matuchet um 1525 bei der Ausmalung eines Manuskripts auf Pergament<br />
mit 12 ganzseitigen Miniaturen ganz offensichtlich auf gedruckte Stundenbuchausgaben<br />
vom Beginn <strong>des</strong> Jahrhunderts, eventuell auch auf Einzelgrafik,<br />
zurück. Am eindeutigsten orientiert er sich an einer Metallschnittfolge<br />
nach Entwurf von Jean Pichore, wie sie hier in einer Ausgabe <strong>des</strong><br />
deutschstämmigen Drucker-Verlegers Thielmann Kerver vom 21. April<br />
1505 (»XI. Kalendas Maii.«) vorliegt. Aus dieser Folge kopiert Matuchet<br />
nicht weniger als fünf Schnitte: Verkündigung, Heimsuchung, Geburt<br />
(seitenverkehrt), Drei Könige, Darbringung im Tempel, wobei auch die<br />
Flucht nach Ägypten Ähnlichkeiten aufweist (siehe hier Abb. der Darbringung<br />
im Tempel in Metallschnitt und in Miniaturmalerei). Matuchet macht<br />
sich die Sache insofern leicht, als er nur auf die Personen im Vordergrund<br />
und deren Choreographie eingeht, während er Landschaft oder zusätzliche<br />
Personenstaffage im Hintergrund großflächig übermalt. Interessant,<br />
dass sich der Maler für die Wiedergabe der Trinität und Kirche fast sklavisch<br />
an die Darstellung aus der Folge eines anderen Druckers hält,<br />
nämlich die aus der Ausgabe von A. Verard vom 25. September 1504 nach<br />
dem Brauch von Tours (beide Ausgaben, die letztere unikal und sehr<br />
M AGIE UND MATERIAL
ähnlich illuminiert, sind ausführlich beschrieben in unserem Katalog<br />
HORAE B.M.V. II, der in sechs Bänden im Oktober/November 2014<br />
erscheinen wird). Von Oudot Matuchet ist bislang nur ein Manuskript<br />
bekannt: British Library Ms. Add. 31240, ihm ist ein ganzes Heft der<br />
Zeitschrift Art de l’Enluminure gewidmet 39 (2011/12).<br />
109<br />
7<br />
»Was war, was wird, was lebet«: Stammbuch, das Achim von Arnim aus<br />
einem historischen Gesellenbuch von 1583 mit vorgedruckten Spruchweisheiten<br />
und Einträgen zu seinem Lebensbuch umgenutzt hat, indem er<br />
es durch das Einbinden und Aufkleben neuer Blätter auf neun Zentimeter<br />
Höhe aufstockte. <strong>Der</strong> fast würfelförmige Buchblock birgt Widmungsblätter<br />
und Briefstücke von den Brüdern Grimm und den Geschwistern Brentano,<br />
Eichendorff, Tieck, Goethe, und Kleist, von Freunden, Verwandten,<br />
Lehrern und Besuchern aus drei Jahrzehnten sowie populäre Kunstdrucke,<br />
Radierungen von Rembrandt, Runge und Chodowiecki und<br />
Kupferstiche nach Dürer. Arnim liest immer wieder darin, kommentiert<br />
Einträge im Nachhinein (»Und was du ahndend hier geschrieben / Es hat<br />
sich schon an Dir erfüllt«) und fordert Augenblickszeugenschaft: »Ich<br />
En<strong>des</strong>unterschriebener bezeuge hiemit durch Ludwig Achim Arnim’s<br />
drey Minuten wiederholtes Magnetisiren in einen ungewöhn wogenden<br />
Zustan[d] versetzt worden und noch etwas närrisch dav[on] zu seyn«, lässt<br />
er 1801 Clemens Brentano hineinschreiben.<br />
8<br />
Allmählich unheimlich: Ausgedienter Turmhahn der Kirche in Cleversulzbach,<br />
den Eduard Mörike aufbewahrt und zwei Mal seine Geschichte<br />
selbst erzählen lässt, einmal in nur 22 Versen »Aus Gelegenheit der<br />
Kirchthurm-Renovation im Juli 1840«:<br />
D I E BES E SSE N E N
110<br />
Zu Klepperfeld im Unterland<br />
Wohl an die hundert Jahr ich stand,<br />
Auf dem Kirchenthurn ein guter Hahn,<br />
Als ein Zierath und Wetterfahn.<br />
In Sturm und Wind und Regennacht<br />
Hab ich allzeit das Dorf bewacht,<br />
Manch falber Blitz hat mich gestreift,<br />
<strong>Der</strong> Frost mein’ roten Kamm bereift,<br />
Auch manchen lieben Sommertag,<br />
Da man gern Schatten haben mag,<br />
Hat mir die Sonne unverwandt<br />
Auf meinen goldigen Leib gebrannt […].<br />
Und 1852 in der ausgearbeiteten Idylle <strong>Der</strong> alte Turmhahn:<br />
[…]<br />
Im Finstern wär ich denn allein.<br />
Das ist mir eben keine Pein.<br />
Ich hör in der Registratur<br />
Erst eine Weil die Totenuhr,<br />
Lache den Marder heimlich aus,<br />
<strong>Der</strong> scharrt sich müd am Hühnerhaus;<br />
Windweben um das Dächlein stieben;<br />
Ich höre, wie im Wald da drüben –<br />
Man heißet es im Vogeltrost –<br />
<strong>Der</strong> grimmig Winter sich erbost.<br />
[…]<br />
Im September 1866 ließ Mörike den Turmhahn fotografieren und verschenkte<br />
ihn so mehrfach. Seinem Verehrer Jean Grellet, der ihn 1870<br />
um ein Porträt-Foto gebeten hatte, schrieb er als Antwort: »Was meine<br />
Photographie betrifft so besitze ich leider selbst im Augenblick nicht<br />
M AGIE UND MATERIAL
ein einziges gutes Exemplar. Dagegen erlaube ich mir als Ersatz ein<br />
anderes Conterfei, – auch eine Art Persönlichkeit – beizufügen«.<br />
9<br />
Augensterne: Walter Benjamin schrieb seine Überlegungen zu »Was ist<br />
Aura?« auf einen Zettel mit roten Sternen – Werbung für San Pellegrino<br />
Mineralwasser und Grundlage <strong>des</strong> Essays Das Kunstwerk im Zeitalter<br />
seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936), in dem er die berühmteste<br />
Definition für das gegeben hat, was ein Original ist: »Aura ist Erscheinung<br />
einer Ferne so nah sie sein mag. Worte selbst haben ihre Aura;<br />
Kraus hat sie besonders genau beschrieben: ›Je näher man ein Wort<br />
ansieht, <strong>des</strong>to ferner blickt es zurück‹.« Benjamin leitet die Erfahrung der<br />
Aura aus »der Übertragung einer in der menschlichen Gesellschaft üblichen<br />
Reak tionsform auf das Verhältnis der Natur zum Menschen« ab.<br />
Wir stellen uns die Welt belebt vor, die toten Gegenstände besessen:<br />
111<br />
<strong>Der</strong> Angesehene oder angesehen sich Glaubende schlägt den Blick<br />
auf / erwidert mit einem Blick. Die Aura einer Erscheinung oder eines<br />
Wesens erfahren, heißt, ihres Vermögens inne werden, einen Blick<br />
aufzuschlagen / zu erwidern. Dieses Vermögen ist voller Poesie. Wo<br />
ein Mensch, ein Tier oder ein Unbeseeltes unter unserem Blick seinen<br />
eignen aufschlägt, zieht es uns zunächst in die Ferne, sein Blick<br />
träumt, zieht uns seinem Traume nach.<br />
Leihgabe: Walter Benjamin Archiv, Akademie der Künste, Berlin /<br />
Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, Blatt 1<br />
von 3 (Signatur: WBA 264/2). Das Original wird aus konservatorischen<br />
Gründen nach drei Monaten durch ein Faksimile ersetzt.<br />
D I E BES E SSE N E N
112<br />
10<br />
Heimlich: Eine Tjurunga aus Stein, ein Kultobjekt der Aborigines aus<br />
Zentralaustralien, das nur den Männern zugänglich ist, die in die geheimen<br />
Geschichten eingeweiht sind, die mit diesem Objekt und seiner mythischen<br />
Schöpferkraft verbunden werden (»secret-sacred«), und daher nur<br />
verhüllt ausgestellt werden darf. Die ausgestellte Tjurunga kam durch<br />
den Ethnologen und Missionar Carl Strehlow 1906 nach Deutschland. –<br />
Leihgabe: Institut für Ethnologie und Afrikastudien der Johannes Gutenberg-Universität<br />
Mainz.<br />
A NNE BRANDSTETTER<br />
Tjurunga sind flache, länglich-ovale Objekte aus Stein oder Holz, in<br />
die konzentrische Kreise, Spiralen, parallele Linien, Schlangenlinien oder<br />
Punkte eingraviert oder aufgemalt sind. Sie gelten als Verkörperungen der<br />
mythischen Schöpferwesen und deren Kraft. Man nahm an, dass jeder<br />
Mensch die Reinkarnation eines solchen mythischen Vorfahren ist, mit<br />
dem er durch seine persönliche Tjurunga verbunden ist. Tjurunga wurden<br />
an heiligen Orten verwahrt und durften nur von eingeweihten Männern<br />
gesehen werden.<br />
Die hier verborgene Tjurunga hat eine lange Reise hinter sich: aus einer<br />
heiligen Höhle in der Umgebung der ehemaligen Missionsstation Hermannsburg<br />
(heute: Ntaria) in Zentralaustralien über den Missionar Carl<br />
Strehlow ins Städtische Völkermuseum in Frankfurt am Main, 1913 weiter<br />
im Tausch an das Linden-Museum in Stuttgart und schließlich 1971<br />
ebenfalls im Tausch in die Ethnografische Studiensammlung der Universität<br />
Mainz. Wie bei einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde die<br />
Tjurunga auf diesem Weg immer wieder vermessen, fotografiert, beschrieben,<br />
nummeriert und ausgestellt. Einst war sie ein persönlicher<br />
Gegenstand einer Frau oder eines Mannes und verkörperte deren oder<br />
<strong>des</strong>sen mythischen Vorfahren. Jetzt ist sie ein ethnografisches Objekt und<br />
soll gleichzeitig für die historische Lebenswelt der Aranda oder gar der<br />
Aborigines allgemein stehen, aus der sie vor langer Zeit entfernt worden<br />
war.<br />
M AGIE UND MATERIAL
Besonders gegen das Ausstellen ihrer heiligen und geheimen Objekte<br />
begannen Vertreter von Aborigines-Gemeinschaften in den 1970er-Jahren<br />
zu protestieren. In der Folge vermeiden es Museen, diese Objekte zu<br />
zeigen. Aber verschleiern wir damit nicht den bürokratischen Akt der<br />
Musealisierung, der die Tjurunga längst allen Geheimen und Heiligen<br />
entledigte? Stilisieren sich die Kuratorinnen und Kuratoren damit nicht zu<br />
den neuen bürokratisch und moralisch legitimierten Eingeweihten? Befördern<br />
wir damit nicht vor allem die von uns geschaffene Aura der Tjurunga,<br />
indem wir sie vollends unnahbar machen, nachdem wir ihre Echtheit<br />
bereits durch unsere Provenienzforschung nachgewiesen haben? Oder ist<br />
das Verbergen der Tjurunga ein ›weißes Erlösungsritual‹, so der australische<br />
Ethnologie Philip Batty, das uns von der ›Schuld‹ an der Verfolgung<br />
der Aborigines und der Zerstörung ihrer Kultur ›reinigen‹ soll? – Lit.:<br />
http://tjurungashadow.blogspot.de/2011/05/practical-project-tjurungashadow_09.html<br />
(13. 8. 2014)<br />
113<br />
D I E BES E SSE N E N
Markt und Politik
G ELD<br />
Originale ziehen kriminelle Energien an. Nichts wird so oft gestohlen,<br />
versteckt und hinterzogen, gefälscht oder fälschungssicher gemacht. Und<br />
nichts wird so oft durch andere Mittel zu ersetzen versucht: Liebe. Wörter.<br />
Küsse. Kippen. Schoko lade. Sex. Gewalt. Geld.<br />
Geld ist der Nerv der Dinge und ihr verlässlicher Maßstab, wenn alle anderen<br />
versagen: Eine bloße Zahl gibt deren <strong>Wert</strong> an. Was ist uns die Rechnung<br />
von Schillers Sarg wert, wie viele Autos könnten wir mit einem Brief<br />
von Kafkas Hand kaufen? 2001 erzielte Jack Kerouacs On the Road<br />
1 782 160 Euro, 2008 André Bretons Manifeste du surréalisme 1 898 534<br />
Euro, 2014 Bob Dylans Song Like a Rolling Stone 1 504 772 Euro.<br />
2007 erwarb Amazon J.K. Rowlings Beedle the Bard für 2 709 910 Euro<br />
und 1994 Bill Gates für 22 625 900 Euro Leonardo da Vincis »Codex<br />
Leicester«. 2013 wurde der <strong>Wert</strong> eines Goethe-Zitats nach einer Auktion<br />
errechnet: »Es regnet gern wo es nass ist«, von ihm selbst auf ein<br />
Albumblatt geschrieben, brachte 2 800 Euro, ohne Aufgeld, also 400 Euro<br />
pro Buchstaben. <strong>Der</strong> Markt handelt mit Originalen und er verlangt nach<br />
ihnen, um der endlosen Zirkulation der Zahlen zu entkommen und etwas<br />
zu besitzen, was sich der Verflüssigung in Geld entzieht und mehr <strong>Wert</strong><br />
hat als seinen Preis.
4/I
4<br />
Brief von Cy Twombly an Heiner Bastian, 26. Juni 1973.
5<br />
Collage, zu der Justinus Kerner um 1850 auch eine Assignate verwendet hat.
Scheck, den Gottfried Benn für seine Geliebte, die Schauspielerin<br />
Ellinor Büller-Klinkowström, am 13. Juli 1931 ausgestellt hat.<br />
6
1<br />
2<br />
G ELD<br />
3<br />
1 Humboldt:<br />
Ausgeschnittene<br />
Unterschriften<br />
2 Rechnung für<br />
Schillers Sarg<br />
3 Kafka: Brief<br />
mit ausgeschnittener<br />
Marke<br />
7 Wagner:<br />
Schuldschein<br />
7
118<br />
1<br />
Inflationär: Ausgeschnittene Unterschriften von Alexander von Humboldt.<br />
Von 1950 bis 1985 wurden rund 1100 Humboldt-Autographen verkauft,<br />
nur 36 davon wurden jeweils auf über 1000 DM geschätzt. Ein zweiseitiger<br />
Brief von Humboldt an Heinrich Heine war 1979 17 000 DM wert.<br />
Nicht viel im Vergleich zu zwei Briefen von Johann Sebastian Bach<br />
(1961: 61 500 DM), Hölderlins Gedichthandschrift Archipelagus (1972:<br />
200 000 DM), einem Manuskript von Karl Marx (1977: 50 000 DM) oder<br />
einem Lutherbrief (1978: 110 000 DM). Mit Daniel Kehlmanns Roman<br />
Die Vermessung der Welt (2005) ist Humboldts <strong>Wert</strong> gestiegen: Die<br />
Stiftung Preußischer Kulturbesitz konnte Ende 2013 die neun ledergebundenen<br />
Tagebücher von Humboldts Amerika-Reise mit ihren knapp<br />
4000 Seiten erwerben – über die genaue, auf alle Fälle sechsstellige und<br />
über drei Millionen Euro hinausgehende Summe wird geschwiegen.<br />
2<br />
Rechnungen: 38 Reichstaler hat der »eichene Bohlen Sarg« gekostet,<br />
den der Tischlermeister Fleischhauer »vor den selichen verstorbenen<br />
Schiller« angefertigt hat, als <strong>des</strong>sen Gebeine 1827 in die Weimarer<br />
Fürstengruft überführt worden sind. Ernst Jünger hat das mit 10 DM<br />
aufgerufene Dokument 1953 zum Hammerpreis von 36 DM erworben.<br />
Ein Autograph <strong>des</strong> Dichters selbst ist selten und teuer, da Schiller<br />
seine Manuskripte meist vernichtet hat, sobald diese gedruckt vorlagen.<br />
Im 19. Jahrhundert hat man daher die wenigen Werk-Handschriften<br />
oft zerschnitten, um sie zu vermehren – oder gefälscht: 1856 wurde<br />
der Weimarer Architekt G. H. K. J. V. von Gerstenbergk für seine über<br />
400 Schiller-Fälschungen zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Auch ein<br />
2008 für Marbach erworbenes, auf 20 000 Euro angesetztes, lange<br />
verschollen geglaubtes Fragment <strong>des</strong> Tell ist Teil eines größeren, mit<br />
der Schere zerschnittenen Blatts: 13 Verszeilen und eine gestrichene Zeile<br />
aus einem Dialog zwischen Ulrich von Rudenz und seinem Onkel Attinghausen:<br />
M ARKT UND POLITIK
Indeß die edle Jugend rings umher<br />
Mit hohem Ruhm sich krönt, sich Land erwirbt,<br />
Sich Ehre sammelt unter Habsburgs Fahnen,<br />
Auf meinem Erb hier müßig still zu liegen,<br />
Und bei gemeinem Tagwerk den Lenz<br />
Des Lebens zu verlieren – Anderswo<br />
Geschehen Taten, eine Welt <strong>des</strong> Ruhms<br />
Bewegt sich glänzend jenseits dieser Berge, –<br />
Mir rosten in der Halle Helm und Schild,<br />
<strong>Der</strong> Kriegstrommete muthiges Getön,<br />
<strong>Der</strong> Heroldsruf, der zum Turniere ladet,<br />
Er dringt in diese Thäler nicht herein,<br />
Nichts als den Kuhreihn und der Heerdenglocken<br />
Einförmiges Geläut vernehm ich hier<br />
119<br />
Eine 2011 auf 150 000 Schweizer Franken geschätzte dreiseitige und<br />
nicht zerschnittene Reinschrift von Schillers Ode an die Freude hat<br />
letztlich eine halbe Million gekostet.<br />
3<br />
<strong>Wert</strong>verschiebung: Bei der Ankunft in Prag am 25. Oktober 1923<br />
gestempelter Umschlag eines Briefs, den Franz Kafka aus Berlin an<br />
Max Brod geschickt und an Martin Salvat adressiert hat, aus dem oben<br />
rechts ein Stück ausgeschnitten worden ist, vermutlich die deutsche<br />
Inflationsbriefmarke, deren Währung die »Papiermark« war, in den Inflationsjahren<br />
1919 – 23 das offizielle Zahlungsmittel der Weimarer Republik.<br />
Als im November 1923 ein US-Dollar 4,2 Billionen Mark kostete, wurde<br />
die Währung auf »Rentenmark« umgestellt, die private Immobilien zum<br />
Gegenwert hatte. Kafka fürchtete die Zerstörung <strong>des</strong> Umschlags im<br />
ursprünglich innenliegenden Brief von Anfang an: »ich vertraue meinen<br />
Worten und Briefen nicht, ich will mein Herz mit Menschen, aber nicht mit<br />
Gespenstern teilen, welche mit den Worten spielen und die Briefe mit<br />
G ELD
hängender Zunge lesen. Besonders Briefen vertraue ich nicht und es ist<br />
ein sonderbarer Glaube, daß es genügt, den Briefumschlag zuzukleben,<br />
um den Brief gesichert vor den Adressaten zu bringen.«<br />
120<br />
Daneben: 2014 durch einen Mäzen für 154 000 Euro für Marbach erworbener,<br />
am 11. September 1923 in Prag gestempelter Umschlag, aus dem<br />
etwas ausgerissen worden ist – der <strong>Wert</strong> wird heute durch den langen<br />
achtseitigen Brief bestimmt, in dem der wegen seiner fortschreitenden<br />
Tuberkulose-Erkrankung frühpensionierte und im tschechischen Planá bei<br />
seiner Schwester Ottla wohnende Kafka unter anderem seine Angst<br />
vor dem Nicht-Schlafen-Können schildert:<br />
Das Äußere eines solchen Zustan<strong>des</strong> muß ich nicht beschreiben, das<br />
kennst Du auch, doch mußt Du an das Höchstgesteigerte denken, was<br />
Du in Deiner Erfahrung hast, dort wo es sich schon danach umsieht,<br />
wie es umklappen könnte. Vor allem weiß ich, daß ich nicht werde<br />
schlafen können, der Schlafkraft wird das Herz herausgebissen, ja ich<br />
bin schon jetzt schlaflos, ich nehme die Schlaflosigkeit förmlich vorweg,<br />
ich leide, wie wenn ich schon die letzte Nacht schlaflos gewesen<br />
wäre. Ich gehe dann aus, kann an nichts anderes denken, nichts als<br />
eine ungeheuere Angst beschäftigt mich und in helleren Augenblicken<br />
noch die Angst vor dieser Angst.<br />
Das Auktionshaus publiziert auf seiner Homepage »starting price«<br />
(120 000 Euro) und »hammer price« (154 000, Euro plus Courtage):<br />
Um 34 000 Euro haben sich die Bieter für den eigenhändigen Brief mit<br />
Unterschrift »F« in die Höhe gesteigert. Bei der Erwerbung <strong>des</strong> nur halb<br />
so langen, vierseitigen »Mäuse-Angst-Briefs«, den Kafka 1917 an Brod<br />
geschickt hat, war die Differenz zwischen »starting price« und »hammer<br />
price« noch höher: 42 000 Euro und 96 000 Euro plus Courtage.<br />
1988 ersteigerte das Deutsche Literaturarchiv Marbach beim Londoner<br />
Auktionshaus Sotheby’s mithilfe der Bun<strong>des</strong>regierung, der Kulturstiftung<br />
M ARKT UND POLITIK
der Länder, <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Baden-Württemberg und von Privatpersonen<br />
für rund 3,5 Millionen DM das Manuskript zum Prozess, das mittlerweile<br />
auf 12 Millionen Euro geschätzt wird – eine Preissteigerung um nahezu<br />
das Siebenfache innerhalb von 26 Jahren.<br />
4<br />
<strong>Wert</strong>brief: Brief von einem mit schriftgleichen Bewegungen arbeiten-<br />
den Maler, für <strong>des</strong>sen Werke auf dem Kunstmarkt inzwischen bis zu<br />
15 Millionen Dollar bezahlt werden: Cy Twombly.<br />
121<br />
Als man in den 70er-Jahren <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts Cy Twombly »Gekrakel«<br />
vorwarf, verteidigte der französische Literaturwissenschaftler Roland<br />
Barthes ihn mit einem Argument aus dem Begriffsfeld <strong>des</strong> <strong>Originals</strong>:<br />
»<strong>Der</strong> Strich von Cy Twombly ist unnachahmlich. Versuchen Sie, ihn nachzuahmen:<br />
Was Sie machen, wird weder von ihm noch von Ihnen sein;<br />
es wird NICHTS sein.« – Leihgabe: Heiner Bastian, Berlin.<br />
H EINER BASTIAN<br />
»Dass es nur Kunst war, verdeckte die Kunst«<br />
(Ovid, Metamorphosen)<br />
<strong>Der</strong> Brief von Cy Twombly sagt, betrachte mich. Er sagt nicht, lies mich.<br />
Versuchst Du mich zu lesen, verstehe, die Zeichen, die Du entzifferst,<br />
sind ohne abschließenden Sinn: keine Aneignung, keine Aufhebung.<br />
Ich bin der Meridian eines Versprechens, das, wie immer Du es auslegen<br />
magst, im Sagbaren und Zeigbaren suspendiert ist.<br />
<strong>Der</strong> Brief von Cy Twombly ist das Anspielungsfeld der Schrift. Roland<br />
Barthes nennt, was Cy Twombly produziert, einen ›Effekt‹.<br />
Ich halte jedoch den Effekt (die Gestik) für das Imaginarium der körperund<br />
bildhaften Mimesis, die eben doch Signifikant und Signifikat besitzt.<br />
<strong>Der</strong> Brief sagt, ich bin eine Figur, aber in einem Sinn, den Du folgendermaßen<br />
deuten musst: Ich bin der Widerschein eines sinnlichen Verlangens,<br />
das ich hiermit fortgebe. In mir kannst Du die einstige Schönheit<br />
G ELD
auf dem Kap Sounion ermessen. Abende, die die Schatten der Pinien ins<br />
Meer stürzen. Du fin<strong>des</strong>t in mir die Erinnerung an Mallarmés »schweigende<br />
Chiffrierung«, Deine Phantasie.<br />
Ich bin die Antwort meines Briefes: wenn Du mich betrachtest, liest Du<br />
mich.<br />
122<br />
5<br />
Umwertung: Collage, zu der Justinus Kerner um 1850 auch eine Assignate<br />
verwendet hat, einen Geldschein, der in der Zeit der Französischen<br />
Revolution gedruckt und dann rasch an <strong>Wert</strong> verloren hat.<br />
»<strong>Der</strong> Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer«, hat Francisco de Goya<br />
eine 1799 veröffentlichte Radierung aus der Reihe seiner Caprichos<br />
betitelt. Kerner versammelt auf seiner Collage inflationäre Bilder aus<br />
dieser Traumzeit: einen Stich nach Johann Heinrich Füsslis <strong>Der</strong> Nachtmahr<br />
(1781), sieben seiner scharenweise angefertigten Klecksographien<br />
und jenen Revolutions- und Inflationsgeldschein, der die Allegorien der<br />
Gerechtigkeit und der Verfassung zeigt.<br />
6<br />
Tauschhandel: »1000 Küsse, Reichsmark keine«: Scheck, den Gottfried<br />
Benn für seine Geliebte, die Schauspielerin Ellinor Büller-Klinkowström,<br />
am 13. Juli 1931 ausgestellt hat, den sie nur bei ihm persönlich unter<br />
dem Kosenamen »Mohrchen« einlösen kann.<br />
7<br />
Schuldschein: Blatt, auf dem Richard Wagner am 2. April 1861 in Paris<br />
den Erhalt von 4000 Francs quittiert. Dass der Leihgeber »Ph. Sturmer«<br />
das Geld zurückbekommen hat, ist unwahrscheinlich. Sein Verleger<br />
Franz Schott bescheinigte dem ›Pump-Genie‹, dass <strong>des</strong>sen »Bedürfnisse<br />
[…] nur ein enorm reicher Bankier bestreiten [kann] oder ein Fürst, der<br />
über Millionen zu verfügen hat.« »Ich werde ewig ein Lump bleiben«,<br />
M ARKT UND POLITIK
gestand Wagner 1853 dem Freund und Finanzier Liszt und verrechnete<br />
1858 seinen Gegenwert: »Ich bin ein großer Verschwender; aber wahrlich,<br />
es kommt etwas dabei heraus.«<br />
123<br />
G ELD
GRUND<br />
Originale führen an den Ursprung der Dinge zurück. Sie haben Gründe<br />
und sie sind Gründe. Wer bauen will, muss an das Fundament denken<br />
und später an ein Dach. Dazwischen ergeben sich die Dinge fast von<br />
selbst. Ohne festen Grund wird alles andere instabil, gleichgültig, was<br />
einer schaffen will, Gesetze, Gedichte, politische Ordnungen, Krieg und<br />
Frieden.<br />
<strong>Der</strong> Grund ist dasjenige am Original, von dem sich alle anderen Sätze,<br />
Verse, Träger und Triftigkeiten ableiten. <strong>Der</strong> Grund macht den Boden<br />
der Dinge dicht gegen das Chaos, den Sumpf, das Unbewusste und die<br />
Stürme der Nacht. Er ist das große Incipit, das alles Frühere in den<br />
Hintergrund treten lässt. Er ist der Urakt der Autorität und der Autorschaft.<br />
Alles Folgende steht zur Diskussion; der Grund selbst bleibt der<br />
Verhandlung entzogen.
4/II
9<br />
Kissen von Sigmund Freuds Couch in London, das er aus Wien mitgebracht hat.
2<br />
Beschriebenes Bergahornblatt aus Peter Handkes Tagebuch<br />
»Terra rossa oder Die Wiederholung«, 1984.
»Ich kann nicht anders« – letzte Seite <strong>des</strong> verloren geglaubten Stichwortmanuskripts<br />
zu Max Webers Vortrag Politik als Beruf, 1919.<br />
7
1<br />
8<br />
3<br />
GRUND<br />
4<br />
5<br />
1 Hölderlin:<br />
Doppelblatt mit<br />
Wasserzeichen aus<br />
dem Hyperion<br />
3 Kant: Entwurf<br />
für Zum ewigen<br />
Frieden<br />
4 Abeken:<br />
»Emser Depesche«,<br />
ein Mitauslöser für<br />
den Deutsch-Französischen<br />
Krieg 1870<br />
5 Mommsen:<br />
»Politisches Testament«<br />
6 Faksimile <strong>des</strong><br />
Grundgesetzes aus<br />
dem Besitz von<br />
Heuss<br />
8 Heidegger: Brief<br />
an den Bruder nach<br />
dem Eintritt in die<br />
NSDAP<br />
10 Fichte: »Zufällige<br />
Gedanken einer<br />
schlaflosen Nacht«<br />
6<br />
10
126<br />
1<br />
Quelle: Von Autographensammlern in drei Teile zerschnittenes und<br />
nun wieder zuammengefügtes Doppelblatt aus der vorletzten Fassung von<br />
Friedrich Hölderlins Freitheitskampf-Roman Hyperion (1797/99) – das<br />
Wasserzeichen <strong>des</strong> aus Frankreich stammenden und seit etwa 1790 auch<br />
in Deutschland erhältlichen Papiers zeigt eine Jakobinermütze und die<br />
umlaufende Inschrift »PRO PATRIA LIBERTATE« (›für Vaterland und<br />
Freiheit‹), die auf Sallusts Bellum Catilinae anspielt: »Nos pro patria, pro<br />
libertate, pro vita certamus; illis supervacaneum est pugnare pro potentia<br />
paucorum« (›Wir kämpfen um Vaterland, um Freiheit, um Leben; jene<br />
drängt nichts, für die Macht einiger weniger zu kämpfen‹).<br />
Mit dem Papier hat man, wenn man es zuspitzen möchte, den ganzen<br />
Roman in nuce in der Hand. Das Papier ist die Quelle, der Ursprung, aus<br />
der Hölderlin ihn entwickelt: Es nennt den Grund, für den die Romanhelden<br />
kämpfen, und gibt den Verlauf <strong>des</strong> Romans vor, in dem sie enttäuscht<br />
erkennen, dass ihr Kampf um Gleichheit ein Kampf um Macht geworden<br />
ist.<br />
2<br />
Ursprung der Poesie: Beschriebenes Bergahornblatt, das Peter Handke<br />
zusammen mit einer Lindenblüte in seinem »Terra rossa oder Die Wiederholung«<br />
betitelten Tagebuch zu einem Eintrag vom 9. Juni 1984 gelegt<br />
hat: »Bei der Arbeit (Mähen) wurden das Rot <strong>des</strong> Rotdorn und das Rot der<br />
Blutbuche hinten eins.«<br />
Handke, der zu dieser Zeit in Salzburg wohnt, hat ein Jahr zuvor in der<br />
Kriminalerzählung <strong>Der</strong> Chinese <strong>des</strong> Schmerzes (1983) die Linde immer<br />
wieder dann auftauchen lassen, wenn die Hauptfigur Andreas Loser,<br />
ein Altphilologe, der in Vergils Lehrgedicht Georgica liest, seine Salzburger<br />
Umgebung genau anschaut und in ihr die Schönheit der antiken<br />
Poesie wiederfindet: »Die gelbe Fassade ist verkleidet mit einem leeren<br />
Spalier; hier sind früher die herzförmigen Marillen gewachsen. Das ganze<br />
M ARKT UND POLITIK
Haus wirkt, als sei es von woanders, aus einer Wohngegend der Stadt,<br />
oder aus einer Vorstadt, in das abgelegene Dorf versetzt worden. In dem<br />
Lorbeerbaum neben der Haustür, dunkles Grün mit lichtdurchschienenen<br />
Adern, hatten sich Lindenblüten und Ahornsporen, auch Spreu von den<br />
angrenzenden Äckern verfangen.« Das beschriebene Blatt ist ein Relikt<br />
aus dieser Welt der Literatur und ein Stück ihres Ursprungs.<br />
127<br />
3<br />
»Das, wodurch etwas anderes bestimmt gesetzt wird, ist Grund;<br />
durch die Folge wird ein Grund unbestimmt gesetzt«: Doppelblatt,<br />
auf dem Immanuel Kant den Anfang seiner 1795 publizierten kleinen<br />
Schrift Zum ewigen Frieden skizziert: »Über die Mißhelligkeit der<br />
Moral und der Politik in Absicht auf den ewigen Frieden«. Kant geht der<br />
Anfang leicht von der Hand, er gerät erst ins großräumige Einfügen<br />
und Streichen, als er an den ersten kritischen Punkt kommt, aus dem er<br />
die logische, aber positive Folge ziehen muss:<br />
<strong>Der</strong> Grenzgott der Moral weicht nicht dem Jupiter (dem Grenzgott der<br />
Gewalt); denn dieser steht noch unter dem Schicksal, d. i. die Vernunft<br />
ist nicht erleuchtet genug, die Reihe der vorherbestimmenden Ursachen<br />
zu übersehen, die den glücklichen oder schlimmen Erfolg aus<br />
dem Tun und Lassen der Menschen, nach dem Mechanism der Natur,<br />
mit Sicherheit vorher verkündigen (obgleich ihn dem Wunsche gemäß<br />
hoffen) lassen.<br />
Das lose Blatt kam aus Kants Nachlass in die Autographensammlung,<br />
die Goethe ab 1805/06 anlegte, um durch das Anschauen und Anfassen<br />
der Handschrift den »bedeutenden Männern« nahe zu sein. Auch in seiner<br />
Einschätzung Kants ist Goethe von der Material- und Ideenwirkung und<br />
nicht vom Wortsinn ausgegangen: »Kant«, so legt ihm Eckermann in den<br />
Mund, »ist der vorzüglichste, ohne allen Zweifel. Er ist auch derjenige,<br />
<strong>des</strong>sen Lehre sich fortwirkend erwiesen hat, und die in unsere deutsche<br />
G RUND
Kultur am tiefsten eingedrungen ist. Er hat auch auf Sie gewirkt, ohne<br />
dass Sie ihn gelesen haben. Jetzt brauchen Sie ihn nicht mehr, denn was<br />
er Ihnen geben konnte, besitzen Sie schon.« – Leihgabe: Goethe- und<br />
Schiller-Archiv Weimar, Klassik Stiftung Weimar.<br />
128<br />
M ANFRED GEIER<br />
Wie lässt sich mit guten Gründen weltweit ein wahrer, dauerhafter<br />
Frieden schaffen, der nicht nur ein vorübergehender Waffenstillstand ist?<br />
Das war Immanuel Kants großer Streitfall, für den er 1795 vor dem<br />
Gerichtshof der Vernunft eine originelle Lösung suchte. Andere Denker<br />
hatten ihm vorgearbeitet. Ihm waren Jean-Jacques Rousseaus Auszug<br />
(»Extrait«) und moralphilosophische Beurteilung (»Jugement«) <strong>des</strong> ›Projet<br />
de Paix Perpétuelle‹ <strong>des</strong> Abbé de Saint-Pierre bekannt, mit dem dieser<br />
frühe Kämpfer für die Aufklärung schon 1713 an die 24 christlichen<br />
Fürsten und Könige Europas appelliert hatte, im eigenen Interesse eine<br />
»Europäische Union« zu bilden. Denn schließlich sei es klüger, miteinander<br />
im Frieden zu überleben, als sich in gegenseitigen Kriegen zu vernichten.<br />
Kant ließ sich zwar durch Saint-Pierre und Rousseau anregen. Doch deren<br />
Schriften boten ihm keinen tragfähigen Grund, auf dem er seine eigenen<br />
Ideen entwickeln konnte. Als Vernunftphilosoph richtete er sich weder an<br />
lan<strong>des</strong>väterliche Machthaber, aus politischen Klugheitsgründen Frieden<br />
von oben durchzusetzen, noch konnte er sich wie Rousseau auf allgemeine<br />
ethische Tugendpflichten beziehen. Statt <strong>des</strong>sen orientierte sich sein<br />
philosophischer Entwurf Zum ewigen Frieden an einer Idee <strong>des</strong> Rechts in<br />
weltbürgerlicher Hinsicht: Es komme darauf an, einen völkerrechtlich<br />
gestifteten Friedenszustand zu denken und anzustreben, der auf einem<br />
Föderalismus freier Republiken gegründet sein müsse. Und nur, wenn<br />
die Politik sich dieser Idee <strong>des</strong> Rechts unterordne, sei wahrer Frieden<br />
möglich.<br />
M ARKT UND POLITIK
4<br />
Ein Auslöser für den Deutsch-Französischen Krieg 1870: Die an den<br />
preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck telegrafierte »Emser<br />
Depesche« vom 13. Juli 1870 im Entwurf seines engen Mitarbeiters<br />
Heinrich Abeken:<br />
S. M. d. König schreibt mir: [Graf] Benedetti fing mich auf der Promenade<br />
ab um auf zuletzt sehr zudringliche Art von mir zu verlangen,<br />
ich sollte ihn autorisiren, sofort zu telegraphiren, daß ich für alle<br />
Zukunft mich verpflichtete, niemals wieder meine Zustimmung zu<br />
geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Candidatur zurückkämen!<br />
Ich wies ihn, zuletzt, etwas ernst, zurück, da man à tout jamais dergleichen<br />
engagements nicht nehmen dürfe noch könne. – Natürlich sagte<br />
ich ihm, daß ich noch nichts erhalten hätte und da er über Paris und<br />
Madrid früher benachrichtigt sei als ich, er wohl einsähe, daß mein<br />
Gouvernement wiederum außer Spiel sei.<br />
S. Majestät hat seitdem ein Schreiben <strong>des</strong> Fürsten bekommen. Da<br />
S. Majestät dem Grafen Benedetti gesagt, daß er Nachricht vom<br />
Fürsten erwarte, hat Allerhöchstderselbe, mit Rücksicht auf die obige<br />
Zumuthung, auf <strong>des</strong> Grafen Eulenburg und meinen Vortrag, beschlossen,<br />
den Grafen Benedetti nicht mehr zu empfangen, sondern ihm<br />
nur durch einen Adjutanten sagen zu lassen: dass S. Majestät jetzt<br />
vom Fürsten die Bestätigung der Nachricht erhalten, die Benedetti aus<br />
Paris schon gehabt, und dem Botschafter nichts weiter zu sagen habe.<br />
S. Majestät stellt Eurer Exc. anheim, ob nicht die neue Forderung<br />
Benedettis und ihre Zurückweisung sogleich sowohl unsern Gesandten<br />
als in der Presse mitgeteilt werden sollte?<br />
129<br />
Bismarck hat das Telegramm gekürzt an die Presse gegeben:<br />
Nachdem die Nachrichten von der Entsagung <strong>des</strong> Erbprinzen von<br />
Hohenzollern der Kaiserlich Französischen Regierung von der Königlich<br />
Spanischen amtlich mitgeteilt worden sind, hat der Französische<br />
G RUND
130<br />
Botschafter in Ems an S. Maj. den König noch die Forderung gestellt,<br />
ihn zu autorisieren, daß er nach Paris telegraphiere, daß S. Maj. der<br />
König sich für alle Zukunft verpflichte, niemals wieder seine Zustimmung<br />
zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur wieder<br />
zurückkommen sollten. Seine Maj. der König hat es darauf abgelehnt,<br />
den Franz. Botschafter nochmals zu empfangen, und demselben durch<br />
den Adjutanten vom Dienst sagen lassen, daß S. Majestät dem Botschafter<br />
nichts weiter mitzuteilen habe.<br />
Am 19. Juli 1870 erklärte Kaiser Napoléon III. Preußen den Krieg.<br />
Leihgabe: Politisches Archiv <strong>des</strong> Auswärtiges Amts, das Blatt darf<br />
wegen seiner nationalen Bedeutung nicht ausgeliehen und nur als<br />
Faksimile gezeigt werden.<br />
5<br />
Gründungsschrift <strong>des</strong> so genannten »Verfassungspatriotismus«:<br />
1899, vier Jahre vor seinem Tod, verfasste der 82-jährige Historiker<br />
Theodor Mommsen sein »Politisches Testament« und unterzeichnete es<br />
im Ostseebad Heringsdorf am 2. September, dem Sedantag, an dem man<br />
zu Mommsens Ärger im Deutschen Kaiserreich die Kapitulation der<br />
Franzosen im Krieg von 1870/71 feierte:<br />
Ich ersuche die Meinigen nach meinem Tode das Erscheinen eingehender<br />
Lebensbeschreibungen nach Möglichkeit zu verhindern, insonderheit<br />
keine Papiere zu diesem Zweck auszuliefern. Ich habe in meinem<br />
Leben, trotz meiner äußeren Erfolge, nicht das Rechte erreicht. Äußerliche<br />
Zufälligkeiten haben mich unter die Historiker und die Philologen<br />
versetzt, obwohl meine Vorbildung und auch wohl meine Begabung<br />
für beide Disziplinen nicht ausreichte, und das schmerzliche Gefühl<br />
der Unzulänglichkeit meiner Leistungen, mehr zu scheinen als zu sein,<br />
hat mich durch mein Leben nie verlassen und soll in einer Biographie<br />
M ARKT UND POLITIK
weder verschleiert noch manifestiert werden. Es kommt dabei ein<br />
Zweites hinzu. Politische Stellung und politischen Einfluß habe ich nie<br />
gehabt und nie erstrebt; aber in meinem innersten Wesen, und ich<br />
meine, mit dem Besten was in mir ist, bin ich stets ein animal politicum<br />
gewesen und wünschte ein Bürger zu sein: Das ist nicht möglich in<br />
unserer Nation, bei der der Einzelne, auch der Beste, über den Dienst<br />
im Gliede und den politischen Fetischismus nicht hinauskommt.<br />
Diese innere Entzweiung mit dem Volke, dem ich angehöre, hat mich<br />
durchaus bestimmt mit meiner Persönlichkeit, soweit mir dies irgend<br />
möglich war, nicht vor das deutsche Publikum zu treten, vor dem mir<br />
die Achtung fehlt. Ich wünsche, daß auch nach meinem Tode dasselbe<br />
mit meiner Individualität sich nichts zu schaffen mache. Meine Bücher<br />
mag man lesen, solange sie eben dauern; was ich gewesen bin,<br />
oder hätte sein sollen, geht die Leute nichts an.<br />
Meine Briefschaften und sonstige Papiere sollen nach meinem Tode<br />
meinen Söhnen Karl und Ernst zur Sichtung übergeben werden, wobei<br />
sie meine Frau nach Ermessen zuziehen und ihre Wünsche berücksichtigen<br />
werden. Da ich nicht die Gewohnheit habe, empfangene<br />
Briefe zu kassieren, so wird bei weitem das Meiste sofort zu vernichten<br />
sein. Im übrigen steht es ihnen frei, was dazu sich eignet, selbst<br />
aufzubewahren oder anderen zu übergeben, jedoch immer unter<br />
Ausschluß der Publikation. Eventuell können sie auch, was sich dazu<br />
eignen sollte, einer öffentlichen Anstalt mit der Maßgabe, daß in den<br />
nächsten 30 Jahren die Papiere unter Verschluß bleiben, dann aber<br />
wie andere öffentliche Akten benutzt werden können, zum Eigentum<br />
übergeben. Hierdurch wird die entgegenstehende Bestimmung in<br />
§ 13 <strong>des</strong> Testament aufgehoben.<br />
131<br />
G USTAV SEIBT<br />
Mommsens Testament, das nicht sein letztes Wort an die Öffentlichkeit<br />
bleibt – 1902 erhält er »als der größte lebende Meister der Geschichtsschreibung<br />
in besonderer Anerkennung für seine monumentale<br />
G RUND
132<br />
Römische Geschichte« den Literaturnobelpreis –, wird 1948 das erste<br />
Mal vollständig veröffentlicht: in der von Dolf Sternberger, Alfred Weber,<br />
Karl Jaspers, Werner Krauss und Lambert Schneider in Heidelberg<br />
herausgegebenen Zeitschrift Die Wandlung. Sternberger leitet es der<br />
Jahre nach dem Ende <strong>des</strong> Zweiten Weltkriegs als Grundschrift <strong>des</strong><br />
20. Jahrhunderts ein: »Ich wollte, wir brächten heute zuwege, die alte<br />
Haut <strong>des</strong> bürgerlichen Charakters abzustreifen, um Bürger zu werden. Ich<br />
will kein Charakter sein, ich wünschte, ein Bürger zu sein. Nichts weiter.<br />
Aber auch nichts weniger als das.«<br />
»… in meinem innersten Wesen, und ich meine, mit dem Besten, was in<br />
mir ist, bin ich stets ein animal politicum gewesen und wünschte, ein<br />
Bürger zu sein.« In genau dieser Form, abgetrennt von seiner depressiven,<br />
ein Lebensscheitern behauptenden Textumgebung, erreichte mich zum<br />
ersten Mal Theodor Mommsens Testamentsklausel. Es war 1977, ich<br />
war Schüler auf einem altsprachlichen Gymnasium und las die von Karl<br />
Christ betreute dtv-Ausgabe von Mommsens Römischer Geschichte; dort<br />
fand ich im Nachwort den abgekürzten Satz. Zwar kam ich unzweifelbar<br />
aus bürgerlichen Verhältnissen – das Mobiliar unserer Berliner Großmutter<br />
stammte noch von ihren Eltern, es kam direkt aus Mommsens Welt –, und<br />
auch meine schulische Umgebung sprach dafür, ebenso wie der Umstand,<br />
dass ich Mommsens klassisches Werk durchlas. Aber niemand, schon<br />
gar kein Lehrer, sagte uns damals, im Jahr <strong>des</strong> ›Deutschen Herbsts‹,<br />
dass es etwas Wünschenswertes, etwas Großes sein könne, ein Bürger zu<br />
sein. Doch genauso wirkte dieser Satz: als Optativ, als stolzes Postulat,<br />
nicht als verzweifeltes Präteritum. <strong>Der</strong> Satz war hundertfach beglaubigt<br />
durch den Stil der tausend Seiten vor Christs Nachwort: Eine mitreißende<br />
Diktion von republikanischem Römergeist, gebrochen durchs nationale<br />
Prisma <strong>des</strong> 19. Jahrhunderts. Ich glaubte dem Satz aufs Wort und habe<br />
ihn nicht mehr vergessen. Später habe ich noch sehr viel antibürgerliche<br />
Literatur gelesen, wie es in meiner Generation unvermeidlich war,<br />
aber überzeugen konnte sie mich nicht. Mommsen hatte mich geimpft.<br />
M ARKT UND POLITIK
6<br />
Grundgesetz: Exemplar <strong>des</strong> am 23. Mai 1949 unterzeichneten Grundgesetzes,<br />
das Theodor Heuss, wichtiges Mitglied im Parlamentarischen<br />
Rat, als Faksimile erhalten hat.<br />
Auf das Original, das für die Öffentlichkeit uneinsehbar in einem Tresor im<br />
Deutschen Bun<strong>des</strong>tag aufbewahrt wird, werden die Bun<strong>des</strong>präsidenten,<br />
-kanzler und -minister vereidigt: »Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem<br />
Wohle <strong>des</strong> deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden<br />
von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong> wahren<br />
und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit<br />
gegen jedermann üben werde.« – Leihgabe: Familienarchiv Heuss,<br />
Basel / Stiftung Bun<strong>des</strong>präsident-Theodor-Heuss-Haus, Stuttgart. Das<br />
Original-Faksimile wird während der Ausstellung durch eine Kopie<br />
ersetzt, damit es im Heuss-Haus im Rahmen von Führungen durchgeblättert<br />
werden kann.<br />
133<br />
D IETER GRIMM<br />
Heute habe ich das Grundgesetz gesehen.<br />
Was soll daran mitteilenswert sein, werden Sie mich fragen. <strong>Der</strong> Mann<br />
war zwölf Jahre Bun<strong>des</strong>verfassungsrichter. Wenn er seine Arbeit ordentlich<br />
getan hat, hat er das Grundgesetz täglich gesehen, wollen wir<br />
doch hoffen. Und als Professor für Verfassungsrecht wird er es wohl<br />
immer noch oft sehen.<br />
Ja, so ist es. Ich habe drei Schreibtische, einen zu Hause, einen in der<br />
Humboldt-Universität und einen im Wissenschaftskolleg. Auf jedem liegt<br />
es. Na bitte, warum stiehlt er uns die Zeit mit solchen Selbstverständlichkeiten?<br />
Vielleicht erzählt er uns als Nächstes, er habe sich heute Morgen<br />
die Zähne geputzt.<br />
Es war anders. Ich bin heute in den Reichstag gegangen, um es zu sehen.<br />
Ich war schon oft im Reichstag, ohne das Grundgesetz dort gesehen zu<br />
haben. Diesmal lag es da, für mich aus einem Tresor geholt. Ich musste<br />
weiße Handschuhe anziehen, um darin blättern zu dürfen, passender:<br />
die Seiten umwenden zu dürfen.<br />
G RUND
134<br />
Es war anders. Es war das Original.<br />
Viele haben das Grundgesetz in Händen gehabt und darin gelesen,<br />
damit gearbeitet. Kaum einer hat das Original gesehen. Die wenigsten<br />
Bun<strong>des</strong>verfassungsrichter werden es gesehen haben, vielleicht kein<br />
einziger. Die amerikanische Verfassung liegt unter Panzerglas in den Na -<br />
tional Archives zur Besichtigung. Das deutsche Grundgesetz ist im<br />
Tresor verschlossen.<br />
Man braucht es ja nicht. Es ist wie mit dem Urmeter, das in Paris liegt,<br />
wie ich in der Schule gelernt habe, fasziniert, dass es ›das Meter‹ gibt,<br />
sichtbar, greifbar. Man braucht es nicht, um zuverlässige Zollstöcke<br />
herzustellen. Wir können korrekt messen, ohne überhaupt zu wissen,<br />
dass irgendwo das Urmeter liegt.<br />
Und man braucht das Original <strong>des</strong> Grundgesetzes nicht, um korrekte<br />
verfassungsrechtliche Urteile zu fällen, Urteile, ob der Bun<strong>des</strong>tag das<br />
Grundgesetz verletzt hat, als er das Luftsicherheitsgesetz verabschiedete,<br />
oder der Bun<strong>des</strong>präsident, als er den Bun<strong>des</strong>tag auflöste, oder die<br />
Bun<strong>des</strong>regierung, als sie Truppen nach Afghanistan entsandte.<br />
Es wäre sogar schädlich, wenn man sich zur Entscheidung solcher Fragen<br />
in den Reichstag begäbe um nachzuschauen, was das Original dazu sagt.<br />
So wie es vor mir lag und nur mit weißen Handschuhen angefasst werden<br />
durfte, ist es gar nicht mehr brauchbar. Denn es ist in den 65 Jahren<br />
seiner Geltung 59 Mal geändert worden.<br />
Das Urmeter ist noch immer das Urmeter. Das Grundgesetz ist nicht mehr<br />
das Grundgesetz. Es gilt zwar immer noch, aber sein Inhalt hat sich<br />
geändert. Wenn man heute wissen will, was die Verfassung verlangt, darf<br />
man nicht in das Original schauen. Wichtig ist, dass man die jetzt geltende<br />
Fassung hat. Von der gibt es kein Original.<br />
Aber man hätte keine Exemplare und keine aktuell geltenden Fassungen,<br />
wenn es nicht ein Original gäbe, wenn das, was heute gilt, nicht einmal in<br />
Geltung gesetzt worden wäre und wenn die Änderungen nicht aufgrund<br />
der Regelung vorgenommen worden wären, die das ursprüngliche Grundgesetz<br />
dafür vorschreibt.<br />
M ARKT UND POLITIK
Gut, das sehen wir ein. Alles muss einen Anfang haben. Aber warum so<br />
viel Aufhebens um die Besichtigung? Wo ist der Mehrwert gegenüber der<br />
Lektüre <strong>des</strong> aktuellen Textes?<br />
Schwer zu sagen. Es sieht schon anders aus als die gängigen Ausgaben<br />
mit ihrem engzeiligen Druck auf möglichst dünnem Papier. Man spürt<br />
etwas von der Bedeutung, die ihm von den Urhebern zugemessen wurde.<br />
Es ging nicht um die 27. Novelle zum Gewerbesteuergesetz. Es war ein<br />
Staatsgründungsakt.<br />
Es wird in einem eigens gefertigten Behältnis aufbewahrt und ist in Leder<br />
gebunden. Gedruckt ist es großzügig und auf kostbarem Papier, soweit es<br />
das in den Nachkriegsjahren gab. Die Artikelüberschriften sind in Rot<br />
gehalten, und das Initial der Präambel, das ›I‹ von »Im Bewußtsein« ist in<br />
Gold aufgetragen.<br />
Das Faksimile <strong>des</strong> <strong>Originals</strong>, welches man mir bei meinem Besuch im<br />
Reichstag geschenkt hat, zeigt ungeschönt die Fettflecken und Tintenkleckse,<br />
welche die Unterzeichner hinterlassen haben. Aber das goldene<br />
›I‹ ist nicht plastisch, golden zwar, aber nicht plastisch, kein gemaltes ›I‹,<br />
halt ein goldfarben gedrucktes ›I‹.<br />
Überhaupt die Unterschriften. Sie sind das <strong>Originals</strong>te an dem Original.<br />
Man kann sie naturgetreu reproduzieren. Das Faksimile zeigt es. Aber<br />
das Faksimile lag nicht vor den Vätern und Müttern <strong>des</strong> Grundgesetzes.<br />
Dort lag der Einmal-Druck, der erst durch ihre Unterschriften zum Original<br />
wurde und eben darin unersetzlich ist. Sie könnten die Unterschrift nicht<br />
wiederholen. Sie sind alle tot.<br />
Wissend, dass es das Original ist, liest man es auch anders. Man liest es<br />
nicht, um sich zu informieren, wie die Steuergelder zwischen Bund und<br />
Ländern verteilt werden. Man wird an den Ursprung erinnert. Man liest es<br />
mit einem Anhauch von Rührung. Das haben sie sich damals ausgedacht,<br />
um uns nach dem Zusammenbruch der Weimarer Republik, nach dem<br />
Nationalsozialismus und dem Krieg eine bessere Zukunft zu sichern.<br />
Und es gilt, länger als jede andere deutsche Verfassung. Es gilt zwar nicht<br />
mehr in dem ursprünglichen Wortlaut. Aber die Änderungen sind Änderun-<br />
135<br />
G RUND
136<br />
gen dieses Grundgesetzes, nicht immer neue Verfassungen. Wenn wir<br />
›Identität‹ nicht auf die Buchstaben beziehen, sondern auf den Geltungskern,<br />
steht es in der Kontinuität zum Gründungsakt.<br />
Die Geltung ist das Spezifische an einem juristischen Dokument wie dem<br />
Grundgesetz. Sie unterscheidet es von zahlreichen anderen Originalen,<br />
vom Originalrezept der Sachertorte, falls es das gibt, von dem Manuskript<br />
der Buddenbrooks, von der Originalpartitur <strong>des</strong> Fidelio, aber auch von<br />
Rechtstexten, die früher einmal galten, aber jetzt nicht mehr.<br />
Das Grundgesetz gilt jetzt. Dass es ›gilt‹, hat nichts mit der Materialität<br />
<strong>des</strong> bedruckten und gebundenen Papiers im Reichstag zu tun. Seine<br />
Geltung gehört in die Vorstellungswelt. Es gilt, weil es mit Geltungsanspruch<br />
versehen und in Kraft gesetzt wurde und weil wir es als geltend<br />
akzeptieren. Wir nehmen ihm den Anspruch ab. Wenn seine Geltung<br />
missachtet wird, reagieren wir.<br />
<strong>Der</strong> Text beglaubigt den Geltungsanspruch. Aber der Anspruch muss<br />
verwirklicht werden. Auch der Text der Paulskirchen-Verfassung von 1849<br />
beglaubigte die Geltung, und trotzdem galt sie nicht. König Friedrich<br />
Wilhelm IV., von <strong>des</strong>sen Bereitschaft, die Kaiserkrone anzunehmen und<br />
die Reichsverfassung anzuerkennen, ihre Geltung abhing, verweigerte<br />
sich.<br />
Ich nehme an, dass es einen Ort in Deutschland gibt, wo man die Paulskirchen-Verfassung<br />
anschauen und mit weißen Handschuhen vielleicht<br />
sogar anfassen darf. Aber man wird es im Wissen um ihr Schicksal<br />
schmerzlich tun, wie bei der Weimarer Verfassung von 1919, die zwar in<br />
Geltung trat, aber das Volk nicht einte, sondern spaltete. Mit dem Grundgesetz<br />
ist es anders.<br />
Die Bewährung schwingt mit, wenn man vor dem Original steht, obwohl<br />
das Original davon nichts wissen konnte, das Original als ein Druckwerk<br />
sowieso nicht, aber auch nicht die Unterzeichner und die Zeitgenossen,<br />
die darüber am nächsten Tag in der Zeitung lasen. Auch dass es gilt, sagt<br />
noch nicht viel, wenn man nicht weiß, ob und wie es wirkt.<br />
M ARKT UND POLITIK
7<br />
»Ich kann nicht anders«: Das 2010 zum Verkauf »im unteren sechsstelligen<br />
Bereich« angebotene, lange verloren geglaubte Stichwortmanuskript<br />
zu Max Webers Vortrag Politik als Beruf (1919), in dem er Verantwortung<br />
als letzten Grund <strong>des</strong> politischen Handelns beschreibt. Die acht Zettel<br />
versammeln über 1000 Stichwörter und enden:<br />
Nur bei voller Übersicht über<br />
Verantwortung<br />
an irgend einem Punkt:<br />
»ich kann nicht anders«<br />
– das erschütternd – u.<br />
menschlich echt.<br />
137<br />
In der gedruckten, 64 Seiten langen Fassung schließt Weber: »Nur wer<br />
sicher ist, daß er daran nicht zerbricht, wenn die Welt, von seinem Standpunkt<br />
aus gesehen, zu dumm oder zu gemein ist für das, was er ihr bieten<br />
will, daß er all dem gegenüber: ›dennoch!‹ zu sagen vermag, nur der hat<br />
den ›Beruf‹ zur Politik.« – Leihgabe: Heribert Tenschert, Ramsen.<br />
8<br />
Begründung: Brief, in dem Martin Heidegger seinem Bruder Fritz am<br />
4. Mai 1933 erklärt, warum er in die NSDAP eingetreten ist.<br />
U LRICH VON BÜLOW<br />
Unter dem Briefkopf der Freiburger Universität, deren Rektor er seit<br />
wenigen Tagen ist, teilt Martin Heidegger seinem Bruder Fritz in Meßkirch<br />
am 4. Mai 1933 bündig mit: »Ich bin gestern in die Partei eingetreten nicht<br />
nur aus innerer Überzeugung, sondern auch aus dem Bewusstsein, dass<br />
nur auf diesem Wege eine Läuterung und Klärung der ganzen Bewegung<br />
möglich ist.« Als hinge das Schicksal von Führer und Volk allein von ihm,<br />
dem Philosophie-Professor, ab! Realitätsverleugnung wird Programm,<br />
wenn er dem Bruder rät, er möge angesichts der »grossen Ziele« <strong>des</strong><br />
G RUND
138<br />
Führers »in keiner Weise darauf achten, was um Dich vorgeht an niedrigen<br />
und weniger erfreulichen Dingen.« Martin Heidegger schrieb 571 handschriftliche<br />
Briefe an seinen Bruder, nur für diesen benutzte er eine<br />
Maschine. Verlangte seine politische Entscheidung nach einer besonderen<br />
Form? Zwei Jahre später bringt er das Schreibgerät in Verbindung mit<br />
dem Wesen <strong>des</strong> Staates: »Worin besteht <strong>des</strong>sen Sein? Darin, daß die<br />
Staatspolizei einen Verdächtigen verhaftet, oder darin, daß im Reichsministerium<br />
so und so viele Schreibmaschinen klappern und Diktate von<br />
Staatssekretären und Ministerialräten aufnehmen?« (Einführung in die<br />
Metaphysik, Sommersemester 1935, Gesamtausgabe, Bd. 40, S. 38.) Die<br />
Schreibmaschine, so heißt es im Kriegswinter 1942/43, verberge »die<br />
Handschrift und damit den Charakter«, sie »entreißt die Schrift dem<br />
Wesensbereich der Hand, und d. h. <strong>des</strong> Wortes« und wird zum Sinnbild<br />
von Technik und Seinsvergessenheit. (Parmeni<strong>des</strong>, Wintersemester<br />
1942/43, GA 54, S. 119.) Als Heidegger im Mai 1933 selbst die Tasten<br />
schlug, mag er sich als Teil einer Maschinerie gefühlt haben, die dazu<br />
da ist, seinen Anordnungen zu folgen.<br />
9<br />
Legendärer Ort <strong>des</strong> Unbewussten: Original-Kissen von Sigmund<br />
Freuds Couch in London, die er aus Wien mitgebracht hat. – Leihgabe:<br />
Freud Museum London<br />
L ILIANE WEISSBERG<br />
Ein rosafarbenes Kissen: Es lädt ein, den Kopf darauf zu legen, zu<br />
schlafen, vielleicht sogar zu träumen. Dabei ist es nicht als Einladung zum<br />
Schlafen und Träumen gedacht. Man soll darauf ruhen, sich entspannen<br />
und einen bereits geträumten Traum zu Wort kommen lassen. <strong>Der</strong> Traum<br />
wird somit vom Schlaf getrennt. Er weist nicht mehr in die Zukunft, wie es<br />
in der griechischen Antike der Fall war; er ist auch keine Nebensächlichkeit<br />
mehr, die von einer aufgeklärten medizinischen Wissenschaft ignoriert<br />
werden kann. <strong>Der</strong> Traum, von dem auf diesem Kissen erzählt werden soll,<br />
ist etwas Anderes und Neues. Er ist der Königsweg zum Unbewussten<br />
M ARKT UND POLITIK
<strong>des</strong> Träumers – und das Kissen bürgt dafür, dass der Weg eingehalten<br />
werden kann.<br />
So steht das rosafarbene Kissen für eine Erinnerung, die den Traum in<br />
das Präsens überführt und nachträglich sprachlich konstituiert. Aber wie<br />
bei jedem Sprechakt gibt es nicht nur jemanden, der spricht, sondern<br />
jemanden, der zuhört. Wer spricht, hört sich selbst zu und ist bisweilen<br />
von den eigenen Worten überrascht, auch vom Traum, der nun Bedeutung<br />
annimmt. Es gibt noch einen zweiten Zuhörer, <strong>des</strong>sen Kopf nicht auf<br />
einem Kissen ruht, der zwar gegenwärtig ist, aber unsichtbar bleibt. Das<br />
Kissen ist eine Grenze zwischen der einst Träumenden und nun Erzählenden<br />
und diesem Anderen, der lediglich zuhört, selten spricht, sich Notizen<br />
macht und Theorien entwirft. Es ist der Traumdeuter, der sich nun als<br />
Therapeut und Arzt versteht.<br />
Das Kissen ist Teil einer medizinischen Ausstattung; es gehört zum<br />
Inventar der Psychoanalyse. Es liegt auf einer Couch für die Patienten.<br />
Hinter dem Kopfende der Couch befindet sich der Stuhl <strong>des</strong> Therapeuten.<br />
Dies ist die ärztliche Grundausstattung, das ›analytische Setting‹, das um<br />
die Wende zum 20. Jahrhundert Karriere gemacht hat. Sigmund Freud<br />
selbst beschrieb es 1913 in seiner Einleitung zur Behandlung und änderte<br />
in den folgenden Jahren nichts an diesem »Zeremoniell der Situation«.<br />
Dabei bedingen sich Couch und Stuhl, stehen für Patientin und Arzt.<br />
Dennoch findet im allgemeinen Denken eine metonymische Konzentration<br />
statt. Nur die Couch, nicht der Stuhl <strong>des</strong> Analytikers, wurde zum Sinnbild<br />
für die Psychoanalyse. Die Position der Patientin ist wichtiger als die <strong>des</strong><br />
Therapeuten, aber die Couch steht nicht nur für das Leid der träumenden<br />
Patientin, sondern auch für das geheimnisvolle Wissen <strong>des</strong> Arztes.<br />
Nicht nur das Unbewusste scheint sich in den freien Assoziationen und<br />
den Traumwiedergaben zu artikulieren. Die Couch selbst spricht.<br />
Und hier nun, in einem weiteren metonymischen Schritt, soll das rosafarbene<br />
Kissen für die Couch stehen. Diese Bildfindung geht von der<br />
Perspektive der Patientin aus, denn die Rolle <strong>des</strong> Psychoanalytikers ist<br />
eben paradox. <strong>Der</strong> Psychoanalytiker soll zuhören und heilen, aber gleich-<br />
139<br />
G RUND
140<br />
zeitig spricht die Patientin nicht nur, sie deutet auch. So war es nicht<br />
allein Freud, der die Psychoanalyse erfand, sondern auch seine Patientinnen<br />
und Patienten, welche die psychoanalytische Theorie entdeckten.<br />
Es waren Bertha Pappenheim, die »Anna O.« der Fallstudie, die für Freud<br />
und seinem älteren Kollegen Josef Breuer den Begriff der »talking cure«<br />
prägte, und Ida Bauer, jene »Dora«, die Freud nicht nur auf den bereits<br />
bekannten Prozess der Übertragung, sondern auch auf die Gegenübertragung<br />
aufmerksam machte. Freuds Patient Sergei Pankejeff, der »Wolfsmann«,<br />
erzählt in seinen Erinnerungen, wie sehr er an der Entwicklung der<br />
Psychoanalyse Freuds beteiligt war. So ist der Psychoanalytiker zwar ein<br />
Arzt, aber als solcher ebenso eine Hilfskraft. Die Hauptarbeit der Analyse<br />
geschieht auf der Couch, vielleicht auch durch die und dank der Couch.<br />
Die Couch als eine Art Ruhebett war bereits Jahrzehnte vor Freud in<br />
medizinischen Praxen üblich. Sie erleichterte die Untersuchung der<br />
Kranken. So gehörte die ärztliche Liege zur Einrichtung jeder gynäkologischen<br />
Praxis. Sanatorien hatten Liegehallen. Besonders Frauen wurden<br />
angehalten, sich bei Schwächeanfällen auf eine Liege oder eine Chaiselongue<br />
zu legen, denn die Ruhestellung <strong>des</strong> Körpers sollte der Normalisierung<br />
der Blutzirkulation entgegenkommen. Und ist ein rosafarbenes<br />
Kissen nicht gerade für Frauen gedacht? Tatsächlich sind die geschlechtsspezifischen<br />
Konnotationen nicht zu unterschätzen, gerade im Wohnbereich,<br />
wo seit dem 18. Jahrhundert Liege und ähnliche Möbelstücke an<br />
Popularität gewannen. Ende <strong>des</strong> 18. Jahrhunderts war das Sofa ein<br />
besonderes Mode- und Luxusstück. Gerade Frauen nahmen eher darauf<br />
Platz, da es auch ihren Kleidern mehr Raum bot, Männer saßen auf einem<br />
Stuhl, in aufrechter Haltung, während die Frau es sich etwas bequemer<br />
machen durfte und sollte. Gleichzeitig musste sie allerdings vorsichtig<br />
sein: <strong>Der</strong> Rocksaum durfte nicht verrutschen. Das Sitzen durfte nicht zu<br />
einem Liegen einladen, die Stellung nicht zu verführerisch wirken. Ein<br />
schwieriger Balanceakt! Auf dem bekannten Gemälde von Jacques-Louis<br />
David von 1800 kann Juliette Recamier auf der später nach ihr benannten<br />
Liege halb sitzend, halb liegend noch eine aristokratische Pose wahren.<br />
M ARKT UND POLITIK
Aber der durchsichtige Stoff <strong>des</strong> Klei<strong>des</strong> und die nackten Füße erinnern<br />
an manche Fotografien von Frauen zweifelhafter Herkunft, die hundert<br />
Jahre später zirkulierten. Den Kopf hält Madame Recamier allerdings<br />
aufrecht und dem Zuschauer bewusst zugewandt. Ein rosafarbenes<br />
Kissen benötigt sie nicht.<br />
Freud selbst wurde mit der therapeutischen Ruheliege in Paris vertraut, in<br />
der Praxis <strong>des</strong> Neurologen Jean-Martin Charcot, bei dem Freud einige<br />
Monate im Herbst und Winter 1885 zu Forschungszwecken verbrachte.<br />
Charcot hypnotisierte seine Patientinnen, die an Hysterie litten, und bat<br />
sie dazu, sich auf einer Liege auszustrecken. Nach Wien zurückgekehrt,<br />
übernahm Freud zunächst die von Charcot gelernte Hypnosetechnik. Seit<br />
1886 besaß er eine Ottomane ohne Lehne. Um die therapeutische Wirkung<br />
der Hypnose zu verstärken, versuchte Freud, einen Druck auf die<br />
Stirn der Patientin durch Handauflegen zu erzeugen; auch diese Technik<br />
wurde durch die liegende Position der Patientin erleichtert.<br />
Die Couch, die Kissen notwendig machte und zum Symbol der Psychoanalyse<br />
wurde, kam erst 1890 in Freuds Besitz. Freuds Frau Martha<br />
berichtet Jahre später, dass sie das Geschenk einer dankbaren Patientin,<br />
Madame Benvenisti, war. Doch diese Patientin konnte bis heute nicht<br />
nachgewiesen werden; Freud war allerdings mit einer wohlhabenden<br />
Familie Benvenisti, die sephardischen Ursprungs war, sehr gut bekannt,<br />
Freud traf sie auf Kur in Karlsbad und aß bei ihnen zu Mittag. Madame<br />
Benvenisti war wohl Mitglied der alteingesessenen türkisch-jüdischen<br />
Gemeinde in Wien und das Möbel, zunächst Diwan genannt, verwies auf<br />
die Schenkerin und war zudem im Wien der Jahrhundertwende modisch<br />
»le dernier cri«.<br />
Freud legte über die niedrige, 186 Zentimeter lange und 83 Zentimeter<br />
breite Couch einen türkischen Teppich, ein seltenes Stück aus Izmir,<br />
damals Smyrna, ein Qashqai Serkarlu. 1891 fand in Wien die erste größere<br />
Ausstellung orientalischer Teppiche statt. Die Stadt Wien, die ihre<br />
eigenen Erfahrungen mit dem osmanischen Reich gemacht hatte, wurde<br />
zu einem europäischen Zentrum <strong>des</strong> Orient-Teppichhandels. Für Freud,<br />
141<br />
G RUND
142<br />
<strong>des</strong>sen Vater Wollhändler war, hatten diese Teppiche vielleicht eine besondere<br />
Bedeutung. Er beließ es auch nicht beim Teppich. Um das Wohlbefinden<br />
seiner Klientel zu befördern, legte er zusätzlich Kissen ans Kopfende:<br />
viereckig und samten. Sie korrespondierten mit den gedeckten Farben<br />
<strong>des</strong> Teppichs. Nur das rosarote Kissen ist von länglicher Form; es ist<br />
ebenfalls einfarbig, greift aber das orientalische Muster <strong>des</strong> Teppichs auf.<br />
Zunächst wurde die Couch in der ersten Wohnung Freuds in der Berggasse<br />
19 aufgestellt, die sich noch unterhalb seiner späteren Wohnung<br />
und Praxis befand. Wahrscheinlich war es dort auch ein Wohnzimmermöbel,<br />
das erst langsam zum therapeutischen Möbel, zur psychoanalytischen<br />
Couch mutierte. Diese feste Bestimmung erhielt sie nach ihrem<br />
ersten Umzug in das zweite Obergeschoss, als Freud zwei Wohnungen als<br />
Privatwohnung und Praxis miteinander verbinden konnte. Nur selten<br />
benutze Freud das Möbel selbst. In einem Brief an Arnold Zweig vom März<br />
1938 gestand er allerdings, dass er nach einer quälenden Kieferoperation<br />
zwölf Tage lang mit Schmerzen und einer Wärmeflasche auf dieser Couch<br />
liegen musste, die doch für andere bestimmt war.<br />
Heute befindet sich in der Berggasse 19 das Sigmund Freud Museum.<br />
Das Zimmer, in dem sich die Praxis Freuds befand, ist leer geräumt.<br />
Freud war 1938 mit nahezu seinem ganzen Hausstand – inklusive Praxismobiliar<br />
und Antiquitätensammlung – nach London emigriert. Nach der<br />
Gründung <strong>des</strong> Wiener Museums im Jahre 1971 kehrten einige Gegenstände<br />
als Geschenke der Tochter Anna Freud nach Wien zurück, an ihren<br />
angestammten Ort. Vor allem historische Fotografien, die in den Räumen<br />
aufgestellt sind, evozieren den Eindruck, den Patienten wie Kollegen,<br />
Freunde, Familienmitglieder beim Besuch der Praxis hatten. Im Wiener<br />
Museum fehlt die Couch, jenes Teil <strong>des</strong> psychoanalytischen Mobiliars, das<br />
zum vielleicht berühmtesten Möbelstück an sich avancierte. Statt <strong>des</strong>sen<br />
offeriert Wien eine 1989 entstandene Liege <strong>des</strong> Künstlers Franz West,<br />
deren Eisenkonstruktion kaum zum Ruhen einlädt. Abweisend folgt sie<br />
gleichzeitig dem Profil <strong>des</strong> Freud’schen Möbelstücks. Sehr zur Enttäuschung<br />
der Wiener Besucher zeigt es die Psychoanalyse in ihrem bloßen<br />
M ARKT UND POLITIK
Schrecken, bar jeder anheimelnden Wirkung. Ein rosafarbenes Kissen<br />
fehlt.<br />
Ist Wests »Liège« auch bar jeglicher Ausstaffierung, so wirkt sie trotz<br />
ihrer festen Metallkonstruktion leicht und portabel. Tatsächlich gleicht sie<br />
den temporären Liegen, die Freud während seiner Aufenthalte in der<br />
Sommerfrische in Bad Aussee oder anderen Orten für seine Patienten<br />
aufstellen ließ. Die Freud’sche Couch hatte in diesen Wochen einen<br />
Doppelgänger, hier diente der Orientteppich auch als Camouflage, um<br />
die Mechanik der Liege zu verdecken.<br />
Als die Couch 1938 mit der Freud’schen Familie in die Emigration ging,<br />
war dieser Umzug teurer als ihr <strong>Wert</strong>. Die Couch selbst war von einfacher<br />
Konstruktion, aus keinem wertvollen Material und zu dieser Zeit ein halbes<br />
Jahrhundert alt. Doch sie besaß bereits mythische Bedeutung. Kurz vor<br />
Freuds Abreise konnte Edmund Engelman heimlich die von der Gestapo<br />
beobachtete Wohnung betreten und fotografierte die berühmten Räume<br />
für die Nachwelt. Selten ist nicht nur ein Arzt, sondern auch sein Mobiliar<br />
Geschichte geworden.<br />
Das Zimmer, in dem die Couch stand, war dunkelgrün tapeziert, die Tür<br />
schalldicht verstärkt. Wie eine Art Höhle bot diese Wohnzimmer-Praxis<br />
Schutz und Sicherheit vor jeglicher Ablenkung von außerhalb. <strong>Der</strong> Stuhl<br />
Freuds befand sich im rechten Winkel zur Couch. Auch für Freud war<br />
diese Aufstellung günstig, denn sie diente nicht nur der Konzentration der<br />
Patientin, sondern bot auch ihm selbst Schutz. So stellte Freud fest, dass<br />
er es wohl nicht aushalten könne, »acht Stunden jeden Tag (und mehr)«<br />
»angestarrt« zu werden. Auf der Couch sind auch Kissen zu sehen, neben<br />
solchen aus Samt auch jenes, das Freud mit einem Überzug versah, der<br />
leicht ausgetauscht werden konnte. Auch dieses Kissen war quadratisch<br />
und schien weiß bezogen gewesen zu sein.<br />
Anders sieht die Couch in London aus. Hier steht sie in einem weißen<br />
Raum, in einem Gartenzimmer. Nicht die Lithografie der ägyptischen<br />
Pyramiden hängt über ihr, wie noch in Wien, noch eine Bildersammlung<br />
irgendwelcher Art, lediglich ein einziges Bild der Klinik Charcots, das an<br />
den Ursprung der Liege und an Freuds Anfangsjahre erinnert.<br />
143<br />
G RUND
144<br />
Im weißen Raum ist die Couch also wieder ins Licht gerückt. Sie ist nicht<br />
mehr Therapiemöbel, sondern Ausstellungsobjekt und will angeschaut<br />
werden. Auf ihr ist nun kein weißes Kissen mit Wechselbezug mehr<br />
zuoberst platziert, dafür das rosa Kissen mit dem Orientmuster. Wie viele<br />
Menschen lagen wohl auf ihm, haben von ihren Träumen erzählt und sich<br />
dabei vor einem Zuhörer selbst zugehört?<br />
Als der Zustand der Couch vor zwei Jahren bedenklich wurde und ihr Alter<br />
deutlich sichtbar, wurde die Restaurierung beschlossen. Wie beim letzten<br />
Umzug sollten die Kosten wiederum den <strong>Wert</strong> der Couch übertreffen;<br />
sie wurden auf £ 5000 geschätzt. Aber es gingen Spenden aus allen<br />
Ländern ein, und Fachleute übernahmen das Wiederherstellen von Nähten,<br />
das Flicken der Leinenpolster und das Überprüfen <strong>des</strong> Rosshaars<br />
kostenlos. Anlässlich der Restaurierung entschied sich das Freud Museum<br />
London für etwas Ungewöhnliches: Es machte nicht nur die Couch,<br />
sondern auch ihre Wiederherstellung zum ›Ausstellungsobjekt‹. Zahlreiche<br />
Besucher waren seit September 2013 Zeuge der Arbeit am Möbel. Dabei<br />
konnten sie etwas sehen, das den Freud’schen Patientinnen und Patienten<br />
verborgen blieb: die nackte Couch.<br />
10<br />
Scheinbar grundlos: Blatt, auf dem Johann Gottlieb Fichte am 24. Juli<br />
1788 in seinem Geburtsort Rammenau »Zufällige Gedanken einer schlaflosen<br />
Nacht« aufgeschrieben hat und das Ernst Jünger zum 61. Geburtstag<br />
geschenkt worden ist.<br />
Sollte nicht der Hauptgrund unsers ganzen moralischen Verderbens –<br />
Verachtung <strong>des</strong> ehelichen Lebens von einer und die durch den Luxus,<br />
und andere unglükliche Beziehungen unsers Zeitalters verursachte<br />
Unmöglichkeit darein zu treten von der andern Seite, sein? – Hierdurch<br />
wird je<strong>des</strong> Individuum gleichsam isolirt, – alle edlere gesellige<br />
Empfindungen unterdrükt – Vaterlandsliebe, Menschenliebe, Mitleid –<br />
Lüderlichkeit befördert, besonders Verschwendung, weil es der<br />
M ARKT UND POLITIK
HauptZwek eines jeden werden muß nur auf die Tage seines Lebens<br />
recht viel zu genießen, so viel an sich zu reißen als er kann. – Daher<br />
Verachtung, u. eben dadurch Verderbung <strong>des</strong> weiblichen Geschlechts<br />
– (dieser ist nicht entgegen der galante Ton gegen dieses Geschlecht<br />
– er am meisten zeigt es eben an, wie sehr wir sie verachten.) Tirannei<br />
der höheren, u. Unterdrükung der niedrigern, besonders <strong>des</strong> landbauenden<br />
Stan<strong>des</strong> (weil durch Lüderlichkeit jede menschenfreundliche<br />
Neigung unterdrükt ist –) Sultanism der Regenten, unnatürliche Laster,<br />
Entkräftung <strong>des</strong> ganzen Geschlechts, Elend, u. Untergang – Entsteht<br />
ein solcher Ton bei einem vorzüglich verfeinerten Volke, so entspringt<br />
daraus der verdrehte, widersprechende Charakter, daß Einsichten<br />
mit dem Herzen und den Sitten in ewigem Widerspruch liegt, und daß<br />
die Dekrete <strong>des</strong> Verstan<strong>des</strong> endlich nichts werden, als ein leerer<br />
Wortschall. […]<br />
145<br />
Ein Jahr vor dem Beginn der Französischen Revolution bringt der Nachhilfe-<br />
und Hauslehrer Fichte einen seiner frühesten erhaltenen Texte zu<br />
Papier. <strong>Der</strong> hier so explizit in seiner Abwesenheit thematisierte Schlaf und<br />
das an seine Stelle getretene Schreiben, der Traum und das Unbewusste<br />
sind Voraussetzungen seiner Philosophie: »Das Anschauen ist der Traum;<br />
das Denken […] ist der Traum von jenem Traume«. Denn »der Charakter<br />
unserer Träume bleibt ein weit treuerer Spiegel unserer Gesamtstimmung,<br />
als was wir davon durch die Selbstbeobachtung <strong>des</strong> Wachens erfahren.«<br />
G RUND
Unsichtbar
Originale können auch unsichtbar sein. Gelegentlich lenken sie den<br />
Gang der Welt, der Märkte, der Geschichte und unseres Denkens sogar<br />
anhaltender und wirkungsvoller als die sichtbaren. Die Gründe ihrer<br />
Unsichtbarkeit sind so zahlreich wie die ihrer Existenz: Sie können zeitweise<br />
oder für immer verschwunden, vernichtet und verloren, wegen<br />
historischer oder moralischer Obszönität verborgen sein. Sie können ein<br />
gut geglaubtes Gerücht oder vollständige Erfindung sein, sie mögen<br />
nie existiert haben. Sie können so wertvoll und einzigartig, so originär<br />
sein, dass sie jeder profanen Besichtigung entzogen sind. Vom musealen<br />
Tausch- und Leihverkehr ganz zu schweigen. Dennoch üben sie einen<br />
starken Zauber auf unsere Vorstellungskraft und unsere Träume aus.<br />
Vielleicht weil eine geheime Ähnlichkeit sie mit diesen verbindet: Außer für<br />
den Träumenden bleiben auch Träume unsichtbar, und jeder ist für sich<br />
ein Original.
5
DER HEILIGE GRAL<br />
Vertrocknete Fledermaus, die Ernst Jünger am 11. Juni 1940 in<br />
der Kathedrale von Laon gefunden hat.
MARCEL DUCHAMPS FOUNTAIN<br />
Eine von Marcel Duchamps Schachspielszenen für Hans Richters Film 8x8.<br />
A Chess Sonata in 8 Movements, 1957.
DER MERCEDES W 14 0,<br />
IN DEM LADY DI VERUNGLÜCKTE<br />
Fotos von Dolfs Sternbergers Merce<strong>des</strong>, mit dem er am 1. November 1952<br />
gegen 23.30 Uhr frontal in einen Lastwagen gefahren war.
HITLERS SCHÄDEL<br />
Betonstück aus dem »Führerhauptquartier« Wolfsschanze,<br />
gesprengt von der Roten Armee am 24. Januar 1945.
Kafka: Zeichnung in<br />
Leonardo da Vincis<br />
Manier<br />
Kleist: Foto eines<br />
verschollenen Manuskripts<br />
Grabstein der Lola<br />
Montez<br />
Kafka: Umschlag<br />
eines Briefs an<br />
Felice Bauer<br />
Umschlag, in dem<br />
Adorno Benjamins<br />
Berliner Kindheit<br />
verschickte<br />
Rosenberg:<br />
Mythus <strong>des</strong><br />
20. Jahrhunderts<br />
aus der Bibliothek<br />
von Georg Lukacs<br />
Koselleck: Einsteins<br />
Relativitätsformel<br />
Schiller: Locke mit<br />
Echtheitszeugnis
150<br />
<strong>Der</strong> Heilige Gral. Seit dem späten 12. Jahrhundert suchen Könige und<br />
Glücksritter nach etwas, von dem sie nicht wissen, was es genau ist.<br />
Vielleicht ein Kelch, eine Schale oder auch ein Stein. Vielleicht hat Jesus<br />
beim letzten Abendmahl daraus getrunken oder man hat damit das Blut<br />
<strong>des</strong> Gekreuzigten aufgefangen. Vielleicht hat Moses die zehn Gebote<br />
darin aufbewahrt und der Gral ist identisch mit der biblischen Bun<strong>des</strong>lade.<br />
So unklar der Gegenstand, so gewiss seine Gaben. Wer ihn findet, dem<br />
wird das Paradies geschenkt: Glückseligkeit und Unsterblichkeit, ewige<br />
Speise und Trank. Wolfram von Eschenbachs Parzival findet den Gral auf<br />
der Gralsburg in den Händen einer jungfräulichen Königin: »Auf grünseidnem<br />
Achmardi / Trug sie <strong>des</strong> Paradieses Fülle, / So den Kern wie die<br />
Hülle. / Das war ein Ding, das hieß der Gral, / Ird’schen Segens vollster<br />
Strahl. / Repanse de Schoie hieß, / Von der der Gral sich tragen ließ. /<br />
<strong>Der</strong> Gral war von solcher Art: / Sie hat das Herz sich rein bewahrt, / <strong>Der</strong><br />
man gönnt <strong>des</strong> Grals zu pflegen: / Sie durfte keine Falschheit hegen.«<br />
Vermutet hat man den Heiligen Gral beispielsweise in England, in Glastonbury,<br />
Winchester und Cornwall, in Schottland, den französischen und<br />
spanischen Pyrenäen, auf der Burg Wildenberg im Odenwald, in der<br />
Schatzkammer der Wiener Hofburg, der Basilika im kastilischen Léon und<br />
der Kathedrale im nordfranzösischen Laon. Richard Wagner soll ihn<br />
gesehen haben, bevor er seinen Parsifal komponierte, in dem der Eremit<br />
die Frage nach dem Gral so beantwortet: »Das sagt sich nicht; / doch,<br />
bist du selbst zu ihm erkoren, / bleibt dir die Kunde unverloren.« Heinrich<br />
Himmler hat den mit Ernst Jüngers Freund Friedrich Hielscher bekannten<br />
Archäologen Otto Rahn beauftragt, nach dem Gral zu suchen, und geglaubt,<br />
ihn 1940 im katalonischen Kloster Montserrat gefunden zu haben.<br />
<strong>Der</strong> Titelheld von Steven Spielbergs Film Indiana Jones und der letzte<br />
Kreuzzug lässt den Gral in einen Abgrund fallen, um sein eigenes Leben<br />
zu retten. Für Robert Langdon in Dan Browns Roman Sakrileg ist der<br />
Gral der Schlüssel zum Da Vinci Code. Rund 200 Heilige Grale hat man<br />
inzwischen identifiziert, ohne zu wissen, ob der echte darunter ist.<br />
U NSICHTBAR
Ausgestellt: Vertrocknete Fledermaus, die Ernst Jünger am 11. Juni<br />
1940 aus der Kathedrale im nordfranzösischen Laon mitgenommen<br />
hat, in der ebenfalls der Heiligen Gral vermutet wurde. Im 1942<br />
erstmals veröffentlichten Tagebuch Gärten und Straßen heißt es: »Wieder<br />
in der Kathedrale, diesmal in den Grüften […], dann in den Spindeln der<br />
Seitentürme und auf den Emporen, von deren Höhe der Blick immer neue<br />
Geheimnisse erfaßt. Bei diesem Gang ergriff mich vor allem die unerbittliche<br />
Solidität <strong>des</strong> Werkes, die eine bessere Ausführung undenkbar macht.<br />
Dazu die fürchterliche Kraft <strong>des</strong> Planes, der, selbst fast jenseits der Zeit,<br />
Generationen fronen läßt. Auf einer der Emporen fand ich eine winzige<br />
vertrocknete Fledermaus und hob sie zur Erinnerung auf.« In den Marmorklippen<br />
(1939) schreibt Jünger über die Figur <strong>des</strong> Oberförsters, einer<br />
Hitler-Persiflage: »Ihm ging erst das Herz auf, wenn auf den Trümmern<br />
der Städte Moos und Efeu grünten und wenn in den geborstenen Kreuzgewölben<br />
der Dome die Fledermaus im Mondschein flatterte.«<br />
151<br />
Die Mona Lisa. Das berühmteste aller Originale hängt seit dem Ende<br />
<strong>des</strong> 18. Jahrhunderts im Pariser Louvre und ist 77 Zentimeter hoch und<br />
53 Zentimeter breit. Gemalt hat es Leonardo da Vinci auf dünnem<br />
Pappelholz, wahrscheinlich zwischen 1502 und 1506. So rätselhaft wie<br />
das Lächeln der Dame ist das ganze Bild. Echt oder nicht echt? Eines von<br />
vielen oder einzigartig? Inbegriff eines sichtbar unsichtbaren Meisterwerks?<br />
Wen Leonardo porträtiert hat, ist strittig: die Florentiner Kaufmannsgattin<br />
Lisa del Gioconda, die Medici-Geliebte Pacifica Brandani,<br />
die Adelstöchter Isabella von Aragonien, Caterina Sforza oder Isabella<br />
d’Este oder seinen Lebensgefährten Andrea Salaino Florentine, genannt<br />
»il Salaí«, ›die Ausgeburt <strong>des</strong> Teufels‹. Anders als bei Albrecht Dürers<br />
Feldhase, der nur zwei Mal in fünf Jahren im Original gezeigt werden darf<br />
und ansonsten in der Wiener Albertina als Faksimile hängt, kann sich<br />
keiner der 15 000 Besucher, die sie im Schnitt an einem Tag anschauen,<br />
sicher sein, ob er tatsächlich hinter dem spiegelnden Panzerglas das
152<br />
Original sieht. Wird das Bild für Forschungszwecke entnommen, so<br />
tauscht der Louvre es stillschweigend gegen eine Kopie aus.<br />
Als die Mona Lisa am 21. August 1911 gestohlen worden ist, ging das<br />
Foto von der leeren Museumswand um die Welt. <strong>Der</strong> Maler Louis Béroud<br />
hatte damals die vier bewachten Haken als Erster entdeckt, an denen<br />
nichts mehr hing, als er zum Kopieren <strong>des</strong> Gemäl<strong>des</strong> in den Saal kam.<br />
Am 9. September besuchten Max Brod und Franz Kafka in Paris mit<br />
anderen zahlreichen Schaulustigen die »unsichtbare Sehenswürdigkeit«:<br />
»Gedränge im Salon Carre, erregte Stimmung, gruppenweises Stehn<br />
wie wenn die Mona Lisa gerade gestohlen worden wäre«, notierte Kafka<br />
in sein Tagebuch, und Brod hielt fest: »Natürlich fehlt sie nicht, die man<br />
jetzt auf allen Reklamen, Bonbonnièren, Ansichtskarten in Paris sieht:<br />
Mona Lisa.«<br />
Das Original, so erzählt es die erfundene Kunsthistorikerin Deborah Dixon<br />
2011 in <strong>Der</strong> Mona Lisa Schwindel, soll danach nie mehr zurück in den<br />
Louvre gekommen sein, sondern nur eine von vier Kopien: »Diese Geschichte<br />
ist wahr. Ich wollte, sie wäre es nicht, und wahrscheinlich würden<br />
auch manche Leser es vorziehen, an eine erfundene Romanhandlung zu<br />
glauben. So viele zerstörte Illusionen, ein so unerbittlicher Hass und nicht<br />
zuletzt diese vergeudeten Millionen – es wäre wirklich besser, es handelte<br />
sich nur um einen Roman.«<br />
Die Mona Lisa ist nicht nur das Kunstwerk, das am meisten vervielfältigt,<br />
kopiert und zitiert worden ist. Die Forschung entdeckt immer wieder neue,<br />
echte Zwillingsbilder: 2011 eine wohl in Leonardos Werkstatt hergestellte<br />
Kopie, die im Madrider Prado hängt, 2012 die auf einem englischen<br />
Landsitz gefundene »Mona Lisa von Isleworth«, die Leonardo selbst zehn<br />
Jahre vor der auf Holz gemalten Mona Lisa auf Leinwand gemalt haben<br />
soll. Die Wirkung <strong>des</strong> Bil<strong>des</strong> im Louvre wird dadurch nicht kleiner. Im<br />
Gegenteil.<br />
Ausgestellt: Frauenkopf und Pferdebein, von Franz Kafka wohl<br />
1911 in Paris in Leonardo da Vincis Manier mit Bleistift gezeichnet.<br />
U NSICHTBAR
<strong>Der</strong> autobiografische Roman, den Heinrich von Kleist geschrieben<br />
haben soll. Majorssohn, Kindersoldat, Gardeleutnant, Student, Beamter,<br />
Partisan und Bauer, Meister der gewaltigen Metaphern und der auf Biegen<br />
und Brechen gespannten Sätze: »Die Welt, die ganze Masse von Objekten,<br />
die auf die Sinne wirken, hält und regiert, an tausend und wieder<br />
tausend Fäden, das junge, die Erde begrüßende, Kind. […] Aber das Kind<br />
ist kein Wachs, das sich, in eines Menschen Händen, zu einer beliebigen<br />
Gestalt kneten lässt; es lebt, es ist frei; es trägt ein unabhängiges und<br />
eigentümliches Vermögen der Entwicklung, und das Muster aller innerlichen<br />
Gestaltung, in sich.«<br />
Vielleicht hat Kleist diesen Musterbogen, diese Macht <strong>des</strong> eigenen<br />
Willens, die er 1810 – ein Jahr vor seinem Freitod am Wannsee – in einem<br />
»allerneuesten Erziehungsplan« proklamiert, in jenem Roman beschrieben,<br />
den er im Herbst 1803 zusammen mit dem nahezu fertigen Manuskript<br />
seines Trauerspiels Robert Guiskard in Paris verbrannt haben soll.<br />
Wir wissen es nicht. Nicht viel mehr ist überliefert als die Nachricht an die<br />
Schwester Ulrike: »Ich habe in Paris mein Werk, so weit es fertig war,<br />
durchlesen, verworfen, und verbrannt: und nun ist es aus. <strong>Der</strong> Himmel<br />
versagt mir den Ruhm. Das größte der Güter der Erde; ich werfe ihm, wie<br />
ein eigensinniges Kind, alles übrige hin.«<br />
Kleists autobiografischer Roman, den es möglicherweise, aber eben<br />
nicht sicher gegeben hat, gehört in die Reihe der verschollenen Manuskripte,<br />
die nur durch Augenzeugen und Selbstbekundungen und manches<br />
Mal auch durch einen Vorabdruck überliefert sind. De Sade hat die<br />
6000 Seiten seines letzten Romans Les Journées de Florbell eigenhändig<br />
im Hof der Anstalt von Charenton verbrannt. Nikolai Gogol hat in<br />
Rom die Fortsetzung der Toten Seelen ins Feuer geworfen, Lord Byron<br />
wie Kleist einen autobiografische Roman. Clemens, das von Thomas<br />
Mann satz fertigredigierte 1 200-Seiten-Manuskript eines Romans von<br />
Joseph Breitbach, wurde 1941 in Paris von der Gestapo beschlagnahmt,<br />
Andrei Platonows Reise aus Moskau nach St. Petersburg 1943 vom<br />
KGB vernichtet. Andere mögen sich noch finden. Franz Kafkas Prosa-<br />
153
sammlung von 1903, Das Kind und die Stadt, zum Beispiel, oder die<br />
ersten Romane von Hermann Hesse und Henry Miller, Schweinigel und<br />
Clipped Wings. T. E. Lawrence hat die erste Fassung seiner Sieben<br />
Säulen der Weisheit 1919 beim Umsteigen auf dem Bahnhof Reading<br />
verloren.<br />
154<br />
Ausgestellt: Von der Staatsbibliothek Berlin 1905 angefertigtes<br />
Foto einer Seite aus dem seit dem Zweiten Weltkrieg verschollenen<br />
Kleist-Manuskript Aphoristische Gedanken über die Rettung der<br />
öster reichischen Staaten (1809), vom Kleistforscher Paul Hoffmann<br />
(1866 – 1945) 1941 entziffert. Kleist schrieb seinen kurzen Text nach<br />
der Schlacht bei Wagram, in der die napoleonischen Truppen die österreichische<br />
Armee besiegten, allerdings erstmals mit großen Verlusten. So<br />
sieht er Chancen für eine zweite Schlacht, in welcher der österreichische<br />
Kaiser zum Partisanenführer wird: »Es gibt ein einziges Wort, welches<br />
imstande ist, im deutschen Reich, besonders im Norden <strong>des</strong>selben, eine<br />
allgemeine, große und gewaltige Nationalerhebung zu bewirken – und<br />
dieses Wort ist das folgende. Proklamation Wir, Franz der Erste, Kaiser<br />
von Österreich, kraft Unseres Willens und mit der Hülfe Gottes, Wiederhersteller<br />
und provisorischer Regent der Deutschen, haben beschlossen<br />
und beschließen, was folgt: 1) Von dem Tage dieses Beschlusses an soll<br />
das deutsche Reich wieder vorhanden sein. 2) Alle Deutsche vom 16. bis<br />
60. Jahr, sollen zu den Waffen greifen, um die Franzosen aus dem Lande<br />
zu jagen. 3) Wer, mit den Waffen in der Hand, gegen das Vaterland<br />
fechtend, ergriffen wird, soll vor ein Kriegsgericht gestellt, und mit dem<br />
Tode bestraft werden. 4) Nach Beendigung <strong>des</strong> Kriegs sollen die Stände<br />
zusammenberufen, und, auf einem allgemeinen Reichstage, dem Reiche<br />
die Verfassung gegeben werden, die ihm am zweckmäßigsten ist. Gegeben<br />
etc. (L. S.) Franz.«<br />
Möglicherweise gehört das fotografierte, dann verschollene Manuskript<br />
zum so genannten »Preußenschatz« (polnisch: Berlinka), einer umfangreichen<br />
Sammlung deutscher Originalhandschriften, die im Zweiten Welt-<br />
U NSICHTBAR
krieg in das schlesische, heute polnische Kloster Grüssau ausgelagert und<br />
nach Kriegsende in die Biblioteka Jagiellońska nach Krakau gebracht<br />
worden ist. Bis 1977 wurde die Existenz der Sammlung von polnischer<br />
Seite dem Westen gegenüber ganz geleugnet. Erst 2006 wurden in der<br />
Berlinka lange verschollen geglaubte Exemplare <strong>des</strong> Grimm’schen Wörterbuchs<br />
mit handschriftlichen Notizen der Brüder Grimm wiedergefunden,<br />
und 2011 hat man dort für vier Wochen erstmals einige von Kleists Briefen<br />
im Original ausgestellt.<br />
155<br />
<strong>Der</strong> Marmorfuß von Lola Montez. Das Berühren von Füßen kann<br />
Glück bringen. Den rechten Fuß der Petrusstatue im Petersdom küssen<br />
seit Jahrhunderten die Pilger blank. In Harvard reiben die Studenten den<br />
linken Fuß <strong>des</strong> in Bronze gegossenen Namenspatrons John Harvard vor<br />
Prüfungen – um dann bei der Abschlussfeier darauf zu pinkeln.<br />
Quelle segensreicher Berührungen, karnevalesker Glücksbringer, Fetisch.<br />
Ludwig I. von Bayern gab 1847 bei dem Bildhauer Johann Leeb eine<br />
Skulptur aus Carraramarmor in Auftrag, die den Fuß seiner Geliebten<br />
zeigen sollte. Schon zuvor hat ein Unbekannter in Berlin, glaubt man den<br />
Memoiren von Lola Montez, ein Modell vom Fuß der Tänzerin genommen,<br />
»<strong>des</strong>sen obern Theil er mit einer weichen Masse überzogen hatte und,<br />
so gut es ging, abdrückte«. Ludwigs Marmorfuß allerdings wird nicht nach<br />
dem Originalfuß geformt. Leeb behilft sich mit einem Abguss der Venus<br />
von Milo und »spottete über den Unterschied <strong>des</strong> nach der Natur abgeformten,<br />
verquetschten, durch enge Schuhe und Tanz fast verkrüppelten<br />
und durch Krähaugen und durillon’s verunzierten Fußorignals und seiner<br />
nach der Venus von Milo gefertigten Kopie«.<br />
Den Auftraggeber hat das nicht gestört. Er überdeckte den Fuß mit<br />
Küssen und hat ihn wohl sogar in den Mund geführt, wie er der Geliebten<br />
gesteht, die als Gegengabe den Abguss seiner Hand erhalten hat.<br />
Auch diese nach dem Ideal und nicht dem Original geformt: ein Marmorhändchen,<br />
geglättet und verkleinert und ganz das Gegenteil der von der
Natur geformten »Hand <strong>des</strong> Königlichen Amanten, welche groß, knotig<br />
und runzlich war«. – Beide, Marmorhand und Marmorfuß, sind heute<br />
verschollen. Die Hand soll Lolas kurzzeitiger Ehemann schon 1850 gestohlen<br />
haben.<br />
156<br />
Lit.: Thomas Weidner, Lola Montez oder eine Revolution in München,<br />
Eurasburg/München 1998.<br />
Ausgestellt: Foto vom Grab der Lola Montez, geborene Elizabeth<br />
Rosanna Gilbert, »auf dem Friedhof zu Greenwood bei New York«:<br />
»died January 17 1861 / aged 42 years« (Beilage zu Paul Alfred<br />
Merbachs Manuskript »Tanz und Weltgeschichte«).<br />
Franz Kafkas Briefe an Felice Bauer. Die Überlieferung von Franz<br />
Kafkas Briefen an Felice Bauer ist dem Umstand zu verdanken,<br />
dass seine zweimalige Verlobte sie mitnahm, als sie mit ihrer Familie<br />
Deutschland verließ, und über Jahrzehnte aufbewahrte. Dem bereits in<br />
den 1930er-Jahren einsetzenden Drängen, die Korrespondenz zugänglich<br />
zu machen, gab sie erst im Jahr 1956 nach, als sie sich durch Krankheit<br />
und finanzielle Not zum Verkauf der Briefe gezwungen sah. In der<br />
Nacht, bevor sie das Konvolut für die vergleichsweise geringfügige<br />
Summe von 8000 Dollar dem Verleger Salman Schocken übergab, hat<br />
sie die Briefe Kafkas ein letztes Mal gelesen und offenbar einige aussortiert<br />
und vernichtet, deren Inhalt ihr zu intim erschien. Nahum N. Glatzer,<br />
ein lang jähriger Mitarbeiter <strong>des</strong> Verlegers, erzählte, sie habe sie<br />
mit den Worten übergeben: »Mein Franz war ein Heiliger.« An die damals<br />
getroffene Vereinbarung, die Briefe nach ihrer Publikation in einem<br />
öffentlichen Archiv zu deponieren, fühlten sich die Erben <strong>des</strong> Verlegers<br />
20 Jahre später nicht mehr gebunden: Im Jahr 1987 wurden Kafkas<br />
Briefe von einem bis heute anonym gebliebenen Käufer für 605 000 Dollar<br />
ersteigert.<br />
U NSICHTBAR
Die mit den Briefen überlieferten Umschläge hatten allerdings schon zuvor<br />
ein Eigenleben entwickelt: Bei der Übergabe durch Felice Bauer-Marasse<br />
hatten in den meisten noch die dazugehörigen Briefe gesteckt; später<br />
wurden diese entnommen und die Umschläge als Devotionalien und<br />
Erinnerungsstücke verschenkt oder verkauft, und mit den Jahren gelangten<br />
auch sie zu stetig steigenden Preisen in den Autographenhandel.<br />
Hans-Gerd Koch<br />
157<br />
Ausgestellt: Zwei der lange vor der Versteigerung von ihrem<br />
Inhalt getrennten Briefumschläge aus Kafkas Korrespondenz mit<br />
Felice, die zu den berühmtesten Liebesbriefwechseln der Weltliteratur<br />
gehört. Kafka trennt sich kurz nach der Verlobung das erste Mal<br />
von Felice, 1916 dann das zweite Mal. Am 5. Juli 1916 hält er im Tagebuch<br />
fest: »Mühsal <strong>des</strong> Zusammenlebens. Erzwungen von Fremdheit<br />
Mitleid, Wollust, Feigheit, Eitelkeit und nur im tiefen Grunde vielleicht<br />
ein dünnes Bächlein würdig Liebe genannt zu werden, unzugänglich dem<br />
Suchen, aufblitzend einmal im Augenblick eines Augenblicks. Arme<br />
Felice«<br />
Marcel Duchamps Fountain. Im April 1917 reichte Marcel Duchamp<br />
bei der Society of Independant Artists in New York sein Werk Fountain<br />
ein, ein datiertes und mit dem Pseudonym »R. Mutt« signiertes Urinal. Es<br />
wurde entgegen den Satzungen der Gesellschaft als einzige von rund<br />
zweieinhalbtausend Einsendungen abgelehnt und nicht ausgestellt. Darauf<br />
hin zeigte es Alfred Stieglitz, der prominente amerikanische Fotograf,<br />
in seiner Galerie ›291‹. Seit diese im Juni 1917 aufgrund wirtschaftlicher<br />
Schwierigkeiten geschlossen worden war, ist das originale Werk verschollen.<br />
Es ist bezeichnend, dass sich alle siebzehn Repliken von Fountain an<br />
dem einzigen erhaltenen Foto <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> orientieren sollen. Die<br />
Aufnahme von Stieglitz nahm mithin die Position <strong>des</strong> verlorenen <strong>Originals</strong>
ein. Die Repliken in<strong>des</strong> weisen alle unterschiedliche Maße, Signaturen und<br />
Formen auf, was Duchamps Konzept <strong>des</strong> Ready-made entspricht:<br />
Nicht der (austauschbare) Gegenstand an sich steht im Zentrum <strong>des</strong><br />
künstlerischen Prozesses, sondern seine Neusituierung in einem von<br />
seinem Ursprungszweck weit entfernten Milieu.<br />
Frank Druffner<br />
158<br />
Ausgestellt: Duchamps Grundrisse zu einem Schachspiel,<br />
die der schachbegeisterte Duchamp als Regieanweisung für den<br />
Film 8 x 8. A Chess Sonata in 8 Movements (1957, Hans Richter,<br />
mit Szenenentwürfen u. a. von Hans Arp, Alexander Calder, Jean<br />
Cocteau, Max Ernst und Fernand Léger) aufgezeichnet hat: »8 mal 8<br />
Felder. 4 x 8 Figuren. Die Regeln sind fest. Die Bewegungen werden<br />
bestimmt durch Rangfolge und Richtung. Doch alles ist in Bewegung.<br />
Bringe die Figuren durcheinander, um ein neues Spiel zu beginnen«.<br />
Walter Benjamins Aktentasche. Wahrscheinlich haben Ratten sie<br />
zernagt. Oder sie ist angeschimmelt entsorgt worden. Ihre Spuren verlieren<br />
sich in der Asservatenkammer <strong>des</strong> Juzgado von Figueres in Katalonien.<br />
Dort lagen zuletzt die Habseligkeiten <strong>des</strong> unbekannten Flüchtlings<br />
»VVALTER BENJAMIN DR.«, der sich am 26. September 1940 in<br />
Portbou das Leben genommen hatte.<br />
Wie sie aussah? Hannah Arendt sprach von einer kleinen Koffertasche,<br />
Lisa Fittko, die Fluchthelferin, von einer schweren schwarzen Aktentasche,<br />
ein Monstrum sei es gewesen. Die katalanischen Gerichtsdiener<br />
registrierten eine große Reisetasche (»una cartera grande de viaje«). Und<br />
sie erfassten auch deren Inhalt: Pfeife, Nickelbrille, Reisepass, Passfotos,<br />
drei Geldscheine. Benjamins goldene Taschenuhr findet sich mit Hersteller,<br />
Artikelnummer und Gravur im Protokoll: Auf wen mögen die Initialen<br />
S. G. verweisen?<br />
Wo wir es genauer wissen möchten, bleiben die Rechtshelfer seltsam<br />
wortkarg: Dabei waren auch einige wenige Papiere unbekannten Inhalts<br />
U NSICHTBAR
(»algunos pocos papeles más que se ignora su contenido«). Wir stehen<br />
vor einem Rätsel.<br />
»Diese Aktentasche ist mir das Allerwichtigste«, hatte der herzkranke<br />
Mann Lisa Fittko erklärt. Darin sei ein neues Manuskript, das vor dem<br />
Zugriff der Gestapo gerettet werden müsse. Dieser Plan scheiterte,<br />
aber aufgegangen ist Benjamins Strategie, sein Archiv zu überliefern,<br />
indem er es unter Freunden verteilte.<br />
Was trug Benjamin über die Pyrenäen? Seine mutigen Thesen Über den<br />
Begriff der Geschichte? Oder einen Text, der uns unbekannt geblieben<br />
ist? Wir wissen es nicht. Aber werden wir darum aufhören, danach zu<br />
fragen?<br />
Erdmut Wizisla<br />
159<br />
Ausgestellt: Umschlag, in dem 1950 Theodor und Gretel Adorno an<br />
Walter Benjamins Sohn Stefan das im Sommer 1932 begonnene<br />
Manuskript seiner Berliner Kindheit um neunzehnhundert zurückgeschickt<br />
haben. Im Sommer 1932 begann Walter Benjamin mit der<br />
Arbeit an einem Buch, das später sein bekanntestes werden sollte:<br />
Berliner Kindheit um neunzehnhundert, kurze Prosa-Stücke, die aus<br />
den Idyllen der Kindheit – dem Glück der seligen Vorfreuden, wohligem<br />
Gruseln und gut behüteten Träumereien – am Ende abgründige, wenigstens<br />
gebrochene Bilder schürfen. »Einzelne Expeditionen in die Tiefe der<br />
Erinnerung«, von der Benjamin hoffte, dass in ihnen zu merken sei,<br />
»wie sehr der, von dem hier die Rede ist, später der Geborgenheit entriet,<br />
die seiner Kindheit beschieden war«. Benjamin selbst hat die Berliner<br />
Kindheit zu seinen »zerschlagnen Büchern« und »unendlich verzettelten<br />
Produktionen« gerechnet – nie zustande gekommen, aber auch in alle<br />
Winde zerstreut. Immer wieder hat er sie überarbeitet, Texte ergänzt und<br />
ausgeschieden und in verschiedenen Reihenfolgen für mögliche Veröffentlichungen<br />
zusammengestellt. Als Buch erschien die Berliner Kindheit erst<br />
1950, zehn Jahre nach seinem Freitod im spanisch-französischen Grenzort<br />
Port Bou, herausgegeben vom Freund Theodor W. Adorno. Neben<br />
kleineren Vorarbeiten sind heute vier umfangreichere Fassungen <strong>des</strong> Texts
160<br />
bekannt, zwei maschinenschriftliche Konvolute und zwei handgeschriebenen<br />
Sammlungen, die nach den Widmungsträgern benannt wurden:<br />
Adornos Ehefrau Gretel, von Benjamin Felizitas genannt, und Benjamins<br />
Sohn Stefan. Benjamins Schwester Dora ließ die Manuskripte nach<br />
dem Tod ihres Bruders zu Adorno nach Amerika bringen, der das Stefan<br />
gewidmete Exemplar nach Abschluss der Edition im November 1950 an<br />
diesen zurückschickte.<br />
Hitlers Schädel. Am Nachmittag <strong>des</strong> 30. April 1945 begingen Adolf<br />
Hitler und seine Frau Eva, geb. Braun, im Bunker unter der Berliner<br />
Reichskanzlei Selbstmord. Die Leichen wurden in Decken gehüllt und im<br />
Garten der Reichskanzlei mit Benzin übergossen und verbrannt; die<br />
Aschenreste wurden verscharrt. Hitler hatte zuvor seiner Sorge Ausdruck<br />
verliehen, dass sein Leichnam wie der <strong>des</strong> toten Mussolini geschändet<br />
oder als Trophäe in Moskau ausgestellt werden könnte. Nach der vollständigen<br />
Einnahme Berlins durch die Rote Armee und der Kapitulation<br />
der Wehrmacht wurden zunächst verschiedene angebliche Hitlerleichen<br />
identifiziert, dann kamen Gerüchte von einer angeblich gelungenen Flucht<br />
<strong>des</strong> ›Führers‹ in Umlauf. Ein Jahr später, Ende April 1946, rekonstruierte<br />
eine Kommission der Roten Armee den genauen Hergang <strong>des</strong> Geschehens,<br />
befragte Zeugen und filmte die nachgestellte Verbrennungsszene.<br />
Das Material verschwand in Geheimarchiven. Die angeblichen Überreste<br />
Hitlers und einiger weiterer Personen, die in Kisten verpackt und schließlich<br />
auf dem Gelände einer Kaserne in Magdeburg eingegraben worden<br />
waren, wurden auf Geheiß <strong>des</strong> Politbüros der KPdSU im März 1970 unter<br />
strengster Geheimhaltung ausgegraben und verbrannt. Zweifelsfrei<br />
identifiziert worden waren nur einige Gebissteile Hitlers und Eva Brauns.<br />
Anlässlich <strong>des</strong> 55. Jahrestages <strong>des</strong> Sieges über Nazideutschland präsentierte<br />
eine Ausstellung im Moskauer Nationalarchiv im April 2000 ein<br />
vermeintliches Fragment von Hitlers Schädel mit dem Einschussloch der<br />
Pistolenkugel, die den Diktator tötete. Im Oktober 2009 ergab eine von<br />
U NSICHTBAR
einem amerikanischen Anthropologen und Archäologen durchgeführte<br />
DNA-Analyse, dass der angebliche Hitlerschädel von einem weiblichen<br />
Skelett stammen musste.<br />
Ausgestellt: Betonstück aus der Wolfsschanze, dem so genannten<br />
Führerhauptquartier in der Nähe von Rastenburg (heute Kętrzyn)<br />
bei Görlitz (Gierłoż), gesprengt von der Roten Armee am 24. Januar<br />
1945; die Reste sind seit 1959 eine Touristenattraktion. Im Sommer<br />
1978 fuhr ich gemeinsam mit einem Freund nach Polen, besuchte Breslau<br />
und Warschau und schwamm in der Danziger Bucht. Dann hatten wir<br />
einen Einfall. Wir fragten uns nach Rastenburg durch, das jetzt Kętrzyn<br />
hieß. Dort in der Nähe hatte Hitlers Hauptquartier gelegen. Wir fanden die<br />
Idee, die Wolfsschanze zu besuchen, ziemlich verwegen. Auf so etwas<br />
musste man erst mal kommen. In unserer Begeisterung bemerkten wir<br />
nicht, wie der Verkehr immer dichter wurde, je näher wir dem Ort kamen.<br />
Dann waren wir da. Vor den massigen, von Birken und Kiefern überwucherten<br />
Ruinen, die an Inkatempel in einem Dschungel erinnerten,<br />
parkte ein halbes Dutzend polnischer Busse, und über dem Eingang zum<br />
Hauptquartier hing der Qualm mehrerer Wurstbuden. Immer wieder<br />
formierten sich fröhliche Gruppen von Inkas, um sich vor den Tempeln<br />
fotografieren zu lassen. Wir durchstreiften die Ruinen, und bevor wir uns<br />
auf den Rückweg machten, nahmen wir einen kleinen, faustgroßen<br />
Brocken Beton mit. Ein Fragment von der Wolfsschanze, ein Stück vom<br />
Planeten <strong>des</strong> Bösen. Zwischen unseren Hemden und Badehosen lag<br />
der Brocken unter der Haube <strong>des</strong> Volkswagens und blieb dort liegen,<br />
nachdem wir wieder in Berlin angekommen waren und ausgepackt hatten.<br />
Erst bei der Kontrolle durch die Vopos, die uns auf irgendeiner schwarzen<br />
Liste hatten und je<strong>des</strong> Mal, wenn wir den Transit passierten, den VW<br />
herausfischten, fiel uns der Brocken wieder ein. Ganz entspannt standen<br />
wir neben dem Wagen, sahen zu, wie die Vopos uns filzten, wobei sie<br />
meist an irgendwelcher verdächtigen Literatur hängenblieben, und bissen<br />
uns auf die Zunge, wenn sie den Brocken Beton fanden, einen Augen-<br />
161
lick lang prüfend in der Hand wogen und achselzuckend wieder auf den<br />
Tank <strong>des</strong> Käfers fallen ließen.<br />
Ulrich Raulff<br />
162<br />
Alfred Rosenbergs Grab. Wenn ich über den Frankfurter Hauptfriedhof<br />
gehe, erinnere ich mich an das Grab von Hedwig Rosenberg, geb.<br />
Kramer. Es lag im Gewann (so heißen die kleinen Viertel in der Stadt der<br />
Toten) – im Gewann XV unter der Nummer 696. Auf dem bescheidenen<br />
Grabstein standen der Name und die Geburts- und Sterbedaten. Und<br />
unter diesen wiederum der Zusatz: »Witwe von Alfred Rosenberg«.<br />
Das Grab ist mittlerweile verschwunden und vermutlich wieder neu belegt.<br />
Vor einigen Jahren wurde es nach Ablauf <strong>des</strong> 25-jährigen Nutzungsrechts,<br />
Frau Rosenberg war 1981 verstorben, aufgehoben; keine Ahnung, wo<br />
der denkwürdige Grabstein geblieben ist. Wie beiläufig notierte er<br />
zwei verschiedene Typen <strong>des</strong> Verschwindens, das einfache und sozusagen<br />
normale von Hedwig, die als Hausfrau in ihrem 83. Lebensjahr eines<br />
friedlichen To<strong>des</strong> gestorben war (so die Gräberakte der Zentralkartei:<br />
auch Friedhöfe, die ja selber Archive sind, haben ihr Archiv) – und daneben<br />
das kompliziertere, gleichsam doppelte Verschwinden von Alfred<br />
Rosenberg, dem Autor <strong>des</strong> Mythus <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts, der in Nürnberg<br />
aufgehängt, eingeäschert und Gott weiß wo verstreut worden war, ein<br />
rest- und bodenlos Verschwundener, bis seine Witwe ihm nach ihrem<br />
Ableben durch ihren Grabstein eine vorübergehende Bleibe auf Erden<br />
gab. Für ein Vierteljahrhundert, bis beide ein weiteres Mal verschwanden,<br />
diesmal gemeinsam.<br />
Ulrich Raulff<br />
Ausgestellt: Alfred Rosenbergs hier offensichtlich ungelesenes<br />
Buch <strong>Der</strong> Mythus <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts. Eine <strong>Wert</strong>ung der<br />
seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit, aus dem Besitz<br />
von Georg Lukács (hier in der 195. – 200. Auflage von 1943). –<br />
Leihgabe: Georg-Lukács-Archiv, Budapest.<br />
U NSICHTBAR
Einsteins Gehirn. Entgegen dem Willen <strong>des</strong> Physikers, der verfügt hatte,<br />
dass sein Körper nach seinem Tod verbrannt werden sollte, blieb sein<br />
Gehirn erhalten und trat eine Jahrzehnte dauernde Odyssee durch die<br />
Vereinigten Staaten an. <strong>Der</strong> Pathologe Thomas Harvey, der den am<br />
15. April 1955 verstorbenen Einstein autopsierte, entwendete <strong>des</strong>sen<br />
Gehirn und trug es, in rund 200 kleine Kuben und Scheiben zersägt,<br />
in Einmachgläsern mit sich herum, nachdem er von seinem Dienstherrn,<br />
dem Princeton Hospital, gefeuert worden war. Etwa ein Drittel seiner<br />
Trophäe verschenkte er im Lauf der Jahre an Kollegen, von denen einige<br />
tatsächlich die erhaltenen Proben analysierten und mit – naturgemäß<br />
unterschiedlichen – Theorien über die Ursache von Einsteins Genie an die<br />
wissenschaftliche Öffentlichkeit traten. 1997 fuhr Harvey als 84-jähriger<br />
quer durch die Vereinigten Staaten, um die Reste von Einsteins Gehirn<br />
<strong>des</strong>sen Enkeltochter zu übergeben. Die meisten der Partikel von Einsteins<br />
Gehirn werden heute an der Princeton University aufbewahrt.<br />
163<br />
Ausgestellt: Einsteins berühmte Relativitätsformel von 1905,<br />
welche die Äquivalenz von Masse und Energie beschreibt –<br />
hier von Reinhart Koselleck notiert und eingekästelt in einer Zettelsammlung<br />
zu »Naturwissenschaft, Naturrecht, Normalismus«:<br />
»m · c2 = E«.<br />
<strong>Der</strong> Merce<strong>des</strong> W 140, in dem Lady Di verunglückte. Die Limousine, in<br />
der Lady Di und ihr Begleiter Dodi al-Fayed in Paris am 31. August gegen<br />
0.25 Uhr am 13. Pfeiler <strong>des</strong> Tunnels unter der Place de l’Alma in Paris<br />
verunglückt sind, geistert immer wieder durch die Presse. Als unbestechlicher<br />
Zeuge, vermeintliche Unfallursache, voyeuristisches Objekt. Angeblich<br />
hat die Pariser Leihfirma ›Etoile Limousines‹ 2008 den Merce<strong>des</strong><br />
von der britischen Polizei zurückgefordert, als späte Entschädigung für<br />
den 75 000 Euro teuren Wagen. Die Mail on Sunday wusste damals: »<strong>Der</strong><br />
Unfallwagen könne einen Preis von rund einer Million Pfund (1,24 Mil-
164<br />
lionen Euro) erbringen. Nach dem Willen der Prinzen William und Harry,<br />
Dianas Söhnen, soll der Merce<strong>des</strong> jedoch ›diskret und privat‹ entsorgt<br />
werden, damit er nicht in die Hände von Souvenir-Jägern fällt.«<br />
Angeblich, so erzählt uns ein anderer, wurde der demolierte Merce<strong>des</strong><br />
am Ort seiner Produktion in Stuttgart-Untertürkheim untersucht und dann<br />
abgewrackt: »Er ging dann den üblichen Weg eines Automobils, <strong>des</strong>sen<br />
Wiederherstellung sich wirtschaftlich nicht rechnet – wir lassen mal die<br />
stückchenweise Ver wertung als Devotionalie oder als Reliquie außer<br />
Betracht. Unter uns gesagt, ist das spurlose Verschwinden doch das<br />
einzig Richtige für dieses ›Exponat‹. ... Na ja, so ganz so spurlos ist das<br />
Verschwinden wohl nicht, vielleicht sind ja in irgendeiner Stahlschraube,<br />
die Sie kaufen, ein paar Atome <strong>des</strong> besagten – sicherlich recycelten –<br />
Fahrzeugs. Also weiterhin mutmaßen, suchen!«<br />
Ausgestellt: Fotos von Dolfs Sternbergers Unfallwagen, aufgenommen<br />
nachdem er am 1. November 1952 »gegen 23.30 Uhr auf<br />
der Wiesbadener Straße bei Kilometer 7,6« mit seinem Merce<strong>des</strong><br />
frontal in einen Lastwagen gefahren war. Das Ehepaar Sternberger<br />
blieb bis auf eine Gehirnerschütterung unverletzt.<br />
Schillers Schädel. Schädel, ob sie echt sind oder nicht, gleichen sich,<br />
so scheint es zumin<strong>des</strong>t, als Reduktionsformen, als Fragmente oder<br />
Bruchstücke, sie weisen Leerstellen auf, die aufzufüllen wären, um zu<br />
erkennen, was sie einst waren, vollständig, eine jeweils in sich gefügte<br />
einheitliche Gestalt. Vor mir befindet sich der Schädel aus dem Sarg der<br />
Fürstengruft, den Goethe sehr wahrscheinlich vom 17. September 1826<br />
bis zum 29. August 1827 bei sich zu Hause bewahrte, bevor er ihn wieder<br />
in die Herzogliche Bibliothek zurückbringen ließ, da kein Geringerer als<br />
der König von Bayern die Reliquie in Augenschein nehmen wollte. Sowohl<br />
der König als auch der Dichterfürst wären gewiss nicht wenig irritiert<br />
gewesen, wenn sie erfahren hätten, dass der Schädel, den Bürgermeister<br />
U NSICHTBAR
Karl Lebrecht Schwabe unter größten Mühsalen aus dem Untergrund<br />
<strong>des</strong> Landschaftskassengewölbes über zwei Jahrzehnte nach Schillers Tod<br />
zutage förderte und als echten Schädel <strong>des</strong> Dichters identifizierte, weil er<br />
unter 23 anderen Schädeln eindeutig der größte war, jemand anderem<br />
gehörte. Es könnte sogar sein, dass Schwabe bei seiner Auswahl indirekt<br />
durch den Erfinder der Organologie, dem Wiener Arzt Franz Joseph Gall,<br />
von Geburt Schwabe wie Schiller, angeregt worden war. Dieser Begründer<br />
der Hirn- und Schädellehre war überzeugt, an der äußeren Schädelform<br />
die geistigen und charakterlichen Eigenschaften ablesen zu können.<br />
Selbst leidenschaftlicher Schädelsammler, löste er, wo immer er auch<br />
auftrat, mit seinen Vorträgen eine Art Sammler-Epidemie in Europa aus.<br />
Bereits im Jahre 1800 ironisierte ein gewisser Herr Froriep die Gallesche<br />
Schädelmanie so: »Ein jeder ist in Wien besorgt und in großer Angst,<br />
daß sein Kopf in Galls Sammlung kommen könnte. Nun halten noch<br />
überdies alle Menschen so viel auf sich selbst, und haben eine so große<br />
Meinung von sich, daß jeder überzeugt ist, Gall laure schon lange auf<br />
seinen Kopf als einen der wichtigsten seiner Sammlung.«<br />
Kein Wunder, dass man Gall bezichtigte, Schillers Schädel aus dem<br />
Kassengewölbe, wo man den Dichter am 12. Mai 1805 um ein Uhr nachts<br />
beerdigt hatte, mit fremder Hilfe oder im Alleingang entwendet zu haben.<br />
Seine Schädel-Lesekunst muß aber insofern erstaunlich gewesen sein,<br />
als Charlotte Schiller nicht ohne Stolz in einem Brief an Cotta berichtete,<br />
dass »Gall sich über Ernsts Kopf erfreut und gesagt« habe, dieser besitze<br />
»den Kopf seines Vaters«. Goethe scheint außerdem auf andere und<br />
durchaus kreative Weise Galls meditativ-ästhetische Kranioskopie fortgesetzt<br />
zu haben. Er inszenierte auch eine Suche nach den verlorenen<br />
sterblichen Resten – er sprach geradezu delikat von »köstlichen Resten«<br />
– seines verstorbenen Freun<strong>des</strong> und holte ihn dann zumin<strong>des</strong>t poetisch<br />
und verbal über die Lesekunst <strong>des</strong> Schwabe-Schädels ins Leben zurück.<br />
Goethe muss in diesem Zusammenhang, als er mit Humboldt bei sich<br />
zu Hause den Schädel betrachtete, diesem von seiner überwältigenden<br />
ästhetisch-morphologischen Erfahrung während seiner zweiten italie-<br />
165
166<br />
nischen Reise beim Anblick <strong>des</strong> Schädels von Raffael berichtet haben,<br />
wobei freilich anzumerken ist, dass der Schädel Raffaels, der Goethe<br />
seinerzeit zu einer ähnlich ästhetisch-morphologischen Begeisterung<br />
hinriss, ebenso unecht war wie der Schillers. In einem Brief an seine Frau<br />
Caroline vom 29. Dezember 1826 vergleicht Humboldt Schillers Kopf mit<br />
dem Raffaels und schwärmt: »der Schillersche Kopf hat etwas Größeres,<br />
Umfasssenderes, mehr auf einzelnen Punkten sich ausdehnend und<br />
entfaltend, neben anderen, wo Flächen oder Einsenkungen sind. Es ist<br />
ein unendlich ergreifender Anblick, aber doch ein sehr merkwürdiger«.<br />
Goethes osteologische Lesekunst gipfelt zweifelsohne in dem Gedicht<br />
Im ernsten Beinhaus. Schillers Schädel wird hier zu einem Kunstprodukt,<br />
an dem nicht nur über die besondere Form die »gottgedachte Spur«,<br />
sondern schließlich die »Gott-Natur« offenbart wird. Doch wie konnte auch<br />
die begabteste Schädellesekunst ein lebendiges Porträt wie dieses<br />
erfinden: »die rötlichen Haare – die gegeneinander sich neigenden Knie,<br />
das schnelle Blinzeln der Augen, wenn er lebhaft opponierte, das öftere<br />
Lächeln während <strong>des</strong> Sprechens, besonders aber die schön geformte<br />
Nase und der tiefe, kühne Adlerblick, der unter einer sehr vollen, breitgewölbten<br />
Stirne hervorleuchtete«. Dieses Kurzporträt Schillers stammt von<br />
dem selbstlosen Jugendfreund Schillers, dem Tonkünstler Andreas<br />
Streicher, der gemeinsam mit ihm aus Stuttgart floh und später in Wien<br />
ein bekannter Klavierfabrikant wurde, <strong>des</strong>sen Flügel Beethoven besonders<br />
schätzte und <strong>des</strong>sen Hausarzt in Wien übrigens der schwäbische Landsmann<br />
und Schädelforscher Gall war.<br />
Doch was spielte sich eigentlich im Beinhaus ab, in dem der echte<br />
Schädel unter vielen anderen lagerte und in dem ständig neue Särge<br />
abgeladen und ältere von Totengräbern wieder »entlastet« oder »zusammengeräumt«<br />
wurden? <strong>Der</strong> eifrige Schillerschädelforscher Schwabe<br />
überliefert durchaus glaubhaft, wie scheußlich der Aufenthalt »in dieser<br />
lang nicht geöffneten, nur mit dem heftigstem Modergeruch angefüllten<br />
Totengruft unter herumliegenden Schädeln und Totengebeinen« gewesen<br />
sein muss, so dass »nur das eifrigste Tabakrauchen … einige Erleichte-<br />
U NSICHTBAR
ung« verschaffen konnte. Kein Wunder, dass Andreas Streicher, als er<br />
über diese Zustände 1820 in der Allgemeinen Zeitung einen entsprechenden<br />
Artikel las, entsetzt war und von Wien aus in mehreren Briefen an die<br />
Weimarer Regierung ein »eigenes Grab« für seinen Jugendfreund forderte.<br />
Obwohl Goethe ihn wegen dieses Eifers als »verrückten« Wiener abtat,<br />
bestätigte auch der Generalsuperintendent Johann Friedrich Röhr, den<br />
übrigens der berühmte Dichter besonders schätzte, das skandalöse<br />
Verhalten der Weimarer folgendermaßen: »Ob und was übrigens mit der<br />
Schillerschen Leiche geschehen ist, davon weiß ich als Oberpfarrer und<br />
Superintendent hiesiger Stadt offiziell bis auf diesen Tag – nichts! Nur<br />
von der Schädelzeremonie [am 17. September 1826] auf der Bibliothek<br />
habe ich in öffentlichen Blättern gelesen und mich in Leipzig in einer<br />
großen Gesellschaft geistreicher Männer fragen lassen müssen: ›wie das<br />
gesittete Weimar mit seinen großen Geistern so huronenmäßig verfahren<br />
könne?‹ Ich habe darauf keine Antwort, konnte aber die Frage nicht<br />
unangemessen finden.«<br />
Walter Hinderer<br />
167<br />
Lit.: Jonas Maatsch / Christoph Schmälzle (Hrsg.), Schillers Schädel.<br />
Physiognomie einer fixen Idee, Göttingen 2009.<br />
Ausgestellt: Haarlocke Schillers, von seinem ältesten Sohn Carl<br />
1855, 50 Jahre nach Schillers Tod, für echt erklärt.
Ausstellung: Heike Gfrereis und Ulrich Raulff<br />
Beratung: Gottfried Boehm<br />
Gestaltung: Diethard Keppler mit Demirag Architekten<br />
Texte ohne Autorenangaben und Redaktion: Heike Gfrereis, Dietmar Jaegle und Ulrich Raulff<br />
Organisation: Johannes Kempf und Annette Rief<br />
Konservatorische Betreuung: Susanne Boehme, Enke Huhsmann und Anaïs Ott<br />
Fotoarbeiten: DLA (Jens Tremmel)<br />
WIR DANKEN<br />
für Leihgaben und Abbildungen sowie Veröffentlichungs- und Abbildungsrechte:<br />
Archäologische Sammlung Freiburg<br />
Auswärtiges Amt – Politisches Archiv<br />
Heiner Bastian, Berlin<br />
Walter Benjamin Archiv, Akademie der Künste<br />
Götz Freiherr von Berlichingen, Schöntal (Foto: Freiherrlich von Berlichingen’sche Archivverwaltung)<br />
Bodleian Libraries, Oxford<br />
Deutsches Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg<br />
Familienarchiv Heuss, Basel / Stiftung Bun<strong>des</strong>präsident-Theodor-Heuss-Haus, Stuttgart<br />
Freud Museum London (Foto: Karolina Urbaniak)<br />
Goethe- und Schiller-Archiv Weimar, Klassik Stiftung Weimar<br />
Institut für Ethnologie und Afrikastudien der Johannes Gutenberg-Universität Mainz<br />
Kleist-Museum Frankfurt a. d. O.<br />
Georg-Lukács-Archiv, Budapest<br />
Sammlung Isolde Moser, Kötschach-Mauthen<br />
Nietzsche-Haus, Sils Maria<br />
Werner Oechslin, Einsiedeln<br />
Kurt Schwitters Archiv im Sprengel Museum Hannover. © für Kurt Schwitters: Kurt und Ernst<br />
Schwitters Stiftung, Hannover (Fotos: Aline Gwose / Michael Herling / Benedikt Werner)<br />
Heribert Tenschert, Ramsen<br />
Theaterwissenschaftliche Sammlung, Universität zu Köln<br />
Universitätsbibliothek Freiburg / Historische Sammlungen<br />
KD Wolf, Frankfurt a. M.<br />
Dietrich Wurm, Lindau
Das vorliegende <strong>Marbacher</strong> <strong>Magazin</strong> <strong>148</strong> erscheint zur Ausstellung ›<strong>Der</strong> <strong>Wert</strong> <strong>des</strong> <strong>Originals</strong>‹<br />
Literaturmuseum der Moderne, Marbach am Neckar<br />
3. November 2014 bis 12. April 2015<br />
© 2014 Deutsche Schillergesellschaft, Marbach am Neckar<br />
Herausgeber: Deutsches Literaturarchiv Marbach<br />
Ausstattung: Diethard Keppler und Heike Gfrereis<br />
nach einem Entwurf von Diethard Keppler und Stefan Schmid<br />
Gesamtherstellung: Offizin Scheufele Druck und Medien, Stuttgart<br />
ISBN 978-3-944469-10-2<br />
Die Deutsche Schillergesellschaft wird gefördert<br />
durch die Bun<strong>des</strong>republik Deutschland,<br />
das Land Baden-Württemberg, den Landkreis Ludwigsburg<br />
und die Städte Ludwigsburg und Marbach am Neckar.