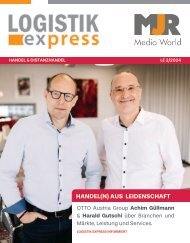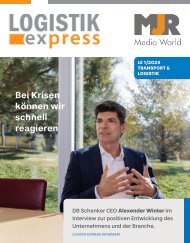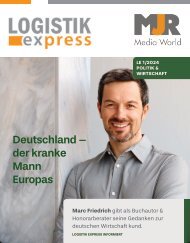UMWELT JOURNAL 2020-6
Die Themen von UMWELT JOURNAL Nr. 6/2020 sind: 02 Termine & Events 03 Editorial, Impressum, Inhalt 04 Aktuelles 06 Technische Regenwasserfilter 10 EU-Green Deal für Batterien 14 AWES 2020 – Rückblick 16 Recycling von Rotorblättern 18 Antrieb für die Azimut-Steuerung 20 Recy & DepoTech 2020 22 Qualität beim Recycling 24 Mobilitätswandel ist Haltung 26 Interview: Ute Teufelberger, BEÖ 28 INNIO mit 1-MW-Großgasmotor 30 Heinzel Energy und ECO-TEC 32 Ausbildungen, Seminare, Partner 33 Kommentar: 5 Erkenntnisse aus 2020 34 Ausblick UMWELT JOURNAL 2021 35 Sonderausgaben für 2021
Die Themen von UMWELT JOURNAL Nr. 6/2020 sind:
02 Termine & Events
03 Editorial, Impressum, Inhalt
04 Aktuelles
06 Technische Regenwasserfilter
10 EU-Green Deal für Batterien
14 AWES 2020 – Rückblick
16 Recycling von Rotorblättern
18 Antrieb für die Azimut-Steuerung
20 Recy & DepoTech 2020
22 Qualität beim Recycling
24 Mobilitätswandel ist Haltung
26 Interview: Ute Teufelberger, BEÖ
28 INNIO mit 1-MW-Großgasmotor
30 Heinzel Energy und ECO-TEC
32 Ausbildungen, Seminare, Partner
33 Kommentar: 5 Erkenntnisse aus 2020
34 Ausblick UMWELT JOURNAL 2021
35 Sonderausgaben für 2021
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ABS.: <strong>UMWELT</strong> <strong>JOURNAL</strong> | HAMEAU STRASSE 44 | 1190 WIEN | AUSTRIA<br />
Heft 6/<strong>2020</strong><br />
Green Deal<br />
für Batterien<br />
Wasserfilter für Mikroplastikr<br />
Green Deal für Batterienr<br />
Recy & DepoTechr<br />
AWES <strong>2020</strong>r<br />
Mobilitätswandelr<br />
Qualität beim Recyclingr
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S2<br />
<strong>2020</strong> MESSEN EVENTS ORT INTERNET<br />
14. – 17. September INTERLIGHT RUSSIA Moskau interlight-building.ru<br />
25. – 26. September OÖ <strong>UMWELT</strong>TAGE Ried www.ooe-umwelttage.at<br />
29.09. – 01. Oktober BATTERY EXPERTS FORUM Frankfurt www.battery-experts-forum.com<br />
28. – 31. Oktober ECO EXPO ASIA Hongkong ecoexpoasia.hktdc.com<br />
03. – 06. November ECOMONDO Rimini en.ecomondo.com<br />
04. – 05. November ACQUA ALTA Essen www.acqua-alta.de<br />
8. – 20. November RECY & DEPO TECH Leoben www.recydepotech.at<br />
26. – 27. November RENEXPO INTERHYDRO Salzburg www.renexpo-hydro.eu<br />
01. – 04. Dezember POLLUTEC Lyon www.pollutec.com<br />
ERSCHEINUNGSTERMINE<br />
31. Jänner <strong>2020</strong><br />
30. April <strong>2020</strong><br />
19. Juni <strong>2020</strong><br />
17. August <strong>2020</strong><br />
05. Oktober <strong>2020</strong><br />
9. Dezember <strong>2020</strong><br />
<strong>UMWELT</strong> <strong>JOURNAL</strong><br />
Ausgabe 1/<strong>2020</strong><br />
Ausgabe 2/<strong>2020</strong><br />
Ausgabe 3/<strong>2020</strong><br />
Ausgabe 4/<strong>2020</strong><br />
Ausgabe 5/<strong>2020</strong><br />
Ausgabe 6/<strong>2020</strong>
EDITORIAL / IMPRESSUM<br />
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!<br />
Werte Kunden!<br />
Das zu Ende gehende Jahr <strong>2020</strong> wird<br />
in die Geschichte eingehen und uns<br />
allen in Erinnerung bleiben. Ich behaupte<br />
sogar: Es wurde eine neue Epoche<br />
eingeleitet. Mit ihrer Benennung wird es<br />
allerdings schwierig sein, wie wäre es mit<br />
„Zeitalter der Virtualisierung“?<br />
In unserer letzten Ausgabe für <strong>2020</strong> widmen<br />
wir uns den Themen Abwassertechnik,<br />
Abfallwirtschaft, Recycling, Mobilität<br />
und Alternative Energien – Windkraft erhält<br />
diesmal besondere Beachtung. Dazu<br />
zeigen wir interessante Möglichkeiten zur<br />
Weiterbildung und Information. Nützen Sie<br />
diese zu ihrem ganz persönlichen Vorteil!<br />
Denn im Grunde gibt es einfach viel zu viel<br />
Verkehr – nicht unbedingt für uns, aber<br />
ganz sicher für die Umwelt. Dazu bedarf<br />
es intelligenter Konzepte zur Vermeidung<br />
von Verkehr. Wie wild bei chinesischen<br />
Internetseiten bestellen, gehört überspitzt<br />
formuliert nicht dazu. Und die Pandemie<br />
hat Konzepte aufgezeigt – eben die Virtualisierung.<br />
Denn diese bedingt ganz sicher<br />
weniger Verkehr. Und das ist gut so!<br />
Das <strong>UMWELT</strong> <strong>JOURNAL</strong> ist seit vielen Jahren<br />
Wegbegleiter der Nachhaltigkeit – wir zeigen<br />
regelmäßig auf, wer nachhaltig arbeitet,<br />
welche Modelle angewendet werden<br />
und welche Arbeitsweisen sinnvoll sind.<br />
PETER NESTLER<br />
HERAUSGEBER<br />
<strong>UMWELT</strong> <strong>JOURNAL</strong><br />
In einem Beitrag zur Mobilität weist die<br />
Autorin auf die wahren Erfordernisse in<br />
Sachen Mobilität hin, und zugleich auf die<br />
Anforderungen an die Industrie: Verzicht!<br />
Ich teile diese Ansicht: Es bringt nichts, Mobilitätsarten<br />
gegeneinander auszuspielen,<br />
weil das nichts am Grundproblem löst.<br />
Ich wiederhole: Wer dieses Jahr übersteht,<br />
hat mit einiger Sicherheit bereits nachhaltig<br />
gearbeitet. Wir wünschen weiterhin viel<br />
Erfolg und ein positives Jahr 2021!<br />
Weiterhin viel Lesevergnügen,<br />
Ihr Peter R. Nestler<br />
INHALT 6/<strong>2020</strong><br />
02 Termine & Events<br />
03 Editorial, Impressum, Inhalt<br />
04 Aktuelles<br />
06 Technische Regenwasserfilter<br />
10 EU-Green Deal für Batterien<br />
14 AWES <strong>2020</strong> – Rückblick<br />
16 Recycling von Rotorblättern<br />
18 Antrieb für die Azimut-Steuerung<br />
20 Recy & DepoTech <strong>2020</strong><br />
22 Qualität beim Recycling<br />
24 Mobilitätswandel ist Haltung<br />
26 Interview: Ute Teufelberger, BEÖ<br />
28 INNIO mit 1-MW-Großgasmotor<br />
30 Heinzel Energy und ECO-TEC<br />
32 Ausbildungen, Seminare, Partner<br />
33 Kommentar: 5 Erkenntnisse aus <strong>2020</strong><br />
34 Ausblick <strong>UMWELT</strong> <strong>JOURNAL</strong> 2021<br />
35 Sonderausgaben für 2021<br />
IMPRESSUM<br />
Medieninhaber: Markus Jaklitsch<br />
Herausgeber: Peter Nestler<br />
Redaktion: Christian Vavra<br />
Grafik: nes2web<br />
Hameaustraße 44, 1190 Wien, Austria<br />
E-Mail: redaktion@umwelt-journal.at<br />
https://umwelt-journal.at
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S4<br />
China stößt 125,8 Prozent mehr CO 2 -Emissionen aus als die USA<br />
China landet mit einem<br />
Ausstoß von 11,54 Milliarden<br />
Tonnen CO2-Emissionen im<br />
Jahr 2019 weltweit auf dem<br />
fragwürdigen ersten Platz.<br />
An zweiter Stelle stehen die<br />
USA mit 5,11 Milliarden Tonnen.<br />
Setzt man die Daten<br />
allerdings in Relation zur<br />
Einwohnerzahl, dann kippt<br />
das Bild. Dies geht aus einer<br />
neuen Handelskontor-Infografik<br />
hervor.<br />
Die Pro-Kopf-Emissionen<br />
liegen in den USA deutlich<br />
höher als im Reich der Mitte.<br />
Der Wert liegt rund 47,1 Prozent<br />
höher.<br />
Deutschland landet bei<br />
den absolut ausgestoßenen<br />
CO2-Emissionen an sechster<br />
Stelle. Bei einem Vergleich<br />
auf Zeit zeichnet sich<br />
im Falle der Bundesrepublik<br />
allerdings eine Besonderheit<br />
ab: Im Jahr 2019 wurde<br />
35,2 Prozent weniger CO2<br />
freigesetzt, als noch im Jahr<br />
1970. Anders die Entwicklung<br />
in den USA und vor allen<br />
Dingen in China. In den<br />
USA stieg der Wert um 8,9<br />
Prozent, in China sogar um<br />
1.168 Prozent.<br />
Im Krisenjahr <strong>2020</strong> wurden<br />
weltweit 6,5 Prozent weniger<br />
CO2-Emissionen freigesetzt<br />
als Vorjahr. Selbst in<br />
China gab es einen Rückgang<br />
in Höhe von 2 Prozent.<br />
Wie die Infografik aufzeigt,<br />
sank der Wert in Spanien<br />
mit Minus 17,2 Prozent besonders<br />
stark. Das Land<br />
verhängte verhältnismäßig<br />
weitreichende Ausgangsbeschränkungen.<br />
„Die Erhebung macht deutlich,<br />
dass das Erreichen der<br />
Klimaziele mit nationalen<br />
Alleingängen nicht möglich<br />
ist“, so Handelskontor-Herausgeber<br />
Raphael Lulay.<br />
„Während die Bundesrepublik<br />
immer weniger CO2<br />
freisetzt, verhält es sich in<br />
anderen Staaten konträr.<br />
Die Corona-Krise verringerte<br />
den Emissionsausstoß zwar<br />
temporär, allerdings zeichnet<br />
sich bereits wieder eine<br />
Normalisierung ab“.<br />
Nachhaltige Fonds von Erste<br />
Asset Management ausgezeichnet<br />
13 nachhaltige Investmentfonds<br />
der Erste Asset Management<br />
(Erste AM) wurden<br />
mit dem Gütesiegel des<br />
Forum Nachhaltige Geldanlagen<br />
(FNG) ausgezeichnet.<br />
FNG ist der Fachverband<br />
für Nachhaltige Investments<br />
in Deutschland, Österreich,<br />
Liechtenstein und<br />
der Schweiz und stellt den<br />
Qualitätsstandard auf dem<br />
deutschsprachigen Finanzmarkt<br />
dar. Die mit dem Gütesiegel<br />
verbundene Nachhaltigkeits-Zertifizierung<br />
muss<br />
jährlich erneuert werden.<br />
Das FNG-Siegel, das seit 2015<br />
vergeben wird, hat sich über<br />
die vergangenen Jahre als<br />
Standard für nachhaltige<br />
Investmentfonds im Markt<br />
etabliert. <strong>2020</strong> haben sich<br />
177 Fonds beworben, die<br />
Zahl der sich bewerbenden<br />
Fondshäuser stieg von 47 auf<br />
73 zum Vorjahr.<br />
Alle vier in den Bewerb geschickten<br />
Impact Fonds der<br />
Erste Asset Management erhielten<br />
die höchste Auszeichnung<br />
(3 Sterne). Unter Impact<br />
Investing (wirkungs-orientiertes<br />
Investieren) sind Investitionen<br />
in Unternehmen, Organisationen<br />
und Fonds mit<br />
der Absicht, neben einer<br />
finanziellen Rendite messbare,<br />
positive Auswirkungen<br />
auf die Umwelt oder die Gesellschaft<br />
zu erzielen. Der Einfluss<br />
wird sichtbar gemacht,<br />
gemessen und es wird<br />
laufend darüber berichtet.<br />
Der erst im Juli <strong>2020</strong> aufgelegte<br />
Impact Fonds ERSTE<br />
GREEN INVEST wurde mit der<br />
Höchstnote ausgezeichnet.
| WT12-01G |<br />
Glassammel-Peak an den<br />
Feiertagen wird erwartet<br />
30 % mehr Altglas – Hochsaison<br />
für Österreichs Glasrecyclingsystem<br />
rund um<br />
Weihnachten und Neujahr.<br />
Aber Achtung: Nicht jedes<br />
Glas ist recyclingtauglich.<br />
Verbrauch und Recycling<br />
von Glasverpackungen lagen<br />
<strong>2020</strong> überdurchschnittlich<br />
hoch. Austria Glas Recycling<br />
(AGR) rechnet mit<br />
einer Rekordsteigerung von<br />
rund 1.000 Sammel-LKW-<br />
Ladungen im Vergleich zum<br />
Vorjahr.<br />
Immer zum Jahresende<br />
schnellt die Menge erfahrungsgemäß<br />
in die<br />
Höhe. Von Sektflasche bis<br />
Olivenglas, von Saftflasche<br />
bis Marmeladeglas - rund 30<br />
Prozent mehr Altglas als im<br />
Jahresmittel füllen am Jahresende<br />
die Glascontainer.<br />
Zusätzliche Entleerungsfahrten<br />
rund um die Feiertage<br />
sind auch heuer<br />
eingeplant, um Hygiene<br />
und Sauberkeit in Stadt und<br />
Land sicherzustellen.<br />
Gefährliche Silvesterraketen<br />
Harald Hauke, Geschäftsführer<br />
von Austria Glas Recycling<br />
und Vorstand der ARA<br />
AG: „Auch wenn wir heuer<br />
leider zurückhaltend feiern<br />
müssen, gehe ich davon<br />
aus, dass die Glassammelmengen<br />
zu den Festtagen<br />
wie jedes Jahr ansteigen.<br />
Die Abfallwirtschaft und die<br />
Industrie sind jedenfalls gerüstet.<br />
Jede richtig entsorgte<br />
Glasverpackung wird dem<br />
Recycling übergeben. Altglas<br />
ist der wichtigste Rohstoff<br />
für die Glasproduktion.“<br />
Kaputte Glaskugeln, Glasschmuck,<br />
Sektgläser und<br />
andere Glasprodukte gehören<br />
allerdings nicht zum<br />
Altglas. Da sie von anderer<br />
chemischer Zusammensetzung<br />
sind, können sie nicht<br />
gemeinsam mit Verpackungsglas<br />
recycelt werden.<br />
Sie gehören zum Restmüll.<br />
Hauke: „Falsche Glasarten<br />
stören den Recyclingprozess.<br />
Gefährlich wird es,<br />
wenn Silvesterraketen und<br />
sogenannte Kracher im<br />
Altglasbehälter gezündet<br />
werden. Jedes Jahr kommt<br />
es vor, dass Glasbehälter<br />
als Abschussbasen genutzt<br />
werden. Das ist unbedingt<br />
zu unterlassen. Denn es<br />
kann fatale Folgen haben,<br />
wenn der Glasbehälter explodiert<br />
und umherfliegende<br />
Blechteile Verletzungen und<br />
Schaden anrichten.“<br />
Alle Gläser wollen zum Altglas<br />
Verpackungsgläser aus<br />
der Küche wie Pesto- oder<br />
Marmeladegläser, sollen<br />
im Altglas entsorgt werden,<br />
auch wenn Speisereste anhaften.<br />
Hauke: „Der Terminus<br />
Technicus lautet<br />
‚restentleert‘. Ich sage,<br />
ausgelöffelt aber nicht unbedingt<br />
ausgewaschen.<br />
Danke allen, die sorgfältig<br />
Altglas entsorgen und<br />
danke an alle unsere Partner!“<br />
Glasrecycling ist ein<br />
wichtiger Baustein von Kreislaufwirtschaft.<br />
In Österreich wird seit über<br />
40 Jahren Altglas gesammelt<br />
und recycelt - ein wichtiger<br />
Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.<br />
bezahlte Anzeige<br />
Windkraftanlagen noch<br />
effizienter steuern<br />
Mit offener PC- und EtherCAT-basierter<br />
Steuerungstechnik<br />
Pitch-Control<br />
Betriebsführung<br />
Parkvernetzung<br />
Condition Monitoring<br />
www.beckhoff.at/wind<br />
Mit PC- und EtherCAT-based Control bietet Beckhoff die durchgängige,<br />
hocheffiziente Steuerungsplattform für Windkraftanlagen.<br />
Auf dem Industrie-PC mit angereihtem I/O-System und<br />
der Automatisierungssoftware TwinCAT werden alle Funktionen<br />
auf einer einheitlichen Plattform automatisiert: z. B. Betriebsführung,<br />
Pitchregelung, Umrichter-, Getriebe- und Bremsenansteuerung,<br />
Visualisierung bis zur Parkvernetzung. EtherCAT als<br />
schnelles, durchgängiges Kommunikationssystem sorgt dabei<br />
für flexible Topologie und einfache Handhabung. Sicherheitstechnik<br />
und Condition Monitoring werden durch entsprechende<br />
Busklemmen nahtlos in das System integriert; eine gesonderte<br />
CPU entfällt. Ein breites Angebot an Softwaremodulen reduziert<br />
die Engineering- und Inbetriebnahmekosten.<br />
Digital/Analog-I/O<br />
Feldbus-Interfaces<br />
Messtechnik<br />
Condition Monitoring<br />
Sicherheitstechnik
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S6<br />
Technische Regenwasserfilter<br />
für Mikroplastik<br />
Aus unserer unmittelbaren Umgebung gelangen winzige Plastikpartikel ins Meer –<br />
und über die Nahrungskette zu uns zurück. Weltweit verteilt belastet Mikroplastik<br />
Luft, Boden und Wasser. Bei der Suche nach dessen Herkunft gerät Reifenabrieb<br />
in den Fokus. Und der Regenabfluss von Straßen bietet die Möglichkeit, einiges<br />
davon zurückzuhalten. Text: KLAUS W. KÖNIG<br />
HIn der Frankfurter Allgemeinen Zeitung<br />
(FAZ) vom 3. Jänner <strong>2020</strong> schreibt Michaela<br />
Seiser aus Wien unter dem<br />
Titel „Europameister im Versiegeln“ über Österreich,<br />
nirgendwo in Europa werde so viel<br />
fruchtbarer Boden verbaut und zerstört. Dafür<br />
entstünden Möbelhäuser, Baumärkte, Einkaufszentren,<br />
Parkplätze und Straßen. Während<br />
die Bevölkerung Österreichs seit 2001 um<br />
9 Prozent zunahm, sei der Flächenverbrauch<br />
um 25 Prozent bzw. 117.000 Hektar gestiegen,<br />
heißt es im Artikel weiter. Konkret sei damit<br />
eine Fläche fast so groß wie die Ackerfläche<br />
des kompletten Burgenlandes in den zurückliegenden<br />
20 Jahren neu bebaut worden,<br />
wird Kurt Weinberger von der Autorin zitiert. Er<br />
ist Vorstandsvorsitzender der Österreichischen<br />
Hagelversicherung.<br />
Abrieb von Reifen und Fahrbahnen<br />
Österreich verliere laut Weinberger jährlich<br />
0,5 Prozent seiner Ackerfläche, doppelt so<br />
viel wie Deutschland. Auch mit 15 Metern<br />
Straßenlänge je Einwohner belege Österreich<br />
einen europäischen Spitzenplatz. Und<br />
auf diesen Straßen, genauso wie auf Parkplätzen,<br />
Garagenzufahrten, gewerblichen<br />
Ladezonen, sonstigen Verkehrsflächen, sammeln<br />
sich Schadstoffe, die mit dem Regen<br />
abgespült werden. Einer davon ist Mikroplastik<br />
– bisher aus der Diskussion um Kunststoffe<br />
in Verpackungsmaterial oder Kunstrasen auf<br />
Sportplätzen bekannt.<br />
Mikroplastik auf Verkehrsflächen entsteht in der<br />
Hauptsache durch Abrieb von Fahrbahnen<br />
sowie Reifen und gelangt fein verteilt in Luft,<br />
Boden und Oberflächengewässer. Das Behandeln<br />
von Straßenabflüssen, bevor das Wasser<br />
diese Schadstoffe diffus verteilt, verringert den<br />
Eintrag in die Natur. Für Partikel kleiner als 100<br />
μm, das ist fast der gesamte Reifenabrieb,<br />
sind technische Filter erforderlich. Solche Filter<br />
mit adsorbierendem Material sind besonders<br />
wirkungsvoll, wenn zuvor eine Sedimentation<br />
mineralischer Partikel stattgefunden hat.
© Fraunhofer UMSICHT<br />
Mikroplastik ist schwer zu fassen<br />
Die Bereiche, in denen besonders viel Reifenabrieb<br />
entsteht, sind leicht zu identifizieren:<br />
• Kreisverkehre, Ampelbereiche und Beschleunigungsstreifen:<br />
Wo gebremst, angefahren,<br />
beschleunigt wird oder wo enge Radien gefahren<br />
werden, ist der Abrieb von Reifen besonders<br />
intensiv. Bei der zu erwartenden hohen<br />
Mikroplastik-Belastung im Abwasser empfiehlt<br />
sich eine Kombination aus den Verfahren<br />
Sedimentation, Flotation und Filtration mit den<br />
Mall-Komponenten ViaTub und ViaGard.<br />
• Parkplätze von Einkaufszentren, Speditionen,<br />
Industrieareale: Wo nicht schnell gefahren<br />
wird, aber dafür rangiert, entstehen<br />
weniger ganz feine Partikel. Doch fallen auf<br />
diesen Flächen zum Beispiel in verstärktem<br />
Maß auch Kupfer und Zink durch abtropfendes<br />
Wasser von Karosserien an. Die aktuellen<br />
technischen Regeln empfehlen in<br />
solchen Situationen eine Filtrationsstufe mit<br />
speziell dafür geeignetem Adsorptionsmaterial.<br />
Abhilfe kann hier zum Beispiel die Mall-<br />
Anlage ViaGard schaffen.<br />
© Fraunhofer UMSICHT
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S8<br />
Hilfreich ist, wenn die Wartungsintervalle<br />
der Filter so rechtzeitig erfolgen, dass sie<br />
funktionstüchtig bleiben. Welcher Typ von<br />
Sedimentationsanlage mit welchem Typ von<br />
Filter kombiniert wird, hängt sowohl von der<br />
spezifischen Flächenbelastung am Entstehungsort<br />
der Schadstoffe als auch von der<br />
Zumutbarkeit für Boden bzw. Gewässer ab,<br />
in die nach Behandlung eingeleitet wird.<br />
Der Betrieb von Regenwasserbehandlungsanlagen<br />
erfordert laut ÖNORM B 2506 bzw.<br />
ÖWAV-Regelblatt eine regelmäßige Kontrolle<br />
und Wartung. Die Mall GmbH Austria<br />
bietet neben der Lieferung von Behandlungsanlagen<br />
auch die Inspektion und Wartung<br />
als Dienstleistung an.<br />
Eignungsnachweis bei Versickerung<br />
Im ÖWAV-Regelblatt 45 werden die unterschiedlichen<br />
Abflussflächen in fünf Kategorien<br />
eingeteilt. Ab Kategorie 3 und höher<br />
sind Behandlungsanlagen mit der Eignung<br />
als „Bodenpassage“ im Sinne der QZV Chemie<br />
GW zu verwenden. Bei Verwendung von<br />
Elementen grüner Infrastruktur, die weder einem<br />
„Natürlichen Bodenfilter nach ÖNORM<br />
B 2506-2“ entsprechen noch nach ÖNORM<br />
B 2506-3 geprüft werden können, kann die<br />
„Eignung zum Rückhalt der anfallenden<br />
Schadstoffe“ mit einem gesonderten Verfahren<br />
nachgewiesen werden.<br />
„Diese gesonderte Beweisführung ist jedoch<br />
am besten mit den jeweiligen Sachverständigen<br />
bzw. Behörden abzustimmen“, empfiehlt<br />
Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Ertl von<br />
der Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien.<br />
Grundsätzlich können technische Filter ergänzt<br />
werden: In Form einer Aktivkohlematte zur<br />
Rückhaltung von polaren Stoffen oder einer<br />
Substratschicht. Hersteller Mall bietet mit Via-<br />
Fil einen Sickerschacht mit Vorfiltervlies und<br />
Substratschicht, der in drei standardisierten<br />
Varianten angeboten wird: Zur Versickerung<br />
von unbelastetem Niederschlagswasser,<br />
von belastetem Dachflächenabfluss aus mit<br />
Pestizid behandelten Materialien (mit Aktivkohlematten<br />
zur Rückhaltung von polaren<br />
Stoffen) sowie von belastetem Oberflächenabfluss<br />
mit polaren gelösten Stoffen, z. B. aus<br />
Verkehrsflächen.<br />
Literatur zum Thema<br />
• Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Ertl, BOKU<br />
Wien: Überprüfung der Eignung von Versickerungsanlagen<br />
in Österreich. In: Ratgeber<br />
Regenwasser, für Kommunen und Planungsbüros.<br />
Rückhalten, Nutzen, Versickern und<br />
Behandeln von Regenwasser. Siehe die<br />
Seiten 12-13, 8. Auflage. (Hrsg.:) Mall GmbH,<br />
Donaueschingen, <strong>2020</strong>.<br />
LINK-TIPP:<br />
Diese und weitere Informationen sind<br />
erhältlich bei Mall GmbH Austria bzw. hier:<br />
https://www.mall-umweltsysteme.at
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S10<br />
EU forciert Green Deal für Batterien<br />
Die EU-Kommission hat am 10. Dezember <strong>2020</strong> eine neue Batterieverordnung<br />
vorgeschlagen. Durch diese Verordnung soll sichergestellt werden, dass auf<br />
dem EU-Markt befindliche Batterien durchgehend nachhaltig und sicher sind -<br />
und zwar über ihren gesamten Lebenszyklus. So geht Kreislaufwirtschaft.<br />
Batterien und Akkus spielen eine wesentliche<br />
Rolle, um sicherzustellen,<br />
dass viele täglich verwendete Produkte,<br />
Geräte und Dienstleistungen ordnungsgemäß<br />
funktionieren. Sie sind damit<br />
eine unverzichtbare Energiequelle in unserer<br />
Gesellschaft. Jedes Jahr werden ungefähr<br />
800.000 Tonnen Autobatterien, 190.000 Tonnen<br />
Industriebatterien und 160.000 Tonnen<br />
Verbraucherbatterien in die Europäische<br />
Union eingeführt.<br />
Sammlung und Recycling mangelhaft<br />
Nicht alle diese Batterien werden ordnungsgemäß<br />
gesammelt und am Ende ihres<br />
Lebens recycelt. Dies erhöht das Risiko der<br />
Freisetzung gefährlicher Substanzen und<br />
stellt eine Verschwendung von Ressourcen<br />
dar. Viele der Komponenten von Batterien<br />
und Akkus könnten recycelt werden und<br />
damit die Freisetzung gefährlicher Stoffe<br />
in die Umwelt vermieden werden. Zudem<br />
könnten wertvolle Materialien zu wichtigen<br />
Produkten und Produktionsprozessen in Europa<br />
bereitgestellt werden.<br />
Die EU-Gesetzgebung zu Altbatterien ist in<br />
der Batterierichtlinie verankert. Sie beabsichtigt<br />
zum Schutz, zur Erhaltung und Verbesserung<br />
der Umweltqualität durch die Minimierung<br />
der negativen Auswirkungen von<br />
Batterien und Akkus und Altbatterien und<br />
Akkus beizutragen. Und sie sorgt auch für<br />
das reibungslose Funktionieren des EU-Binnenmarktes<br />
durch die Harmonisierung der<br />
Anforderungen hinsichtlich des Inverkehrbringens<br />
von Batterien und Akkumulatoren.<br />
Mit einigen Ausnahmen gilt dies für alle Batterien<br />
und Akkus, unabhängig von den darin<br />
verwendeten Chemikalien, von der Natur,<br />
Größe oder des Designs der Produkte.<br />
Neue Batterierichtlinie<br />
Die Europäische Kommission will eine Modernisierung<br />
der EU-Rechtsvorschriften für Bat-<br />
terien vorantreiben und setzt damit ihre erste<br />
Initiative im Rahmen der im neuen Aktionsplan<br />
für die Kreislaufwirtschaft angekündigten<br />
Maßnahmen um Batterien. Diese sollen über<br />
ihren gesamten Lebenszyklus nachhaltiger<br />
sein und sind von entscheidender Bedeutung<br />
für die Verwirklichung der Ziele des europäischen<br />
Grünen Deals. So soll zum Null-Schadstoff-Ziel<br />
beigetragen werden.<br />
Der Green Deal fördert eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit<br />
und ist für grünen Verkehr<br />
und saubere Energie ebenso erforderlich<br />
wie für die Erreichung der Klimaneutralität bis<br />
2050. Der Vorschlag zur Batterierichtlinie befasst<br />
sich mit den sozialen, wirtschaftlichen<br />
und ökologischen Fragen im Zusammenhang<br />
mit allen Typen von Batterien.<br />
Batterien, die in der EU in Verkehr gebracht<br />
werden, sollten über ihren gesamten Lebenszyklus<br />
nachhaltig, leistungsfähig und sicher<br />
sein. Das heißt, dass Batterien mit möglichst<br />
geringen Umweltauswirkungen aus Materialien<br />
hergestellt werden, die unter vollständiger<br />
Einhaltung der Menschenrechte sowie<br />
sozialer und ökologischer Standards gewonnen<br />
wurden. Batterien müssen langlebig und<br />
sicher sein und am Ende ihrer Lebensdauer<br />
sollten sie umgenutzt, wiederaufbereitet<br />
oder recycelt werden, sodass wertvolle Materialien<br />
in die Wirtschaft zurückfließen.<br />
Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit in Europa<br />
Die Kommission schlägt verbindliche Anforderungen<br />
für alle Batterien (d. h. Industrie-,<br />
Starter-, Traktions- und Gerätebatterien) vor,<br />
die in der EU in Verkehr gebracht werden.<br />
Für die Entwicklung einer nachhaltigeren<br />
und wettbewerbsfähigeren Batterieindustrie<br />
in Europa und weltweit sind Anforderungen<br />
wie die Verwendung verantwortungsvoll beschaffter<br />
Materialien mit begrenztem Einsatz<br />
gefährlicher Stoffe, ein Mindestgehalt an<br />
recyceltem Material und ein kleiner CO2-<br />
Fußabdruck, Leistung, Haltbarkeit und Ken-
nzeichnung sowie die Erfüllung der Sammelund<br />
Recyclingvorgaben von wesentlicher<br />
Bedeutung.<br />
Die Schaffung von Rechtssicherheit wird<br />
zusätzlich zur Mobilisierung umfangreicher<br />
Investitionen und zur Steigerung der Produktionskapazität<br />
für innovative und nachhaltige<br />
Batterien nicht nur in Europa beitragen,<br />
um auf den rasch wachsenden Markt<br />
zu reagieren.<br />
Weniger Umweltauswirkungen von Batterie<br />
Die von der Kommission vorgeschlagenen<br />
Maßnahmen werden die Verwirklichung der<br />
Klimaneutralität bis 2050 erleichtern. Bessere<br />
und leistungsfähigere Batterien werden einen<br />
wichtigen Beitrag zur Elektrifizierung des<br />
Straßenverkehrs leisten, sodass die Emissionen<br />
aus diesem Bereich erheblich sinken werden<br />
und die Verbreitung von Elektrofahrzeugen<br />
steigen wird. Außerdem lässt sich mit ihrer Hilfe<br />
der Anteil erneuerbarer Energiequellen am<br />
Energiemix der EU leichter erhöhen.<br />
Mit diesem Vorschlag will die Kommission<br />
ferner die Kreislaufwirtschaft in den Batterie-<br />
Wertschöpfungsketten und eine effizientere<br />
Ressourcennutzung fördern, sodass sich Batterien<br />
so wenig wie möglich auf die Umwelt<br />
auswirken. Ab dem 1. Juli 2024 dürfen nur<br />
noch wiederaufladbare Industrie- und Traktionsbatterien<br />
in Verkehr gebracht werden,<br />
für die eine Erklärung zum CO2-Fußabdruck<br />
erstellt wurde. Um die Lücken im Kreislauf<br />
zu schließen und wertvolle Materialien, die<br />
in Batterien verwendet werden, so lange<br />
wie möglich in der europäischen Wirtschaft<br />
zu halten, schlägt die Kommission neue Anforderungen<br />
und Zielvorgaben für den Gehalt<br />
an recycelten Materialien sowie für die<br />
Sammlung, Behandlung und das Recycling<br />
von Batterien am Ende der Lebensdauer vor.<br />
Dadurch würde sichergestellt, dass Industrie-,<br />
Starter- oder Traktionsbatterien nach<br />
ihrer Nutzungsdauer der Wirtschaft nicht verloren<br />
gehen.<br />
Um die Sammlung und das Recycling von<br />
Gerätebatterien erheblich zu verbessern,<br />
sollte die derzeitige Sammelquote von 45<br />
% auf 65 % im Jahr 2025 und 70 % im Jahr<br />
2030 steigen, damit die Materialien für Batterien,<br />
die wir zu Hause verwenden, für die<br />
Wirtschaft nicht verloren gehen.<br />
Andere Batterien – Industrie-, Starter- oder<br />
Traktionsbatterien – müssen ohne Ausnahme<br />
gesammelt werden. Alle gesammelten Batterien<br />
müssen recycelt und ein hoher Verwertungsgrad<br />
erreicht werden, insbesondere<br />
bei wertvollen Materialien wie Kobalt, Lithium,<br />
Nickel und Blei.<br />
In der vorgeschlagenen Verordnung wird ein<br />
Rahmen festgelegt, der die Umnutzung von
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S12<br />
Batterien aus Elektrofahrzeugen erleichtert,<br />
damit sie beispielsweise als stationäre Energiespeichersysteme<br />
weiter zum Einsatz kommen<br />
oder als Energieressourcen in Stromnetze<br />
integriert werden können.<br />
Der Einsatz neuer IT-Technologien, insbesondere<br />
des Batteriepasses und des vernetzten<br />
Datenraums, wird für einen sicheren Datenaustausch,<br />
die größere Transparenz des<br />
Batteriemarkts und die Rückverfolgbarkeit<br />
großer Batterien während ihres gesamten<br />
Lebenszyklus wesentlich sein. Die Technologien<br />
werden es den Herstellern ermöglichen,<br />
innovative Produkte und Dienstleistungen im<br />
Rahmen der parallelen grünen und digitalen<br />
Wende zu entwickeln.<br />
Mit ihren neuen Nachhaltigkeitsstandards für<br />
Batterien wird die Kommission auch weltweit<br />
den grünen Wandel fördern und ein Konzept<br />
für weitere Initiativen im Rahmen ihrer nachhaltigen<br />
Produktpolitik aufstellen.<br />
Äußerungen der Mitglieder der Kommission<br />
Der für den europäischen Grünen Deal<br />
zuständige Exekutiv-Vizepräsident Frans Timmermans<br />
erklärte: „Saubere Energie ist der<br />
Schlüssel zum europäischen Grünen Deal,<br />
dabei sollte unsere zunehmende Abhängigkeit<br />
von Batterien beispielsweise im Verkehr<br />
der Umwelt nicht schaden. Die neue Batterie-<br />
Verordnung wird dazu beitragen, die ökologischen<br />
und sozialen Auswirkungen aller Batterien<br />
über ihren gesamten Lebenszyklus zu<br />
verringern. Der heutige Vorschlag ermöglicht<br />
es der EU, die Verwendung und Herstellung<br />
von Batterien auf sichere, kreislauforientierte<br />
und gesunde Weise auszuweiten.“<br />
Maroš Šefčovič, Vizepräsident für Interinstitutionelle<br />
Beziehungen, sagte: „Die Kommission<br />
legt einen neuen zukunftsfähigen<br />
Rechtsrahmen für Batterien vor, mit dem sie<br />
dafür sorgen will, dass es nur die umweltfreundlichsten,<br />
leistungsfähigsten und sichersten<br />
Batterien auf den EU-Markt schaffen.<br />
Dieser ehrgeizige Rahmen für die transparente<br />
und ethische Beschaffung von Rohstoffen,<br />
den CO2-Fußabdruck von Batterien und<br />
das Recycling ist ein wesentliches Element,<br />
um in diesem kritischen Sektor eine offene<br />
strategische Autonomie zu erreichen und<br />
unsere Arbeit im Rahmen der Europäischen<br />
Batterie-Allianz zu beschleunigen.“<br />
Der für Umwelt, Meere und Fischerei<br />
zuständige Kommissar Virginijus Sinkevičius<br />
erklärte:„Mit diesem innovativen Vorschlag<br />
der EU für nachhaltige Batterien geben wir
der Kreislaufwirtschaft den ersten großen<br />
Impuls im Rahmen unseres neuen Aktionsplans<br />
für die Kreislaufwirtschaft. Batterien<br />
sind von entscheidender Bedeutung für<br />
Schlüsselbereiche unserer Wirtschaft und<br />
Gesellschaft wie Mobilität, Energie und Kommunikation.<br />
Dieses zukunftsorientierte Legislativinstrumentarium<br />
wird die Nachhaltigkeit<br />
von Batterien in jeder Phase ihres Lebenszyklus<br />
verbessern. Batterien enthalten große<br />
Mengen an wertvollen Materialien, und wir<br />
wollen sicherstellen, dass keine Batterie einfach<br />
in den Müll wandert. Mit ihren steigenden<br />
Zahlen auf dem EU-Markt müssen Batterien<br />
gleichzeitig nachhaltiger werden.“<br />
Der für den Binnenmarkt zuständige Kommissar<br />
Thierry Breton sagte: „Europa muss seine<br />
strategische Kapazität im Bereich neuer und<br />
grundlegender Technologien wie Batterien,<br />
die für unsere industrielle Wettbewerbsfähigkeit<br />
und die Verwirklichung unserer grünen<br />
Ziele unerlässlich sind, ausbauen. Mit Investitionen<br />
und den richtigen politischen Anreizen<br />
– einschließlich des heutigen Vorschlags<br />
für einen neuen Rechtsrahmen – tragen wir<br />
dazu bei, die gesamte Wertschöpfungskette<br />
für Batterien in der EU zu etablieren, von<br />
Rohstoffen und Chemikalien über Elektromobilität<br />
bis hin zum Recycling.“<br />
Hintergrund<br />
Seit 2006 werden Batterien und Altbatterien<br />
auf EU-Ebene durch die Batterien-Richtlinie<br />
(2006/66/EG) geregelt. Aufgrund geänderter<br />
sozioökonomischer Bedingungen, wegen<br />
der gegebenen technologischen Entwicklungen,<br />
der veränderten Märkte sowie der<br />
sich ändernden Arten der Verwendung von<br />
Batterien ist laut EU-Kommission eine Modernisierung<br />
des Rechtsrahmens erforderlich.<br />
Dazu wurde nun ein Ent-wurf für eine neue<br />
Batterieverordnung vorgelegt.<br />
Die Nachfrage nach Batterien wächst rasch<br />
und dürfte bis 2030 um das 14fache steigen.<br />
Ausschlaggebend hierfür ist vor allem die<br />
Elektromobilität, die diesen Markt weltweit<br />
zunehmend an strategischer Bedeutung<br />
gewinnen lässt. Eine derartige weltweit exponenziell<br />
zunehmende Nachfrage nach<br />
Batterien wird zu einem entsprechenden<br />
Anstieg der Nachfrage nach Rohstoffen führen,<br />
deren Umweltauswirkungen in der Folge<br />
minimiert werden müssen.<br />
LINK-TIPP:<br />
Weitere Informationen finden Sie hier:<br />
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_20_2359<br />
https://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S14<br />
Viel frischer Wind beim Windenergie<br />
Symposium AWES <strong>2020</strong><br />
Alljährlich treffen sich Experten aus der Windenergie-Branche zur Diskussion - dieses<br />
Mal fand das österreichische Windenergie Symposium AWES <strong>2020</strong> rein virtuell statt.<br />
Die Themen waren ungebrochen spannend und die Dringlichkeit politischen Handelns<br />
wurde nicht nur von Umweltökonom Gernot Wagner eingemahnt.<br />
Ende November versammelte sich die<br />
Windbranche im digitalen Raum und<br />
diskutierte anlässlich des 14. Wind Energy<br />
Symposiums AWES <strong>2020</strong> über fachliche<br />
Themen und über die dringende Notwendigkeit<br />
neuer politischer Rahmenbedingungen.<br />
So fordert auch Sigrid Stagl, Professorin der<br />
Wirtschaftsuniversität Wien: „Wir müssen weg<br />
von den Ankündigungen und hin zum Tun.“<br />
Mit über 500 Teilnehmern war die Branchenveranstaltung<br />
noch nie so gut besucht wie<br />
diesmal. Bei 18 Präsentationsständen zeigten<br />
Firmen der Windbranche ihre Angebote und<br />
Leistungen und konnten auch digital mit den<br />
Besuchern Details zu den Produkten erörtern.<br />
Mehr als 1.000 Mal wurden die Präsentationsstände<br />
von Teilnehmern des AWES besucht.<br />
Auf zwei digitalen Bühnen konnte sich die<br />
Branche über aktuelle Themen der Windenergie<br />
informieren und an über 70 Diskutanten<br />
am Podium ihre Fragen stellen, die geschickt<br />
von führenden Journalisten des Landes in die<br />
Diskussion eingebunden wurden. „Trotzt der<br />
schwierigen Umstände, die uns der Lock Down<br />
in der Pandemie beschert hat, war die Veranstaltung<br />
ein voller Erfolg“, freut sich Stefan Moidl,<br />
Geschäftsführer der IG Windkraft.<br />
Es braucht eine europäische Zulieferbranche<br />
In Österreich arbeiten mehr als 180 Firmen in<br />
der Windbranche. Beinahe jeder Teil eines<br />
Windrades wird auch in Österreich hergestellt.<br />
Einige Firmen sind sogar Weltmarktführer in<br />
ihrem Segment. Damit diese Firmen am Weltmarkt<br />
reüssieren können, ist auch der Ausbau<br />
der Windkraft im Heimmarkt wichtig. „Es macht<br />
auch für einen Zulieferbetrieb, der seine Produkte<br />
international vermarktet, einen großen<br />
Unterschied ob ein Land als windkraftfreundliches<br />
Land vom Ausland aus wahrgenommen<br />
wird oder nicht“, erklärt Bernhard Zangerl von<br />
Bachmann electronic aus Vorarlberg. Besonders<br />
auch für die Forschung und Entwicklung<br />
ist eine funktionierende Zulieferbranche von<br />
größter Bedeutung. „Forschung zu betreiben<br />
über Produkte, wo die Produktion auf einem<br />
anderen Kontinent liegt, ist eine große Herausforderung“,<br />
erklärt Roland Stör von WINDnovation:<br />
„Die Produktion in Europa zu halten ist ein<br />
wichtiger Faktor um Innovation und technologischen<br />
Fortschritt langfristig zu erhalten.“<br />
„Bei Corona haben wir gesehen, dass es von<br />
Vorteil ist, wenn wir Produkte vor Ort produzieren,<br />
anstatt alles importieren. Dies trifft auch<br />
auf die Windbranche zu. Die Innovation müssen<br />
wir in Europa halten, damit die Wertschöpfung<br />
in Europa bleiben kann“, betont Moidl.<br />
Auch bei der Diskussionsrunde der Windkrafthersteller<br />
herrschte Konsens, dass die Branche<br />
stabile Rahmenbedingungen braucht.<br />
„Besonders wenn es um die Sektorkopplung<br />
geht, die wir für die Klimaneutralität 2040 dringend<br />
benötigen“, bemerkt Bernhard Fürnsinn<br />
von der IG Windkraft.<br />
Neben technischen Fragestellungen der<br />
Windenergie waren aber auch die politischen<br />
Rahmenbedingungen ganz oben auf der<br />
Themenliste des Symposiums. Sowohl bei der<br />
Diskussionsrunde der Energie- und Umweltsprecher<br />
der Parteien, aber auch bei jenen<br />
von hochkarätigen Fachpersonen aus Europa<br />
und Übersee wurde besonders deutlich,<br />
dass die politisch gesetzten Ziele nun endlich<br />
mit konkreten Maßnahmen umgesetzt wer-
den müssen. „Weg von den Ankündigungen<br />
und hin zum Tun“ forderte auch Sigrid Stagl,<br />
Professorin der Wirtschaftsuniversität Wien<br />
und setzt fort: „Es müssen sich alle Sektoren<br />
und alle Akteure am Riemen reißen und jetzt<br />
handeln.“ Dem stimmt auch Gernot Wagner,<br />
Umweltökonom von der New York University<br />
zu: „Ohne Politik geht bei Covid-19 wenig<br />
und ohne Politik geht auch beim Klimaschutz<br />
nichts.“ Österreich hat sich das Ziel gesetzt bis<br />
2030 eine Stromversorgung mit 100 Prozent<br />
erneuerbarer Energien zu erreichen und bis<br />
2040 zur Gänze klimaneutral zu sein.<br />
Bundesländer und Gemeinden einbinden<br />
Die Europäische Union ist gerade dabei seine<br />
Klimaschutzziele anzuheben. Österreich<br />
hat mit dem Ziel bis 2040 klimaneutral zu sein,<br />
die Verschärfung der Ziele schon vorweggenommen.<br />
Damit die Ziele aber auch erreicht<br />
werden können, sind die Bundesländer und<br />
Gemeinden gefordert, jetzt aktiv zu werden<br />
und ebenfalls Konzepte für ein klimaneutrales<br />
Bundesland, oder eine klimaneutrale<br />
Gemeinde, zu entwickeln. „Für eine naturverträgliche<br />
Energiewende brauchen wir ein<br />
gemeinsames Voranschreiten der Gemeinden,<br />
Bundesländer und des Bundes“, fordert<br />
auch Karl Schellmann, Klima-und Energiesprecher<br />
vom WWF. „Dies betrifft auch klare Ausbaupläne<br />
für die erneuerbaren Energien, damit<br />
die Ziele erreicht werden können“, ergänzt<br />
Hans Winkelmeier vom Energiewerkstatt Verein<br />
und Hans-Dieter Kettwig, Geschäftsführer<br />
von ENERCON setzt fort: „Ob man die nationalen<br />
Ausbauziele nimmt oder deren Summe<br />
auf EU-Ebene oder die globalen Klimaziele<br />
aus dem Pariser Abkommen – stets wird klar:<br />
Ohne einen substanziellen Ausbau der Onshore<br />
Windenergie sind alle Energiewendepläne<br />
und mithin alle Klimaschutzziele Makulatur.“<br />
EAG als Nagelprobe der Klimapolitik<br />
Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) soll<br />
Anfang nächsten Jahres im Parlament beschlossen<br />
werden. „Das EAG muss für die erneuerbaren<br />
Branche endlich stabile Bedingungen<br />
zur Verfügung stellen, und das nicht<br />
für ein Jahr, sondern für die nächsten zehn<br />
Jahre“, fordert Moidl: „Dabei sollten wir nicht<br />
dieselben Fehler machen, die in den letzten<br />
Jahren in Deutschland passiert sind.“ Heiko<br />
Messerschmidt, von der IG Metall Bezirk Küste<br />
aus Deutschland ergänzt: „Unsere Sorge ist,<br />
dass die rund 30.000 Arbeitsplätze,<br />
die in der Windbranche<br />
verloren gingen, nicht<br />
wiederkommen. Das kann<br />
man nicht aus und wieder<br />
anschalten. Es braucht hier<br />
eine Kontinuität, die wir derzeit<br />
nicht haben.“<br />
Auch Daniela Kletzan-Slamanig<br />
vom WIFO stößt in<br />
dasselbe Horn: „Eine Stop-<br />
And-Go Politik bringt Arbeitsplatzverluste<br />
und die<br />
Abwanderung von Knowhow.<br />
Klimaschutz ist kein<br />
Add-On, sondern muss<br />
endlich umfassend gedacht<br />
und umgesetzt werden.“<br />
Stefan Moidl hofft in<br />
diesem Zusammenhang<br />
auf ein EAG, das die nötigen<br />
Rahmenbedingungen<br />
für die dringend nötige<br />
Energiewende schafft.<br />
LINK-TIPP<br />
Einen Rückblick zum AWES <strong>2020</strong> gibt es hier:<br />
https://eventmaker.at/interessengemeinschaft_windkraft_oesterreichigw/awes_<strong>2020</strong>_-_14_oesterreichisches_windenergie_symposium
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S16<br />
Nach dem letzten Dreh<br />
Mit dem Wegfall der EEG-Förderung werden zahlreiche Windenergieanlagen abgerissen.<br />
Damit kommen auf die Entsorgungsbrache große Mengen glasfaserverstärkte<br />
Kunststoffe (GFK) zu. Das könnte zu Recyclingengpässen führen. Ein Bremer<br />
Spezialist bietet schon seit fünf Jahren eine Lösung an.<br />
Zum Jahreswechsel wird es ernst: In<br />
Deutschland fallen zahlreiche Windenergieanlagen<br />
aus der staatlichen<br />
Förderung – einige werden wohl ihre Rotorblätter<br />
für immer abstellen. Hintergrund ist<br />
das Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG),<br />
das den Windpark-Betreibern grundsätzlich<br />
eine feste Einspeisevergütung gewährt. Diese<br />
Finanzspritze, die im Jahr 2000 eingeführt<br />
wurde, gilt allerdings nur für 20 Jahre und<br />
wird daher im Jahr 2021 erstmals für einige<br />
Anlagen auslaufen. Der Branchenverband<br />
WindEnergie rechnet damit, dass davon eine<br />
Altanlagenleistung von bis zu vier Gigawatt<br />
betroffen ist.<br />
Lohnt sich der Weiterbetrieb ohne die finanzielle<br />
Unterstützung nicht mehr und kommt<br />
ein Verkauf, beispielsweise ins Ausland, nicht<br />
in Frage, müssen die Anlagen demontiert und<br />
verwertet werden. Das Umweltbundesamt<br />
(UBA) sieht dabei auf den deutschen Entsorgungsmarkt<br />
einiges an Abfällen zukommen.<br />
In einer Studie geht das UBA davon aus, dass<br />
falls alle Windkraftanlagen, die aus der Förderung<br />
fallen, auch rückgebaut werden, allein<br />
im Jahr 2021 etwa 3,2 Millionen Tonnen<br />
Beton, 850.000 Tonnen Stahl, 25.500 Tonnen<br />
Elektronik-Schrott, etwas über 12.000 Tonnen<br />
Kupfer und rund 2.000 Tonnen Aluminium anfallen.<br />
Dazu kommen nochmal etwa 51.000<br />
Tonnen glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK),<br />
aus denen ein Großteil der Rotorblätter gefertigt<br />
ist. In den kommenden Jahren könnten<br />
diese Mengen noch deutlich steigen.<br />
Auch in Österreich erreichen jährlich einige<br />
Windkraftanlagen das Ende ihrer Wirtschaftlichkeit.<br />
Das Pendant zur deutschen EEG-Förderung<br />
– die Unterstützung durch das Ökostromgesetz<br />
– ist hier auf maximal 13 Jahre<br />
festgelegt. Prognosen oder Untersuchungen<br />
zu den konkreten Abfallmengen gibt es allerdings<br />
nicht.<br />
Während für Beton, E-Schrott und die Metalle<br />
aus den Windkraftanlagen längst ausreichend<br />
Verwertungswege und -kapazitäten<br />
vorhanden sind, gibt es für die GFK-Abfälle<br />
noch kaum Recyclingmöglichkeiten. Das<br />
Problem: Die mechanische Trennung der<br />
Verbundmaterialien ist sehr kompliziert, für
eine Verbrennung sind der Heizwert und der<br />
Aschegehalt viel zu hoch. Das UBA warnt hier<br />
vor massiven Verwertungsengpässen.<br />
Eine Lösung für das Recyclingproblem der<br />
Rotorblätter bietet bereits seit fünf Jahren<br />
der Bremer Spezialist neocomp GmbH an,<br />
ein von der Nehlsen Gruppe und dem Recyclingunternehmen<br />
neowa GmbH gemeinschaftlich<br />
gegründeter Betrieb für die<br />
stoffliche Verwertung von glasfaserverstärkten<br />
Kunststoffen. „Bei unserem Zero-Waste-<br />
Verfahren werden alle GFK-Abfälle für die<br />
Zementindustrie aufbereitet und dort vollständig<br />
thermisch oder stofflich verwertet“,<br />
sagt neocomp-Geschäftsführer Frank J. Kroll.<br />
„Unsere europaweit einzigartige Technologie<br />
wurde im Jahr 2017 zudem mit dem Green-<br />
Tec Award ausgezeichnet“.<br />
Jährlich werden bei neocomp derzeit etwa<br />
30.000 Tonnen an Rohstoffsubstituten produziert.<br />
„Etwas mehr als die Hälfte dabei sind<br />
Produktionsabfälle, der Rest stammt unter anderem<br />
aus der Windenergie-Branche“, sagt<br />
Kroll. „Alleine aus dem Windpark ‚Nordsee-<br />
Ost‘ haben wir 72 Offshore-Rotorblätter mit einem<br />
Umfang von ca. 1.600 Tonnen recycelt.“<br />
Soll ein Rotorblatt bei den Bremern recycelt<br />
werden, wird es noch vor Ort auf der Baustelle<br />
in transportfähige Längen geschnitten und<br />
anschließend in die Hansestadt gebracht.<br />
Dort startet ein mehrstufiger Prozess, bei dem<br />
den GFK-Abfällen zunächst Reststoffe aus<br />
der Papierindustrie zugemischt werden. „Anschließend<br />
wird der Materialmix in einen Vorzerkleinerer<br />
geladen und im nächsten Schritt<br />
in einem Querstromzerspaner fein aufgemahlen“,<br />
erklärt Kroll. „Am Ende erhalten wir ein<br />
Rohstoffsubstitut mit einer Körnung, die kleiner<br />
als 40 Millimeter ist.“<br />
zur GFK-Abfällen sowie die hohe Nachfrage<br />
nach den Ersatzstoffen am Markt planen wir<br />
schon jetzt den Ausbau der internen Kapazitäten<br />
und knüpft Kontakte zu weiteren Branchen<br />
als Abnehmer der Ersatzstoffe“, sagt<br />
Kroll. „Unter anderem führen wir konkrete Gespräche<br />
mit Österreich wegen des Ausbaus<br />
der Kapazitäten für Zentraleuropa und Süddeutschland.“<br />
Für die prognostizierten Abfallmengen<br />
aus stillgelegten Rotorblättern fühlen<br />
sich die Bremer jedenfalls gerüstet.<br />
Dennoch bleibt das Recycling von Rotorblättern<br />
ein Thema, das weiterer innovativer<br />
Ideen bedarf. Nicht zuletzt, weil künftig auch<br />
immer mehr carbonfaserverstärkte Kunststoffe<br />
(CFK) anfallen werden, für die es bisher<br />
kaum Verwertungswege gibt.<br />
Aktuell stellt neocomp etwa 100 Tonnen dieses<br />
Substitutes pro Tag her. Dieser wird dann<br />
in der Zementklinkerindustrie eingesetzt, wo<br />
er fossilen Brennstoff sowie Kohlen und Sand<br />
für die Zementherstellung ersetzen kann. „Das<br />
im GFK enthaltene und im Ersatzstoff verbleibende<br />
Silizium ist ein wichtiger Rohstoff für die<br />
Zementproduktion“, sagt Kroll.<br />
Bei den hundert Tonnen EBS täglich soll es<br />
aber nicht bleiben. „Mit Blick auf Prognosen
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S18<br />
Antriebslösung spart Platz und<br />
Gewicht für die Azimut-Steuerung<br />
Gut bedienbare Steuerelemente sind bei der Windkraft das Um und Auf. Das<br />
deutsche Unternehmen Beckhoff stellt ein dezentrales Servoantriebssystem für<br />
die Gondelverstellung bei Windenergieanlagen her.<br />
Das dezentrale Servoantriebssystem<br />
AMP8000 des deutschenb Herstellers<br />
Beckhoff eignet sich ideal für die<br />
Verstellung der Gondel einer Windenergieanlage<br />
(WEA). Das AMP8000 integriert den<br />
Servoantrieb direkt in den Servomotor der<br />
Windanlage, und das in sehr kompakter<br />
Bauform. Durch diese Verlagerung der Leistungselektronik<br />
reduzieren sich der Platzbedarf<br />
im Schaltschrank und die Verkabelung.<br />
Das Ergebnis: eine signifikante Einsparung<br />
von Gewicht, Bauvolumen, Material und<br />
Installationsaufwand. Zudem lassen sich die<br />
Lasten und somit der Verschleiß für die wartungsintensiven<br />
hydraulischen Bremssysteme<br />
deutlich reduzieren und dadurch die Effizienz<br />
und Sicherheit gegenüber konventionellen<br />
Yaw-Lösungen erhöhen.<br />
Mit der PC-basierten Steuerungstechnik lassen<br />
sich komplette Windparks optimieren. Dafür<br />
steht der gesamte und durchgängige Komponentenbaukasten<br />
von Beckhoff zur Verfügung,<br />
vom TwinCAT Wind Framework über die<br />
ultraschnelle EtherCAT-Kommunikation und<br />
ein leistungsfähiges Condition Monitoring bis<br />
hin zum AMP8000 als Antriebslösung für die<br />
Azimut-Steuerung.<br />
Geräusche und Verschleiß reduzieren<br />
Für die horizontale Ausrichtung und das Arretieren<br />
der WEA-Gondel werden neben<br />
den elektrischen Antrieben typischerweise<br />
auch hydraulische Bremssysteme eingesetzt,<br />
die während der Windnachführung ein Gegenmoment<br />
zum elektrischen Antrieb stellen.<br />
Durch die permanente Nutzung des<br />
© Beckhoff
Bremsaggregats bei der aktiven Windnachführung<br />
entstehen neben störenden Geräuschen<br />
ein ständiger Abrieb und Verschleiß<br />
im Azimut-System und daraus folgend ein<br />
hoher Wartungs- und Serviceaufwand. Verschleißärmer<br />
und effizienter ist die Nutzung<br />
der ohnehin vorhandenen elektrischen<br />
Antriebe zum Aufbau des erforderlichen Gegenmoments<br />
und Verspannen der Mechanik.<br />
So lässt sich mit dem AMP8000 die erforderliche<br />
Bremsleistung bzw. Steifigkeit mit einer<br />
optimalen Drehmomentaufteilung direkt im<br />
elektrischen Antriebssystem umsetzen.<br />
Dezentrales Antriebsystem spart Platz<br />
Moderne Windkraftanlagen bieten immer<br />
weniger Platz für Schaltschränke; vor allem<br />
in der Gondel muss zusätzliches Gewicht<br />
und Volumen vermieden werden. Mit dem<br />
AMP8000 reduziert sich der Platzbedarf für<br />
den Antrieb im Schaltschrank deutlich. Durch<br />
Einsatz des neuen IP-65-Versorgungsmoduls<br />
AMP8620 kann der Platzbedarf für den<br />
Antrieb im Schaltschrank sogar komplett entfallen.<br />
Denn das AMP8620-Modul wird direkt<br />
an das Versorgungsnetz angeschlossen und<br />
enthält alle hierfür benötigten Schaltungsteile<br />
wie Netzfilter, Gleichrichter und Ladeschaltung<br />
für die integrierten Zwischenkreiskondensatoren.<br />
Per EtherCAT P, also über ein Kabel für Ether-<br />
CAT und Power, kann das Versorgungsmodul<br />
je nach Leistungsbedarf bis zu fünf dezentrale<br />
Servoantriebe AMP8000 ansteuern. Vorkonfektionierte<br />
Anschlussleitungen erleichtern<br />
die Logistik erheblich und minimieren die Fehler<br />
während der Verdrahtung. Die Verkabelung<br />
der Motoren und der Montageaufwand<br />
werden zudem deutlich reduziert.<br />
LINK-TIPP<br />
Zum Produkt geht es hier:<br />
www.beckhoff.de/amp8000<br />
qualityaustria Aus- und Weiterbildungen<br />
Trainieren Sie für Ihren Erfolg!<br />
www.qualityaustria.com/kursprogramm
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S20<br />
Recy & DepoTech findet hybrid statt<br />
Trotz Corona wird das Team des Lehrstuhls für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft<br />
die international beliebte und etablierte wissenschaftliche Fachkonferenz<br />
Recy & DepoTech von 18. bis 20. November veranstalten.<br />
Aus einer ansonsten rein<br />
physischen Konferenz mit<br />
rund 500 TeilnehmerInnen<br />
wird aus der Recy & Deppo-<br />
Tech <strong>2020</strong> eine Hybrid Konferenz.<br />
Dabei wird uns als kompetenter<br />
Partner das Unternehmen meetyoo,<br />
ein führender Anbieter für<br />
digitale Events und virtuelle Konferenzen<br />
in Europa, begleiten.<br />
Oberste Priorität ist für die langjährigen<br />
und potenziellen Partnern aus Wissenschaft,<br />
Wirtschaft, Öffentlichkeit und Politik<br />
die gewohnte Qualität der Beiträge und<br />
Vorträge trotz den erschwerten Rahmenbedingungen<br />
aufrecht zu erhalten und die<br />
Recy & DepoTech als wichtige<br />
Plattform für aktuelle Themen der<br />
Abfallwirtschaft auch in diesem<br />
Jahr stattfinden zu lassen.<br />
Wie auch in den letzten Jahren<br />
wird die Veranstaltung auch<br />
diesmal getragen und gestaltet<br />
von den ProgrammgestalterInnen,<br />
den ReferentInnen, AutorInnen,<br />
Chairperson, DiskutantInnen,<br />
TeilnehmerInnen sowie<br />
natürlich unseren Sponsoren.<br />
Der Ablauf der diesjährigen Recy & Depo-<br />
Tech wird demnach wie folgt aussehen:<br />
Am Mittwoch den 18.11.<strong>2020</strong> wird es die
einzigen physischen Programmpunkte<br />
in Leoben für<br />
eine begrenzte Teilnehmerzahl<br />
von maximal 199 Personen<br />
geben. Das sind die<br />
Eröffnung, die Plenarvorträge,<br />
der Abfall-Disput, und<br />
der Top of Circular Solution<br />
Start-Up (Start Ups & Ideen<br />
stellen sich vor). Das Live-<br />
Programm wird mittels Live-<br />
Stream in unsere virtuelle<br />
Konferenzwelt bei meetyoo<br />
übertragen.<br />
Übersicht Programmpunkte<br />
am Mittwoch den<br />
18.11.<strong>2020</strong><br />
• Begrüßung/Eröffnung mit<br />
Live-Stream<br />
• Festvortrag und Plenarvorträge<br />
mit Live-Stream<br />
• ISWA-Preisverleihung mit<br />
Live-Stream<br />
• Abfall-Disput zum Thema<br />
„CORONA vs. Abfallwirtschaft<br />
– Krise oder Erfolgsstory?“<br />
mit Live-Stream<br />
• Top of Circular Solution<br />
Start-Ups (Start Ups & Ideen<br />
stellen sich vor) in Kooperation<br />
mit der Green Tech<br />
Cluster Styria GmbH mit<br />
Live-Stream<br />
• Networking während der<br />
Mittagspause und des Ausklangs<br />
(kein Live-Stream).<br />
Am Donnerstag den<br />
19.11.<strong>2020</strong> und Freitag den<br />
20.11.<strong>2020</strong> wird die Recy &<br />
DepoTech dann zu einer<br />
reinen Webkonferenz, also<br />
ohne physischer Teilnahme.<br />
Die Programmpunkte an<br />
diesen beiden Tagen sind<br />
die virtuellen Vorträge, Poster-Vorträge,<br />
Messestände<br />
und Meetingräume zum virtuellen<br />
Austausch.<br />
Übersicht Programmpunkte<br />
am Donnerstag den<br />
18.11.<strong>2020</strong>:<br />
• Online-Vorträge inkl. Diskussionen<br />
• Online-Poster-Vorträge<br />
• Online-Aussteller<br />
• Online-Meetingpoints<br />
Sollte es bedingt durch verschärfte<br />
Corona-Maßnahmen<br />
dazu kommen, dass<br />
der physische Teil am Mittwoch<br />
nicht in Leoben statt-<br />
finden kann, werden wir die<br />
geplanten Programmpunkte<br />
ebenfalls in rein virtueller<br />
Form durchführen. Hier bitten<br />
wir um Ihr Verständnis<br />
und um Ihre Flexibilität, da<br />
auch wir uns flexibel schnell<br />
änderten Rahmenbedingungen<br />
anpassen müssen.<br />
Wir arbeiten derzeit intensiv<br />
an unserer virtuellen Konferenzwelt,<br />
die für Sie als Teilnehmer/in,<br />
Vortragende/r<br />
oder Aussteller eine bedienerfreundliche<br />
Konferenzumgebung<br />
bieten wird (siehe<br />
Abbildung auf der linken<br />
Seite).<br />
LINK-TIPP:<br />
Zum genauen Konferenz-programm der diesjährigen<br />
Recy & DepoTech <strong>2020</strong> geht es hier.
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S22<br />
„Qualität kennt keine Kompromisse“<br />
Trotz stetig steigender Abfallmengen muss es gelingen, sinnvoll und nachhaltig<br />
mit Ressourcen umzugehen. In einer Kreislaufwirtschaft wird der Ressourcenbedarf<br />
reduziert, und dem Recycling kommt eine Schlüsselposition zu. Die Vecoplan AG<br />
bietet dafür Maschinen und Anlagen, die Primär- und Sekundärrohstoffe zerkleinern,<br />
fördern und aufbereiten – und damit den Grundstein für ein funktionierendes<br />
Recycling bieten. Welche Anforderungen an die Zerkleinerungstechnik gestellt<br />
werden, weiß Martina Schmidt, Leiterin des Geschäftsbereichs Recycling I Waste.<br />
© Vecoplan AG<br />
MARTINA SCHMIDT<br />
RECYCLING | WASTE<br />
VECOPLAN AG<br />
Frau Schmidt, welche Anforderungen werden<br />
heute an die Zerkleinerungstechnik gestellt?<br />
Martina Schmidt: Um Kreisläufe schließen zu<br />
können, gilt es, Downcycling zu vermeiden<br />
und die Akzeptanz von Rezyklat auf der<br />
Abnehmerseite zu erhöhen. Damit einher<br />
geht ein hoher Qualitätsanspruch an die<br />
eingesetzte Anlagentechnik. Eine häufig<br />
unterschätzte Komponente steht ganz am<br />
Anfang einer jeden Wiederaufbereitung:<br />
der Schredder. Kunststoffe haben die unterschiedlichen<br />
mechanischen und thermischen<br />
Eigenschaften. Das Aufgabematerial<br />
weist verschiedene Verschmutzungsgrade<br />
auf und ist teilweise stark störstoffbehaftet.<br />
Die richtige Auswahl des Schredders ist Garant<br />
für die Prozessstabilität: hohe kontinuierliche<br />
Durchsatzleistung, homogene Korngrößenverteilung<br />
mit geringer Streuung.<br />
Wie unterstützt Vecoplan die Recyclingunternehmen<br />
bei diesen vielfältigen Inputmaterialien?<br />
Schmidt: Die Recycling- und Entsorgungswirtschaft<br />
hat sich der Aufgabe angenommen,<br />
leistungsfähige Anlagen zu betreiben,<br />
die dem Markt gleichbleibend gute Qualität<br />
an Rezyklat zur Verfügung stellen. Der<br />
Schredder hat dabei eine entscheidende<br />
Rolle. Unsere Produktentwicklungen und -innovationen<br />
zielen auf höhere Flexibilität und<br />
breites Aufgabespektrum ab. Der Schredder<br />
ebnet dem nachfolgenden Prozess den<br />
Weg zu mehr Produktivität und Profitabilität:<br />
die richtige Auswahl der Schneideinheit,<br />
perfekte Abstimmung und Auswahl des<br />
Programms, hohe und flexible Schneidkraft<br />
oder auch einfache und exakte Einstellung<br />
des Schnittspalts, um nur einige wichtige<br />
Eckpunkte zu nennen. Dies natürlich alles<br />
gepaart mit der höchstmöglichen Verfügbarkeit<br />
und einfachster Wartung bei größtmöglichem<br />
Bedienkomfort. Dafür stehen wir<br />
und unsere Schredder.<br />
Wie finden Sie für jeden Anwendungsfall die<br />
passende Lösung?<br />
Schmidt: Wir arbeiten bei der Entwicklung<br />
eng mit unseren Kunden zusammen. In den<br />
vergangenen Jahren kamen Verarbeiter mit<br />
immer neuen Herausforderungen auf uns zu.<br />
Unter den Kunden befanden sich auch Unternehmen,<br />
die bei anderen Herstellern keine<br />
zufriedenstellende Lösung erhielten. Wir entwickeln<br />
Schredder, die wir in zahlreichen<br />
Versuchen in unserem Technologiezentrum<br />
genau auf die individuellen Anwendungen<br />
abstimmen. Alle Versuche werden dokumentiert,<br />
dem Kunden zur Verfügung gestellt und<br />
in unsere Datenbank aufgenommen. Diese<br />
beinhaltet mittlerweile mehr als 2.000 Tests. In<br />
Echtzeit werden Output-Materialtemperatur,<br />
Lärmemission, Drehmomente und Schnittkräfte<br />
überwacht und aufgezeichnet. Ein<br />
internes Labor zur Feuchtigkeitsmessung, Korngrößen-<br />
und Dichtebestimmung sowie Materialprüfung<br />
ist vorhanden.<br />
Im Laufe der Jahre haben wir uns so einen<br />
enormen Wissensstand erarbeitet und dies<br />
nicht nur in der Theorie, sondern vor allem in<br />
der Praxis. Vecoplan hat im Markt die längste<br />
Erfahrung im Bereich der langsam laufenden<br />
Einwellenschredder.<br />
Um zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln,<br />
bedarf es der richtigen Personen im jeweiligen<br />
Geschäftsfeld. Wie sieht das im Bereich<br />
Recycling I Waste aus?
Schmidt: Wie in den anderen Geschäftsfeldern<br />
bei Vecoplan auch, besteht unser<br />
Team aus absoluten Spezialisten. Dazu gehören<br />
Kunststoff- und Anwendungstechniker,<br />
Maschinenbauer, Vertriebsprofis und Projektmanager.<br />
Wir bündeln im Geschäftsbereich<br />
nicht nur sehr viel technisches Know-how,<br />
sondern auch umfangreiche persönliche Erfahrung.<br />
Wie zeigt sich dies in Ihren Entwicklungen?<br />
Schmidt: Die Expertise führt letztlich in die<br />
Entwicklung neuer Technologien wie unsere<br />
neue Schredder-Baureihe VIZ, die wir im Oktober<br />
vergangenen Jahres erstmals auf der K<br />
in Düsseldorf vorgestellt haben. Die Initialen<br />
stehen für Vecoplan Infinity Zerkleinerer.<br />
Der einstufige Schredder stellt eine Lösung<br />
für alle Input-Materialien dar. Durch das<br />
Konzept der geschraubten Werkzeughalterplatten<br />
mit variabel ausführbaren Schneidkronengrößen<br />
gehören Rotorwechsel der<br />
Vergangenheit an. Grenzenlose Flexibilität<br />
auch in der Antriebstechnik – variabel einstellbarer<br />
Drehzahlbereich, Fremdkörpererkennung,<br />
hohe Dynamik im Antrieb durch<br />
schnelles Reversieren und Wiederanlaufen,<br />
höchst mögliches Drehmoment bei niedriger<br />
Drehzahl, problemloser Anlauf bei gefüllter<br />
Maschine. Paaren wir dies mit absoluter<br />
Bedienerfreundlichkeit, hoher Verfügbarkeit<br />
und niedrigen Betriebskosten und der VIZ<br />
trägt seinen Namen zu Recht: No limits.<br />
Über die Rotor- und<br />
Messer-Bestückung sowie<br />
die entsprechende Siebwahl<br />
passt Vecoplan die<br />
Zerkleinerer detailliert an<br />
die Input- und Output-<br />
Anforderungen an.<br />
Bilder (2): Vecoplan AG<br />
Der neue VIZ<br />
von Vecoplan<br />
kann vielfältigste<br />
Kunststoffmaterialien<br />
zuverlässig<br />
zerkleinern.
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S24<br />
Mobilitätswandel ist Haltung – nicht Technik<br />
Kennen Sie das “Braess-Paradoxon”? Nein? Dabei stammt es aus Deutschland, vom<br />
gleichnamigen Mathematiker, der es 1968 nachwies. Aber vielleicht kennen Sie es<br />
als Zitat: “Säet Straßen und ihr werdet noch mehr Verkehr ernten.” Text: KATJA DIEHL<br />
LINK-TIPP<br />
Weitere Beiträge hier:<br />
https://katja-diehl.de/<br />
Was paradox klingt, wurde wissenschaftlich<br />
von Dietrich Braess belegt:<br />
Der Bau einer zusätzlichen Straße<br />
führt bei gleichem Verkehrsaufkommen zur<br />
Erhöhung der Fahrtdauer für alle.<br />
Wikipedia nennt Beispiele aus der Praxis:<br />
1969 führte in Stuttgart die Eröffnung einer<br />
neuen Straße dazu, dass sich in der Umgebung<br />
des Schlossplatzes der Verkehrsfluss verschlechterte.<br />
Auch in New York konnte dieses<br />
Phänomen 1990 beobachtet werden. Eine<br />
Sperre der 42. Straße sorgte für weniger Staus<br />
in der Umgebung. Gleichermaßen verbesserten<br />
sich 2005 Verkehrsfluss und Fahrzeiten in<br />
der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, nachdem<br />
eine vierspurige querungsfreie Stadtautobahn<br />
abgerissen worden war. Schlagen Sie<br />
mal die tollen Bilder nach, die es dazu gibt.<br />
Echter Stadtraum, der neidisch macht!<br />
Haltung heißt: Hinterfragen! lassen.<br />
Was hat aber nun dieses Paradoxon mit meinem<br />
Gedanken zur Haltung zu tun? Ich las<br />
letztens einen Artikel zum geplanten Neubau<br />
einer Rheinbrücke – und fragte mich: Werden<br />
vor dem Hintergrund von Klimakrise und<br />
Verkehrswende solche großen Infrastrukturprojekte<br />
heute nicht automatisch überprüft?<br />
Die Brücke führt durch ökologisch sehr empfindliches<br />
Gebiet und – so hoffe ich doch – in<br />
wenigen Jahren wird es sehr viel weniger Individualverkehr<br />
und innovative, nachhaltigere<br />
Lösungen zur effizienten LKW-Logistik geben.<br />
Braucht es da Neubauten oder vielmehr engagierte<br />
Instandhaltung?<br />
Immer wieder stolperte ich 2019 über die Feststellung:<br />
Es wird am Status Quo geradezu sklavisch<br />
festgehalten. Er wird nicht hinterfragt, obwohl<br />
wir aktuell viele gute Gründe haben, das<br />
zu tun. Und hier fängt das Thema “Haltung”<br />
meiner Meinung nach an. Wir scheinen uns<br />
nicht wohl damit zu fühlen, gestalten zu können<br />
oder es gar zu müssen. Wir strapazieren<br />
den Begriff der enkeltauglichen Zukunft, treiben<br />
aber weiter das Hamsterrad von Wachstum<br />
und Gewinnen an. Na klar, das ist uns über<br />
Jahrzehnte so vorgelebt und eingetrichtert<br />
worden. Aber genau das brachte uns ja in die<br />
Klimakrise. Wir müssen hinterfragen, was wir tun.<br />
Aber dazu bedarf es nicht nur des eigenen Engagements,<br />
sondern auch der Unternehmen,<br />
die diese konstruktive Haltung zur eigenen Arbeit<br />
und der des Arbeitgebers anregen.<br />
Unser heutiges Koordinatensystem ist nicht<br />
zukunftsfähig. Wenn wir uns mit den “Werten”<br />
von Wachstum weiter in die Zukunft bewegen,<br />
wird es so sein, als hätten wir eine Karte aus<br />
dem 19. Jahrhundert und wollten uns im heutigen<br />
Hamburg bewegen.<br />
Die Zukunft ist längst schon da.<br />
Wir müssen unser vertrautes Koordinatensystem<br />
zum Teil neu justieren, sonst verlieren wir<br />
nicht nur den Überblick, sondern gehen im<br />
schlimmsten Fall sogar in die falsche Richtung<br />
– nämlich rückwärts. Und genau das gibt auch<br />
mein Gefühl von 2019 in Sachen Mobilitätswandel<br />
wider. Es ist nicht so, dass nichts passiert<br />
wäre, aber viel wurde wieder verzagter.<br />
Große Player haben den Markt wieder verlassen<br />
oder sich mehrjährige Expansionpausen<br />
verordnet, um “Verluste zu vermeiden”. Aber<br />
wird der Mobilitätswandel ohne geldwerte<br />
Verluste zu starten sein? Sollten in Sachen klimarettende<br />
Verkehrswende nicht andere<br />
Währungen zählen wie z. B. der ökologische<br />
Gewinn für die Gemeinschaft?<br />
Braess sagt es mit seiner Theorie deutlich: Da,<br />
wo jeder nur an sich denkt, wird es am Ende<br />
allen schlechter gehen, weil der Schaden des<br />
Gemeinwohls immer ein individueller ist – auch<br />
wenn sich der Gewinn (in der Vorausschau)<br />
zunächst sehr groß für das Individuum anfühlt.<br />
Ich habe mit viel mehr Menschen als sonst<br />
in den Jahren zuvor über “mein Jahr 2019”<br />
gesprochen. Wurde gefragt, wie anstrengend<br />
es eigentlich ist, sich für das Thema<br />
Verkehrswende einzusetzen und dabei auch<br />
immer zuverlässig die Thema Diversität und<br />
neue Arbeitsformen anzubringen. Ob das
nicht ein paar Baustellen zuviel seien? Sie<br />
sehen mich nicken: Ja. Es ist enorm anstrengend.<br />
Aber ich sehe einfach keine Chance,<br />
diese Themen voneinander zu trennen. Und ja:<br />
Gerade das Thema der neuen Mobilität jenseits<br />
des privat besessenen PKW ist ein völliges<br />
Filterblasen-Thema, das sehe ich aktuell bei<br />
meinen Tagen im Emsland. Hier gibt es keinen<br />
gut ausgebauten ÖPNV, es gibt aber auch<br />
kaum Menschen, die diesen fordern, weil vor<br />
jedem Eigenheim gleich mehrere Autos stehen.<br />
Also: Ad hoc Mobilität ist vorhanden. Immer.<br />
Und natürlich ist hier dementsprechend<br />
weder Parkdruck noch Stau ein Thema.<br />
Gallup: Nur 39 Prozent sagen, dass in ihrem Unternehmen<br />
ein Klima der freien Meinungs- und<br />
Ideenäußerung herrscht. Wow. Was nützen da<br />
moderne Tools der bereichsübergreifenden<br />
Zusammenarbeit, wenn der analoge Wille zur<br />
Veränderung noch nicht mal ausgeprägt ist?<br />
Ein Beweis, dass Digitalisierung nicht intrinsisch<br />
und damit nicht als Haltung in Unternehmen<br />
verankert ist, findet sich bei der civity-Studie<br />
“Eine Frage der Unternehmenskultur – Voraussetzungen<br />
für die digitale Transformation von<br />
Verkehrsunternehmen:” Die befragten Unternehmen<br />
nannten als Top-Grund für den<br />
für den möglichen Nutzen.<br />
Doch Politik und Autohersteller<br />
in Deutschland<br />
jazzen aktuell nur große<br />
Produktionszahlen, mögliche<br />
Verkaufsstarts von<br />
zum Teil wieder riesigen<br />
Mo-dellpaletten, schaffen<br />
eine Verdopplung der<br />
Kaufprämie durch Investition<br />
der Wirtschaft, die<br />
diese dann durch Verkauf<br />
zurückerhält – und ist in<br />
Dennoch muss auch die Mobilität in Mittelzentren<br />
und kleineren Städten sich verändern. Hier<br />
kommen wir wieder zum Thema Haltung. Da,<br />
wo die Änderung stattfinden muss, wird sich<br />
zunächst Widerstand regen. Weil Verbote und<br />
Verzicht bei uns negativ belegt sind. Unsere<br />
Freiheit ein hohes Gut ist. Wir unsere Privilegien<br />
nicht gefährdet sehen wollen, auch, weil wir<br />
diese zum Teil als gegeben wahrnehmen –<br />
und nicht als “ungerecht, aber vor allem an<br />
uns verteilt”. Es müssten also sehr viele Fragen<br />
gestellt werden, von möglichst vielen, um<br />
möglichst viele in unserer Gesellschaft in der<br />
Zukunft zu berücksichtigen. Und das beginnt<br />
bei den Unternehmen, die Auto- und andere<br />
Mobilität gestalten.<br />
Die benannte Gallup-Studie hat festgestellt,<br />
dass sich 1/3 der Angestellten trotz Bedenken<br />
gegen das unternehmerische Handeln ihre<br />
Meinung dazu nicht geäußert haben. Man<br />
kann dies als mangelnde emotionale Bindung<br />
zum Unternehmen oder als Angst vor<br />
offen geäußerter Einschätzung deuten. Im<br />
schlimmsten Falle trifft beides zu.<br />
Wie weit sind wir mit unserem Wandel, wenn<br />
2019 noch so ein Klima in den meisten Unternehmen<br />
herrscht? Wenn Vorgesetzte sich<br />
immer noch so verhalten, wie es diese antiquierte<br />
Wort beschreibt: Sie werden VOR gesetzt.<br />
Elitäre Führungszirkel werden stets auch<br />
durch Geheimnisse zu Bündnissen. Gibt es hier<br />
wirklich den Willen, zumindest das Wissen, das<br />
alle benötigen, um gut und innovativ arbeiten<br />
zu können, zu teilen? Oder kommt es bei Krisen<br />
zu dem Wunsch, wieder in die bekannten<br />
Spurrillen z. B. von Präsenzkultur und Organigrammgläubigkeit<br />
zurückzukehren?<br />
Rückstand ihrer Digitalisierungsstrategie und<br />
-umsetzung die Unternehmenskultur. Zitat:<br />
“In den Unternehmen herrscht zumeist eine<br />
techniklastige Kultur vor, bei der der Mensch<br />
nicht ausreichend im Mittelpunkt steht. Dabei<br />
sind es die Menschen, die das Unternehmen<br />
verändern und im Zuge dessen auch ihre Einstellungen<br />
und Verhaltensweisen weiter entwickeln<br />
müssen. Digitale Transformation ist<br />
daher immer auch kulturelle Transformation.”<br />
Ich predige es geradezu stündlich: Antriebswende<br />
ist nicht Verkehrswende. Wenn wir<br />
alle PKW einfach nur 1:1 austauschen, dann<br />
müssen wir nicht nur alle Infrastrukturprojekte<br />
im Straßenbau durchführen, dann haben<br />
wir auch nix gewonnen. Denn sie ist maximal<br />
Brückentechnologie für jene Bereiche, in<br />
denen aktuell noch Alternativen ausgebaut<br />
oder nie existieren werden, da zu aufwändig<br />
Sachen Entwicklung notwendiger<br />
neuer Fahrzeugkonzepte<br />
und Mobilitätsansätze<br />
sehr sehr (um es<br />
höflich zu sagen) schwerfällig.<br />
Ich weiß, dass in den<br />
Unternehmen daran gearbeitet<br />
wird, das ist für den<br />
Laien außerhalb meiner<br />
Bubble aber (bewusst!?)<br />
nicht wahrnehmbar.<br />
Ich vermisse die Aussage:<br />
Wir werden weniger produzieren<br />
(müssen). Dem<br />
wird aber so sein, das ist der<br />
Wandel. Er verändert Arbeit,<br />
löst Arbeitsplätze ab und<br />
schafft neue. DIESE Haltung<br />
zur Transparenz vermisse ich.
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S26<br />
E-Mobilität: Alles eine Preisfrage<br />
Die Elektromobilität wächst in Österreich langsam aber stetig. Sind alle Fragen zur<br />
E-Moilität gelöst? Im Interview antwortet Ute Teufelberger, Vorsitzende des Bundesverbandes<br />
Elektromobilität Österreich - BEÖ und Leiterin der Abteilung Elektromobilität<br />
und Energieeffizienz in der EVN AG. Interview: PETER R. NESTLER<br />
Wir sind in Österreich bei rund zwei Prozent<br />
zugelassener E-Autos – sind Sie zufrieden mit<br />
dem Erreichten?<br />
Ute Teufelberger: Da ist sicherlich noch Luft<br />
nach oben. Vergleichen wir jedoch die<br />
Neuzulassungen von rein elektrisch angetriebenen<br />
Autos im ersten Halbjahr <strong>2020</strong> mit<br />
dem Vorjahr, so kamen - trotz Corona – rund<br />
5.000 vollelektrische (!) E-Autos neu dazu. Und<br />
damit stieg der Anteil von E-Fahrzeugen an<br />
den Gesamt-Neuzulassungen auf 4,2 Prozent.<br />
Wir sind in Österreich zwar auf einem guten<br />
Weg, aber immer noch weit entfernt vom<br />
Vorzeigeland Norwegen, wo bereits jeder<br />
zweite neu zugelassene PKW mit Strom fährt.<br />
Wie ist das Kaufverhalten bei E-Mobilen in Österreich<br />
im Vergleich zu anderen Ländern?<br />
Teufelberger: Die Niederlande ist der EU-<br />
Spitzenreiter bei den E-Pkw-Neuzulassungen.<br />
Neun Prozent der Neuwagen fahren dort<br />
ausschließlich mit Strom. Österreich weist mit<br />
4,2 Prozent den fünfthöchsten Anteil in der<br />
EU auf, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt.<br />
Den höchsten E-Pkw-Anteil Europas haben<br />
Norwegen mit fast 47 Prozent und Island mit<br />
27 Prozent. Der Gesamtbestand von E-Pkw<br />
ist in Österreich von rund 30.000 (Dezember<br />
2019) auf 35.000 (Juli <strong>2020</strong>) gestiegen.<br />
Zuletzt wurde die Förderung zur Neuanschaffung<br />
von Elektroautos nochmals angehoben.<br />
Ist die Förderung von der Höhe her nun<br />
ausreichend und von der Art her richtig positioniert?<br />
Oder wären Sie für eine gestaffelte<br />
Förderung je nach Einsatz der Fahrzeuge?<br />
Teufelberger: Als BEÖ begrüßen wir diese<br />
neue E-Mobilitäts-Offensive der Bundesregierung.<br />
So erhält man ab dem 1. Juli beim<br />
Kauf eines neuen E-PKW 5.000 statt 3.000<br />
Euro. Zusätzlich werden auch die Beträge für<br />
Zweirad-E-Fahrzeuge angehoben. Was uns<br />
besonders freut, ist die Verdreifachung der<br />
Förderungen für den Ausbau der privaten<br />
Ladeinfrastruktur, etwa in Mehrparteienhäusern.<br />
Damit geht eine weitere wichtige<br />
Forderung des BEÖ in Erfüllung.<br />
Aus unserer Sicht ist der Preis eines Autos immer<br />
noch entscheidend für den Umstieg auf<br />
klimafreundliche E-Mobilität. Ein E-Auto darf<br />
heute einfach nicht mehr kosten als ein Verbrenner!<br />
Deshalb wollen wir als BEÖ auch<br />
eine befristete Befreiung von der Umsatzsteuer<br />
– etwa bis 2024 – für reine E-Fahrzeuge.<br />
Gerade dort, wo E-Mobilität den größten<br />
Sinn ergeben würde – in den Städten – ist<br />
die Ladeinfrastruktur am schwierigsten einzurichten.<br />
Sehen Sie da technologisch Lösungen,<br />
die das Thema vorantreiben könnten?<br />
Teufelberger: Unsere öffentliche Lade-Infrastruktur<br />
ist in den letzten Jahren – vor allem<br />
dank der Investitionen der großen Energieunternehmen<br />
– stark angewachsen. Mit<br />
rund 5.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten<br />
ist das BEÖ-Netz das größte Ladenetz<br />
Österreichs und wird weiter ausgebaut. Und<br />
was die Infrastruktur in den Städten betrifft,<br />
so werden allein in Wien bis Ende <strong>2020</strong> rund<br />
1.000 öffentliche E-Ladeanschlüsse zur Verfügung<br />
stehen. Der nächste wichtige Schritt, ist<br />
der rasche und zügige Ausbau von privaten<br />
Lademöglichkeiten, etwa in Parkgaragen<br />
und in Mehrparteienhäusern. Dabei geht<br />
es weniger um technologische Lösungen,<br />
sondern um rechtliche Rahmenbedingungen.<br />
Denn bisher mußten etwa beim Einbau<br />
einer neuen Ladestation in einer privaten<br />
Wohnanlage alle Eigentümer zustimmen. Ab<br />
Herbst soll die gesetzliche Vorgabe der Vergangenheit<br />
angehören und die nachträgliche<br />
Installation, etwa von modernen Wallboxen<br />
in Mehrparteienhäusern, deutlich<br />
vereinfacht werden. Wir rechnen hier mit<br />
einem deutlichen Anstieg der privaten<br />
Ladekapazitäten.
© EVN<br />
Wie sieht es mit den Fuhrparks von Unternehmen<br />
aus, welche Quoten von Elektrofahrzeugen<br />
gibt es da in Österreich?<br />
Teufelberger: Wir wissen, dass rund 70 Prozent<br />
aller Elektroautos in Österreich gewerblich<br />
genutzt werden. Es sind hier vor allem<br />
die finanziellen und steuerlichen Vorteile,<br />
die überzeugen. Den größten E-Fuhrpark<br />
hat etwa die österreichische Post mit knapp<br />
1.700 Fahrzeugen, vom E-Moped bis zum<br />
Klein-Lkw. Großes Potenzial sehen wir im<br />
öffentlichen und kommunalen Bereich: Zum<br />
Beispiel Nutzfahrzeuge für den Bauhof. Auch<br />
beim Thema Car-Sharing bemerken wir einen<br />
Trend in Richtung E-Fahrzeug, wenn auch<br />
derzeit nur als Ergänzung zum Verbrenner.<br />
Thema Umwelt: Bei starker Zunahme der Zulassungen:<br />
Was machen wir mit den Akkus?<br />
Teufelberger: Intakte Akkus, die nicht mehr<br />
im E-Auto benutzt werden, aber noch einen<br />
Energieinhalt von bis zu 75 Prozent haben,<br />
könnten eine zweite Verwendung - Second<br />
Life - im stationären Betrieb finden. Etwa als<br />
Stromspeicher für private Haushalte oder<br />
auch als Großspeicher; vereinzelt werden<br />
bereits Second Life-Batterien an Stromverteilnetze<br />
angeschlossen, um Schwankungen<br />
und Bedarfsspitzen in Stromnetzen auszugleichen.<br />
Bis das Recycling von E-Auto-Batterien<br />
notwendig wird, werden möglicherweise<br />
noch Jahrzehnte vergehen. Die erste große<br />
Altakku-Welle wird nach Expertenmeinung<br />
erst in knapp 10 bis 20 Jahren auf uns zurollen.<br />
E-Autos sind nach wie vor teuer, gemessen<br />
an der darin enthaltenen Technologie. Ab<br />
wann rechnen Sie mit sinkenden Preisen?<br />
Teufelberger: Auf lange Sicht scheint der<br />
Trend hin zu elektronisch betriebenen Autos<br />
ungebrochen zu sein. Mit der erhöhten Kaufprämie<br />
sind viele Elektroautos annähernd<br />
gleich beziehungsweise bereits günstiger als<br />
Diesel und Benziner. Entscheidend ist nämlich<br />
nicht nur der Kaufpreis, sondern die gesamten<br />
Kosten über die gesamte Nutzungsdauer.<br />
Berücksichtigt man alle Kosten eines<br />
Autos, vom Kaufpreis, Betriebskosten über<br />
Wartungsaufwände, Versicherung bis zum<br />
Wertverlust, so schneiden Elektroautos immer<br />
häufiger besser ab als Verbrenner.
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S28<br />
Weltweit erster 1-MW-Großgasmotor<br />
Ein umgerüstetes Erdgas-Blockheizkraftwerk läuft mit 100 % Wasserstoff und liefert<br />
damit einen Meilenstein für die Klimaneutralität Deutschlands und für den europäischen<br />
Energiesektor. Die Investitionssicherheit für die Betreiber ist abgesichert.<br />
AMit dem kürzlich gestarteten Feldtest<br />
des umgerüsteten Blockheizkraftwerks<br />
(BHKW) in Hamburg-Othmarschen<br />
geht ein gemeinsames Leuchtturmprojekt von<br />
INNIO* Jenbacher* und HanseWerk Natur einen<br />
entscheidenden Schritt voran. Bei dieser<br />
1-Megawatt-Pilotanlage von INNIO Jenbacher<br />
handelt es sich um den weltweit ersten<br />
Großgasmotor der 1-MWKlasse, der sowohl<br />
mit 100 Prozent Erdgas als auch mit variablen<br />
Wasserstoff-Erdgas-Gemischen bis hin zu 100<br />
Prozent Wasserstoff betrieben werden kann.<br />
„Unser gemeinsames Projekt mit der<br />
HanseWerk Natur ist ein wichtiger Meilenstein<br />
auf dem Weg zur Klimaneutralität, denn<br />
grüner Wasserstoff ist ein wichtiger Teil der<br />
Lösung. Besonders attraktiv an unserer Gasmotorentechnologie<br />
ist, dass auch bestehende<br />
Erdgasmotoren auf den Wasserstoffbetrieb<br />
umgerüstet werden können. Dies bietet<br />
den Betreibern Investitionssicherheit und zudem<br />
den Vorteil, dass vorhandene Infrastruktur<br />
nicht nur langfristig, sondern auch klimagerecht<br />
genutzt werden kann“, so Carlos<br />
Lange, CEO und President von INNIO.<br />
Getestet wird nun der Betrieb mit unterschiedlichen<br />
Wasserstoff-Erdgas- Gemischen,<br />
der wichtige Erkenntnisse für den zukünftigen<br />
Betrieb ähnlicher Anlagen liefern soll. „Mit<br />
diesem Feldtest eines bis zu 100 Prozent mit<br />
Wasserstoff betriebenen Blockheizkraftwerks<br />
von INNIO zeigen wir, dass eine grünere, sichere,<br />
flexible und zukunftsorientierte Energieversorgung<br />
in Hamburg technisch möglich<br />
ist“, so Thomas Baade, technischer Geschäftsführer<br />
der HanseWerk Natur GmbH, erfreut.<br />
Einspeisung in öffentliches Stromnetz<br />
Das umgerüstete BHKW versorgt 30 Wohngebäude,<br />
eine Sport- und eine Kindertagesstätte<br />
sowie das Freizeitzentrum Othmarschen Park<br />
verlässlich mit jährlich 13.000 Megawattstunden<br />
Nahwärme. Der erzeugte Strom wird<br />
von Elektroautos in den Ladestationen im<br />
Parkhaus Othmarschen „getankt“ und in das<br />
örtliche Stromnetz eingespeist.
Fotos (2): © INNIO<br />
ÜBER INNIO:<br />
INNIO ist ein führender Lösungsanbieter<br />
von Gasmotoren, Energieanlagen, einer<br />
digitalen Plattform sowie ergänzender<br />
Dienstleistungen im Bereich Energieerzeugung<br />
und Gasverdichtung nahe am<br />
Verbraucher. Mit den Produktmarken<br />
Jenbacher und Waukesha verschiebt<br />
INNIO die Grenzen des Möglichen und<br />
blickt gleichzeitig voller Optimismus in die<br />
Zukunft. Unser breit gefächertes Portfolio<br />
aus zuverlässigen, wirtschaftlichen und<br />
langlebigen Industrie-Gasmotoren erfüllt<br />
im Leistungsbereich zwischen 200 KW und<br />
10 MW die Anforderungen verschiedenster<br />
Wirtschaftszweige. Weltweit können<br />
wir die mehr als 52.000 bisher von uns ausgelieferten<br />
Gasmotoren über ihre gesamte<br />
Nutzungsdauer betreuen. Unterstützt<br />
durch ein breites Netzwerk an Serviceanbietern<br />
ist INNIO in mehr als 100 Ländern<br />
vertreten und kann umgehend auf Ihren<br />
Servicebedarf reagieren.<br />
Die Unternehmenszentrale befindet sich<br />
in Jenbach, weitere Hauptbetriebsstätten<br />
liegen in Welland (Ontario, Kanada)<br />
sowie in Waukesha (Wisconsin, USA).<br />
ÜBER DIE HANSEWERK AG:<br />
Die HanseWerk AG ist ein deutscher<br />
Energiedienstleister mit den Schwerpunkten<br />
auf Netzbetrieb und dezentrale<br />
Energieerzeugung. Über die Netze und<br />
Anlagen des Unternehmens werden mehr<br />
als drei Millionen Menschen in den Bundesländern<br />
Schleswig-Holstein, Hamburg,<br />
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg<br />
und Niedersachsen direkt oder indirekt<br />
mit Strom, Erdgas, Wärme oder Wasser<br />
versorgt. Über ihre Tochtergesellschaft<br />
HanseWerk Natur ist sie für 900 Kilometer<br />
Nahwärmenetze, 9.000 Heizanlagen sowie<br />
200 Blockheizkraftwerke verantwortlich.<br />
Die HanseWerk AG hat in den vergangenen<br />
Jahren mehrere zehntausend Anlagen<br />
zur Erzeugung erneuerbarer Energien<br />
mit einer Einspeiseleistung von fast 9.000<br />
MW an die Netze angeschlossen.
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S30<br />
Heinzel Energy & ECO-TEC gemeinsam<br />
Der Steirische Photovoltaik-Experte eco-tec.at und das oberösterreichische Unternehmen<br />
Heinzel Energy errichten einige der größten Photovoltaik-Aufdach-<br />
Anlagen in Österreich. Die Partnerschaft gedeiht und bringt tolle Projekte hervor.<br />
Aktuell laufen bei den beiden österreichischen<br />
Partnern Heinzel Energy und<br />
ECO-TEC zwei Photovoltaik-Großanlagen.<br />
Weitere Projekte werden nun von der<br />
eco-tec.at in Kooperation mit Heinzel Energy,<br />
dem Erneuerbaren Energie-Unternehmen der<br />
Heinzel EMACS Firmengruppe realisiert. Heinzel<br />
ist auch in den Bereichen Zellstoff und Papier,<br />
Landwirtschaft sowie Immobilien nach eigenen<br />
Angaben äußerst erfolgreich tätig.<br />
Die Partnerschaft zwischen Heinzel Energy<br />
und eco-tec.at begann bereits im Jahr 2016<br />
mit der Errichtung einer Photovoltaik-Anlage<br />
mit 400 kWp Leistung auf den Dächern des<br />
Wirtschaftshofes der Domaine Albrechtsfeld<br />
in Andau (siehe Bild unten), einem landwirtschaftlichen<br />
Betrieb im Seewinkel (Burgenland),<br />
der rund 1.500 Hektar biologisch<br />
bewirtschaftet. Seit Inbetriebnahme im Juli<br />
2017 wurden mit dieser Anlage bereits über<br />
1,2 GWh erneuerbare Energie erzeugt.<br />
Im Jahr 2018 folgte dann die Photovoltaikmontage<br />
– insgesamt mit 400 kWp Leistung –<br />
auf mehreren Dächern in Oberösterreich; die<br />
Hälfte davon in Linz bei Bunzl & Biach, dem<br />
Altpapier-Unternehmen der Heinzel Zellstoffund<br />
Papiergruppe.<br />
Projekte in Oberösterreich und Steiermark<br />
Im Jahr <strong>2020</strong> hat die eco-tec.at im Auftrag<br />
von Heinzel Energy Photovoltaikanlagen<br />
auf ausgewählten Dachflächen von deren<br />
Schwesterfirmen Laakirchen Papier AG<br />
(Oberösterreich) und Zellstoff Pöls AG (Steiermark)<br />
errichtet. Die Photovoltaikanlage in<br />
Pöls (siehe Bild rechte Seite) ging am 24.<br />
September <strong>2020</strong> in Betrieb. In Laakirchen ist<br />
die Inbetriebnahme im Dezember <strong>2020</strong> geplant.<br />
Insgesamt werden auf rund 15.000 m²<br />
Dachfläche über 9.000 Photovoltaik Paneele<br />
montiert (2,6 MWp in Laakirchen und 0,5<br />
MWp in Pöls), welche mehr als 3 GWh Ökostrom<br />
pro Jahr erzeugen.<br />
Der an diesen beiden Standorten mit Photovoltaik<br />
produzierte Strom ist ausreichend, um<br />
über 850 Haushalte mit elektrischer Energie<br />
zu versorgen. Mit beiden Photovoltaikanlagen<br />
können pro Jahr bis zu 800 Tonnen CO2<br />
eingespart werden.
Fotos (2): ©HeinzelEnergy<br />
„Es ist uns ein großes Anliegen, Projekte im<br />
Bereich der erneuerbaren Energien aus Sonnen-,<br />
Wind- oder Wasserkraft zu forcieren und<br />
wir freuen uns, Laakirchen Papier und Zellstoff<br />
Pöls sowie eco-tec.at für die Photovoltaik-<br />
Großanlagen als Partner zu haben.“, erklärt<br />
Christoph Heinzel, Geschäftsführer der Heinzel<br />
EMACS Energie GmbH.<br />
Neue Großanlagen geplant<br />
Im Jahr 2021 werden zwei weitere Photovol-<br />
ÜBER ECO-TEC:<br />
ECO-TEC.at ist eines der größten österreichischen<br />
Unternehmen im Bereich<br />
Planung, Konzeption und Errichtung von<br />
Photovoltaik-Anlagen und Speichersystemen<br />
für Kunden aus dem privaten, kommerziellen,<br />
landwirtschaftlichen und auch<br />
aus dem öffentlichen Bereich.<br />
Die Firma ECO-TEC.AT hat in den vergangenen<br />
zehn Jahren einige der größten<br />
Aufdach- und Freiflächen Photovoltaik<br />
Anlagen in Österreich mit in Summe mehr<br />
als 110 MWp Leistung errichtet.<br />
taik-Aufdach-Großanlagen mit in Summe<br />
über 6.000 Photovoltaik-Paneelen auf Dächern<br />
der Heinzel Group errichtet, 0,5 MWp in<br />
Pöls und 1,6 MWp bei Bunzl & Biach in Wien.<br />
„Heinzel Energy ist für eco-tec.at ein wichtiger<br />
und innovativer Partner mit dem wir<br />
langfristig spannende Projekte realisieren,<br />
so planen wir bereits die nächsten Großprojekte<br />
für die nächsten Jahre“, so Helmut Perr,<br />
Geschäftsführer bei eco-tec.at.<br />
ÜBER HEINZEL ENERGY:<br />
Die unter Heinzel EMACS Energie GmbH<br />
firmierende Heinzel Energy plant, entwickelt<br />
und betreibt Kraftwerke, welche<br />
die Energie der Elemente Wasser, Wind<br />
und Sonne ernten. Dazu zählen Wasserkraftwerke<br />
am steirischen Fluss Pöls sowie<br />
an der Traun in Oberösterreich. Weiters<br />
betreibt das Unternehmen im Seewinkel<br />
(Burgenland) einen Windpark auf den<br />
Gründen der Landwirtschaft Domaine<br />
Albrechtsfeld GmbH sowie Photovoltaik-<br />
Großanlagen mit tausenden Kollektoren<br />
an diversen Standorten in Österreich.<br />
Insgesamt produzieren die Kraftwerke<br />
der Heinzel Energy jährlich rund 140 GWh<br />
erneuerbare Energie.
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S32<br />
Seminare, Prüfungen & Ausbildungen<br />
2021 TITEL ORT INTERNET<br />
diverse<br />
Ausbildung zum Betrieblichen Umweltexperten<br />
(Ausbildungsreihe, 10 ECTS)<br />
Bad Sankt Leonhard<br />
KEC Kanzian<br />
22.02. – 25.02.<br />
Umweltbeauftragter und geprüfter Interner Umwelt-Auditor<br />
gemäß EMAS, ISO 14001 und ISO 19011<br />
Bad Sankt Leonhard<br />
KEC Kanzian<br />
09.03. – 12.03.<br />
Abfallbeauftragter und<br />
Grundlagen des Abfallwirtschaftskonzeptes<br />
Bad Sankt Leonhard<br />
KEC Kanzian<br />
26.04. – 28.04.<br />
Energiemanagementbeauftragter u. geprüfter Interner Energiemanagementsystem-Auditor<br />
(ISO 50001, EN 16247, ISO 19011)<br />
Bad Sankt Leonhard<br />
KEC Kanzian<br />
11.01. / 18.01. Start: Lehrgangsreihe Umweltmanagement UM Wien / Linz qualityaustria<br />
06.04. / 20.09. Start: Lehrgangsreihe Energiemanagement UMEM Wien / Linz qualityaustria<br />
08.02. – 10.02.2021 Umweltmanagementsysteme Wien qualityaustria<br />
28.04. – 29.04.2021<br />
NEU: Cradle to Cradle® und ISO-Konzepte<br />
zur Förderung der Kreislaufwirtschaft<br />
Wien<br />
qualityaustria<br />
06.05.2021 NEU: E-Mobilität für Betriebe – Faktencheck statt Fake News Linz qualityaustria<br />
23.06. – 24.06.2021<br />
Integriertes Managementsystem – Methoden und Werkzeuge<br />
(Lehrgangsreihe Umweltmanagement - UM, Teil 4)<br />
Wien<br />
qualityaustria<br />
Im E-Paper/PDF klicken Sie für weitere Informationen einfach auf die Ausbildung oder den Veranstalter.<br />
Anbieterverzeichnis<br />
Ausbildung<br />
Das Umwelt Journal bietet<br />
Ihnen den idealen Ort, um<br />
auf Ihr Unternehmen, Ihre<br />
Organisation aufmerksam<br />
zu machen. Im Anbieterverzeichnis<br />
können Sie Ihr Logo<br />
präsentieren. Dazu wird das<br />
Logo mit einer Wunsch-URL<br />
Ihrer Wahl verlinkt.<br />
Sie wollen Ihren Auftritt noch<br />
verstärken? Dann fragen Sie<br />
nach unserem Online-Anbieterverzeichnis.<br />
Dieses finden<br />
Sie hier (klicken). Gehören<br />
auch Sie künftig zu den Topanbietern<br />
im Umwelt Journal,<br />
als verlässlicher Partner in der<br />
Umweltbranche. Sie erhalten<br />
dazu eine persönlich gestaltete<br />
Microsite im Rahmen<br />
der Website des Fachmagazins<br />
Umwelt Journal.<br />
Als Package Print + E-Paper<br />
+ Online ist Ihre Präsenz übrigens<br />
nicht nur am höchsten,<br />
sondern besonders günstig!<br />
Fragen Sie uns einfach:<br />
p.nestler@umwelt-journal.at.<br />
<strong>UMWELT</strong> <strong>JOURNAL</strong> Partnermedien
Die Top 5 Erkenntnisse aus <strong>2020</strong>, die wir<br />
nun durch eine andere Brille sehen<br />
<strong>2020</strong> ist ein anspruchsvolles Jahr, inklusive vieler Hürden und wir sehnen wohl alle – heuer mehr<br />
denn je – einen Neustart in 2021 herbei. Zugleich wissen wir jedoch, dass viele Auswirkungen dieses<br />
Jahres erst in den Folgejahren so richtig spürbar sein werden. Herausforderungen, die keinen Halt<br />
vor Landesgrenzen machen und sämtliche gesellschaftliche sowie private Bereiche beeinflussen<br />
und einschränken, gehören zu unserem „neuen Normal“ ab sofort dazu. Dieser aktuelle Jahresrückblick<br />
ist ein geeigneter Moment, <strong>2020</strong> nicht nur als „Katastrophenjahr“ zu sehen, sondern auch<br />
die Chancen, die sich daraus ergeben, zu betrachten und uns bewusst zu machen.<br />
In vielerlei Hinsicht wurden uns heuer die<br />
Augen geöffnet und wir mussten erkennen,<br />
dass nichts mehr für selbstverständlich zu<br />
nehmen ist, sich Dinge rasch und ohne Vorwarnung<br />
ändern können und wir kreative Lösungen<br />
finden müssen, damit umzugehen. Auf der<br />
einen Seite, war es positiv überraschend zu sehen,<br />
wie lernfähig wir sind und woran wir uns in<br />
kurzer Zeit gewöhnen können, wie wichtig es ist<br />
dankbar für gewisse Dinge zu sein und wie hilfreich<br />
klare sowie oftmals neue Spielregeln sein<br />
können, um gemeinsam vorwärts zu kommen.<br />
Auf der anderen Seite haben wir erkannt, das<br />
der Spagat zwischen dem beruflichen und privaten<br />
Leben nur ein sehr kleiner ist. Vieles, was<br />
wir im beruflichen Alltag gelernt haben, gilt<br />
auch für den privaten Bereich und umgekehrt.<br />
1. Gesundheit, unser wichtigstes Gut<br />
Ob Mitarbeiter, Partner oder Kunden: die Gesundheit<br />
und der größtmögliche Schutz aller<br />
Beteiligten steht für Organisationen im Vordergrund<br />
– und das ist heuer eine ganz besondere<br />
Aufgabe. Eine ständige Evaluierung der<br />
Arbeitsplatzsituation bzw. des Orts der Begegnung,<br />
ist essentiell um die rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
zu erfüllen, richtige Schritte zu<br />
setzen und für die Gesundheit aller zu sorgen.<br />
Viele mussten ihre Leistungen von „vor Ort“ auf<br />
„virtuell“ umstellen, sei es innerbetrieblich oder<br />
auch auf Kundenseite, um ihren Betrieb aufrecht<br />
zu erhalten. Dabei spielen auch soziale<br />
und psychologische Auswirkungen eine große<br />
Rolle. Während es für die Einen zu „Entschleunigung“<br />
kam, gehörten für Andere ständiger<br />
Stress, Dauererreichbarkeit und Beschleunigung<br />
zum neuen Arbeitsalltag dazu. Die Zusammenhänge<br />
von Mitarbeitergesundheit<br />
und Arbeitssicherheit können Sie hier nachlesen.<br />
Wertvolle Experten-Tipps, um psychischen<br />
Belastungen am Arbeitsplatz entgegenzuwirken,<br />
finden Sie in diesem Artikel.<br />
2. Agilität und Purpose in Wechselwirkung<br />
Um mit dem aktuellen Tempo, der täglichen<br />
Dynamik und Komplexität mitzuhalten, müssen<br />
Unternehmen abseits starrer Hierarchien, anpassungsfähig<br />
und unter ständiger Abwägung<br />
aktueller Bedingungen agil reagieren. Kurz gesagt:<br />
wer agil sein und die Krise bestmöglich<br />
meistern möchte, muss flexibel sein. Dass dieser<br />
Denkansatz von den Führungskräften bis zu<br />
den Mitarbeitern gelebt werden muss, hat uns<br />
die aktuelle Pandemie gezeigt. Ob es geplant<br />
war oder nicht, gerade heuer gilt es offen für<br />
Neues zu sein und gleichzeitig das „Trial-and-<br />
Error“ Prinzip zu verinnerlichen.<br />
Jeden Tag lernen wir so flexibel und anpassungsfähig<br />
zu sein, wie es die täglichen Herausforderungen<br />
in und außerhalb des Unternehmens<br />
verlangen. Werte wie Eigenverantwortung und<br />
Selbstorganisation rücken in den Fokus. Gleichzeitig<br />
stellt sich jedoch die Frage nach dem<br />
„Warum?“ und der Sinnhaftigkeit hinter der<br />
eigenen Tätigkeit. Aus diesem Grund darf der<br />
Purpose eines Unternehmens gerade in Krisenzeiten<br />
nie aus den Augen verloren werden.<br />
3. Es braucht besonders in Krisenzeiten Struktur<br />
Führungskräfte und Mitarbeiter, die in Krisensituationen<br />
wissen, was zu tun ist, reagieren besser<br />
und kommen schneller zum gewünschten<br />
Output. Managementsysteme, in denen Abläufe,<br />
Zuständigkeiten und Rahmenvorgaben<br />
definiert sind, helfen bei der Zielerreichung.<br />
Gleichzeitig unterstützen sie u. a. Führungskräfte<br />
dabei, jede Krise auch als Chance zu sehen.<br />
In Zeiten großer Unsicherheit beeinflussen<br />
Systemausfälle nicht nur das Unternehmensimage,<br />
kosten Geld und Zeit, sondern gefährden<br />
im Worst Case die<br />
Existenz. Jetzt ist es also<br />
wichtiger denn je, Normen<br />
wie die ISO 22301 (Business<br />
Continuity Managementsystem)<br />
als nützliche und<br />
hilfreiche Tools zu verwenden,<br />
um Betriebsunterbrechungen<br />
bzw. Unterbrechungen<br />
der Lieferfähigkeit<br />
zu vermeiden und somit im<br />
Krisenfall rasch wieder zur<br />
gewohnten Betriebsfähigkeit<br />
zu gelangen. Gleichzeitig<br />
bietet auch die ISO<br />
45001 (Arbeitssicherheit<br />
und Gesundheitsschutz)<br />
einen ganzheitlich präventiven<br />
Ansatz – in Kombination<br />
der beiden Normen ISO<br />
22301 und ISO 45001 kann<br />
es systematisch gelingen,<br />
sowohl Betriebsfähigkeit als<br />
auch Gesundheit der Mitarbeiter<br />
sicher zu stellen.<br />
4. Digitalisierungsbooster<br />
Wir erleben gerade eine<br />
massive Beschleunigung<br />
der Digitalisierung und können<br />
den Nutzen davon<br />
aufdecken.<br />
(...)<br />
LINK-TIPP:<br />
Lesen Sie den ganzen<br />
Beitrag auf der Website<br />
von Quality Austria.
<strong>UMWELT</strong>journal 6/<strong>2020</strong> | S34<br />
THEMEN FÜR IHREN ERFOLG<br />
Ausblick: <strong>UMWELT</strong> <strong>JOURNAL</strong> 2021<br />
Ausgabe 1/2021 erscheint Ende Jänner<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Unterlagenschluss<br />
Erscheinungstermin<br />
• Aus-, Weiterbildung Freitag Montag<br />
• Abfallbehandlung, -verwertung 15. Jänner 25. Jänner<br />
• Erneuerbare Energie<br />
• Special: E-World energy&water<br />
• Special: Energiesparmesse<br />
• Special: Bauen und Wohnen<br />
• Special: Tiroler Hausbau & Energie Messe<br />
• Wasser-, Abwasserbehandlung Freitag Montag<br />
• Messtechnik 2. April 12. April<br />
• Energietechnik und -netze<br />
• Bau-, Gebäudetechnik<br />
• Special: Light + Building<br />
• Special: IFAT<br />
• Special: RENEXPO<br />
• Green Logistics Freitag Montag<br />
• Kommunale Infrastruktur 21. Mai 31. Mai<br />
• Abluftreinigung | Filtertechnik<br />
• Grüne Industrietechnologie<br />
• Special: OÖ Umwelttage<br />
• Special: BatteryExperts Forum<br />
• Special: Smart Automation Austria<br />
• Recycling, Entsorgung Freitag Montag<br />
• Nachhaltiges Bauen, Sanieren 5. November 15. November<br />
• Kanal-, Rohrleitungstechnik<br />
• Deponietechnik, Rohstoffrückgewinnung<br />
• Special: Recy & DepoTech<br />
• Special: Ecomondo<br />
• Special: Pollutec<br />
In jedem Heft:<br />
Spezialthema • Branchennews • Internationale Entwicklungen • Technische Innovationen •<br />
Best Practices und Anwenderberichte • Serviceteil • Umweltrechtliche Fragen • Förderungen •<br />
Karriere und Ausbildung • Veranstaltungen • Pressestimmen • Rezensionen
<strong>UMWELT</strong> <strong>JOURNAL</strong> Sonderausgaben 2021<br />
Das <strong>UMWELT</strong> <strong>JOURNAL</strong> erscheint seit Jahren mit jeweils sechs gedruckten<br />
Ausgaben pro Jahr. Sie vereinen insbesondere Best-Practice-Beispiele, Anwenderberichte,<br />
Kommentare und Meinungen sowie Hintergrundberichte<br />
und Serviceinhalte. Den ganzen Newsflow aus den Themenwelten Klima,<br />
Umwelttechnik, Abfallwirtschaft, Energie, Green Finance und Mobilität gibt<br />
es laufend auf unserer Website umwelt-journal.at sowie begleitend in den<br />
Newslettern und auf unseren Social-Media-Kanälen.<br />
Im Jahr 2021 trennen wir zwei Ausgaben vom Erschinungszyklus ab und veröffentlichen<br />
diese als Sonderausgaben: Special Nr. 1 wird sich ausschließlich<br />
dem Thema MOBILITÄT widmen - von Alternativen Antrieben bis hin zu<br />
Mobilitäts- und Verkehrskonzepten. Special Nr. 2 wird sich zur Gänze einem<br />
bestimmten Umweltthema widmen. Details dazu im Laufe des Jahres.<br />
THEMEN FÜR IHREN ERFOLG<br />
Wir wollen mit dieser Aufteilung für unsere Leser aber auch für unsere<br />
Kunden den Fokus noch weiter verschärfen und die Ausgaben des Fachmagazins<br />
stärker themenorientiert orientieren. Schon jetzt freuen wir uns<br />
auf das Jahr 2021, denn Umweltthemen haben definitiv einen längeren<br />
Atem als jede Pandemie und werden uns alle daher weiterhin begleiten!<br />
Special 1 • MOBILITÄT<br />
Unterlagenschluss<br />
Freitag<br />
11. Juni<br />
Erscheinungstermin<br />
Montag<br />
21. Juni<br />
Special 2 • <strong>UMWELT</strong><br />
Freitag<br />
10. September<br />
Montag<br />
20. September<br />
HJS MEDIA WORLD APP<br />
Ihr exklusiver Zugriff auf die ganze Welt der Logistik: <strong>UMWELT</strong><br />
<strong>JOURNAL</strong>, BUSINESS+LOGISTIC, LOGISTIK EXPRESS, ÖSTERR.<br />
VERKEHRSZEITUNG bzw. blogistic.net, logistik-express.com,<br />
Holen Sie sich die Magazine mit einem einfachen Klick auf<br />
Ihr Smartphone oder Ihr Tablet und schmökern Sie in den<br />
aktuellsten Ausgaben und/oder in unserem für Sie bereit<br />
gestellten Magazin-Archiv. Und bei Bedarf können Sie die<br />
Magazine on Demand im Hochglanzformat drucken und<br />
zusenden lassen.<br />
umwelt-journal.at, oevz.com & Partner. Mit dieser App ent-<br />
Wir produzieren und vermarkten weitere SPECIALS und Sonderpublikationen zu anderen<br />
steht das größte zusammenhängende Informationsportal Hier warten mehr als 100.000 News, Artikel, Interviews,<br />
rund Themen um die Logistik. gerne jederzeit und auf Ihren Wunsch!<br />
Round Tables,<br />
Wenden<br />
Filme etc. rund<br />
Sie<br />
um<br />
sich<br />
die Themen<br />
dazu<br />
Logistik<br />
an unseren<br />
&<br />
Vertrieb:<br />
Zeit peter.nestler@umwelt-journal.at.<br />
ist kostbar! Daher beziehen Sie über die jetzt in den Umwelt. Rund 800.000 Unique User aus der DACH-Region<br />
App-Stores von Android und Apple erhältliche LOGISTIK nutzten in 2019 die Leistungen und Services der HJS MEDIA<br />
NEWS | HJS MEDIA WORLD APP täglich News.<br />
WORLD & Partner. Gehören auch Sie dazu!