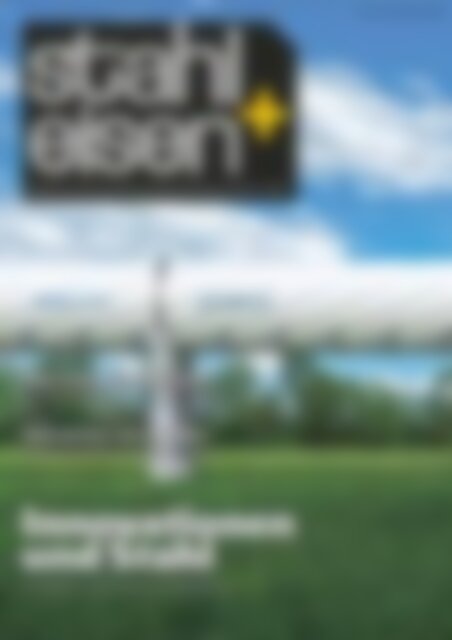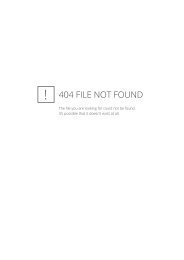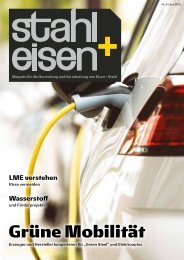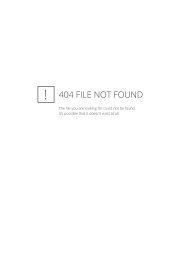stahl + eisen 01/2021 (Leseprobe)
INNOVATIONEN UND STAHL // WEITERE THEMEN: u.a. Erste Direktreduktionsanlage mit Einschmelzer, Effiziente Wartung des Lichtbogenofens, China-Kolumne: Modernisierungsoffensive, aus Wissenschaft + Technik: Richtmaschine lässt Planheitswerte bei allen Produkten deutlich steigen, Lieferketten - vom Härtetest zu neuen Allianzen, Nachhaltige Sicherheit mit Treppen aus Stahl
INNOVATIONEN UND STAHL // WEITERE THEMEN: u.a. Erste Direktreduktionsanlage mit Einschmelzer, Effiziente Wartung des Lichtbogenofens, China-Kolumne: Modernisierungsoffensive, aus Wissenschaft + Technik: Richtmaschine lässt Planheitswerte bei allen Produkten deutlich steigen, Lieferketten - vom Härtetest zu neuen Allianzen, Nachhaltige Sicherheit mit Treppen aus Stahl
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nr. 1/2 | Januar/Februar <strong>2021</strong><br />
Magazin für die Herstellung und Verarbeitung von Eisen + Stahl<br />
Wertschöpfungsketten<br />
Digitale Lösungen<br />
Simulation von Stählen<br />
Vorhersage mechanischer Eigenschaften<br />
Innovationen<br />
und Stahl<br />
Schlaglichter auf Erzeugung und Anwendung
EINFACH VIELSEITIG.<br />
Unsere Ventiltechnik ist genauso vielfältig wie Ihre Applikationen.<br />
Wir bieten kundenspezifische Lösungen mit Fokus auf den<br />
jeweiligen Einsatzfall und die Funktionalität der Gesamtanlage.<br />
So wird aus unserem Herzstück VENTIL eine kompakte Einheit<br />
bis hin zur energetisch effizienten Gesamtanlage.<br />
CALL US. LET‘S<br />
BRING OUT THE BEST.<br />
TEL.: +49 (0)2741 93 289 0<br />
EVERTZ Hydrotechnik GmbH & Co. KG | Gewerbepark 4 | 57518 Betzdorf, Germany | info@evertz-hydro.com | www.evertz-hydro.com | The EVERTZ-Group
Liebe Leserinnen & Leser,<br />
Im PS des Editorials<br />
verweise ich auf<br />
die wöchentlichen<br />
Stahl<strong>eisen</strong>News.<br />
Sie wollen unsere<br />
Branchen-Infos<br />
auch in den Social<br />
Media? Auf Twitter<br />
finden Sie uns als<br />
@<strong>stahl</strong><strong>eisen</strong>_de.<br />
auf den ersten Blick kennen meine Kollegen in der Tages- und<br />
Wirtschaftspresse weiterhin nur ein Thema. Positive, andere<br />
Meldungen fliegen da leicht unter dem Radar, auch wenn sie mehr<br />
Aufmerksamkeit verdient hätten. Beispiele aus unserer Branche gefällig?<br />
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Lang<strong>stahl</strong> hat Voestalpine den<br />
zweiten Hochofen am Standort Donawitz wieder hochgefahren; damit sind<br />
alle fünf Hochöfen in Österreich wieder in Betrieb. Noch erfreulicher sind die<br />
Nachrichten aus dem Ruhrgebiet. Die hohe Nachfrage nach Stahl hilft thyssenkrupp zu<br />
operativem Gewinn im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/<strong>2021</strong>, weshalb der<br />
Konzern seine Prognose erhöht hat – in der Folge stieg der Aktienkurs gleich mal um mehr als<br />
fünf Prozent. Außerdem investiert Deutschlands Erzeuger Nummer 1 wieder massiv an den<br />
Standorten in Duisburg und Bochum. Es handelt sich dabei um sein größtes Investitionspaket für<br />
Stahl seit 2003.<br />
Inhaltlich möchte ich Ihre Aufmerksamkeit u.a. auf unsere Titelstrecke lenken, in der wir<br />
verschiedene Schlaglichter rund um Innovationen in der Stahlerzeugung und Bearbeitung sowie<br />
Anwendung werfen. Auch hier ist thyssenkrupp Steel Europe vertreten, und zwar mit einem<br />
Beitrag über die erste Direktreduktionsanlage mit Einschmelzer und die Route zur<br />
Dekarbonisierung. Weitere Beiträge befassen sich u.a. mit ultradünner Produktion in maximaler<br />
Breite, einer hochdynamischen Servopresse ohne Zahnräder und Stahlkonzepte für höchste<br />
Hyperloop-Geschwindigkeiten.<br />
In den weiteren Rubriken finden Sie außerdem einen vierseitigen Marktüberblick zu Italien<br />
unseres Redakteurs Niklas Reiprich,einen lebenswerten englischsprachigen Fachbeitrag über<br />
„Multi-scale simulation of Steels“ und das Interview zur Umstellung der Stahl-Akademie auf<br />
Online-Seminare.<br />
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.<br />
Torsten Paßmann, Chefredakteur<br />
Quelle: Christian Talla (www.talla.hamburg)<br />
PS: Seit kurzem erscheint unser Newsletter Stahl<strong>eisen</strong>-News übrigens Dienstags. Zahlreiche Leser hatten sich<br />
die Verschiebung gewünscht, damit sie nach dem üblichen „Montagstrubel“ den kopf frei haben für die<br />
wichtigsten Infos aus der Branche. Auf <strong>stahl</strong><strong>eisen</strong>.de können Sie sich anmelden.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 3
Magazin für die Herstellung und Verarbeitung von Eisen + Stahl<br />
Digitale Lösungen<br />
Vorhersage mechanischer Eigenschaften<br />
Schlaglichter auf Erzeugung und Anwendung<br />
Nr. 1/2 | Januar-Februar 2020<br />
STAHL<br />
EISEN<br />
Inhalt 1/2 | <strong>2021</strong><br />
Cover:<br />
Stahl ist die Grundlage<br />
der Moderne.<br />
Wertschöpfungsketten<br />
Simulation von Stählen<br />
Innovationen<br />
und Stahl<br />
Quelle: Tata Steel<br />
NEWS<br />
TERMINE<br />
6 Wirtschaft + Industrie<br />
u.a. mit thyssenkrupp Steel Europe, Swiss Steel Group<br />
und GMH<br />
10 Klima + Umwelt<br />
u.a. mit ArcelorMittal, SSAB und einer BMU-Förderrichtlinie<br />
12 Additive Fertigung<br />
u.a. mit Trumpf, Forward AM und der MAMC<br />
TITELTHEMA: INNOVATIONEN<br />
16 Erste Direktreduktionsanlage mit<br />
Einschmelzer<br />
Deutschlands größter Stahlerzeuger skizziert den<br />
Status quo von „tk H2 Steel“ und den Weg zur Dekarbonisierung<br />
16<br />
Erste<br />
Direktreduktionsanlage mit<br />
Einschmelzer<br />
Status quo von „tk H2Steel“ und der Weg zur Dekarbonisierung<br />
18 Stahlkonzepte für höchste<br />
Geschwindigkeiten<br />
Die Erzeuger Tata Steel und Posco kooperieren bei der<br />
Entwicklung von Hyperloops<br />
19 Ultradünne Produktion in maximaler<br />
Breite<br />
Die kommende ESP-Anlage für U.S. Steel wird die<br />
erste ihrer Art in den USA sein<br />
20 Effiziente Wartung des Lichtbogenofens<br />
Ferngesteuertes Spritzen von Feuerfestmassen<br />
24 Höhere Wettbewerbsfähigkeit dank<br />
besser sortiertem Metallschrott<br />
Internationale Projektgruppe aus Forschung und Industrie<br />
will die Effizienz beim Recycling steigern<br />
POLITIK<br />
MÄRKTE<br />
26 Konträre Haltungen bei den Verbänden<br />
Wie sinnvoll sind die Schutzmaßnahmen für Stahl?<br />
28 Wo steht die italienische Stahl- und<br />
Anlagenbranche?<br />
Ein Blick auf Europas zweitgrößten Industriestandort<br />
32 Absatzeinbruch setzt Automobilbranche<br />
massiv unter Druck<br />
18% der mittelständischen Automobilzulieferer<br />
gefährdet<br />
70<br />
Nachhaltige Sicherheit mit<br />
Treppen aus Stahl<br />
Fluchtwege aus Edel<strong>stahl</strong> Rostfrei überzeugen<br />
auch durch ihre Optik<br />
34 Digitale Abbildung der Wertschöpfungskette<br />
und Online-Zertifizierung in Echtzeit<br />
Maßgeschneiderte Produkte lassen sich mit intelligenten,<br />
online-basierten Lösungen besser schützen<br />
36 Lieferketten – vom Härtetest zu neuen<br />
Allianzen<br />
Herausforderungen bei den Wertschöpfungsketten<br />
sind auch ein Thema der Metav digital<br />
4 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
38 „Ein noch höherer Mehrwert mit erweiterten<br />
digitalen Formaten“<br />
Interview mit Gerrit Nawracala von der Messe<br />
Düsseldorf<br />
40 Modernisierungsoffensive<br />
China-Kolumne von Fabian Grummes<br />
41 Stagnation der deutschen Wirtschaft<br />
im Schlussquartal 2020<br />
Aktuelle Meldung aus dem BMWi<br />
WISSENSCHAFT<br />
TECHNIK<br />
47 Multi-scale simulation of Steels<br />
Advanced microstructural modelling to incorporate<br />
microstructure parameters<br />
28<br />
Wo steht die italienische Stahlund<br />
Anlagenbranche?<br />
Interview mit den Partnern des Projektes „ProLMD“<br />
53 Richtmaschine lässt Planheitswerte bei<br />
allen Produkten deutlich steigen<br />
Anwenderbericht skizziert die Erfahrungen eines<br />
Stahl-Service-Centers<br />
RECHT<br />
FINANZEN<br />
58 Neuregelung zur Frauenquote für<br />
Vorstände und Aufsichtsräte<br />
Das Gesetz wird praktischen Konsequenzen wird<br />
das Gesetz haben<br />
60 Frauenquote als Einstiegsdroge<br />
Standpunkt von Birgit Kelle, Publizistin<br />
61 Vollstreckungsschutz gegen das Finanzamt<br />
Rechts-Tipp von Prof. Dr. Gunter M. Hoffmann<br />
BERUF<br />
KARRIERE<br />
62 Sich trennen ohne vermeidbare Wunden<br />
Zur Wahrung des Betriebsfriedens können externe<br />
Berater eine Lösung sein<br />
64 „Unsere Online-Formate finden weltweite<br />
Resonanz“<br />
Interview mit Peter Schmieding von der Stahl-<br />
Akademie<br />
STYLE<br />
STORY<br />
Multi-Scale Simulation of Steels<br />
47 Advanced microstructural modelling to<br />
incorporate microstructure parameters<br />
70 Nachhaltige Sicherheit mit Treppen<br />
aus Stahl<br />
Fluchtwege aus Edel<strong>stahl</strong> Rostfrei überzeugen<br />
zusätzlich durch ihre Optik<br />
IMMER<br />
EWIG<br />
3 Editorial<br />
9 Termine<br />
42 Länder + Anlagen<br />
66 VDEh-Personalia<br />
72 Vorschau + Impressum<br />
74 People<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 5
NEWS<br />
TERMINE<br />
Wirtschaft<br />
Industrie<br />
Luftaufnahme Standort<br />
Duisburg, thyssenkrupp Steel<br />
Europe AG<br />
Größtes Stahl-Investitionspaket<br />
für thyssenkrupp seit 2003<br />
Mit dem Neubau von Kernaggregaten an<br />
den Standorten Duisburg und Bochum<br />
zielt thyssenkrupp auf den Ausbau von<br />
Premium-Stählen und die Stärkung der<br />
Wettbewerbsfähigkeit. Geplant ist der<br />
Umbau der Duisburger Gießwalzanlage<br />
in eine neue Stranggießanlage mit einem<br />
dahinter geschalteten, in wesentlichen<br />
Komponenten neuen Warmbandwerk.<br />
Zur Optimierung der Brammenfertigung<br />
wird, ebenfalls in Duisburg, zudem die<br />
bestehende Stranggießanlage 3 neu gebaut.<br />
Auch am Standort Bochum sind<br />
Investitionen vorgesehen: Geplant ist ein<br />
neues Doppelreversiergerüst und eine<br />
Glüh- und Isolierlinie. Beides stärkt Bochum<br />
als Kompetenzzentrum bei Stählen<br />
für die Elektromobilität. Die gesamte<br />
Investitionssumme beläuft sich auf einen<br />
hohen dreistelligen Millionenbetrag. Alle<br />
Projekte sollen bis Ende 2024 realisiert<br />
werden. Mit dem Maßnahmenbündel<br />
setzt thyssenkrupp die hauseigene<br />
„Stahlstrategie 20-30“ weiter um. Für den<br />
in der jüngeren Vergangenheit heftig von<br />
Krisen geschüttelten Ruhrgebietskonzern<br />
handelt es sich dabei um größte Investitionspaket<br />
im Stahl seit dem Bau der Kokerei<br />
Schwelgern im Jahr 2003.<br />
Frank Koch wird neuer CEO der Swiss Steel Group<br />
Frank Koch<br />
Demontieren, reparieren, wieder montieren<br />
– darum ging es in den letzten Wochen<br />
des vergangenen und den ersten des<br />
neuen Jahres bei Feralpi Stahl. Dafür ruhte<br />
das Stahlwerk vom 21. Dezember bis<br />
25. Januar, das Drahtwerk bis 3. Januar<br />
und das Walzwerk bis 18. Januar. Es wurden<br />
beispielsweise Absaugleitungen erneuert,<br />
die Schrottplatzwand saniert, die<br />
Schlackenbeete für Ofen- und Pfannenschlacke<br />
rekonstruiert, Rekuperationsrohre<br />
für die Luftvorwärmung an den<br />
Pfannenfeuern installiert, die Pfannenfeuer<br />
selbst einer Revision unterzogen<br />
und Seilrollen gewechselt. Im Schmelzhaus<br />
ist ein neuer Schrotteinsatzkran<br />
Spätestens ab dem 1. Januar 2022 soll Frank Koch<br />
die Swiss Steel Group leiten. Der Verwaltungsrat<br />
des Schweizer Stahlkonzerns hat den Manager vor<br />
kurzem zum künftigen CEO ernannt. Koch (48)<br />
begann seine berufliche Laufbahn 1991 mit einer<br />
Ausbildung zum Industriekaufmann in der Stahlsparte<br />
von thyssenkrupp. Beim Einsatz in verschiedenen<br />
Stationen des Industriekonzerns war er erstmals<br />
für die zur Swiss Steel Group gehörenden<br />
Deutsche Edel<strong>stahl</strong>werke (DEW) tätig, bevor er<br />
2004 bis 2006 für Strategie und Vertrieb beim italienischen<br />
Anlagenbauer Danieli verantwortlich<br />
zeichnete. Diesen Bereich verantwortete er dann<br />
auch bei der DEW, zu welcher er 2006 zurückkehrte.<br />
Zuletzt stand Koch an der Spitze der Georgsmarienhütte<br />
Holding, von wo aus er nun zur Swiss<br />
Steel Group wechselt. Dort folgt er auf Clemens<br />
Iller, der sich laut einer Pressemeldung des Konzerns<br />
dazu entschieden hat, das Unternehmen zu<br />
verlassen. Er werde jedoch bis auf Weiteres beratend<br />
zur Verfügung stehen, „um einen nahtlosen<br />
Übergang an seinen Nachfolger sicherzustellen“.<br />
Feralpi Stahl beendet Großreparatur und investiert<br />
hinzugekommen, am Ende der Walzstraße<br />
geht die Drahtbindezone nach zwei<br />
Jahren Projekt- und Bauzeit an den Start,<br />
und im Drahtwerk wird die neue Versaline-Anlage<br />
zur Herstellung von Listenmatten<br />
in Betrieb genommen.<br />
Quellen: thyssenkrupp Steel Europe; Swiss Steel Group<br />
6 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
EJP expandiert in der internationalen Drahtindustrie<br />
Die EJP Maschinen GmbH mit Sitz in Baesweiler bei Aachen hat im Dezember 2020<br />
eine substanzielle Beteiligung an der Italmec Sp. Z o.o. aus dem polnischen Kattowit<br />
übernommen. So komplettiert die EJP Gruppe mit Drahtziehmaschinen für<br />
kohlenstoffhaltige Drähte ihr Produktspektrum und liefert vollständige Produktionslinien<br />
für die gesamte Prozesskette vom Walzdraht bis zum fertigen Coil aus<br />
einer Hand. Bereits im Frühjahr 2020 hatte EJP gemeinsam mit Lothar Köppen die<br />
EJP WIRE Technology gegründet, die Maschinen und die dazugehörige Prozesstechnologie<br />
für die Vorbehandlung von Draht liefert. Gleichzeitig war EJP mit dem polnischen<br />
Maschinenbauunternehmen Italmec eine Kooperation für die Vermarktung<br />
von Drahtziehlinien eingegangen. Die EJP Maschinen GmbH stellt nach wie<br />
vor Maschinen für die Herstellung von Stangen, Rohren und Profilen her.<br />
Geradeausziehmaschine von EJP Italmec für hochgekohlte Drähte<br />
Tragende Rolle für Dillinger bei Tageszeitung Le Monde<br />
Der Sitz von Le Monde, in dem auch 1 000 Grobblech<br />
von Dillinger stecken, steht in der Nähe des Pariser<br />
Bahnhofs Austerlitz.<br />
Mit der offiziellen Eröffnung des neuen<br />
Hauptsitzes der französischen Tageszeitung<br />
Le Monde erhielt Paris ein<br />
neues architektonisches Highlight.<br />
Eine Stahlkonstruktion, ähnlich einer<br />
Fußgängerbrücke, an der Metall- und<br />
Betonböden aufgehängt werden. Die<br />
verglaste Brücke des 7-stöckigen Bauwerks<br />
ist 137 Meter lang und 37 Meter<br />
hoch und verbindet Natur mit<br />
Technologie: einerseits Grünanlagen,<br />
andererseits die über die gesamte<br />
Fläche verteilte LED-Beleuchtung,<br />
ähnlich den sich am Himmel bewegenden<br />
Sternen. Die Fassade des Gebäudes<br />
ist mit einer Matrix aus Glaspixeln<br />
verkleidet, welche verschiedene<br />
Effekte – mal transparent, mal<br />
undurchsichtig – ergeben. Das Dach<br />
ist mit Photovoltaikmodulen und einer<br />
Regenwasserauffanganlage ausgestattet.<br />
Stahl von Dillinger spielt dabei<br />
eine „tragende Rolle“: 1 000 Tonnen<br />
Dillinger Grobblech stecken in der<br />
Stahlkonstruktion des außergewöhnlichen<br />
Projekts. Sowohl Dillinger als<br />
auch die Tochtergesellschaft Dillinger<br />
France stellten die bei diesem Neubauprojekt<br />
eingesetzten Bleche her.<br />
Notwendig wurde die Brückenkonstruktion<br />
durch die städtebauliche Auflage,<br />
eine nicht bebaubare Fläche in<br />
der Mitte des Grundstücks zu überspannen.<br />
GMH-Gruppe verstärkt sich mit Windhoff<br />
und Kranbau Köthen<br />
Nach ihrer Neuausrichtung als separat gehaltene Unternehmen<br />
der Familie Großmann sind Kranbau Köthen und Windhoff<br />
Bahn- und Anlagentechnik seit Mitte Januar wieder in die GMH-<br />
Gruppe integriert. Diese Geschäftsfelderweiterung in die Bereiche<br />
Maschinen- und Anlagenbau stärke die Unternehmensgruppe<br />
ihre Substanz und Ertragskraft, heißt es in einer Unternehmensmeldung.<br />
Kranbau Köthen ist spezialisiert auf Sonder-,<br />
Prozess- und Automatikkrane (von rund 50 Tonnen bis 650 Tonnen)<br />
und liefert Planung, Engineering, Fertigung, Montage und<br />
Service aus einer Hand. Windhoff Bahn- und Anlagentechnik<br />
GmbH bietet Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeugtechnik,<br />
Bahn- und Rangiertechnik für Bau- und Instandhaltung der<br />
Schieneninfrastruktur. Im Jahr 2<strong>01</strong>9 erzielten die beiden Unternehmen<br />
mit rund 250 bzw. 280 Mitarbeitern einen Umsatz von<br />
rund 50 respektive 70 Mio. Euro.<br />
Quellen: EJP Italmec; Dillinger<br />
Salzgitter-Konzern beliefert Pipelineprojekt in Katar<br />
Der Salzgitter-Konzern hat einen Großauftrag für rund 160 000 Tonnen längsnahtgeschweißter Großrohre und Rohrbögen für ein<br />
bedeutendes Pipeline- Projekt in Katar erhalten. Der Auftrag wurde an die internationale Handelstochter der Salzgitter AG, die Salzgitter<br />
Mannesmann International GmbH, erteilt. Das Unternehmen ist neben der Überwachung der Lieferkette auch für alle Projektkoordinierungs-<br />
und Ausführungsschritte gesamtheitlich verantwortlich. Die Großrohre werden von Europipe, Mülheim, einem<br />
Joint Venture der Salzgitter AG mit der AG der Dillinger Hüttenwerke, erzeugt. Die Rohrbögen werden im Mülheimer Rohrbiegewerk<br />
von Salzgitter Mannesmann Grobblech hergestellt.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 7
NEWS<br />
TERMINE<br />
Klima<br />
Umwelt<br />
Im ArcelorMittal-Hochofen in<br />
Eisenhüttenstadt soll künftig<br />
Erdgas eingesetzt werden<br />
ArcelorMittal und VNG kooperieren für<br />
nachhaltige Produktion<br />
Der Stahlerzeuger ArcelorMittal und der Erdgaslieferant VNG<br />
wollen künftig zusammenarbeiten, um die Produktion von<br />
Stahlerzeugnissen am Standort Eisenhüttenstadt nachhaltiger<br />
zu gestalten. Dafür sei zunächst geplant, den CO 2 -Ausstoß der<br />
Stahlherstellung an dem Standort ab diesem Jahr um etwa<br />
fünf Prozent zu verringern, so ArcelorMittal in einer Pressemeldung.<br />
Gelingen soll dies durch eine Umstellung des Hochofens<br />
auf den Einsatz von Erdgas. Das reduziere den Kohlebedarf<br />
und trage außerdem – neben der Senkung der CO 2 -Emissionen<br />
– zu niedrigeren Energiekosten bei. Die Umrüstung des<br />
Ofens, die Unternehmensangaben zufolge rund vier Millionen<br />
Euro kostet, will ArcelorMittal Eisenhüttenstadt bis Mitte des<br />
Jahres abschließen. Im Rahmen der Klimastrategie des Konzerns<br />
beabsichtigt der brandenburgische Stahlhersteller –<br />
ebenfalls gemeinsam mit VNG – in einem späteren Schritt die<br />
Beimischung von CO 2 -neutralem Wasserstoff. Vorerst müsse<br />
dieser aber in ausreichender Menge und zu wirtschaftlichen<br />
Kosten zur Verfügung stehen.<br />
BMU-Förderrichtlinie „Dekarbonisierung in<br />
der Industrie“ in Kraft getreten<br />
Zum Jahresbeginn ist die neue Förderrichtlinie „Dekarbonisierung<br />
in der Industrie“ in Kraft getreten. Das Förderprogramm<br />
des Bundesumweltministeriums soll energieintensiven Branchen<br />
– darunter Stahl, Kalk, Chemie und Nicht<strong>eisen</strong>metalle –<br />
dabei helfen, schwer vermeidbare, prozessbedingte Treibhausgasemissionen<br />
durch den Einsatz innovativer Klimaschutztechnologien<br />
weitgehend und dauerhaft zu reduzieren. Bis 2024<br />
stehen für das Programm insgesamt rund zwei Milliarden Euro<br />
zur Verfügung. Das Ziel sei eine „starke, wettbewerbsfähige<br />
Industrie, die ohne fossile Energie und Rohstoffe“ auskomme,<br />
denn Klimaschutz sei ein „Innovationstreiber für die Wirtschaft“,<br />
mache „den Industriestandort Deutschland zukunftsfähig“<br />
und sichere „hochqualifizierte Arbeitsplätze“, so Bundesumweltministerin<br />
Svenja Schulze. Ansprechpartner für das<br />
BMU-Förderprogramm ist das Kompetenzzentrum Klimaschutz<br />
in energieintensiven Industrien (KEI) in Zusammenarbeit mit<br />
dem Umweltbundesamt (UBA). Veröffentlicht wurde die Richtlinie<br />
Mitte Januar im Bundesanzeiger.<br />
Quellen: Bernd Geller<br />
10 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
CO 2 -Emissionen 2020 stark rückläufig<br />
Infolge der Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus sind<br />
die Treibhausgasemissionen Deutschlands im Jahr 2020 erheblich<br />
zurückgegangen. Sie lagen um 42,3 Prozent unter den<br />
Emissionen des Referenzjahres 1990. Der Treibausgasausstoß<br />
sank somit unter die Marke des Klimaschutzziels für 2020 von<br />
40 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt der Thinktank „Agora<br />
Energiewende“ in seinem Jahresrückblick. Den Abschätzungen<br />
zufolge reduzierte Deutschland seine Treibhausgasemissionen<br />
um über 80 Millionen Tonnen CO 2 auf rund 722 Millionen Tonnen.<br />
Zwei Drittel dieser Minderung sind Corona-Effekte, ohne<br />
sie hätte der Rückgang bei etwa 25 Millionen Tonnen gelegen.<br />
Haupttreiber der Entwicklung waren laut Agora Energiewende<br />
die durch die Rezession bedingten Rückgänge bei Energieverbrauch,<br />
Industrieproduktion und Verkehr, relativ hohe CO 2 -Preise<br />
in Kombination mit niedrigen Gaspr<strong>eisen</strong>, sowie ein milder<br />
Winter mit geringem Heizenergieverbrauch.<br />
Wasserelektrolyse von thyssenkrupp: Großauftrag<br />
in Kanada<br />
Für seinen Produktbereich „Green Hydrogen“ hat thyssenkrupp<br />
Uhde Chlorine Engineers einen Großauftrag des kanadischen<br />
Wasserkraftversorgers Hydro-Québec erhalten. Eine der „weltweit<br />
ersten und größten“ Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff<br />
soll installiert werden. Bei der Anlage handelt es sich<br />
um eine sogenannte Wasserelektrolyse, die Wasser mittels elektrischen<br />
Stroms in seine Bestandteile Wasser- und Sauerstoff zerlegt.<br />
Weil sie die bisher einzige skalierte Technologie zur Produktion<br />
grünen (mit erneuerbaren Energien erzeugten) Wasserstoffs<br />
ist, gilt sie als Schlüsseltechnologie zur Dekarbonisierung<br />
des Industriesektors. Das Exemplar für Hydro-Québec umfasst<br />
eine Kapazität von 88 Megawatt und soll nach Betriebsbeginn<br />
jährlich 11 100 Tonnen des Energieträgers produzieren. Der Bau<br />
der Wasserelektrolyse erfolgt am Standort Varennes, wo die Anlage<br />
Ende 2023 in Betrieb gehen soll. Hierzulande planen thyssenkrupp<br />
Steel, Uhde Chlorine Engineers sowie das Energieunternehmen<br />
Steag den Bau und Betrieb einer Wasserelektrolyse<br />
in Duisburg-Walsum. Derzeit untersuchen die Unternehmen,<br />
wie das benachbarte Stahlwerk von thyssenkrupp Steel Europe<br />
mit grünem Wasserstoff und Sauerstoff versorgt werden kann.<br />
Montage eines Wasserelektrolyse-Moduls zur Herstellung von<br />
grünem Wasserstoff<br />
Design-S Award für Gebäude mit organisch<br />
beschichtetem SSAB-Stahl<br />
Quellen: thyssenkrupp Steel Europe<br />
Aufgrund seiner Ästhetik, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit hat<br />
Architekt Thomas Sandell organisch beschichteten GreenCoat-<br />
Stahl für die Fassade und das Dach seines ausgezeichneten Entwurfs<br />
gewählt.<br />
In der Kategorie Architektur hat das in Schweden viel beachtete<br />
„Fisksätra Folket Hus“den angesehenen Swedish Design Award<br />
„Design-S 2020“ erhalten. Gestaltet wurde das Kulturzentrum<br />
von dem Architekturbüro sandellsandberg in Stockholm, das<br />
beid er Gestaltung auf nachhaltigen, organisch beschichteten<br />
GreenCoat-Stahl von SSAB setzte. Das Gebäude hat eine auffällige,<br />
zeltförmige Konstruktion, bei der die Wände und das Dach<br />
aus Stahl in sinusförmigen Profilen gebaut sind. Der warme<br />
Farbton Silver Fir Green wurde gewählt, um einen ausgezeichneten<br />
Kontrast zu den orangefarbigen Backsteingebäuden der Umgebung<br />
zu bilden. Der schwedische Stararchitekt Thomas Sandell<br />
hat sich für GreenCoat Pro BT wegen dessem Fähigkeit entschieden,<br />
ein auffälliges Erscheinungsbild zu gestalten sowie<br />
seiner Umformbarkeit, einfachen Montage und seiner UV- und<br />
Korrosionsbeständigkeit. Hinzu kommt die Nachhaltigkeitskomponente<br />
des Stahls: „Da das Gebäude temporär sein soll, war es<br />
wichtig, ein umweltfreundliches Material zu nehmen, das auch<br />
wiederverwendet werden kann“, erklärt Sandell.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 11
NEWS<br />
TERMINE<br />
Additive Fertigung<br />
Unter anderem mittels<br />
„Laser Metal Fusion“<br />
arbeitet das Joint Venture<br />
„Trumpf-SISMA“,<br />
das Trumpf nun komplett<br />
übernehmen will.<br />
Trumpf will AM-Sparte stärken<br />
Das Unternehmen Trumpf plant, seinen Geschäftsbereich Additive<br />
Manufacturing (AM) zu stärken. Nach eigenen Angaben befindet<br />
sich der Werkzeugmaschinenhersteller „in fortgeschrittenen<br />
Gesprächen“ mit seinem italienischen Partner SISMA. Gegenstand<br />
der Verhandlung ist eine Komplettübernahme des gemeinsamen<br />
Joint Ventures „Trumpf-SISMA“, an dem Trumpf derzeit<br />
55 Prozent der Anteile trägt. Der Betrieb wurde 2<strong>01</strong>4 gegründet<br />
und hat seinen Sitz im norditalienischen Schio. Dort arbeiten<br />
rund 60 Mitarbeiter in Entwicklung und Produktion von Metall-3D-Druck-Maschinen<br />
mittels der Technologie „Laser Metal<br />
Fusion“. Darüber hinaus beabsichtigt Trumpf, die AM-Aktivitäten<br />
von SISMA in der Industrie und Medizin weiterzuführen.<br />
3D-Druck-Software nutzt künstliche Intelligenz<br />
für Bauteil-Nesting<br />
Die neue Nesting-Funktion der Software 4D_Additive von Core-<br />
Technologie bedient sich erstmals der künstlichen Intelligenz<br />
(KI) zur Automatisierung intelligenten Verhaltens und maschinellen<br />
Lernens. So bilde die neue Technologie bestimmte Entscheidungsstrukturen<br />
des Menschen nach, heißt es seitens der<br />
Entwickler. Der Computer bearbeite aufgrund der Programmierung<br />
dann eigenständig aufwändige Aufgaben im Bereich der<br />
Bauteil-Anordnung. CoreTechnologie zufolge ist das Nesting-<br />
Modul mit einer „Pack und Optimize“-Strategie in der Lage,<br />
sowohl für eine maximale Füllung des Bauraums als auch eine<br />
gleichmäßige Verteilung der zu druckenden Masse zu sorgen.<br />
In der Folge ermögliche es eine möglichst konstante Slice-Fläche.<br />
„Hierbei nutzt das fortschrittliche Programm die KI-Technologie<br />
und ahmt das Verhalten eines erfahrenen Anwenders<br />
nach, indem nach der Vorpositionierung gezielt leere Stellen<br />
im Bauraum automatisch gefüllt werden“, erklärt das Unternehmen<br />
seine neue Lösung. Das habe den Vorteil, dass auch<br />
nicht maximal bestückte Bauräume gleichmäßig ohne sogenannte<br />
Wärme-Nester bestückt werden. Über das intelligente<br />
Nesting hinaus stehen weitere Funktionen zur Optimierung<br />
der Wärmeverteilung zur Verfügung: Unter anderem integriert<br />
die neue Software eine Analyse zur Ermittlung sogenannter<br />
„massiver Zonen“, die problematische Bereiche mit viel Materialvolumen<br />
grafisch darstellt. Für die Aufbereitung von 3D-<br />
Druckdaten verfügt das Tool 4D_Additive über CAD-Daten-<br />
Schnittstellen aller B-Rep-Nativ- und Standardformate sowie die<br />
gängigen 3D_Printing-Formate wie STL und 3mf.<br />
Das 3D-Printing-Tool 4D_Additive nutzt erstmals Algorithmen der<br />
künstlichen Intelligenz, um die Druckergebnisse zu optimieren.<br />
Quellen: Trumpf; CoreTechnologie<br />
12 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
MAMC <strong>2021</strong> findet im November statt<br />
Vom 3. bis 5. November findet in der<br />
Wirtschaftskammer Österreich in Wien<br />
die Neuauflage der Metal Additive Manufacturing<br />
Conference (MAMC) <strong>2021</strong> statt.<br />
Darin lädt ASMET, die österreichische<br />
Gesellschaft für Metallurgie und Materialien,<br />
Entscheider, Ingenieure, Entwickler,<br />
Industrie-Experten, Wissenschaftler und<br />
Studenten dazu ein, exklusive Einblicke<br />
in die additive Verarbeitung von Metallen<br />
zu erhalten. Behandelt werden etwa<br />
der grundlegende Themenbereich Pulver,<br />
Systeme und Ausrüstung . Ein weiterer<br />
Fokus liegt auf den konkreten Prozessen<br />
Laser Melting, Electro Beam Melting und<br />
Direct Energy Deposition sowie dem<br />
Qualitätsmanagement und der Nachbearbeitung.<br />
Aktuelle Forschungsfragen<br />
runden das inhaltliche Spektrum ab.<br />
Forward AM launcht neues Edel<strong>stahl</strong>-Filament<br />
Unter seiner Marke Forward AM hat das Unternehmen<br />
BASF das neue Filament Ultrafuse 17-4 PH für den Metall-3D-Druck<br />
eingeführt. Geeignet ist es nach eigenen Angaben<br />
für die Technologie Fused Filament Fabrication (FFF).<br />
Nach dem anschließenden Entbinderungs- und Sinterungsprozess<br />
bestehe das fertige Bauteil aus 17-4 Edel<strong>stahl</strong>, der<br />
sich aufgrund seiner hohen mechanischen Festigkeit und<br />
Härte für eine Vielzahl von Anwendungen – beispielsweise<br />
für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau – eignet.<br />
Impression des neuen Edel<strong>stahl</strong>-Filaments 17-4 PH von<br />
Forward AM.<br />
Erfolgreiche Finanzierungsrunde für Uniformity Labs<br />
Das Unternehmen Uniformity Labs, ein kalifornischer Hersteller<br />
von Material- und Softwarelösungen für den industriellen<br />
3D-Druckmarkt, hat eine Finanzierungsrunde über 38,35 Millionen<br />
US-Dollar abgeschlossen. Der Erlös soll vor allem in den<br />
Ausbau der Produktionskapazitäten und die Entwicklung weiterer<br />
Spezialmaterialien fließen. Darüber hinaus soll er dazu<br />
beitragen, das Führungsteam zu verstärken – insbesondere in<br />
den Bereichen Marketing und Vertrieb. Noch im Laufe des Jahres<br />
werde der Prozess „deutlich an Fahrt aufnehmen“, heißt es<br />
seitens Uniformity Labs. Die Investition entstammt einem<br />
Fonds, der von Orion Resource Partners verwaltet wird. Dabei<br />
handelt es sich um einen der weltweit führenden Investoren in<br />
den Bereichen Bergbau, Metallverarbeitung und Metallrohstoffhandel<br />
mit einem Gesamtvermögen von rund 6,3 Milliarden<br />
US-Dollar.<br />
Protolabs übernimmt Handelsplattform 3D Hubs<br />
Quelle: Forward AM<br />
Das Unternehmen Protolabs hat eine endgültige Vereinbarung<br />
zur Übernahme der Online-Handelsplattform 3D Hubs geschlossen.<br />
Die Transaktion in Höhe von 280 Millionen Euro<br />
stellt Protolabs nun ein Netzwerk von rund 240 Fertigungspartnern<br />
zur Verfügung, die – so das Unternehmen – ein „breites<br />
Spektrum an Möglichkeiten außerhalb des derzeitigen Leistungsumfangs“<br />
erfüllen. Das 2<strong>01</strong>3 in Amsterdam gegründete<br />
Unternehmen 3D Hubs hat über seine digitale Plattform die<br />
Produktion von über sechs Millionen kundenspezifischen Teilen<br />
und Produkten ermöglicht. Dabei erhalten die Nutzer nach<br />
eigenen Angaben eine sofortige Preiskalkaltion sowie Feedback<br />
zum Design. Anschließend würden eingehende Bestellungen<br />
durch sorgfältig geprüfte Fertigungspartner in über 20 Ländern<br />
weltweit ausgeführt, „die enorme Fertigungskapazitäten und<br />
eine breite Palette von Fertigungsmöglichkeiten zu wettbewerbsfähigen<br />
Pr<strong>eisen</strong> bieten“.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 13
TITELTHEMA: INNOVATIONEN<br />
Überblick<br />
Innovationen im<br />
Viele Errungenschaften der Moderne<br />
sind erst durch Stahl möglich geworden.<br />
Aber auch die Branche entwickelt sich<br />
permanent weiter.<br />
14 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
und mit Stahl<br />
Die Titelstrecke beleuchtet verschiedene Aspekte rund um den Werkstoff,<br />
ohne den keine Zukunft möglich ist. Dazu gehören Schlaglichter auf die Dekarbonisierung<br />
der Stahlerzeugung, ultradünne Produktion bei maximaler Walzbandbreite,<br />
Umformung mit einer neuen Servorpresse und ein Transportmittel mit Höchstgeschwindigkeit.<br />
Quelle: Tata Steel<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 15
TITELTHEMA: INNOVATIONEN<br />
Transformtation<br />
Als thyssenkrupp mit dem Konzept für Elektro-Roh<strong>eisen</strong> aus dem Hochofen 2.0 an die Öffentlichkeit ging, waren auch Bundeswirtschaftsminister<br />
Peter Altmaier und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet vor Ort.<br />
Erste Direktreduktionsanlage mit<br />
Einschmelzer<br />
Deutschlands größter Stahlerzeuger skizziert den Statusquo von „tk H2 Steel“ und den<br />
Weg zur Dekarbonisierung<br />
DARUM GEHT’S: Der Stahlbereich steht<br />
heute für rund zwei Prozent der CO 2 <br />
Emissionen in Deutschland. Als größter<br />
hiesiger Stahlerzeuger kann thyssenkrupp<br />
damit einen spürbaren Beitrag<br />
zur Dekarbonisierung des Landes leisten.<br />
Bis 2030 sollen die Emissionen um<br />
30 % gesenkt werden und bis 2050 soll<br />
das Unternehmen ein klimaneutral sein.<br />
Ab 2026 will das Unternehmen Eisenschwamm<br />
elektrisch einschmelzen.<br />
Die Stahlherstellung über Eisenerz ist<br />
bisher eng verbunden mit dem Einsatz<br />
von Kohlenstoff. Die seit Jahrhunderten<br />
bestehende Hochofenroute steht<br />
für rund 80% der weltweiten Stahlproduktion.<br />
Dabei entstehen große Mengen CO 2 .<br />
Durch den Einsatz von Wasserstoff kann<br />
Kohlenstoff ersetzt werden. Bereits heute<br />
erprobt thyssenkrupp den Einsatz von Wasserstoff<br />
in einem bestehenden Hochofen in<br />
Duisburg. So können kurzfristig im bestehenden<br />
Anlagenpark erste CO 2 Einsparungen<br />
erreicht werden. Um vollständig klimaneutral<br />
zu werden, ist jedoch ein vollständiger<br />
Technologiewandel notwendig. Die Stahlproduktion<br />
muss neu gedacht werden.<br />
tkH2Steel als innovativer und<br />
kostengünstiger Weg<br />
thyssenkrupp Steel setzt auf den Umstieg<br />
auf Direktreduktionsanlagen. In diesen<br />
können Erdgas oder Wasserstoff als Reduktionsmittel<br />
eingesetzt werden, um aus Eisenerz<br />
Eisenschwamm zu gewinnen. Kohle<br />
ist dann nicht mehr nötig. Bereits der<br />
Einsatz von Erdgas reduziert die CO 2 -<br />
Emissionen deutlich, Wasserstoff senkt sie<br />
gegen Null. Die erste Direktreduktionsanlage<br />
soll 2024 in Duisburg in den Betrieb<br />
gehen und rund 1,2 Millionen Tonnen Eisenschwamm<br />
produzieren. Dabei handelt<br />
es sich um ein festes Produkt. Um den Eisenschwamm<br />
im Stahlwerk weiterzuverarbeiten,<br />
muss er zunächst eingeschmolzen<br />
werden. Anfangs wird dies im Hochofen<br />
geschehen. Ab 2026 wird thyssenkrupp<br />
dafür stattdessen ein völlig neues, strombetriebenes<br />
und innovatives Schmelzaggregat<br />
einsetzen und so den ersten Hochofen<br />
vollständig ersetzen. Das Gute: die Vorteile<br />
des integrierten Standortes bleiben erhalten.<br />
Zudem ermöglicht dieser Weg die geringsten<br />
Transformationskosten und den<br />
Beibehalt des vollständigen Produktportfolios.<br />
Standortvorteil Duisburg –<br />
Sicherung von Arbeitsplätzen<br />
Duisburg als größter europäischer Stahlstandort<br />
kann dabei auch zukünftig seine<br />
Vorteile ausspielen. Neben den bestehenden<br />
logistischen Anbindungen durch die<br />
Nähe zum Rhein und die direkten Anschlüsse<br />
an Straßen und Schienennetz<br />
kann das Stahlwerk Duisburg mit wenig<br />
Aufwand an wichtige Gasnetze angeschlossen<br />
werden – und damit perspektivisch<br />
auch Wasserstoffnetze. Die neuen Direktreduktionsanlagen<br />
und Schmelzaggregate<br />
werden sich nahtlos in das bestehende<br />
Produktionsnetzwerk einfügen, sodass die<br />
Vorteile kurzer Wege zu Stahl und Walzwerken<br />
bestehen bleiben. Das sichert Arbeitsplätze<br />
am Stahlstandort Duisburg.<br />
Klimaneutraler Wasserstoff als<br />
entscheidender Faktor<br />
Wichtige Voraussetzung für die klimaneutrale<br />
Stahlindustrie ist die Verfügbarkeit<br />
von grünem Wasserstoff, der für die Transformation<br />
der Stahlproduktion ohne Alternative<br />
ist. Beim Stahl ist der Einsatz des<br />
Wasserstoffs zudem enorm effektiv: eine<br />
Tonne grüner Wasserstoff vermeidet<br />
Quelle: thyssenkrupp Steel Europe<br />
16 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
25 Tonnen CO 2 . Gleichzeitig werden sehr<br />
große Mengen zu wettbewerbsfähigen Pr<strong>eisen</strong><br />
benötigt, weshalb die politischen und<br />
regulatorischen Rahmenbedingungen eine<br />
wichtige Rolle spielen: Neben dem Auf und<br />
Ausbau der inländischen Wasserstoffkapazitäten<br />
sind internationale Partnerschaften<br />
unabdingbar. Daneben müssen Transportinfrastrukturen<br />
durch Pipelines und<br />
Schiffsrouten ausgebaut werden.<br />
Rahmenbedingungen für Investitionen<br />
integrale Voraussetzung<br />
Die Transformation der Stahlproduktion<br />
ist mit erheblichen finanziellen Anstrengungen<br />
verbunden. Für den Bau einer Direktreduktionsanlage<br />
inklusive Schmelzaggregat<br />
sind Investitionen von rund einer<br />
Milliarde Euro notwendig. Um diese Kosten<br />
zu stemmen, sind die Stahlproduzenten auf<br />
staatliche Hilfe angewiesen. Dabei kommen<br />
verschiedene Optionen in Frage, die von<br />
einer Verstärkung und Flexibilisierung von<br />
Förderprogrammen bis zu Investitionszulagen<br />
reichen. Kein Stahlhersteller wird die<br />
Klimatransformation aus eigener Kraft<br />
schaffen können.<br />
Aufbau eines Marktes für<br />
grünen Stahl<br />
Neben den hohen Investitionskosten wird<br />
auch die laufende Produktion von grünem<br />
Stahl selbst mit höheren Kosten verbunden<br />
sein als die Produktion von herkömmlichem<br />
Stahl. Haupttreiber ist dabei der deutliche<br />
Aufpreis für Wasserstoff gegenüber Kohle.<br />
Entsprechend wichtig ist es, Anreize und<br />
Instrumente zu schaffen, die einen Markt<br />
für grünen Stahl etablieren. Im Rahmen der<br />
Klimatransformation der Stahlproduktion<br />
wird das Angebot von grünem Stahl kontinuierlich<br />
steigen. thyssenkrupp wird bereits<br />
2022 erste Mengen (50.000 Tonnen pro Jahr)<br />
anbieten können. Diese Menge wird ab 2027<br />
auf rund 950.000 Tonnen ansteigen. Aber:<br />
Nur wenn grüner Stahl auch Abnehmer<br />
findet, kann die Transformation gelingen.<br />
Meilensteine bis 2050 definiert<br />
Um die Klimaziele bis 2030 und 2050 zu<br />
erreichen, werden weitere Schritte – über<br />
die erste Direktreduktionsanlage hinaus –<br />
notwendig sein. Ab etwa 2030 will thyssenkrupp<br />
daher eine zweite Anlage inkl.<br />
Schmelzaggregat betreiben und so insgesamt<br />
bereits rund 3 Mio. Tonnen klimaneutralen<br />
Stahl produzieren. Bis zum Jahr<br />
2050 werden dann zwei weitere Anlagen<br />
gebaut, die schrittweise die bestehenden<br />
Hochöfen ersetzen, um das Ziel der Klimaneutralität<br />
bis 2050 zu erreichen. Parallel<br />
wird das Unternehmen weiter auf Carbon-<br />
2Chem und die Nutzung von CO 2 setzen,<br />
um die Mengen des Treibhausgases aufzufangen<br />
und in Chemieprodukte umzuwandeln,<br />
die sich nicht durch den Wasserstoffeinsatz<br />
vermeiden lassen.<br />
Laufende Anpassung der<br />
Klimastrategie<br />
Entlang von technologischen Entwicklungen<br />
und Erkenntnissen wird thyssenkrupp<br />
die Klimastrategie kontinuierlich überprüfen<br />
und bei Bedarf anpassen. Geltende Maxime<br />
ist dabei stets, die Klimatransformation<br />
möglichst effizient und möglichst<br />
schnell zu gestalten. Eine erste Anpassung<br />
des Pfades ist der Einsatz der neuartigen<br />
Schmelzaggregate, die die Integration der<br />
Direktreduktionsanlage in die bestehende<br />
Struktur des Duisburger Hüttenwerks ermöglichen.<br />
Damit einhergeht, dass das<br />
Unter nehmen derzeit keine Elektrolichtbogenöfen<br />
bauen wird, die zeitweise als<br />
Folgeaggregate eingeplant waren. Ferner<br />
ist das Unternehmen mit Blick auf die absehbar<br />
geringe Verfügbarkeit von grünem<br />
Wasserstoff in den kommenden Jahren<br />
davon abgerückt, alle Hochöfen in Duisburg<br />
für den Einsatz von Wasserstoff auszurüsten.<br />
Verfügbarer Wasserstoff wird ab<br />
dem Jahr 2024 primär in der neuen Direktreduktionsanlage<br />
eingesetzt werden.<br />
tk Steel Europe<br />
Hochofen und Direktreduktionsanlage mit Einschmelzer<br />
im Vergleich<br />
Der Umstieg auf „Elektro-Roh<strong>eisen</strong>“ ist das erklärte Ziel.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 17
TITELTHEMA: INNOVATIONEN<br />
Anwendung<br />
Hochdynamische Servopresse<br />
ohne Zahnräder<br />
Der Werkzeugbauer und Lohnfertiger Huissel setzt auf eine 800 Tonnen starke Presse<br />
neuester Bauart von Schuler<br />
DARUM GEHT‘S: In herkömmlichen mechanischen<br />
Pressen sorgt ein Getriebe im<br />
Kopfstück für den Gleichlauf der Motoren.<br />
Die MSP-Baureihe setzt in dort und<br />
auch in anderen Bereichen auf andere<br />
Ansätze. In der Praxis führt das zu einigen<br />
Optimierungen, mit denen der<br />
Werkzeugbauer und Lohnfertiger Huissel<br />
als erster Nutzer zufrieden ist.<br />
Vor allem das innovative Konzept der<br />
800 Tonnen starken Presse hat Gerald<br />
Schug überzeugt: Bei der Anlage<br />
kommen zwei ausschließlich elektronisch<br />
synchronisierte Antriebsstränge in gegenüberliegender<br />
Anordnung zum Einsatz, die<br />
aus jeweils einem hochdynamischen Servomotor,<br />
einem Bremsmodul und einer Exzenterwelle<br />
bestehen. In herkömmlichen<br />
mechanischen Pressen sorgt ein Getriebe im<br />
Kopfstück für den Gleichlauf der Motoren.<br />
„Durch den Verzicht auf Zahnräder ist die<br />
Maschine viel dynamischer als bisherige<br />
Servopressen“, erklärt Schug. Er ist Geschäftsführer<br />
der Huissel GmbH mit Sitz im<br />
pfälzischen Enkenbach-Alsenborn, die als<br />
erster Kunde von Schuler eine Presse der<br />
neu entwickelten MSP-Baureihe einsetzt.<br />
Mechanische Eigenschaften<br />
Bei der MSP-Baureihe liegen zudem die<br />
Druckpunkte weiter außen, als man es aus<br />
dem traditionellen Pressenbau kennt, wodurch<br />
sich die mögliche außermittige Belastung<br />
erhöht. Teil des Gesamtkonzepts ist<br />
auch eine sehr feine elektronische Parallelitätsüberwachung<br />
für den Stößel. „Der<br />
Kniehebelantrieb in Querwellenbauweise<br />
spielt vor allem im unteren Arbeitsbereich<br />
seine Stärken aus“, ergänzt Schug. Die konstante<br />
Umformgeschwindigkeit kurz vor<br />
dem unteren Umkehrpunkt bietet vor allem<br />
beim Prägen, Biegen und Ziehen mechanische<br />
Vorteile. Davon profitiert die<br />
Huissel GmbH, die u.a. alle gängigen Stahlblechqualitäten<br />
und Edel<strong>stahl</strong> bearbeitet,<br />
beispielsweise bei der Umformung von Deckeln<br />
und Schalen für Lüftungsanlagen.<br />
Auch mit der Automation der Presse, die<br />
Schuler ebenso geliefert hat, ist Schug<br />
rundum zufrieden. Zum Lieferumfang gehören<br />
eine Bandanlage in Langbauform<br />
Der Werkzeugbauer und Lohnfertiger Huissel ist der erste Kunde mit einer 800 Tonnen<br />
starken Schuler-Presse der neu entwickelten MSP-Baureihe.<br />
vom Typ „Power Line“, der Walzenvorschub<br />
„Power Feed“ und der modulare elektronische<br />
Drei-Achs-Transfer „ProTrans“ mit<br />
aktiver Schwingungskompensation. Eine<br />
Dreifach-Beölung des Bandmaterials sorgt<br />
für optimale Umformbedingungen.<br />
Werkzeug-Simulation verhindert<br />
mögliche Kollisionen<br />
Darüber hinaus investierte Huissel unter<br />
anderem für den eigenen Werkzeugbau in<br />
die Simulations-Lösung DigiSim. Damit<br />
lässt sich eine mögliche Kollision eines<br />
Werkzeugs mit dem Transfer bereits erkennen,<br />
während sich dieses noch in der<br />
Konstruktionsphase befindet. Im Rahmen<br />
einer Schulung im Oktober vergangenen<br />
Jahres mit den Experten von Schuler lernten<br />
die Anwender die umfassenden Möglichkeiten<br />
der Software kennen und bedienen.<br />
Zur Steuerung der Presse braucht<br />
es dagegen keine großen Vorkenntnisse, da<br />
die Bediener bei Bedarf unter sechs bereits<br />
einprogrammierten Bewegungskurven des<br />
Stößels auswählen können, die auf das gewünschte<br />
Produkt abgestimmt sind. Der<br />
„Smart Assist“ führt außerdem Schritt für<br />
Schritt durch den Einrichtevorgang für<br />
neue Werkzeuge, wodurch sich der Produktionsanlauf<br />
bei Huissel verkürzen lässt.<br />
Sicherheit und Fazit<br />
Sollte es trotz allem zu einer Fehlbedienung<br />
kommen, verhindert die elektronische<br />
Überlastsicherung Schlimmeres: Sie<br />
registriert ein Überschreiten der Presskraft<br />
sofort und ändert innerhalb von wenigen<br />
Millisekunden das Drehmoment des Hauptantriebs<br />
in die entgegengesetzte Richtung,<br />
um einen Werkzeugschaden zu minimieren.<br />
Dank eines Energiespeichers reduziert<br />
sich die Anschlussleistung des Gesamtsystems<br />
deutlich. Nicht zuletzt stimmt für<br />
Gerald Schug das äußere Erscheinungsbild<br />
der bisher größten Investition in der Firmengeschichte<br />
von Huissel: „Der Aufbau<br />
der Maschine macht was her“, formuliert<br />
es der Geschäftsführer – zumal die MSP 800<br />
auch mit ihren inneren Werten überzeugen<br />
kann.<br />
Quelle: Schuler Group<br />
22 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Nr. 1/2 | Januar-Februar 2020<br />
Magazin für die Herstellung und Verarbeitung von Eisen + Stahl<br />
Wertschöpfungsketten<br />
Digitale Lösungen<br />
Simulation von Stählen<br />
Vorhersage mechanischer Eigenschaften<br />
Innovationen<br />
und Stahl<br />
Schlaglichter auf Erzeugung und Anwendung<br />
Lesen Sie,<br />
was wirklich wichtig ist!<br />
Einzelhefte und Abonnements finden Sie im Shop.<br />
www.<strong>stahl</strong><strong>eisen</strong>shop.de
POLITIK<br />
MÄRKTE<br />
Verbände<br />
Auch in diesem Jahr bleiben der Stahlindustrie die Herausforderungen erhalten, die sie bereits 2020 beschäftigt haben.<br />
Konträre Haltungen bei WV Stahl<br />
und IBU<br />
Branchenverbände der Erzeuger und Verarbeiter bewerten Schutzmaßnahmen<br />
gegensätzlich<br />
AUTORIN: Niklas Reiprich<br />
niklas.reiprich@<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de<br />
DARUM GEHT’S: Engpässe in der Stahlversorgung,<br />
ein drohender Importdruck<br />
und die Sorge vor zu hohen Transformationskosten<br />
– das sind jene Herausforderungen,<br />
die <strong>stahl</strong>verarbeitende und -produzierende<br />
Unternehmen hierzulande<br />
auch weiterhin beschäftigen. Die aktuellen<br />
Schutzmaßnahmen spalten dabei die<br />
Gemüter. Ein Überblick.<br />
Bei den Verarbeitern gilt Stahl – vor<br />
allem Flach<strong>stahl</strong> – derzeit als Mangelware,<br />
wie der Industrieverband<br />
Blechumformung (IBU) verdeutlicht. Erste<br />
Ergebnisse einer Blitzumfrage des Verbandes<br />
Ende 2020 zeigen, dass knapp 90 Prozent<br />
der Mitgliedsunternehmen Beschaffungsprobleme<br />
haben. Weil die geltenden<br />
Einfuhrbeschränkungen das Ausweichen<br />
auf Stahl aus Drittländern erschweren, befürchtet<br />
IBU-Geschäftsführer Bernhard Jacobs:<br />
„Auf die Pandemiekrise folgt die Beschaffungskrise.“<br />
Ihm zufolge müsse die<br />
Marktversorgung in Europa „Vorrang haben<br />
vor Anti-Dumping-Maßnahmen und politisch<br />
motivierten Importbeschränkungen“.<br />
Die Beschaffungsprobleme beträfen sowohl<br />
planmäßig bestellte Mengen als auch<br />
Mehrbedarfe. Laut Umfrage haben 86 Prozent<br />
der Unternehmen Versorgungsprobleme<br />
beim Stahleinkauf über Servicecenter.<br />
Auf Platz zwei folgt der Direktbezug bei<br />
Stahlherstellern. Beide Bezugsquellen konfrontierten<br />
verarbeitende Unternehmen<br />
zurzeit mit Lieferzeiten bis weit ins neue<br />
Jahr, manche böten Jahresverträge gar<br />
nicht mehr an. Als Folge befürchten laut<br />
IBU-Erhebung über 70 Prozent der Mitglieder<br />
Produktionsunterbrechungen im ersten<br />
Quartal <strong>2021</strong>. 96 Prozent sehen durch<br />
die dramatische Versorgungslage ihre Lieferfähigkeit<br />
bedroht. „Teilweise müssen sie<br />
bereits jetzt Mengen reduzieren, weil das<br />
Vormaterial fehlt“, so Jacobs. Zusätzlicher<br />
Bedarf sei gar nicht oder nur unter großen<br />
Mühen zu decken.<br />
Stahlangebot wächst langsamer<br />
als Nachfrage<br />
Parallel dazu erleben Einkäufer massive<br />
Preisaufschläge, so der IBU. Auch im Ver-<br />
Quelle: Shutterstock<br />
26 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
tragsgeschäft sei die Rede von deutlichen<br />
Erhöhungen. „Das hat niemand kommen<br />
sehen“, registriert auch Andreas Schneider<br />
von Stahlmarkt Consult. „Am Ende eines<br />
Stahljahres, das lange unter dem Vorzeichen<br />
einer großen Krise stand, zeigen die<br />
Märkte eine fulminante Aufwärtsbewegung.<br />
Stahl- und Rohstoffpreise haben inzwischen<br />
nicht nur das Vor-Corona-Niveau<br />
übertroffen, sondern langjährige oder sogar<br />
historische Höchststände erreicht.“ Ein<br />
Grund: Das europäische Stahlangebot<br />
wachse langsamer als die Nachfrage. „Kern<br />
der Entwicklung ist, dass die im Sommer<br />
vorherrschende Erwartung einer nur zögerlichen<br />
Erholung der Industrie und des<br />
Welthandels von der tatsächlichen Entwicklung<br />
überholt worden ist“, so Schneider.<br />
Demnach haben Produzenten die<br />
Hochöfen also nicht parallel zum Bedarfsanstieg<br />
hochgefahren.<br />
Einfuhren aus Drittländern könnten<br />
dem Mangel entgegenwirken, meint der<br />
IBU. Über 60 Prozent der befragten Verbandsmitglieder<br />
sind jedoch der Meinung,<br />
dass geltende EU-Importbeschränkungen<br />
das Versorgungsproblem verstärken. Vor<br />
kurzem hat die EU bekanntgegeben, neue<br />
Antidumping-Zölle auf Einfuhren warmgewalzter<br />
Coils aus der Türkei zu verhängen.<br />
Vor diesem Hintergrund geht der IBU<br />
davon aus, ebendiese „gewollte Abschottung“<br />
schütze europäische Stahlproduzenten<br />
und belaste wiederum die Stahlverarbeiter,<br />
die auf das Vormaterial angewiesen<br />
seien. Der Verband will nun mit Nachdruck<br />
auf die erwähnten Beschaffungsprobleme<br />
aufmerksam machen und dazu anregen,<br />
Einfuhrbeschränkungen zu hinterfragen.<br />
„Unsere Mitglieder sehen gerade ein paar<br />
Lichtblicke. Wir können es uns jetzt nicht<br />
leisten, diesen Positivtrend durch einen<br />
Materialengpass zu gefährden“, zieht Jacobs<br />
ein Fazit.<br />
Neue Steuerbelastung trifft<br />
Produzenten hart<br />
In der Tat ist die WV Stahl grundsätzlich<br />
der Meinung, die Schutzmaßnahmen im<br />
Außenhandel müssten der coronabedingt<br />
konjunkturellen Situation der Stahlhersteller<br />
angepasst werden – so betonte es Verbandschef<br />
Hans Jürgen Kerkhoff bereits im<br />
Juli des vergangenen Jahres. Nur so, das<br />
wird auch aus einem jüngsten Statement<br />
im vergangenen Dezember deutlich, könne<br />
die hiesige Stahlindustrie ihre Schlüsselrolle<br />
auf dem Weg zur klimaneutralen<br />
Wirtschaft entfalten. Mit CO 2 -armen Produktionsverfahren<br />
und nachhaltigen Produkten<br />
mache sich die Branche auf den<br />
Weg, einen „entscheidenden Beitrag zum<br />
Erreichen der Klimaziele“ zu leisten. Die<br />
Bundesregierung jedoch will letztere seit<br />
Jahresbeginn maßgeblich durch eine CO 2 -<br />
Bepreisung erreichen, die rechtlich im sogenannten<br />
Brennstoffemissionshandelsgesetz<br />
(BEHG) geregelt ist.<br />
Im Auftrag der WV Stahl hat nun das<br />
Beratungsunternehmen Prognos jene Risiken<br />
analysiert, die entstehen können, sollte<br />
die Dekarbonisierung der Stahlindustrie<br />
ausschließlich durch steigende CO 2 -Preise<br />
forciert werden. So führe eine einseitige<br />
Erhöhung der CO 2 -Preise in diesem Wirtschaftszweig<br />
unweigerlich zu einem Rückgang<br />
von Produktion und Beschäftigung –<br />
insbesondere bei der Primär<strong>stahl</strong>route.<br />
Konkret sei bei einer nicht international<br />
abgestimmten Anhebung jenes Preises in<br />
Deutschland bis 2035 ein Produktionsrückgang<br />
in Höhe von 40 Prozent zu erwarten.<br />
Das wiederum bedeute einen Verlust von<br />
rund 200 000 Arbeitsplätzen und rund 114<br />
Milliarden Euro Wertschöpfung, schildert<br />
die Studie ein Szenario.<br />
Sorge: Hohe Kosten durch<br />
CO 2 -Verlagerung<br />
Anlässlich dieser möglichen Entwicklung<br />
zeigt sich Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident<br />
der WV Stahl, alarmiert. Er weist auf die<br />
„massiven Herausforderungen“ hin, denen<br />
die Stahlunternehmen in Deutschland und<br />
Europa gegenwärtig gegenüberstehen. „Sie<br />
werden durch immer ambitioniertere Klimaziele<br />
gefordert, ohne dass der notwendige<br />
Förderrahmen steht.“ Die einzige Möglichkeit,<br />
die klimapolitischen Ziele zu erreichen,<br />
sei die Einführung neuer CO 2 -armer<br />
Produktionsverfahren. „Gelingt diese Transformation<br />
nicht, droht Stahl künftig in anderen<br />
Regionen der Welt mit deutlich geringeren<br />
Klimaschutzauflagen produziert und<br />
anschließend nach Europa importiert zu<br />
werden“, warnt Kerkhoff.<br />
Das Resultat: ein Anstieg der globalen<br />
CO 2 -Emissionen. Dessen wirtschaftliche Auswirkungen<br />
analysiert Prognos-Experte Dr.<br />
Michael Böhmer wie folgt: „Die volkswirtschaftlichen<br />
Kosten je ins Ausland verlagerter<br />
Tonne CO 2 belaufen sich auf durchschnittlich<br />
600 Euro. Dies übersteigt die<br />
höheren Produktionskosten eines wasserstoffbasierten<br />
Verfahrens um ein Vielfaches.“<br />
Daher sei es ökonomisch effizienter,<br />
rät Böhmer, „wenn die Politik die betroffenen<br />
Stahlunternehmen bei ihrer Transformation<br />
zu CO 2 -armen Produktionsverfahren<br />
unterstützt“. Die Transformation müsse<br />
umfassend finanziell gefördert und abgesichert<br />
werden, wenn Europa seine Vorreiterrolle<br />
im Klimaschutz ernst nehme, fügt Verbandschef<br />
Kerkhoff hinzu.
POLITIK<br />
MÄRKTE<br />
Italien<br />
Viele italienische Produzenten<br />
erzeugen aus<br />
Eisenschrott Langprodukte,<br />
um die nationale sowie<br />
internationale Baubranche<br />
zu bedienen.<br />
Status Quo: Wo steht die<br />
italienische Stahl- und Anlagenbranche?<br />
Ein Blick auf Europas zweitgrößten Industriestandort<br />
AUTOR: Niklas Reiprich,<br />
niklas.reiprich@<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de<br />
DARUM GEHT‘S: Wie kein anderes Land in<br />
der Europäischen Union hat Italien derzeit<br />
mit den Folgen der Corona-Pandemie zu<br />
kämpfen. Hinzu gesellt sich eine tiefgreifende<br />
Regierungskrise. Und dennoch gilt<br />
die hiesige Industrie, an der Stahlproduktion<br />
und Maschinenbau im hohen Maße<br />
beteiligt sind, als die zweitstärkste Europas<br />
und trägt durch hohe Ausfuhren essenziell<br />
zur Wirtschaftsstärke bei. Grund<br />
genug also, einen Blick auf die konkreten<br />
Herausforderungen dieser Branchen sowie<br />
deren ökonomische Beschaffenheit zu<br />
werfen.<br />
Das Geschäft mit dem Stahl macht in<br />
Italien einen erheblichen Teil der<br />
Wirtschaftsleistung aus – und spendet<br />
in vielen Regionen eine Vielzahl von<br />
Arbeitsplätzen. Nach Angaben des in Mailand<br />
ansässigen Branchenverbands Federacciai<br />
hat die Nation im jüngsten Berichtszeitraum<br />
November 2020 knapp 2 Millionen<br />
Tonnen Roh<strong>stahl</strong> erzeugt (3,2 Prozent<br />
mehr im direkten Vorjahresvergleich), und<br />
reiht sich somit – nach Deutschland – auf<br />
Platz zwei der größten Stahlindustrien<br />
Europas. Doch zeigt diese Zahl nur einen<br />
Teil der Rechnung, hat das Land im gesamten<br />
Jahresverlauf (Stand November) seine<br />
Produktion doch um 14,2 Prozent eindampfen<br />
müssen.<br />
Die Zahl entspricht in etwa jener, die Alessandro<br />
Bonzato, Präsident von Federacciai,<br />
im Sommer des vergangenen Jahres gegenüber<br />
dem Informationsdienst S&P Global<br />
Platts genannt hatte. Darin betonte er sogar,<br />
die italienische Stahlproduktion werde<br />
2020 um etwa 15 Prozent sinken, insbesondere<br />
bedingt durch die eingebrochene<br />
Nachfrage aus dem Automobilsektor. Weitere<br />
Einschränkungen aus der Politik, so<br />
schätzte der Manager seinerzeit die Lage<br />
ein, würden jedoch voraussichtlich lokal<br />
begrenzt und somit „weniger wirtschaftlich<br />
störend“ sein als solche aus dem Frühjahr.<br />
Zu dieser Zeit – ab dem ersten Shutdown<br />
Mitte März – schloss Italien für fast<br />
zwei Monate alle Stahlwerke mit Ausnahme<br />
von Arvedi und ArcelorMittal Italia, so<br />
S&P Global Platts. Letzteres Werk, gemeinhin<br />
bekannt unter dem Namen „Ilva“,<br />
schmückt auch abseits der Corona-Lage seit<br />
geraumer Zeit die Schlagzeilen der Presse.<br />
Ilva: ArcelorMittal Italia<br />
zunehmend unter Druck<br />
Wie Kallanish Steel berichtete, hat das apulische<br />
Gericht von Lecce, das Tribunale Amministrativo<br />
Regionale (TAR), ArcelorMittal Italia<br />
– dem aktuellen Betreiber von Ilva – 60<br />
Tage Zeit gegeben, die Flüssigphase des Werks<br />
einzustellen. Der Grund für die Anordnung<br />
Quelle: Elchin Javadov/Shutterstock<br />
28 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Quelle: Oleksiy Mark/Shutterstock<br />
sei dessen übermäßiger CO 2 -Ausstoß, beruft<br />
sich die Branchenplattform auf die Entscheidung<br />
des Gerichts. Demzufolge seien die<br />
Emissionen „außer Kontrolle“ und eine Gefahr<br />
für das Leben der Bürger von Tarent, die<br />
bereits seit Jahrzehnten die negativen Umweltauswirkungen<br />
beklagen. Während ArcelorMittal<br />
selbst Einspruch gegen eine Schließung<br />
des Betriebs erheben wolle, habe auch<br />
Federacciai seine Besorgnis geäußert. Der<br />
Verband befürchte, „dass eine solche Aktion<br />
den Neustart des Werks stoppen oder verlangsamen<br />
könnte“. Die Arbeiten zur Verbesserung<br />
der Umweltleistung an dem Standort<br />
seien nach dessen Angaben im Gange.<br />
Dabei schien nach monatelangem Zittern<br />
um dessen Zukunft – und damit auch<br />
um die zahlreichen Arbeitsplätze in der<br />
Hafenstadt – nun endgültig eine feste Vereinbarung<br />
getroffen, die einen von Europas<br />
größten Stahlstandorten aus der Schieflage<br />
führen soll. Zuletzt hatte ArcelorMittal<br />
bekanntgegeben, eine „öffentlich-private<br />
Partnerschaft“ mit der italienischen Betriebsansiedlungsagentur<br />
Invitalia gebildet<br />
zu haben – eine entsprechende Unterzeichnung<br />
erfolgte am 10. Dezember 2020. Damit<br />
wurde offiziell: Der Stahlkonzern hat<br />
den italienischen Staat als Mehrheitseigentümer<br />
an Bord geholt. Mit einer Beteiligung<br />
von 60 Prozent ist letzterer in das operative<br />
Geschäft jenes Unternehmens eingestiegen,<br />
welchem in der Vergangenheit schon mehrere<br />
Male das endgültige Aus prophezeit<br />
wurde. Insgesamt fließen dafür 1,1 Milliarden<br />
Euro, heißt es in einer Pressemeldung<br />
von ArcelorMittal, zu zahlen in zwei<br />
Tranchen. Die erste Zahlung in Höhe von<br />
400 Millionen Euro soll – vorbehaltlich der<br />
kartellrechtlichen Genehmigung der EU –<br />
bis zum 31. Januar <strong>2021</strong> getätigt werden.<br />
Dadurch erhält Invitalia zugleich die gemeinsame<br />
Kontrolle an dem vor Ort zuständigen<br />
Unternehmen AM InvestCo Italy.<br />
Die zweite Tranche in Höhe von rund 680<br />
Millionen Euro wird hingegen fällig, sobald<br />
alle Bedingungen für den Kauf erfüllt sind.<br />
Die Deadline beläuft sich derzeit auf Mai<br />
2022. Zu diesem Zeitpunkt erhöht sich der<br />
Anteil Invitalias an AM InvestCo dann auf<br />
60 Prozent. Der Stahlhersteller selbst will<br />
ebenfalls bis zu 70 Millionen Euro investieren,<br />
um einen Teil der Kontrolle (40 Prozent)<br />
zu halten.<br />
Anlagen zur Dekarbonisierung<br />
im Fokus<br />
Auch auf einen neuen Industrieplan für<br />
Ilva haben sich beide Unternehmen bereits<br />
geeignet. Demnach sehen sie unter anderem<br />
Investitionen in kohlenstoffärmere<br />
Technologien zur Stahlerzeugung vor, darunter<br />
den Bau eines Elektrolichtbogenofens<br />
(EAF) mit einer Kapazität von 2,5<br />
Millionen Tonnen pro Jahr. Zudem umfasst<br />
das Modernisierungspaket, das in erster<br />
Linie auf die Umweltverträglichkeit des<br />
Werks abzielt, auch den Bau einer Direktreduktionsanlage<br />
(DRI). Bis 2025, so das<br />
grundsätzliche Ziel, wollen die Partner die<br />
Produktion auf 8 Millionen Tonnen pro<br />
Jahr erhöhen. Gelingen soll dies etwa durch<br />
eine Reihe öffentlicher Unterstützungsmaßnahmen<br />
einschließlich einer staatlich<br />
finanzierten Beschäftigungsförderung.<br />
Im Rahmen der neuen Vereinbarung, so<br />
heißt es seitens Invitalia, sollen die insgesamt<br />
10 700 im Werk beschäftigten Mitarbeiter<br />
übernommen werden. Zuvor – noch unter<br />
alleiniger Führung – hatte ArcelorMittal geplant,<br />
knapp die Hälfte der Arbeitsplätze als<br />
Bedingung für die Fortsetzung der Produktion<br />
abzubauen. Ein entsprechendes Echo<br />
löste im vergangenen Sommer unter anderem<br />
ein 24-stündiger Streik aus, durch welchen<br />
sich die zunehmend besorgten Mitarbeiter<br />
eine hörbare Stimme verschaffen wollten.<br />
Unterstützung erhielten sie seinerzeit von<br />
Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri, der<br />
den angekündigten Kahlschlag als „inakzeptabel“<br />
bezeichnete. „Das Unternehmen muss<br />
seiner Verantwortung bewusst werden“, betonte<br />
er hiesigen Medienberichten zufolge<br />
im Gespräch mit Gewerkschaftsvertretern.<br />
Mini-Mills: Starke Wirtschaftsstruktur<br />
im Norden<br />
Im Jahr 2<strong>01</strong>9 wurde<br />
in Italien ein<br />
überproportional<br />
hoher Anteil von<br />
81,8 Prozent des<br />
Stahls über die<br />
Elektro<strong>stahl</strong>route<br />
erzeugt.<br />
Während in Tarent die Wirtschaft erst wieder<br />
angekurbelt werden muss, offenbart<br />
sich weiter nördlich ein konstanter und<br />
wesentlicher Treiber für die ökonomische<br />
Leistung Italiens: eine dichte Konzentration<br />
der heimischen Stahlbranche auf die Industrieregion<br />
Brescia. Informationen der hiesigen<br />
Handelskammer zufolge entstanden<br />
dort bereits nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
mehrere mechanische Walzwerke – hauptsächlich<br />
dank der hohen Verfügbarkeit von<br />
Schrott, der durch die von Bomben zerstörten<br />
Schienen in der Region anfiel. Da<br />
jedoch ab der zweiten Hälfte der 1950er<br />
Jahre keine zu verschrottenden Schienen<br />
mehr zur Verfügung standen, waren jene<br />
Walzwerke gezwungen, ihren Stahl in anderen<br />
italienischen Provinzen zu kaufen.<br />
Damit verloren sie zugleich den Kostenvorteil,<br />
den sie durch den Erwerb von gutem<br />
und günstigem Schrott in der Nachkriegszeit<br />
errungen hatten. Daraufhin beschloss<br />
eine Reihe von Stahl- und Eisenunternehmen<br />
aus Brescia, gemeinsam ein Werk zu<br />
errichten, das die benötigten Stahlbarren<br />
direkt produzierte. Letztere konnten sie<br />
dann – im Gegensatz zum Material aus<br />
anderen Regionen – verhältnismäßig günstig<br />
an sich selbst verkaufen.<br />
Heute finden sich in Italien eine Vielzahl<br />
sogenannter „Mini-Mills“. Entgegen eines<br />
herkömmlichen integrierten Stahlwerks,<br />
das einen hohen Kapitalbedarf aufweist,<br />
zeichnen sich diese durch einen EAF mit<br />
direkter Anbindung zu den nachgeschalteten<br />
Gießanlagen und Walzwerken aus. Im<br />
Vergleich zur Hochofenroute pointieren<br />
Hersteller entsprechender Produktionskomplexe<br />
geringere Gesamtkosten, die sich<br />
unter anderem aus der kompakteren Bauweise<br />
ergäben. Auch das Anlagendesign sei<br />
in der Regel komprimierter, weil die Gießwärme<br />
üblicherweise direkt in die Walzung<br />
überführt und somit keinen Erwärmungsofen<br />
mehr benötigt werde. Da überwiegend<br />
recycelte Rohstoffe als Energieträger fungieren,<br />
gelten Mini-Mills zudem als wesentlich<br />
energieeffizienter.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 29
POLITIK<br />
MÄRKTE<br />
Messen<br />
Die Heller-Gruppe entwickelt und<br />
produziert CNC-Werkzeugmaschinen<br />
und Fertigungssysteme für die<br />
spanende Bearbeitung. Das Unternehmen<br />
setzt vornehmlich auf europäische<br />
Lieferanten, bezieht Material<br />
aber auch aus Asien, um Kostenvorteile<br />
zu erzielen.<br />
Lieferketten – vom Härtetest zu<br />
neuen Allianzen<br />
Herausforderungen bei den Wertschöpfungsketten sind auch ein Thema der Metav digital<br />
AUTOR: Cornelia Gewiehs, freie Journalistin*<br />
DARUM GEHT’S: Kurzarbeit bei Zulieferern,<br />
Störungen auf dem Rohstoffmarkt sowie<br />
Unwägbarkeiten von Handelskonflikten und<br />
politischem Einfluss: Die Zuverlässigkeit von<br />
Lieferketten war schon immer ein relevantes<br />
Thema und ist es seit Beginn der Corona-<br />
Pandemie noch mehr. In der Werkzeugmaschinen-industrie<br />
dürfte die Frage nach der<br />
Resilienz von Wertschöpfungsketten vor allem<br />
eng mit Digitalisierung und Vernetzung<br />
verbunden sein – Themen, die auch die Metav<br />
digital vom 23. bis 26. März beschäftigt.<br />
Bereits im Frühjahr 2020 sorgte eine Studie<br />
der TU München für Aufmerksamkeit,<br />
die zu dem Ergebnis kam, dass sich die<br />
Strukturen weltweiter Lieferketten in Zukunft<br />
„dramatisch verändern werden“. Es sei wichtig,<br />
hieß es, in künftigen Krisensituationen in der<br />
Lage zu sein, alternative Lieferanten in einer<br />
wenig beeinträchtigten Region zu haben und<br />
auszuweichen. Doch anders als etwa die chemische<br />
oder pharmazeutische Industrie, sieht der<br />
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken<br />
(VDW) die eigene Branche weit weniger unter<br />
Handlungsdruck. Als Grund nennt VDW-Geschäftsführer<br />
Dr. Wilfried Schäfer die hohen<br />
Qualitätsstandards der Branche: „Die Unternehmen<br />
besitzen entweder eine sehr hohe<br />
Wertschöpfungstiefe, oder sie kaufen bereits<br />
überwiegend in Deutschland ein.“ Bei Komponenten<br />
und Rohmaterial aus China oder dem<br />
südlichen Europa habe es zwar Ausfälle, aber<br />
auch Kompensationsmöglichkeiten über andere<br />
Lieferanten gegeben.<br />
KI- und Big-Data-Spezialist für<br />
die Lieferantensuche<br />
Eine Lösung, die sich hier anbietet, kommt<br />
vom Würzburger Unternehmen Scoutbee, das<br />
auf digitale Lieferantensuche spezialisiert ist.<br />
Das Unternehmen bedient sich Künstlicher<br />
Intelligenz (KI) und Big Data, damit Kunden<br />
mittels Software as a Service (SaaS) in Milliarden<br />
von Datensätzen nach Produkten und<br />
geeigneten Lieferanten fahnden können.<br />
Durchforstet werden tiefgreifende Marktinformationen,<br />
darunter Finanzzahlen, Expertisen<br />
zur Nachhaltigkeit oder aktive Zertifizierungen,<br />
sprachübergreifend und in Echtzeit, um<br />
Benjamin Scoutbee<br />
Scoutbee, ein Spezialist für die<br />
digitale Lieferantensuche,<br />
gehört zu den Ausstellern auf<br />
der Metav digital. Mit der<br />
Lösung seines Hauses verringere<br />
sich eine manuelle<br />
Globalsuche nach sämtlichen<br />
aktuellen und potenziellen<br />
Lieferanten allenfalls auf Tage,<br />
so Benjamin Eichinger, Director<br />
Sales Germany.<br />
Quelle: Gebr. Heller Maschinenfabrik; Scoutbee GmbH<br />
36 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Andreas Gützlaff<br />
Quelle: WZL, RWTH Aachen<br />
sämtliche aktuellen und potenziellen Lieferanten<br />
weltweit zu identifizieren. Dauere<br />
eine manuelle Suche üblicherweise Wochen<br />
oder Monate, so Benjamin Eichinger, Director<br />
Sales Germany, seien es digital allenfalls<br />
Tage. Nach Kundenerfahrungen betrage die<br />
Durchschnittliche Zeitersparnis 85 Prozent.<br />
Scoutbee verzeichnete 2020 einen<br />
sprunghaften Zuwachs an Aufträgen und<br />
Kunden, darunter auch Werkzeugmaschinenhersteller.<br />
2<strong>01</strong>5 gegründet und erst seit<br />
zwei Jahren auf dem Markt, beschäftigt das<br />
Unternehmen inzwischen über 130 Mitarbeiter.<br />
Ein virtueller Stand auf der Fachmesse<br />
Metav digital <strong>2021</strong>, die vom 23. bis<br />
26. März <strong>2021</strong> stattfindet, ist bereits gebucht.<br />
Eichinger bestätigt, dass es in letzter<br />
Zeit eine Bevorzugung von Lieferanten „in<br />
der Nähe“ durchaus gegeben habe. Auch<br />
seien globale Strategien zurückgefahren<br />
worden. Doch ausgelöst hat die Suche nach<br />
neuen Lieferanten nicht unbedingt Corona.<br />
Auch Qualitäts-mängel oder die Reduzierung<br />
von Lieferkosten spielen bei gewünschten<br />
Veränderungen eine Rolle.<br />
Lieferanten in die Planung<br />
einbeziehen<br />
Sich gegen Überraschungen und mögliche<br />
Ausfälle zu wappnen, gehört für Werkzeugmaschinenhersteller<br />
zum Geschäft. „Grundsätzlich<br />
hat sich an unserer Einkaufsstrategie<br />
nichts geändert“, sagt Manfred Maier,<br />
Chief Operating Officer (COO) der Heller-<br />
Gruppe, Nürtingen, auf Nachfrage zu möglichen<br />
Konsequenzen aus der Corona-Pandemie.<br />
Die Heller-Gruppe entwickelt und<br />
produziert CNC-Werkzeugmaschinen und<br />
Fertigungssysteme für die spanende Bearbeitung.<br />
„Wir setzen nach wie vor auf die hohe<br />
Qualität und Zuverlässigkeit unserer vornehmlich<br />
europäischen Lieferanten“, betont<br />
der COO. Dass diese zunehmend Wertschöpfungsanteile<br />
in Niedriglohnländer verlagern,<br />
um Kostenvorteile zu erzielen, räumt Maier<br />
durchaus ein. Aus demselben Grund wird<br />
bei Heller Eisenguss aus Asien bezogen. Ein<br />
Problem sieht er darin nicht: „Generell gilt<br />
das Ziel einer Dual-Sourcing-Strategie, in<br />
einigen Warengruppen auch Multiple-Sourcing-Strategie,<br />
etwa wegen der Komplexität<br />
von Baugruppen, die es abzusichern gilt.“<br />
Nach Maiers Angaben ist die Materialversorgung<br />
2020 insgesamt auf einem sehr<br />
hohen Niveau geblieben, trotz Kurzarbeit<br />
bei einer überwiegenden Anzahl der Zulieferer.<br />
„Wir haben rechtzeitig kritische<br />
Lieferanten in die Forecast-Planung unserer<br />
Bedarfe mit aufgenommen, die jeweils monatlich<br />
aktualisiert verschickt werden.“ So<br />
könnten sich Lieferanten frühzeitig auf<br />
Bedarfsschwankungen einstellen und die<br />
Materialversorgung gewährleisten. Um kritischen<br />
Entwicklungen vorzubeugen, seien<br />
zudem alle strategischen und operativen<br />
Einkäufer angehalten, ihr „Ohr am Lieferanten“<br />
zu haben. Da werde in täglich stattfindenden<br />
Gesprächen durchaus nachgefragt,<br />
„mit Fingerspitzengefühl“, wie Maier<br />
betont. Über die Qualität von Zulieferern<br />
gebe die QKZ (Qualitätskennziffer)-Quote<br />
Auskunft, die die Lieferantenzuverlässigkeit<br />
sowie auftretende Reklamationen in<br />
einer Quote vereint. Die Daten werden aus<br />
dem SAP-System ermittelt.<br />
KMU setzen auf vertrauensbasierte<br />
Kooperationen<br />
Dass für die bevorzugte Art von Lieferantenbeziehungen<br />
die Struktur einer Branche<br />
eine Rolle spielt, geht aus einer Studie der<br />
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply<br />
Chain Services, Nürnberg, über Wertschöpfungsketten<br />
in der Automations-Branche<br />
hervor. Demnach sind kleine und mittelständische<br />
Unternehmen (KMU) bei benötigten<br />
Produkten und Dienstleistungen<br />
eher regional aufgestellt. Sie setzen bevorzugt<br />
auf langjährige und vertrauensbasierte<br />
Kooperationen. Großunternehmen beschaffen<br />
die benötigten Waren tendenziell<br />
auf einer globalen Basis, suchen Wege<br />
durch komplexe Strukturen, erheben validierbare<br />
Kennziffern und planen vorausschauende<br />
Steuerungsmechanismen.<br />
Die Studie belegt zudem, dass sich mit<br />
zunehmender Automatisierung auch KMU<br />
einer wachsenden Komplexität der Lieferbeziehungen<br />
kaum entziehen können. Aus<br />
dem einfachen „Order-to-Payment-Prozess“<br />
früherer Zeiten, der nur innerhalb eines einzelnen<br />
Unternehmens abläuft und sich von<br />
Unternehmen zu Unternehmen in einer Kette<br />
zusammenfügt, wird ein komplexes Netz.<br />
Maschinen, Förderanlagen, Roboter, Steuerungen<br />
und Softwarekomponenten werden<br />
verknüpft und mit Marketing, Vertrieb und<br />
Distribution verbunden. Der Unternehmenserfolg<br />
ist zudem immer stärker abhängig von<br />
begleitenden Dienstleistungen über den gesamten<br />
Lebenszyklus einer Lösung, einschließlich<br />
(Fern-) Wartung, Reparatur und<br />
Entsorgung. Dafür müssen oft externe Experten<br />
und Spezialisten hinzugezogen werden.<br />
Das Ganze potenziert sich dann in der digitalen<br />
Welt über Cyber-physische Systeme<br />
(CPS), also Systeme, bei denen informationsund<br />
softwaretechnische mit mechanischen<br />
Komponenten verbunden werden.<br />
Andreas Gützlaff, Leiter der<br />
Abteilung Produktionsmanagement<br />
im WZL der RWTH Aachen<br />
sagt: „Durch eine gesteuerte<br />
Komplexität lassen sich Einsparungen<br />
von bis zu 15 Prozent im<br />
Betriebsergebnis realisieren.“<br />
Komplexitätstreiber Kunde<br />
Der größte Komplexitätstreiber, so Andreas<br />
Gützlaff, Leiter der Abteilung Produktionsmanagement<br />
im Werkzeugmaschinenlabor<br />
WZL der RWTH Aachen, seien jedoch oft die<br />
Kunden. Individuelle Kundenwünsche erfordern<br />
mehr Produktvarianten, die zu<br />
komplexeren Produktportfolios führen und<br />
sich unmittelbar auf Konstruktion, Planung,<br />
Lieferkette, Produktion und Vertrieb auswirken.<br />
Die Komplexität dieser Entwicklung<br />
verlangt nach Transparenz und einem neuartigen<br />
Datenmanagement, sagt Gützlaff.<br />
Am Ende gehe es um die einfache, aber existenziell<br />
wichtige Frage: „Wo verdiene ich<br />
Geld und wo verliere ich welches?“<br />
In den komplexen Wertschöpfungsnetzen<br />
schlummern nach Erkenntnissen des<br />
WZL nicht nur (Kosten-)Risiken, sondern<br />
auch erzielbare Effizienzgewinne. „Durch<br />
eine gesteuerte Komplexität lassen sich Einsparungen<br />
von bis zu 15 Prozent im Betriebsergebnis<br />
realisieren“, betont Gützlaff.<br />
Das belegen Erfahrungen aus den Unternehmen,<br />
mit denen das WGP-Institut WZL<br />
zusammenarbeitet.<br />
Prozesskette im Fokus der<br />
METAV digital <strong>2021</strong><br />
Die gesamte Prozesskette in der Metallbearbeitung<br />
abzubilden, ist traditionell ein<br />
zentrales Anliegen der METAV. Wachsende<br />
Bedeutung erlangte dabei schon auf den<br />
vergangenen Präsenzmessen der Themenkomplex<br />
Industrie 4.0 mit Aspekten wie<br />
vernetzte Fertigung, Cloud-Anwendungen,<br />
Datenmanagement, Cybersecurity oder<br />
Plattformökonomie. Die jetzt anstehende<br />
METAV digital könnte für diesen Bereich<br />
ebenfalls für Schub sorgen, weil sich die<br />
Teilnehmer auch untereinander sehr gut<br />
vernetzen können. Der VDW als Veranstalter<br />
erwartet daher, dass auch die METAV digital<br />
von Unternehmen verstärkt genutzt wird,<br />
um am virtuellen Messestand neue Geschäftsverbindungen<br />
aufzubauen und belastbare<br />
neue Allianzen zu schmieden.<br />
* zu ihren Auftraggebern zählt u. a. der<br />
VDW.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 37
POLITIK<br />
MÄRKTE<br />
Länder<br />
Anlagen<br />
4<br />
5<br />
<br />
Das Stahlwerk von Tosyali Algérie hat einen neuen<br />
DRI-Produktionsrekord aufgestellt.<br />
ALGERIEN<br />
Produktionsrekord bei<br />
Tosyali Algérie<br />
Der algerische Stahlhersteller<br />
Tosyali Algérie hat im<br />
vergangenen Jahr nach eigenen<br />
Angaben mehr als 2,23<br />
Mio. t direktreduziertes Eisen<br />
(DRI) produziert – laut<br />
Unternehmen ein „Weltrekord<br />
für ein einzelnes Direktreduktionsmodul“.<br />
Das<br />
Werk mit einer Gesamtkapazität<br />
von 2,5 Mio. t begann<br />
im Februar 2<strong>01</strong>9 damit, heißes<br />
DRI (HDRI) im Schmelzbetrieb<br />
des Elektrolichtbogenofens<br />
zu verwenden. Diese<br />
Form des Rohstoffs<br />
machte 72 % der Gesamtproduktion<br />
(1,6 Mio. t) aus. Die<br />
Eisenerzpelletes, die die DRI-<br />
Anlage sp<strong>eisen</strong>, wurden<br />
überwiegend von Tosyalis eigener<br />
4 Mio. t/a Pelletanlage<br />
vor Ort geliefert.<br />
BAHRAIN<br />
<br />
2<br />
Gemeinsames Projekt:<br />
SULB und SMS digital<br />
arbeiten an Energieeffizienz<br />
SULB und SMS digital wollen<br />
bei der Potenzialerfassung<br />
für Energieeinsparung im integrierten<br />
SULB-Stahlwerk in<br />
Hidd, Bahrain, zusammenarbeiten.<br />
Neben der SMS group<br />
sind das in Brasilien ansässige<br />
Tochterunternehmen Vetta<br />
und Midrex Technologies<br />
mit Sitz in North Carolina,<br />
USA, an dem Projekt beteiligt.<br />
Ziel ist es, die Energieeffizienz<br />
durch eine Steigerung<br />
der betrieblichen Effizienz<br />
der Anlage zu verbessern<br />
und die Sekundärenergie<br />
und Restwärme vollständig<br />
zu nutzen.Die zweite Phase<br />
des Projektes wurde bereits<br />
eingeleitet und konzentriert<br />
sich auf vier Bereiche: Direktreduktionsanlage,<br />
Elektrolichtbogen-<br />
und Pfannenofen,<br />
Schwerprofilwalzwerk<br />
und integriertes Energiemanagement.<br />
Vetta zum Beispiel<br />
wird die energiebezogenen<br />
Leistungskennzahlen<br />
(KPI) des Gesamtwerks bewerten,<br />
Schlussfolgerungen<br />
ziehen und Empfehlungen<br />
geben, wie die Energieeffizienz<br />
verbessert werden kann.<br />
Midrex hingegen soll in Bezug<br />
auf die Direktreduktionsanlage<br />
zeigen, wie die<br />
dessen Technologie durch<br />
Einsatz von grünem Wasserstoff<br />
dazu beitragen kann,<br />
den CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren<br />
und den Weg für<br />
einen schrittw<strong>eisen</strong> Übergang<br />
zur emissionsfreien<br />
Stahlerzeugung zu ebnen.<br />
Die erste Projektphase, die<br />
bereits im Frühling 2020<br />
durchgeführt wurde, bestand<br />
aus einer Evaluierung<br />
der Schwerpunktbereiche<br />
und spezifischen Maßnahmen.<br />
CHINA<br />
Das „weltweit größte“ Lasermessgerät will TBK Automatisierung<br />
und Messtechnik an Masteel liefern.<br />
3<br />
Masteel erhält<br />
Lasermessgerät in<br />
Rekordgröße<br />
Maanshan Iron & Steel (Masteel)<br />
hat das Unternehmen<br />
TBK Automatisierung und<br />
Messtechnik, eine Tochter<br />
der SMS group mit Sitz im<br />
österreichischen Graz, mit<br />
der Lieferung des laserbasierten<br />
Lichtschnittmessgeräts<br />
„Progauge“ beauftragt. Damit<br />
will Masteel seine schwere,<br />
von der SMS group entwickelte<br />
Profilstraße erweitern.<br />
Zudem plant der Stahlproduzent,<br />
so die Möglichkeit zu<br />
erhalten, Profile inline zu<br />
vermessen und Oberflächenfehler<br />
erkennen und analysieren<br />
zu können. Das Progauge-System<br />
inklusive Surf-<br />
Tec-Oberflächenfehlererkennungssystem<br />
wird innerhalb<br />
der schweren Profilstraße<br />
zwischen der CCS (Compact<br />
Cartridge Stand)-Tandemwalzgruppe<br />
und der Kontrollkühlvorrichtung<br />
installiert.<br />
Dort kommt es dann<br />
für die Messung von H-Profilen<br />
mit einer Steghöhe von<br />
bis zu 1 100 mm und bis zu<br />
500 mm Flanschbreite sowie<br />
für Spundbohlen mit Abmessungen<br />
von 600 auf 310 mm<br />
zum Einsatz. Damit erreicht<br />
das Gerät TBK zufolge eine<br />
weltweite Rekordgröße, als<br />
„größtes laserbasiertes Lichtschnittmessgerät,<br />
das aktuell<br />
am Weltmarkt erhältlich<br />
ist“.<br />
Nun in Betrieb bei Yonggang:<br />
Der 100. RSB des Unternehmens<br />
Friedrich Kocks.<br />
Quelle: Quelle: Tosyali; SMS group; Friedrich Kocks, Shutterstock<br />
42 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Quelle: Quelle: Primetals Technologies; SMS group<br />
2<br />
3<br />
Ein spezieller Kran bewegt das Walzgerüst R1 an seine neue<br />
Position als Gerüst R3 in der Arvedi-ESP-Linie bei Acciaieria<br />
Arvedi in Cremona, Italien.<br />
Yonggang walzt ersten<br />
Stab auf 100. Kocks RSB<br />
Der chinesische Eisen- und<br />
Stahlproduzent Jiangsu Yonggang<br />
Group hat seine modernisierte<br />
700 000 t/a SBQ-<br />
Walzzstraße mit einem Reducing<br />
& Sizing Block (RSB) von<br />
Friedrich Kocks in Betrieb genommen.<br />
Yonggang produziert<br />
hochwertigen Stab<strong>stahl</strong><br />
für den Maschinenbau, den<br />
Schiffbau und die Windkraftindustrie<br />
in einem Abmessungsbereich<br />
von durchschnittlich<br />
16 bis 100 mm bei<br />
einer maximalen Walzgeschwindigkeit<br />
von 18 m/s. Mit<br />
der Entscheidung für die 5.<br />
Generation der RSB-Technologie<br />
von Friedrich Kocks, erreichte<br />
der Produzent die<br />
Schwelle von nunmehr 100<br />
Blöcken des Herstellers.<br />
ITALIEN<br />
4<br />
Acciaieria Arvedi fährt<br />
modernisierte Arvedi-<br />
ESP-Linie wieder an<br />
Im italienischen Cremona hat<br />
Acciaieria Arvedi seine Arvedi-ESP-Linie<br />
wieder angefahren,<br />
nachdem diese von Primetals<br />
Technologies modernisiert<br />
wurde. Die Maßnahme<br />
umfasste Änderungen an der<br />
Stranggießmaschine und resultierte<br />
Primetals zufolge in<br />
einer Erhöhung des Massendurchsatzes<br />
und damit der<br />
Produktionskapazität auf<br />
nunmehr 3 Mio. t pro Jahr.<br />
Der Elektrolichtbogenofen<br />
des ESP-Stahlwerks wurde<br />
ebenfalls einer Modernisierung<br />
unterzogen und erhielt<br />
eine größere Gießpfanne.<br />
Dementsprechend wurde der<br />
Pfannendrehturm durch eine<br />
größere Einheit ersetzt, einschließlich<br />
neuer Softwarefunktionen<br />
und weiterer Leistungsmerkmale.<br />
Verbesserte<br />
Automatisierungsmodelle sollen<br />
überdies dazu beitragen,<br />
dass der Markt für höherwertige<br />
Produkte direkt aus der<br />
ESP-Linie bedient werden<br />
kann.<br />
AST in Terni: Fives soll für<br />
intelligentes Qualitätsmanagement<br />
sorgen<br />
Der italienische Edel<strong>stahl</strong>hersteller<br />
Acciai Speciali Terni<br />
(AST) hat die Fives Gruppe<br />
mit einem neuen Projekt für<br />
seine Flach<strong>stahl</strong>produktion<br />
im italienischen Terni beauftragt.<br />
Es zielt auf die Verbesserung<br />
der digitalen Technologien<br />
des Werks ab und fokussiert<br />
dahingehend<br />
insbesondere die Qualitätssicherung.<br />
Vor diesem Hintergrund<br />
will Fives seine digitale<br />
Lösung „Eyeron“ implementieren,<br />
die – so der Entwickler<br />
– automatisch Daten aus verschiedenen<br />
Prozessen erfasst<br />
und analysiert, und so den<br />
Anlagenbedienern einen klaren<br />
Überblick über die Produktqualitäten<br />
gibt. Unter anderem<br />
sei eine automatische<br />
Kontrolle jedes Coils in Echtzeit<br />
oder die Vorhersage von<br />
Oberflächenfehlern entsprechend<br />
spezifischer Prozessbedingungen<br />
an vorgelagerten<br />
Linien möglich.<br />
MEXIKO<br />
Lamina Y Placa startet<br />
Warmbetrieb auf neuer<br />
Feuerverzinkungslinie<br />
Der zur Villacero Gruppe gehörende<br />
mexikanische Stahlverarbeiter<br />
Lamina y Placa Comercial<br />
hat die Warminbetriebnahme<br />
einer moderni -<br />
sierten Feuerverzinkungslinie<br />
in Apodaca abgeschlossen. Im<br />
Rahmen des Projekts lieferte<br />
die SMS group ein neues Quarto-Dressierwalzwerk,<br />
eine<br />
neue Streckbiege-Richtanlage,<br />
neue Fluidtechnik sowie neue<br />
Elektrik und Automation. Die<br />
Maßnahme umfasste dabei<br />
vier Phasen, beginnend mit<br />
der Verlagerung der bestehenden<br />
Anlagen auf eine neu installierte<br />
Brückenkonstruktion.<br />
So konnten die neuen Fundamente<br />
und die neuen Anlagen<br />
während des laufenden Betriebs<br />
installiert werden und<br />
die Kaltinbetriebnahme im<br />
Schattenbetrieb zur normalen<br />
Produktion stattfinden, heißt<br />
es seitens der SMS group. Die<br />
betont weiter, dass Lamina Y<br />
Placa Comercial nun auf die<br />
steigende Nachfrage nach<br />
dressierten Flach<strong>stahl</strong>produkten<br />
reagieren könne. So sei der<br />
mexikanische Hersteller in<br />
der Lage, auf der neuen Linie<br />
profiliertes verzinktes Band<br />
und Blech, verzinkte Stahldachfirsthauben<br />
sowie vorbeschichtetes<br />
Band und Blech<br />
für Strukturbauteile herzustellen.<br />
Mit der modernisierten Feuerverzinkungslinie will Lamina y<br />
Placa Comerciel die steigende Nachfrage nach dressierten<br />
Flach<strong>stahl</strong>produkten bedienen.<br />
5<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 43
POLITIK<br />
MÄRKTE<br />
Roh<strong>stahl</strong>herstellung<br />
Roh<strong>stahl</strong>herstellung im Dezember 2020<br />
Dezember Dezember % Veränd. 12 Monate Veränderung<br />
2020 2<strong>01</strong>9 Dez. 20/19 2020 2<strong>01</strong>9 in %<br />
Belgien 359 505 -28,9 6 119 7 760 -21,1<br />
Deutschland 3 137 2 835 10,6 35 658 39 627 -10,0<br />
Finnland 339 186 81,8 3 500 3 473 0,8<br />
Frankreich 1 155 918 25,7 11 596 14 450 -19,8<br />
Großbritannien 710 e 550 29,0 7 185 7 218 -0,5<br />
Italien 1 500 e 1404 6,9 20200 23 190 -12,9<br />
Luxemburg 113 97 17,3 1 886 2 119 -11,0<br />
Niederlande 540 521 3,6 6 054 6 657 -9,1<br />
Österreich 530 e 521 1,7 6 665 7 424 -10,2<br />
Polen 680 e 642 5,9 7 890 8 956 -11,9<br />
Schweden 410 376 8,9 4 409 4 721 -6,6<br />
Spanien 891 765 16,4 10 934 13 588 -19,5<br />
Tschechien 408 359 13,7 4 465 4 437 0,6<br />
Ungarn 90 164 -44,8 1 513 1 769 -14,5<br />
Weitere EU-Länder (32) (e) 895 e 820 163,6 10 712 11 909 -61,0<br />
Europäische Union (28) 11 757 10 665 10,2 138 786 157 298 -11,8<br />
Bosnien-Herzegowina 75 70 6,5 759 8<strong>01</strong> -5,2<br />
Mazedonien 33 24 35,9 180 239 -24,8<br />
Norwegen 41 40 3,2 624 621 0,5<br />
Serbien 119 158 -24,8 1 456 1929 -24,6<br />
Türkei 3 403 2 893 17,7 35 763 33 743 6,0<br />
Europa außer EU 3 671 3 185 15,3 38 782 37 333 3,9<br />
Kasachstan 355 e 374 -5,0 3 835 4 134 -7,2<br />
Moldawien 45 e 35 28,2 465 392 18,7<br />
Russland 6 110 e 6 159 -0,8 73 400 71 575 2,6<br />
Ukraine 1906 1 561 22,1 20 616 20848 -1,1<br />
Usbekistan 80 e 84 -4,8 950 666 42,6<br />
Weißrussland 200 e 225 -11,2 2 490 2 621 -5,0<br />
C.I.S. 8 696 8 438 3,1 1<strong>01</strong> 756 100 236 1,5<br />
Kanada 1 070 e 1 092 -2,0 11 078 12 897 -14,1<br />
Mexiko 1 550 e 1 361 13,9 16 854 18 387 -8,3<br />
USA 6 434 7292 -11,8 72 690 87 761 -17,2<br />
Weitere Länder (3) (e) 53 e 56 -18,1 497 638 -66,5<br />
Nordamerika 9 107 9 8<strong>01</strong> -7,1 1<strong>01</strong> 119 119 683 -15,5<br />
Argentinien 388 326 19,0 3 651 4 645 -21,4<br />
Brasilien 2 886 2 462 17,2 30 971 32 569 -4,9<br />
Chile 105 e 109 -3,5 1 165 1 133 2,8<br />
Kolumbien 110 e 97 13,5 1 126 1333 -15,5<br />
Weitere Länder (5) (e) 165 e 149 288,9 1 246 1 976 -152,6<br />
Südamerika 3 654 3 143 16,3 38 158 41 656 -8,4<br />
Ägypten 994 574 73,0 8 229 7 257 13,4<br />
Libyen 73 63 16,2 495 606 -18,4<br />
Südafrika 292 e 297 -1,5 3 877 6 152 -37,0<br />
Afrika 1 359 934 45,5 12 600 14 <strong>01</strong>5 -10,1<br />
Iran 2 660 e 2 224 19,6 29 030 25609 13,4<br />
Katar 85 186 -54,3 1 218 2 558 -52,4<br />
Saudi Arabien 440 664 -33,8 7 775 8 191 -5,1<br />
Vereinigte Arabische Emirate 280 297 -5,8 2 722 3 327 -18,2<br />
Mittlerer Osten 3 465 3 371 2,8 40 745 39 685 2,7<br />
China 91 252 84692 7,7 1 052 999 1 0<strong>01</strong> 306 5,2<br />
Indien 9 796 9 383 4,4 99 570 111 350 -10,6<br />
Japan 7 526 7 785 -3,3 83 194 99 284 -16,2<br />
Pakistan 380 e 261 45,6 3 743 3 304 13,3<br />
Südkorea 5 952 5 880 1,2 67 121 71 412 -6,0<br />
Taiwan, China 1 700 e 1693 0,4 20570 21 954 -6,3<br />
Thailand 410 e 357 14,8 4 420 4 246 4,1<br />
Vietnam 1 600 e 1 876 – 19 500 17 469 11,6<br />
Asien 118 616 111 927 6,0 1 351 117 1 330 325 1,6<br />
Australien 473 449 5,4 5 490 5 493 0,0<br />
Neuseeland 59 57 3,8 586 667 -12,2<br />
Ozeanien 533 506 5,2 6 076 6 160 -1,4<br />
Gesamt 64 Länder (1) 160 858 151 969 5,8 1 829 140 1 846 391 -0,9<br />
1)<br />
Die an worldsteel berichtenden Länder repräsentieren etwa 99 % der Weltroh<strong>stahl</strong>produktion 2<strong>01</strong>8 in 1.000 t. e – geschätzt<br />
46 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
WISSENSCHAFT<br />
TECHNIK<br />
Automotive<br />
MULTI-SCALE<br />
SIMULATION<br />
OF STEELS<br />
In this paper, advanced microstructural modelling is used to incorporate microstructure<br />
parameters, whose importance depend on the specific steel grade. The combination with<br />
a crystal plasticity model enables the quantitative description of mechanical properties.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 47
WISSENSCHAFT<br />
TECHNIK<br />
Automotive<br />
<br />
AUTHORS: C. Celada-Casero, W. Spanjer,<br />
F. Korver, M. Aarnts, Tata Steel,<br />
and P.J.J. Kok, Tata Steel and Ghent<br />
University<br />
Carola.Alonso-de-Celada-Casero@<br />
tatasteeleurope.com<br />
ABSTRACT: In the automotive industry<br />
many different steel grades are<br />
used for the different automotive<br />
body parts. The accurate prediction of<br />
the mechanical properties of these<br />
steel grades and their performance<br />
on component scale strongly depends<br />
on how well the geometrical and crystallographic<br />
information of the microstructure<br />
are taken into account.<br />
In this paper, advanced microstructural<br />
modelling is used to incorporate<br />
microstructure parameters, whose<br />
importance depend on the specific<br />
steel grade. The combination with a<br />
crystal plasticity model enables the<br />
quantitative description of mechanical<br />
properties.<br />
In the automotive industry, many different<br />
steel grades are used for the<br />
different automotive body parts. The<br />
Application of different steel grades<br />
in the automobile body structure<br />
Every part of a car needs its own solution<br />
Figure 1. Application of different steel grades in the automobile body structure. Optical<br />
micrographs and a colour phase map obtained by Electron Backscatter Diffraction display<br />
the microstructures of an Interstitial Free (IF), Dual Phase (DP) and Complex Phase (CP)<br />
steel grade. For comparison, the counterpart artificial microstructures, generated using<br />
the Multi-Level Voronoi (MLV) generator developed by Tata Steel, are shown.<br />
mechanical properties and performance<br />
of such steel grades depend strongly on<br />
the microstructure and the chemical composition.<br />
Formable steels, like Interstitial<br />
Free (IF) steels, are predominantly used<br />
for outer automotive components, where<br />
shape is an important factor. Multiphase<br />
advanced high strength steels (AHSS) are<br />
employed in parts where high-strength<br />
and energy absorption during impact play<br />
an important role for safety, e.g. safety<br />
cage components like B-pillars or floor<br />
panel tunnels [1] . Figure 1 shows optical<br />
micrographs of the microstructures of<br />
single-phase IF and Dual-Phase (DP) steel<br />
grades, and the colour phase map of a<br />
Complex Phase (CP) steel grade obtained<br />
by Electron Backscatter Diffraction<br />
(EBSD). The microstructure of the IF steel<br />
consists of relatively large ferrite grains,<br />
which exhibit an equiaxed morphology<br />
with smooth grain boundaries. The DP<br />
microstructure presents ferrite grains<br />
(light) and smaller martensite particles<br />
(dark). The martensite phase is located at<br />
the ferrite grain boundaries, which results<br />
in more complex shaped boundaries<br />
than in the IF steel. In the CP microstructure,<br />
a complex geometry is not only observed<br />
in the ferrite grains (green phase),<br />
but also in the spatial distribution and<br />
morphology of the martensite and bainite<br />
phases (in blue and red, respectively),<br />
which appear partially distributed in elongated<br />
bands and in homogenously scattered<br />
particles or clusters. Depending on<br />
the manufacturing process, the volume<br />
fraction, composition, spatial distribution<br />
and texture of the steel constituent phases<br />
can be modified. To quantitatively characterise<br />
the influence of each of these<br />
microstructural variables on the mechanical<br />
and performance properties is key to<br />
the optimization and development of new<br />
AHSS grades.<br />
In this study, we show how advanced<br />
microstructure geometry modelling is<br />
used to capture microstructural parameters<br />
at the grain level and crystallographic<br />
orientations to perform parametric<br />
analyses in complex artificial<br />
microstructures. Using a Multi-Level<br />
Voronoi (MLV) generator developed by<br />
Tata Steel [2] , realistic and extreme 3D<br />
Representative Volume Elements (RVE)<br />
are constructed based on experimental<br />
crystallographic and microstructure<br />
characterization data from 2D electron<br />
backscatter diffraction (EBSD). The RVEs<br />
are directly interfaced to the extremely<br />
fast Fourier Spectral Solver of the Düsseldorf<br />
Advanced Material Simulation<br />
Kit (DAMASK) [3] for Crystal Plasticity<br />
(CrP) simulations in a realistic time. This<br />
allows to study the influence of microstructure<br />
parameters and texture on the<br />
mechanical properties and performance<br />
of single- and multi-phase steel grades.<br />
The accuracy of CrP predictions relies<br />
on how realistic the artificial microstructure<br />
is and on the material parameters,<br />
which describe the mechanical<br />
properties and hardening behaviour of<br />
the constituent phases according to the<br />
CrP formulation. The focus of this work<br />
is on the creation of realistic artificial<br />
microstructures to improve the suitability<br />
of multiscale modelling in AHSSs.<br />
Microstructure modelling<br />
Voronoi tessellations are widely used for<br />
artificial microstructure generation.<br />
Figure 2a shows a standard Voronoi tessellation,<br />
which is based on a randomly<br />
generated point field. The seeds of the<br />
point field are represented by the small<br />
circles within each Voronoi cell. However,<br />
the application of standard Voronoi<br />
cells to complex microstructures is limited<br />
by their geometrical properties,<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
such as normal Gaussian grain size distribution<br />
and polygonal morphology.<br />
The Multi-Level Voronoi (MLV) generator<br />
developed by Tata Steel [2,4] enables the<br />
creation of more realistic artificial microstructures,<br />
with complex grain morphologies,<br />
precise phase volume fraction,<br />
spatial distribution and average<br />
grain size. This is illustrated by Figure 2.<br />
Figure 2 displays artificial microstructures<br />
built using standard (a) and<br />
Multi-Level (b-d) Voronoi tessellations.<br />
The main differences are pointed out. All<br />
artificial microstructures, or RVEs, in Figure<br />
2a-c are based on random point fields<br />
and aim to mimic DP microstructures,<br />
where RGB-coloured and black cells represent<br />
ferrite grains and martensite particles,<br />
respectively. For comparison, the<br />
number of ferrite grains has been kept<br />
constant (100) and the total area fraction<br />
of martensite is very similar (around<br />
0.15). In the standard Voronoi, the grain<br />
size distribution of both phases is limited<br />
to one and the ferrite grain morphology<br />
is that of convex polygons. In the<br />
Multi-Level Voronoi RVEs, the ferrite<br />
grain boundaries have a more complex<br />
morphology and the mean grain size of<br />
the martensite is much smaller than that<br />
of ferrite. The use of MLV diagrams allow<br />
multiple phases to be introduced in different<br />
kinds of spatial configurations; i.e.<br />
in Figure 2d, blue and red small particles<br />
represent different phases: the red phase<br />
has been randomly distributed at the ferrite<br />
grain boundaries, while the blue has<br />
been distributed in bands of different<br />
thickness and continuity.<br />
In order to extend the potential of<br />
MLV tessellations for realistic microstructure<br />
modelling, the capabilities of<br />
the MLV software have been extended<br />
with other options, for instance:<br />
• to regularize the cell morphology by<br />
shifting each seed of the random point<br />
field towards the centre of mass of<br />
each Voronoi cell [5] ;<br />
• to create elongated cells with an average<br />
grain aspect ratio (a:1) by, first,<br />
calculating the Voronoi diagram in the<br />
specific a:1 deformed geometry and,<br />
then, by deforming it back to the original<br />
geometry (Figure 2e), or<br />
• to accurately capture user-defined<br />
grain size distributions by using<br />
Laguerre Voronoi diagrams [5,6] , which<br />
assign weights to the cells.<br />
For exemplification of these extended<br />
capabilities, Figure 2e shows an artificial<br />
DP microstructure where the<br />
Comparison of Standard and Multi-<br />
Level Voronoi tessellations<br />
The artificial dual- and multi-phase microstructures are based on random<br />
point fields and multiple phases with the desired spatial distribution,<br />
grain size and morphology.<br />
Figure 2. (a) Standard first-level and (b-d) Multi-Level Voronoi tessellations that mimic<br />
dual- and multi-phase microstructures. The spatial distribution of black phase has been<br />
varied from randomly distributed along the grain boundaries (b) to a banded distri bution of<br />
different bandwidths and intensities. In (d), in addition to the banded phase, a third phase<br />
(red) has been randomly introduced. (e) 3D RVE of dual phase microstructure with grains<br />
elongated in the rolling direction (RD) and view of different ND, RD and TD cross sections.<br />
grains are elongated in the rolling direction<br />
(RD). Ferrite grain orientations (i.e.<br />
one set of Euler angles per grain) are<br />
coloured in RGB scale. The black martensite<br />
particles are partially distributed<br />
in bands and partially random. The<br />
grain elongation and the inhomogeneous<br />
spatial distribution of martensite<br />
causes geometrical anisotropy. Hence,<br />
the microstructure might be revealed<br />
very differently depending on the observed<br />
cross section, as the 2D views of<br />
the different cross sections point out<br />
(ND=normal direction, TD=transverse<br />
direction). Other than the ferrite grain<br />
size and morphology, the area fraction<br />
of martensite might be significantly affected,<br />
even when comparing two cross<br />
sections along the same direction. In ND<br />
cross section 1, the martensite area fraction<br />
is a few percent, whereas in the ND<br />
cross section 2, it is of about 0.50.<br />
In summary, MLV-based artificial microstructures<br />
offer a smart alternative<br />
to the representation of single- and<br />
multi-phase microstructures in a more<br />
realistic manner than standard Voronoi<br />
tessellations, as also supported by the<br />
artificial RVEs of different steel grades<br />
shown in Figure 1.<br />
Using 2D EBSD characterization<br />
data to create 3D RVEs<br />
In addition to the microstructure geometry,<br />
the crystallographic orientations<br />
of the RVE constituent phases play a<br />
major role in the deformation behaviour<br />
and the mechanical response. For multiphase<br />
steels, quantitative data of phase<br />
volume fractions, grain size distributions,<br />
grain shape parameters and crystal<br />
orientations of the constituent<br />
phases are usually obtained by EBSD.<br />
For the accurate assignment of the experimentally<br />
characterised texture, the<br />
MLV-generator assigns the grain orientations<br />
from 2D EBSD to the 3D RVE by<br />
converting grain areas into volume fractions<br />
using a standard stereology formula<br />
according to [7] . This requires some<br />
postprocessing of the EBSD data. For<br />
instance, in the case of single-phase IF<br />
microstructures, ferrite grains are defined<br />
considering a minimum misorientation<br />
of 5°; i.e. if the crystal orientation<br />
between two adjacent EBSD measurement<br />
points is larger than 5°, these two<br />
points are considered to belong to different<br />
ferrite grains. Once the grains are<br />
identified, the crystal orientation of all<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 49
WISSENSCHAFT<br />
TECHNIK<br />
Forschung<br />
Deutsch-schwedische Roadmap<br />
zur Dekarbonisierung<br />
Die Erkenntnisse des Vorhabens dienen dem Transformationsprozess zu einer<br />
treibhausgasneutralen Industrie<br />
AUTOREN: Dr. Ali Aydemir, Fraunhofer-Institut<br />
für System- und Innovationsforschung<br />
ISI; Dr. Marlene Arens,<br />
Lunds Tekniska Högskola<br />
ali.aydemir@isi.fraunhofer.de<br />
DARUM GEHT’S: Das Fraunhofer ISI,<br />
die Universität Lund und das Wuppertal<br />
Institut arbeiten seit Kurzem in einem<br />
Forschungsprojekt daran, Eckpunkte<br />
einer Roadmap für die Dekarbonisierung<br />
der Stahl- und<br />
Zementindustrie zu erarbeiten.<br />
Hintergrund<br />
Deutschlands Langfristziel ist es,<br />
bis zum Jahr 2050 weitgehend<br />
treibhaus-gasneutral zu werden.<br />
Damit orientiert sich die Bundesregierung<br />
am Ziel des Pariser Abkommens,<br />
in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts<br />
weltweit Treibhausgas-neutralität<br />
zu erreichen. Im Jahr 2<strong>01</strong>8 emittierte<br />
der deutsche Industriesektor etwa 196<br />
Mio. Tonnen CO 2 -Äquivalente. Damit<br />
trägt er mit 23 % zu den nationalen<br />
Treibhausgasemissionen bei und ist somit<br />
nach der Energiewirtschaft die<br />
zweitgrößte Emissionsquelle in Deutschland.<br />
Etwa zwei Drittel der Emissionen<br />
des Industriesektors stammen aus der<br />
energieintensiven Industrie. Die Stahlund<br />
Zement-industrie wiederum verursachen<br />
fast die Hälfte dieser Emissionen.<br />
Die beiden Industriesektoren sind<br />
daher für die Erreichung der Klimaschutzziele<br />
besonders relevant. Wenn<br />
andere Sektoren ihre Emissionen reduzieren<br />
(z.B. der Stromsektor), werden sie<br />
umso relevanter, da ihr Anteil dann bei<br />
gleichbleibender Produktion steigt. Im<br />
Klimaschutzplan 2050 setzt die Bundesregierung<br />
für den Industrie-sektor ein<br />
Treibhausgasminderungsziel für 2030<br />
von ca. 40 Mio. Tonnen CO 2 -Äquivalenten<br />
gegenüber 2<strong>01</strong>4. Dies entspricht<br />
einer Minderung von 49 bis 51 Prozent<br />
gegenüber 1990 und stellt somit ein<br />
Zwischenziel auf dem Weg zur Errei-<br />
chung der Treibhausgasneutralität des<br />
Industriesektors bis 2050 dar.<br />
Vorhaben<br />
Im Projekt werden Eckpunkte für Roadmaps<br />
zur Dekarbonisierung der Stahlsowie<br />
der Zementindustrie erstellt. Die<br />
Eckpunkte zeigen auf, welche Techniken<br />
und Maßnahmen bis zum Jahr 2030<br />
von der Zement- und Stahlindustrie umgesetzt<br />
werden können und welche weiteren<br />
Maßnahmen bis zum Jahr 2050<br />
relevant sind.<br />
Zu Beginn wird eine Methodik zur<br />
Bewertung von Dekarbonisierungsmaßnahmen<br />
und -techniken entwickelt. In<br />
einem weiteren Schritt werden relevante<br />
Techniken und Maßnahmen identifiziert<br />
und bewertet.<br />
Partizipation<br />
Ein zentrales Element des Projekts ist<br />
die umfassende Einbeziehung von Interessengruppen.<br />
Zu diesem Zweck wurden<br />
zwei Stakeholdergruppen gebildet,<br />
eine für die Stahlindustrie und eine für<br />
die Zementindustrie. Diese setzen sich<br />
jeweils aus Vertretern der Industrie, der<br />
gesellschaftlichen Interessengruppen,<br />
der Politik und der Wissenschaft zusammen<br />
und treffen sich während der<br />
Projektlaufzeit regelmäßig. Aufgabe der<br />
Gruppen ist es, die Ergebnisse der Arbeitsschritte<br />
zu reflektieren, zu diskutieren<br />
und mit dem eigenen Wissen zu<br />
ergänzen. Flankiert wird dies durch zusätzliche<br />
themenspezifische Untergruppen,<br />
in denen branchenspezifische Fachthemen<br />
vertieft werden.<br />
Erwartete Ergebnisse<br />
Auf der Grundlage der Bewertungen und<br />
unter Beteiligung der Stakeholder werden<br />
Eckpunkte für Roadmaps zur Dekarbonisierung<br />
der Stahl- und Zementindustrie<br />
in Deutschland formuliert, die bis zum<br />
Jahr 2050 zu einer weitgehenden Treibhausgasneutralität<br />
dieser beiden Sektoren<br />
führen können. Die Erkenntnisse des<br />
Vorhabens dienen somit dem Transformationsprozess<br />
zu einer treibhausgasneutralen<br />
Industrieproduktion.<br />
Das gemeinsame Projekt vom Fraunhofer ISI und der Universität Lund wird vom<br />
Umweltbundesamt finanziert (FKZ 3719 41 303 0); der Abschluss ist für Anfang 2022<br />
vorgesehen. Dr. Ali Aydemir in Karlsruhe ist für die Koordination zuständig, Dr. Marlene<br />
Arens in Lund ist die Arbeitspaket-Leiterin für Stahl.<br />
Quelle: Shutterstock<br />
52 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
WISSENSCHAFT<br />
TECHNIK<br />
Anwendung<br />
„Six-high“-Richtmaschine lässt<br />
Planheitswerte bei allen Produkten<br />
deutlich steigen<br />
Anwenderbericht skizziert die Erfahrungen eines<br />
Stahl-Service-Centers<br />
Quelle: Heinrich Georg Maschinenfabrik<br />
DARUM GEHT’S: Der Anwenderbericht<br />
skizziert am praktischen Beispiel,<br />
wie ein Stahl-Service-Center seinen<br />
Maschinenpark punktuell aktualisiert<br />
und welche Leistung die neue<br />
Maschine bringt.<br />
Da die Anforderungen an die Planheit<br />
von Coils mit höherer Festigkeit<br />
beständig steigen, hat<br />
EMW Stahl-Service-Center aus Neunkirchen<br />
die bestehende Multi-Blanking<br />
Linie 2 mit einer neuen Hochleistungs-<br />
Richtmaschine ausgestattet. Sie ersetzt<br />
eine Richtmaschine, die Band mit einer<br />
Streckgrenze von maximal 300 N/mm²<br />
verarbeiten konnte, und erweitert das<br />
Produktspektrum um Coils aus hochfesten<br />
Werkstoffen. Gleichzeitig erzielt<br />
sie einen deutlich höheren Durchsatz.<br />
Im Vordergrund stand bei dem Projekt,<br />
die Lieferfähigkeit für Coils aus Werkstoffen<br />
mit Streckgrenzen zwischen 600<br />
und 1 000 N/mm² und mit einer Dicke<br />
zwischen 1,0 und 1,5 mm deutlich zu<br />
erhöhen. Das Produktspektrum von<br />
EMW umfasst sowohl warmgewalzte<br />
Güten mit gebeizter oder verzinkter<br />
Oberfläche als auch kaltgewalzte, anorganisch<br />
oder organisch beschichtete<br />
Güten. Geliefert wurde die Maschine<br />
von Heinrich Georg Maschinenfabrik<br />
(Georg) aus Kreuztal im nördlichen Siegerland.<br />
Maschine und Daten<br />
Die neue Maschine vom Typ RM 55/17/7–<br />
6h–1600 ist mit einem Richtwalzensatz<br />
in „six-high“-Ausführung mit 19 Richtwalzen<br />
ausgerüstet, deren Durchmesser<br />
jeweils 50 mm beträgt. So ist sie auch<br />
für Bänder mit hochwertigen Oberflächen<br />
geeignet, unter anderem für elektrolytisch<br />
verzinktes Feinblech oder<br />
Güten für die Außenhaut von Automobilen.<br />
Die neue Richtmaschine ist ausgelegt<br />
für eine Materialbreite zwischen<br />
300 und 1 600 mm. Im Dickenbereich<br />
zwischen 0,4 und 3,0 mm richtet sie<br />
Band mit einer Zugfestigkeit bis 700 N/<br />
mm², einer Streckgrenze bis 450 N/mm²<br />
und einer Bruchdehnung zwischen 15<br />
und 45 %. Im Bereich zwischen 0,4 und<br />
2,0 mm Dicke bearbeitet sie Band mit<br />
einer Zugfestigkeit von maximal 1 200<br />
N/mm², einer Streckgrenze bis zu 1 000<br />
N/mm² und einer Bruchdehnung von 8<br />
%. Um die hohen Anforderungen für<br />
hochfeste Anwendungen zu erfüllen,<br />
verfügt die Maschine über einen besonders<br />
stabilen Maschinenrahmen und<br />
einen Antrieb mit drei Abtriebsebenen<br />
am Verteilergetriebe. Mit vier spielarmen<br />
Planetengetrieben an der Richtspalteinstellung<br />
und sieben Keilverstellungen<br />
an den Stützreihen lassen sich<br />
die Verstellachsen sehr präzise und mit<br />
hoher Wiederholgenauigkeit einstellen<br />
– ein besonders wichtiger Aspekt gerade<br />
für dünne Bänder.<br />
Kurze Wechselzeiten bei den<br />
Walzen<br />
Die Richtmaschine verfügt über ein semiautomatisches<br />
Schnellwechselsystem<br />
für das Wechseln der Richtwalzenkassetten;<br />
sie werden als komplette Baueinheit<br />
ein- und ausgefahren, ohne dass die<br />
Kugelgelenkwellen demontiert werden.<br />
Der Zeitbedarf für das Wechseln der<br />
Kassetten reduziert sich so auf 15 bis 25<br />
Minuten. Damit die Anlage zukünftige<br />
Anforderungen im Dickenbereich zwischen<br />
0,4 und 0,8 mm erfüllen kann,<br />
können auch Wechselkassetten mit 21<br />
Richtwalzen verwendet werden.<br />
Der Lieferumfang umfasst ein neues<br />
Einführaggregat mit einem Einführtisch,<br />
einer Gegenbiegerolle und einem<br />
Transportaggregat für den Vorschub des<br />
Bandes in die Richtmaschine. Zwischen<br />
dem Einführaggregat und der Richtmaschine<br />
hat GEORG eine vorhandene<br />
Schopfschere integriert, um so die<br />
Die semiautomatische Schnellwechseleinrichtung<br />
reduziert den Zeitbedarf für das<br />
Wechseln der Kassetten auf 15 bis 25 min.<br />
Durchlaufzeiten der Coils weiter zu minimieren.<br />
Planheitswerte über dem<br />
Vorgänger<br />
Georg hat die Richtmaschine innerhalb<br />
von acht Monaten ausgeliefert und in<br />
Betrieb genommen. Die ersten Coils<br />
sind zu Beginn der zweiten Jahreshälfte<br />
2020 erfolgreich gerichtet worden, Ende<br />
September hat EMW die Anlage formell<br />
abgenommen. Sie arbeitet seitdem kontinuierlich<br />
im Dreischichtbetrieb. Die<br />
ersten Ergebnisse belegen, dass die neue<br />
Maschine ein deutlich größeres Produktspektrum<br />
als die alte bearbeiten<br />
kann. Außerdem erzielt sie bei allen<br />
Produkten Planheitswerte, die um 50 %<br />
besser sind als die DIN EN 1<strong>01</strong>31 fordert.<br />
Torsten Brüggemann, Fertigungsleiter<br />
bei EMW Stahl Service Center,<br />
zieht eine erste Bilanz: „Wir erzielen<br />
jetzt bei allen Produkten aus unserem<br />
Spektrum eine noch höhere Qualität.<br />
Die Planheit der Bänder ist bei unseren<br />
Produktionsmeetings kein Thema mehr.<br />
Außerdem richten wir jetzt auf der neuen<br />
Maschine Bänder, die wir vorher nur<br />
auf einer größeren bearbeiten konnten.“<br />
Das spare nicht nur Kosten, ergänzt<br />
er, man sei in der Produktion<br />
auch deutlich flexibler geworden und<br />
könne somit mehr produzieren. <br />
tp<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 53
WISSENSCHAFT<br />
TECHNIK<br />
Produkte<br />
Erzeugnisse und Verfahren<br />
für den Umgang mit Stahl<br />
Trumpf und Jungheinrich gestalten Intralogistik intelligenter, Lamiflex beschleunigt<br />
Coil-Verpackungen und Optris stellt eine neue Lösung für die Temperaturmessung vor<br />
Effizientes Drehen von<br />
Stahl<br />
Sandvik Coromant präsentiert neues<br />
Werkzeug für die Außen- und Innenbearbeitung<br />
von Stählen.<br />
Die Wendeschneidplatten GC4425 und<br />
GC4415 von Sandvik Coromant basieren<br />
auf einer neuen Aluminiumoxidbeschichtung.<br />
Sandvik Coromant hat sein Angebot an<br />
Wendeschneidplatten für die Bearbeitung<br />
von ISO-P-Stählen um die Sorten<br />
GC4425 und GC4415 erweitert. Damit<br />
hat das Unternehmen zwei neue Hartmetallsorten<br />
auf den Markt gebracht,<br />
die für die Außen- und Innenbearbeitung<br />
von niedriglegierten und unlegierten<br />
Stählen ausgelegt sind. Nach eigenen<br />
Angaben seien diese insbesondere<br />
für Fertigungsunternehmen geeignet,<br />
die entsprechendes Material in der<br />
Groß- und Kleinserienfertigung bearbeiten.<br />
Zu diesem Zweck zeichneten sich<br />
beide Sorten durch eine hohe Verschleißfestigkeit<br />
aus. Diese basiere auf<br />
einer neuen Aluminiumoxidbeschichtung,<br />
deren Oberfläche durch eine unidirektionale<br />
Kristallorientierung charakterisiert<br />
ist. Das bedeutet, jeder Kristall<br />
ist in der gleichen Richtung aufgereiht<br />
und bildet so „eine starke Barriere zur<br />
Spanbildungszone“, erklärt Sandvik Coromant.<br />
Außerdem werde die Wärme<br />
schneller aus der Spanbildungszone abgeführt,<br />
wodurch die Schneidkante länger<br />
intakt bleibe. Zudem punkteten<br />
beide Sorten „mit verlängerten Standzeiten,<br />
vorhersagbaren Leistungen und<br />
einem reduzierten Materialverbrauch<br />
bei Werkstück und Wendeschneidplatte“.<br />
Aus der Praxis führt Sandvik Coromant<br />
einen Fall bei einem Unternehmen<br />
aus dem allgemeinen Maschinenbau<br />
auf. Dort sei der Awender in der<br />
Lage gewesen, „die Schnittgeschwindigkeiten<br />
zu erhöhen und den Vorschub zu<br />
vervielfachen“. Bei der Außenschruppbearbeitung<br />
eines komplex gestalteten<br />
Werkstückes aus wärmebehandeltem<br />
Stahl habe er eine Verdoppelung der<br />
Produktivität bei gleichzeitiger Halbierung<br />
der Durchlaufzeit erreichen können.<br />
Sandvik Coromant<br />
www.sandvik.coromant.com<br />
Intelligente<br />
Transportsysteme für<br />
die Blechfertigung<br />
In einer neuen Zusammenarbeit fokussieren<br />
Trumpf und Jungheinrich die<br />
Intralogistik in der Blechfertigung.<br />
: In den Werkshallen von Trumpf hat sich<br />
die neue Intralogistik-Lösung bereits<br />
etabliert: Dort transportieren die Flurförderzeuge<br />
von Jungheinrich fahrerlos<br />
Teile auf Europaletten zu den verschiedenen<br />
Maschinen.<br />
Trumpf und Jungheinrich wollen künftig<br />
eine neue Intralogistik-Lösung für<br />
die Blechfertigung anbieten. Im Rahmen<br />
der Kooperation soll der Automatisierungsspezialist<br />
Jungheinrich autonom<br />
agierende Fahrzeuge liefern, die<br />
Blechteile zwischen den Werkzeugmaschinen<br />
und Lagerpositionen selbstständig<br />
transportieren. Start und Ziel der<br />
Flurförderzeuge sind Docking-Stationen<br />
an den Maschinen oder einem Lager. Sie<br />
sind mit Sensoren ausgestattet, sodass<br />
sich alle logistischen Vorgänge in der<br />
Blechfertigung digital erfassen lassen.<br />
Wenn die autonom agierenden Fahrzeuge<br />
eine Europlatte an eine Stanz-,<br />
Laserschneid-, Biege- oder Laserschweißmaschine<br />
liefern, melden sie diese automatisch<br />
am Arbeitsplatz des zuständigen<br />
Maschinenbedieners an. Die Fahrzeuge<br />
sorgen auch dafür, dass Paletten<br />
zur Ablage von Teilen oder Material für<br />
den nächsten Arbeitsschritt rechtzeitig<br />
zur Verfügung stehen. Trumpf hingegen<br />
will mit der Fertigungsteuerung „TruTops<br />
Fab“ für effizientere Logistikabläufe<br />
in der Fertigung beitragen. Die Software<br />
priorisiert Transportaufträge entsprechend<br />
des Produktionsplans und leitet<br />
sie in Echtzeit an die Transportsysteme<br />
von Jungheinrich weiter. Darüber hinaus<br />
beabsichtigt das Unternehmen, Kunden<br />
bei der Einbindung der neuen<br />
Transportsysteme zu unterstützen.<br />
Trumpf/ Jungheinrich<br />
www.trumpf.com/ www.jungheinrich.de<br />
Quellen: Sandvik Coromant; Trumpf; Lamiflex<br />
56 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Service<br />
DIE RUBRIK PRODUKTE basiert auf Mitteilungen von Unternehmen über Erzeugnisse und Verfahren, die für die<br />
Herstellung und Verarbeitung von Stahl von Interesse sind. Die Redaktion übernimmt weder eine Gewähr für die sachliche<br />
Richtigkeit noch gibt sie ein Werturteil ab. Sie möchten auch in dieser Rubrik veröffentlichen? Dann schicken Sie Ihre<br />
Meldung unserem Redakteur Niklas Reiprich. Sie erreichen ihn via redaktion@<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de.<br />
Beschleunigte<br />
Verpackung von Coils<br />
Lamiflex wirbt für sein neues Verpackungssystem<br />
mit hohen Kapazitäten<br />
und zuverlässiger Betriebszeit.<br />
zudem auf einer Technologie, die einen<br />
vernetzten Zugriff auf Echtzeit-<br />
Produktionsdaten ermögliche. Entscheidet<br />
sich der Werksbetreiber also<br />
für eine Automatisierung seiner Anlagen,<br />
so Lamiflex, „ist der Multiwrapper<br />
bereit für die Integration“.<br />
Für Blechproduktionsanlagen mit hohem<br />
Ausstoß hat das schwedische<br />
Unternehmen Lamiflex ein neues Coil-<br />
Verpackungssystem entwickelt, das<br />
sich einer Stretch-Wickel-Lösung bedient.<br />
Nach eigenen Angaben verfügt<br />
der sogenannte „Multiwrapper“ sowohl<br />
über eine überdurchschnittliche<br />
Kapazität als auch eine zuverlässige<br />
Betriebszeit. Gerade letztere ergebe<br />
sich Lamiflex zufolge durch einen speziellen<br />
Doppelstationen-Aufbau, in<br />
dem Laden, Wickeln und Entladen parallel<br />
ablaufen. Die Gesamtkapazität<br />
betrage daher bis zu 14 Coils pro Stunde,<br />
heißt es seitens des Unternehmens.<br />
Innerhalb des Prozesses wird jedes<br />
Coil eng mit Stretchfolie umwickelt,<br />
um Korrosion während des Transports<br />
und der Lagerung zu verhindern. Lamiflex<br />
gibt an, die Maschine als wartungsarme<br />
Lösung konzipiert zu haben.<br />
Demnach könne sie über lange<br />
Zeiträume ununterbrochen laufen<br />
und weise dabei eine „ausgezeichnete<br />
Gesamtbetriebszeit“ auf. Sie basiere<br />
Bis zu 14 Coils pro Stunde wickelt der neue<br />
„Multiwrapper“ von Lamiflex in sichere Stretchfolie.<br />
Lamiflex<br />
www.lamiflex.com<br />
Messungen<br />
optimal ausrichten<br />
und fokussieren<br />
Mit einem neuen Video-Pyrometer<br />
stellt sich Optris der Herausforderung<br />
einer perfekten Ausrichtung<br />
während der Temperaturmessung.<br />
Temperaturmessungen mit Pyrometern<br />
haben den enormen Vorteil, dass<br />
kein Kontakt zum Messobjekt notwendig<br />
ist. Doch stehen sie zugleich der<br />
Herausforderung gegenüber, perfekt<br />
auf das Messobjekt ausgerichtet sein<br />
zu müssen, gegebenenfalls muss die<br />
Optik fokussiert werden. Diesem Problem<br />
will sich nun das Unternehmen<br />
Optris stellen, das vor diesem Hintergrund<br />
den neuen „Video Pyrometer<br />
CSvideo 3M“ entwickelt hat. Dieser<br />
Wie genau der Verpackungsprozess<br />
des „Multiwrappers“<br />
aussieht, hat Lamiflex<br />
in einem Praxis-Video<br />
festgehalten. Scannen<br />
Sie einfach den beigefügten<br />
QR-Code mit<br />
Ihrem Smartphone,<br />
um einen Einblick zu<br />
erhalten.<br />
Die Konfiguration des neuen „Video<br />
Pyrometer CSVideo 3M“ von Optris<br />
kann alternativ auch über ein Android-<br />
Mobiltelefon erfolgen.<br />
verfügt neben einem kreuzförmigen<br />
Visierlaser über eine integrierte Videokamera.<br />
Unternehmensangaben zufolge<br />
lässt sich damit das Messfeld<br />
„sehr genau anvisieren, auch wenn<br />
sich das Messobjekt in einem nur<br />
schwer zugänglichen Bereich befindet“.<br />
Das CSvideo 3M wird über ein<br />
Adapterkabel an eine USB-Schnittstelle<br />
am Laptop oder PC angeschlossen.<br />
Die darauf installierte Software Compact<br />
Connect stellt neben dem Temperatur-Zeit-Diagramm<br />
das Videobild der<br />
integrierten Kamera dar. Mit dem<br />
Drehknopf an der Rückseite, so Optris,<br />
lässt sich die Optik dann „sehr einfach<br />
fokussieren und optimal auf das Messobjekt<br />
ausrichten. Auch alle weiteren<br />
Einstellung könnten in der Software<br />
vorgenommen werden – beispielsweise<br />
eine Anpassung des Emissionskoeffizienten<br />
oder die Skalierung der Ausgangslage.<br />
Optris<br />
www.optris.de<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 57
RECHT<br />
FINANZEN<br />
Gleichstellung<br />
Das Zweiten Führungspositionen-Gesetz strebt noch keine vollständige Gleichstellung der Geschlechter an, will sie aber angleichen. Im<br />
ersten Schritt trifft das Gesetz weniger Unternehmen, als der erste „inoffizielle“ Referentenentwurf andeutete.<br />
Neuregelung zur Frauenquote für<br />
Vorstände und Aufsichtsräte<br />
Das Gesetz wird praktischen Konsequenzen wird das Gesetz haben<br />
AUTOR: Dr. Thorsten Kuthe, Miriam<br />
Schäfer, Rechtsanwälte, Heuking Kühn<br />
Lüer Wojtek<br />
t.kuthe@heuking.de<br />
DARUM GEHT’S: Im ersten „inoffiziellen“<br />
Referentenentwurf zur Neuregelung<br />
der Frauenquote waren auch<br />
GmbH eingeschlossen. In der verabschiedeten<br />
Fassung von Anfang Januar ist davon<br />
keine Rede mehr. Die Autoren<br />
schlüsseln auf, welche Unternehmen betroffen<br />
sind und welche Auswirkungen<br />
wahrscheinlich sind.<br />
Nach jahrelangen Debatten hat die<br />
Bundesregierung am 6. Januar<br />
<strong>2021</strong> den Entwurf des sogenannten<br />
Zweiten Führungspositionen-Gesetzes verabschiedet,<br />
das künftig erstmals eine Mindestbeteiligung<br />
einer Frau in Vorständen<br />
großer deutscher Unternehmen vorsieht.<br />
Das Gesetzgebungsverfahren soll nach dem<br />
Willen der federführenden Ministerinnen<br />
Giffey und Lambrecht am 1. Mai <strong>2021</strong> in<br />
Kraft treten. Die praktischen Folgen werden<br />
nachfolgend beleuchtet.<br />
Mindestbeteiligung für Vorstände<br />
börsennotierter, paritätisch<br />
mitbestimmter Gesellschaften<br />
Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Vorständen<br />
von börsennotierten (= regulierter<br />
Markt) und paritätisch mitbestimmten<br />
Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern<br />
mindestens eine Frau angehören muss. Das<br />
umfasst insbesondere börsennotierte Gesellschaften,<br />
die der Montan-Mitbestimmung<br />
unterliegen. Die Bestellung eines Vorstandsmitglieds<br />
unter Verstoß gegen dieses Beteiligungsgebot,<br />
wäre demnach nichtig (§<br />
76 Abs. 3a AktG-E). Das sog. Mindestbeteiligungsgebot<br />
soll auf Aktiengesellschaften<br />
sowie dualistische SE anwendbar sein. Entgegen<br />
dem ersten „inoffiziellen“ Referentenentwurf<br />
wird das Mindestbeteiligungsgebot<br />
nicht für GmbHs gelten.<br />
Erstmals könnte das Beteiligungsgebot<br />
bei Bestellungen ab dem 1. Januar 2022 zu<br />
beachten sein. Bestehende Vorstandsmandate<br />
können jedoch bis zu ihrem vorgesehenen<br />
Ende wahrgenommen werden. Verfassungsrechtlich<br />
ist der Gesetzesvorstoß<br />
nicht ganz unbedenklich. Zwingende gesetzliche<br />
Vorgaben hinsichtlich der Besetzung<br />
des Vorstands stellen nach einem<br />
Urteil des Bundesverfassungsgerichts einen<br />
Eingriff in die von Art. 14 Abs. 1 GG<br />
geschützte unternehmerische Freiheit der<br />
Anteilseigner dar. Diese umfasst auch die<br />
Quelle: FrankHH/Shutterstock<br />
58 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Möglichkeit, frei darüber bestimmen zu<br />
können, wer die Gesellschaft leitet und<br />
über die Verwendung des investierten Kapitals<br />
entscheidet. Der Gesetzgeber stützt<br />
seinen Gesetzentwurf auf das ebenfalls<br />
verfassungsrechtlich verankerte Gebot der<br />
Gleichberechtigung von Frauen und Männern<br />
nach Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG. Ob solche<br />
verfassungsrechtlichen Bedenken noch zu<br />
einer Änderung des Entwurfs führen ist<br />
jedoch eher zweifelhaft.<br />
Zielgrößenbestimmung für<br />
Frauen in Führungspositionen<br />
Der Aufsichtsrat börsennotierter oder mitbestimmter<br />
Gesellschaften hat bereits die<br />
Aufgabe, Zielgrößen für Vorstand bzw.<br />
Geschäftsführung und Aufsichtsrat festzulegen.<br />
Künftig ist nicht nur der Frauenanteil,<br />
sondern auch die Gesamtzahl der<br />
Frauen in Führungspositionen im Unternehmen<br />
festzulegen. Liegt der Frauenanteil<br />
bei Festlegung der Zielgröße unter<br />
30 % darf, dürfen die Zielgrößen den jeweils<br />
erreichten Anteil nicht mehr unterschreiten.<br />
Allerdings lag der Anteil mitbestimmter,<br />
der Quote unterliegender Unternehmen,<br />
die bei Zielgrößenfestlegung einen<br />
frauenfreien Vorstand hatten und die Zielgröße<br />
„Null“ festgelegt haben, bislang bei<br />
36,7 %. Bei den nicht der Quote unterfallenden<br />
Unternehmen lag der Anteil sogar<br />
bei 58,2 %. Daher sieht der Gesetzesentwurf<br />
nun vor, dass die Zielgröße „Null“ in<br />
Zukunft zwar zulässig bleibt, aber klar und<br />
verständlich unter ausführlicher Darlegung<br />
der Erwägungen zu begründen ist.<br />
Eine solche Pflicht besteht für den Aufsichtsrat<br />
in Bezug auf die Zielgrößen bei<br />
der Aufsichtsrats- und Vorstands- bzw. Geschäftsführungsbesetzung.<br />
Eine Begründung<br />
von 100 bis 150 Wörtern soll laut<br />
Gesetzesbegründung reichen, wobei inhaltlich<br />
Ausführungen zu Personalstruktur<br />
und -strategie zur Einordung in das<br />
Gesamtkonzept der Frauenförderung im<br />
Unternehmen geboten erscheinen.<br />
Eine entsprechende Berichtspflicht trifft<br />
den Vorstand bzw. die Geschäftsführung<br />
in Bezug auf die Zielgrößen für den Frauenanteil<br />
in den beiden Führungsebenen<br />
unterhalb des Vorstands/der Geschäftsführung<br />
festzulegen hat. Durch die Eingliederung<br />
der Berichtspflichten in das<br />
bestehende Sanktionssystem im Handelsgesetzbuch<br />
drohen künftig empfindliche<br />
Bußgelder.<br />
Was ist zu erwarten?<br />
Es bietet sich an einen Blick auf andere<br />
Länder zu werfen. Norwegen hat 2003 als<br />
erstes Land eine verbindliche Frauenquote<br />
für hohe Führungspositionen in börsennotierten<br />
Unternehmen eingeführt, die<br />
2006 mit einer zweijährigen Übergangsfrist<br />
verpflichtend in Kraft getreten ist, nachdem<br />
die Unternehmen eine freiwillige Erfüllung<br />
ohne gesetzlichen Zwang bis 2005<br />
nicht erreicht haben. Diesem Beispiel sind<br />
auch andere europäische Länder wie Italien,<br />
Portugal, Spanien, Belgien, Frankreich,<br />
Island, Österreich und die Niederlande gefolgt.<br />
Die Unternehmen in Norwegen antizipierten<br />
die Regelung, sodass der Frauenanteil<br />
in der Unternehmensleitung zunahm<br />
und schließlich in 2007 die geforderten 40<br />
% erreichte, da bei Nichteinhaltung harte<br />
Strafen bis zur Auflösung der Gesellschaft<br />
drohten. Der Frauenanteil verweilte auch<br />
in den Jahren darauf auf hohem Niveau,<br />
stieg allerdings nicht weiter an. Anscheinend<br />
haben die Unternehmen über die Erfüllung<br />
der Quote hinaus keine Anreize,<br />
den Frauenanteil weiter zu erhöhen.<br />
Um der Quote zu entgehen, haben etliche<br />
Unternehmen in Norwegen ihre<br />
Rechtsform geändert oder rechtlich ihren<br />
Sitz ins Ausland verlegt. Besonders häufig<br />
war dieses Phänomen bei den 80 Unternehmen<br />
zu beobachten, die 2002 noch<br />
keine weiblichen Führungskräfte hatten:<br />
Im Jahr 2009 tätigten 37 dieser Unternehmen<br />
(46 %) ihre Geschäfte in einer quotenfreien<br />
Rechtsform. Bei Unternehmen mit<br />
mindestens einer weiblichen Führungskraft<br />
lag der Anteil immerhin noch bei<br />
31 % (12 von 39 Unternehmen).<br />
Abzuwarten bleibt, inwieweit deutsche<br />
Unternehmen die Quotenregelung annehmen<br />
werden. Eine von der Bundesregierung<br />
in Auftrag gegebene Umfrage zeigte,<br />
dass 68 % der befragten männlichen (und<br />
30 % der weiblichen) Führungskräfte die<br />
Zielgrößenvereinbarung und sogar 77 %<br />
der befragten männlichen (und 33 % der<br />
weiblichen) Führungskräfte die feste<br />
30 %-Quotenregelung ablehnen. Neben der<br />
Verkleinerung des Vorstands auf drei Personen<br />
bleibt auch die „Flucht“ in eine quotenfreie<br />
Rechtsform oder ins quotenfreie<br />
europäische Ausland eine Umgehungsmöglichkeit<br />
für hartnäckige Verweigerer.<br />
Nach Angaben der Bundesregierung<br />
werden von der neuen Regelung über die<br />
Mindestbeteiligung über 70 Unternehmen,<br />
von denen 31 aktuell keine Frau im Vorstand<br />
haben, betroffen sein. In der Stahlindustrie<br />
ist für diese Neuerung kurzfristig<br />
kein großer Handlungsbedarf zu erwarten:<br />
Die Salzgitter AG hat zwar einen ausschließlich<br />
mit Männern besetzten Vorstand,<br />
da dieser aber nur drei Mitglieder<br />
zählt, besteht jedenfalls bis zum Ablauf der<br />
aktuellen Mandate kein Handlungsbedarf.<br />
Im Fall einer künftig erforderlichen Nachbesetzung<br />
strebt der Aufsichtsrat bis zum<br />
30. Juni 2022 einen Frauenanteil von mindestens<br />
30 % an. Die thyssenkrupp AG ist<br />
gewissermaßen Vorreiter bei der Beteiligung<br />
von Frauen in Führungspositionen,<br />
nicht nur in der Stahl-Branche: Im Aufsichtsrat<br />
sind acht der insgesamt 20 Mitglieder<br />
Frauen (40 %), zudem stellt die<br />
thyssenkrupp AG mit Martina Merz eine<br />
der wenigen weiblichen CEO in großen<br />
deutschen Unternehmen. Von 188 im DAX,<br />
MDAX und SDAX sowie im Regulierten<br />
Markt notierten, voll mitbestimmten Unternehmen<br />
haben nur fünf einen weiblichen<br />
Vorstandsvorsitzenden. Die weitere<br />
Neuerung zu der Berichtspflicht über die<br />
Zielquote trifft sicherlich mehr Unternehmen<br />
aus allen Branchen.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 59
BERUF<br />
KARRIERE<br />
Weiterbildung<br />
„Unsere Online-Formate finden<br />
weltweite Resonanz“<br />
Peter Schmieding von der Stahl-Akademie berichtet über die Erfahrungen nach der<br />
Umstellung auf Online-Formate<br />
AUTOR: Torsten Paßmann<br />
torsten.passmann@<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de<br />
DARUM GEHT’S: Innerhalb kürzester<br />
Zeit mussten sich die Anbieter von Bildungsangeboten<br />
im vergangenen Jahr<br />
neu sortieren. Die Stahl-Akademie innerhalb<br />
des Stahlinstituts VDEh hat sich<br />
diesen Herausforderungen gestellt und<br />
wandelt bislang erfolgreich auf dem neuen<br />
digitalen Pfad. Im Interview berichtet<br />
Peter Schmieding, der Leiter der Stahl-<br />
Akademie, über die bisherigen Erfahrungen<br />
und die Resonanz. Auch wagt er einen<br />
Ausblick.<br />
<strong>stahl</strong> + <strong>eisen</strong>: Präsenzveranstaltungen wie<br />
die Seminare der Stahl-Akademie stehen seit<br />
gut einem Jahr unter Druck. Wie haben Sie<br />
reagiert?<br />
Schmieding: Die Stahl-Akademie hat in<br />
der Sohnstraße in Düsseldorf ein eigenes<br />
Filmstudio für ihre Online-Seminare aufgebaut.<br />
Mit dieser technischen Innovation<br />
ist es möglich, den Seminarteilnehmern<br />
mehr zu bieten als es die üblichen Bildmotive<br />
und -formate der aktuellen Video-<br />
Kommunikations-Software tun.<br />
<strong>stahl</strong> + <strong>eisen</strong>: Was unterscheidet Ihre technische<br />
Lösung von den Tools, die aus dem Arbeitsalltag<br />
mittlerweile bekannt sind?<br />
Schmieding: Mittels Kamera, Mikrofon,<br />
Scheinwerfern, Green Screen sowie Bildund<br />
Tonmischern haben die Zuschauer<br />
nun ein Bild, das an eine Nachrichtensendung<br />
erinnert. Damit sind die Online-Seminare<br />
viel anschaulicher, kurzweiliger<br />
und lebendiger als die üblichen Zoom-Seminare.<br />
Es sieht so ähnlich aus wie eine<br />
TV-Nachrichtensendung. Für dieses Bildformat<br />
müssen die Referenten natürlich<br />
ins Studio kommen. Diejenigen, die verhindert<br />
sind oder zu weit entfernt wohnen,<br />
können wir via Teams oder Zoom in<br />
den Live-Stream hineinschalten.<br />
Stahl + Eisen: Wann haben Sie damit angefangen<br />
und welche Erfahrungen haben Sie bislang<br />
gesammelt?<br />
Schmieding: Ende August haben wir das<br />
Studio mit einem dreitägigen internationalen<br />
Seminar zum Elektrolichtbogenofen<br />
eingeführt. Danach folgten Seminare<br />
zu den Themen Konverter, Sekundärmetallurgie,<br />
Walzen und Feuerfest-Technologie<br />
sowie einer Übersichtsveranstaltung<br />
zur Eisen- und Stahlherstellung. Mit jedem<br />
Online-Seminar haben wir technisch<br />
dazugelernt, so dass die Durchführung<br />
inzwischen viel ausgereifter abläuft als zu<br />
Beginn.<br />
Stahl + Eisen: Was war Ihr persönliches<br />
Highlight bei dem neuen Online-Ansatz?<br />
Schmieding: Den vorläufigen Höhepunkt<br />
der Online-Seminarreihe stellte im<br />
letzten Oktober die internationale Veranstaltung<br />
„Hydrogen-based reduction of<br />
iron ores“ dar, in deren Live-Stream sich<br />
50 Teilnehmer schalteten. Dass das Thema<br />
mit Anmeldungen aus Deutschland,<br />
Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg,<br />
Niederlande, Österreich, Schweden und<br />
Tschechien nicht nur Europa umtreibt,<br />
sondern auch weltweit Resonanz findet,<br />
zeigten weitere Teilnehmer aus Australien,<br />
China, Brasilien, Japan, Singapur und<br />
Südafrika.<br />
Stahl + Eisen: Wie sieht es mit der Teilnehmerzahl<br />
bei den Online-Seminaren aus – was<br />
ist praktisch möglich bzw. sinnvoll?<br />
Schmieding: Technisch sind laut Aussage<br />
des Streaming-Dienstleisters einige<br />
Tausend Teilnehmer möglich. Aber die<br />
bereits genannten 50 wollen wir nicht<br />
überschreiten. Sonst wird es in der Fragerunde<br />
via Chatroom unübersichtlich wird<br />
die Sache kann zeitlich aus dem Ruder<br />
laufen.<br />
Stahl + Eisen: Wie geht es mit dem Online-<br />
Bereich der Stahl-Akademie weiter?<br />
Schmieding: Ich denke, dass die Online-<br />
Formate auch nach Corona bleiben –<br />
nicht ausschließlich wie momentan, aber<br />
in einer Koexistenz mit Präsenzseminaren.<br />
Die Menschen sehnen sich natürlich<br />
danach, wieder andere Köpfe aus der<br />
Branche zu treffen und wirklich zu diskutieren.<br />
Aber für Teilnehmer mit weiten<br />
Wegen, z.B. aus Übersee, sinken die Kosten<br />
zweifelsohne beträchtlich, wenn sie<br />
Online-Seminare buchen. Die Stahl-Akademie<br />
setzt vorerst mindestens bis zum<br />
Sommer weiterhin ausschließlich auf die<br />
Online-Varianten. Wir widmen uns bis<br />
dahin den Eisenerzen, der Roh<strong>eisen</strong>erzeugung<br />
im Hochofen, dem Schrottrecycling,<br />
dem Elektrolichtbogenofen und der Feuerfest-Technologie<br />
Stahl + Eisen: Vielen Dank für das Interview,<br />
Herr Schmieding!<br />
Kommende Seminare<br />
Industrieofentechnik, 10.-12. März<br />
Elektrolichtbogenofen, 15.-17. März<br />
Schrottrecycling, 12.-13. April<br />
Iron Ores,<br />
20.-21. April<br />
Ironmaking, Basic 4.-5. Mai /<br />
Advanced<br />
8.-9. Juni<br />
Refractory Materials and Slags,<br />
<br />
26.-28. April<br />
Steel Ladle Lining, 31. Mai bis 1. Juni<br />
https://www.vdeh.de/<br />
<strong>stahl</strong>-akademie/seminare/<br />
64 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Technologie, Forschung,<br />
Märkte und Menschen!<br />
DER Stahl-Newsletter!<br />
Ihr wöchentlicher Info-Kanal.<br />
Jetzt anmelden: www.<strong>stahl</strong><strong>eisen</strong>.de
STYLE<br />
STORY<br />
Fluchttreppen<br />
Metallgewebe verkleidet umlaufende Fluchtbalkone,<br />
deren Laufstege durch Fluchttreppen verbunden werden.<br />
Häufig wird der zweite Rettungsweg als außenliegender<br />
Treppenturm umgesetzt und als Absturzsicherung mit<br />
Gewebe aus Edel<strong>stahl</strong> Rostfrei verkleidet.<br />
Nachhaltige Sicherheit<br />
mit Treppen aus Stahl<br />
Fluchtwege aus Edel<strong>stahl</strong> Rostfrei überzeugen zusätzlich durch ihre Optik<br />
AUTOR: Dr. Hans-Peter Wilbert,<br />
Geschäftsführer, Warenzeichenverband<br />
Edel<strong>stahl</strong> Rostfrei<br />
www.wzv-rostfrei.de<br />
DARUM GEHT‘S: Mehrgeschossigen Gebäuden<br />
gibt es nur mit Treppen: Sie verbinden<br />
die einzelnen Etagen miteinander<br />
und sind im Notfall der entscheidende<br />
Flucht- oder Rettungsweg.<br />
Entsprechend streng sind die Vorschriften<br />
zu ihrer Planung und Gestaltung.<br />
Eine Schlüsselrolle übernimmt dabei<br />
Edel<strong>stahl</strong> Rostfrei mit Qualitätssiegel:<br />
Nicht brennbar, korrosionsbeständig<br />
und extrem robust ist er eine Investition<br />
in nachhaltige Sicherheit.<br />
Eine Verkleidung aus Edel<strong>stahl</strong>gewebe für<br />
Fluchtbalkone verhindert, dass Menschen<br />
von dort abstürzen.<br />
Eine Fülle an Vorschriften – neben der<br />
DIN 18065 für Gebäudetreppen auch<br />
Landesbauordnungen, Technische<br />
Richtlinien für Schulbauten, Arbeits- oder<br />
Versammlungsstätten oder auch die Musterbauordnung<br />
– gilt es bei Planung und<br />
Bau oder Umbau von Gebäuden zu berücksichtigen.<br />
Dabei unterscheidet das Baurecht<br />
zwischen Fluchtwegen, auf denen<br />
Personen das Gebäude aus eigener Kraft<br />
verlassen können und Rettungswegen, die<br />
die Personenbergung durch Rettungskräfte<br />
ermöglichen. Abhängig von Gebäudegröße,<br />
-typologie und -nutzung sowie Anzahl und<br />
Art der Nutzer sind Abmessungen, Erreichbarkeit<br />
und Gestaltung strikt vorgeschrieben.<br />
Nicht minder enge Vorgaben gibt es<br />
zu Baustoffen für Unterkonstruktion, Stufen<br />
und Belag in Bezug auf Feuerwiderstand<br />
und Sicherheit. Alle Verordnungen<br />
unterscheiden zwischen notwendigen und<br />
nicht notwendigen Treppen. Letztere sind<br />
zusätzliche Treppen zur Haupttreppe, die<br />
im Falle des Falles als erster Fluchtweg<br />
dient. Bei öffentlichen Gebäuden gelten<br />
interne Verbindungstreppen, die nicht für<br />
den Publikumsverkehr zugänglich sind, als<br />
nicht notwendige Treppen. Deshalb müssen<br />
sie auch nur geringere Anforderungen<br />
erfüllen als für den ersten Rettungsweg<br />
notwendige. Diese müssen einen direkten<br />
Ausgang ins Freie ermöglichen und auf<br />
jedem Geschoss ein Fenster haben, das geöffnet<br />
werden kann. Dadurch ist es bei einem<br />
Brand als Rauchabzug, Fluchtweg oder<br />
auch Zugang für die Feuerwehr nutzbar.<br />
2 Meter Breite oder mehr bei<br />
Arbeitsstätten ab 500 m 2<br />
Treppentypen und -bauformen gibt es auch<br />
bei Fluchttreppen in großer Bandbreite: Ob<br />
gerade, gewendelt oder gewinkelt, ein- oder<br />
mehrläufig, mit oder ohne Richtungswechsel<br />
hängt vor allem von den räumlichen<br />
Gegebenheiten ab. Dabei richten sich die<br />
Abmessungen notwendiger Treppen nach<br />
Anzahl und Art der Personen, die die Treppe<br />
im Gefahrenfall gleichzeitig benutzen<br />
müssen. Für Krankenhäuser, Kindergärten<br />
oder Seniorenheime gelten naturgemäß<br />
höhere Sicherheitsvorschriften für die Gestaltung<br />
von Stufen, Handläufen oder Steigungen.<br />
Ansonsten schreiben die Landesbauordnungen<br />
für bis zu 20 Personen eine<br />
Treppenbreite von einem Meter, für bis 200<br />
Personen 1,20 Meter und für bis zu 400<br />
Personen 2,40 Meter vor. In Arbeits- oder<br />
Verkaufsstätten mit mehr als 500 Quadratmeter<br />
allgemein zugänglicher Fläche muss<br />
eine Fluchttreppe sogar mindestens zwei<br />
Meter breit sein. Grundsätzlich ist nach<br />
Quellen: WZV/PcP. Sicherheitsroste; WZV/GKD<br />
70 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Bei der Gestaltung von Fluchttreppen<br />
übernimmt Edel<strong>stahl</strong> Rostfrei eine<br />
Schlüsselrolle.<br />
Unverzichtbar für eine dauerhafte Korrosionsbeständigkeit ist, dass auch<br />
alle Schrauben, Unterlegscheiben oder Anker zur Befestigung an der<br />
Fluchttreppenverkleidung ausschließlich aus Edel<strong>stahl</strong> Rostfrei sind.<br />
maximal 18 Stufen eine Unterbrechung<br />
durch ein Podest erforderlich, damit die<br />
Benutzer warten, sich ausruhen oder auch<br />
ausweichen können. Als Tragkonstruktionen<br />
der Fluchttreppen dienen Wangen,<br />
Holme, Spindeln oder angrenzende Wände.<br />
Für Stufen und Podeste ist eine waagerechte<br />
Ausrichtung vorgeschrieben.<br />
Außen oft Fluchtwege aus Stahl<br />
Der zweite Rettungsweg wird an öffentlichen<br />
Gebäuden und mehrgeschossigen Wohnanlagen<br />
häufig auch als überdachte Stahltreppenkonstruktion<br />
an der Außenseite der Fassade,<br />
als außenliegender Treppenturm oder<br />
als umlaufende Fluchtbalkone, deren Laufstege<br />
durch Fluchttreppen und -türen verbunden<br />
werden, umgesetzt. Alle Arten von<br />
Fluchttreppen – innen wie außen – müssen<br />
bei der Materialwahl und der Gestaltung von<br />
Geländern, Handläufen und Stufenbelägen<br />
hohe Anforderungen erfüllen. So sind gesicherte<br />
Tragfähigkeit auch bei extremen Bedingungen<br />
– also beispielsweise Temperaturbeständigkeit<br />
und Nichtbrennbarkeit der<br />
eingesetzten Materialien – Grundvoraussetzung<br />
für eine Verwendungsgenehmigung.<br />
Für Außentreppen sind zudem für Stufen<br />
und Podeste rutschhemmende sowie poröse<br />
Oberflächen vorgeschrieben, um auch bei<br />
Regen eine sichere Benutzung und Abfließen<br />
des Wassers zu gewährleisten. Insbesondere<br />
die Stufenkanten und Auftritte müssen<br />
rutschfest ausgeführt sein. Zudem dürfen<br />
Fluchttreppen im Außenraum auch nach<br />
jahrelangen Witterungseinflüssen weder rosten<br />
noch verspröden.<br />
Nachhaltige Sicherheit durch<br />
Edel<strong>stahl</strong> Rostfrei<br />
Dieses anspruchsvolle Eigenschaftsprofil<br />
paart Edel<strong>stahl</strong> Rostfrei mit robuster Haltbarkeit,<br />
Wartungsfreiheit und attraktiver<br />
Optik. Die hohe Korrosionsbeständigkeit<br />
und mechanische Belastbarkeit des Werkstoffs<br />
werden maßgeblich durch die chemische<br />
Zusammensetzung der gewählten<br />
Edel<strong>stahl</strong>sorte bestimmt. Ausschlaggebend<br />
für nachhaltige Sicherheit von Edel<strong>stahl</strong><br />
Rostfrei im Fluchttreppenbau ist die sachgerechte<br />
Materialauswahl und fachgerechte<br />
Verarbeitung. Alle nichtrostenden Stähle<br />
w<strong>eisen</strong> mindestens 10,5 Prozent Chromgehalt<br />
und maximal 1,2 Prozent Kohlenstoff<br />
auf. Je nach Korrosionsbeanspruchung und<br />
Einsatzzweck wählt der Fachmann aus dem<br />
breiten Gütenspektrum die jeweils optimal<br />
ausgelegte Legierung.<br />
1.43<strong>01</strong> dominiert<br />
Die mit Abstand am häufigsten verwendete<br />
Edel<strong>stahl</strong>sorte ist 1.43<strong>01</strong>. Sie lässt sich gut<br />
verformen und schweißen. Außerdem können<br />
alle Verfahren zur mechanischen und<br />
thermischen Trennung oder spanenden Fertigung<br />
angewendet werden. In Küstennähe<br />
sollten jedoch höher legierte Sorten zum<br />
Einsatz kommen, die den hier vorherrschenden<br />
aggressiven Bedingungen entsprechend<br />
gut gewachsen sind. Bereits geringe Molybdän-Gehalte<br />
(Mo) verbessern ihre Beständigkeit<br />
gegen Umwelteinflüsse. Stufenbeläge<br />
aus Gitterrosten der Werkstoffgüte 1.43<strong>01</strong><br />
mit gebeizter Oberfläche bieten durch ihre<br />
rutschhemmende Antrittskante und Oberflächengestaltung<br />
die gebotene Rutschfestigkeit<br />
bei Nässe, Schnee oder Eis. Zusätzliche<br />
Sicherheit geben Produkte mit einer zur optischen<br />
Markierung doppelt gelochten Vorderkante,<br />
wodurch die Stufenübergänge<br />
besser zu erkennen sind. Geländerhohe Wangen<br />
aus Lochblech oder Geländer mit Füllungen<br />
aus Gittern, Stäben, Netzen oder Seilen<br />
verhindern, dass Menschen und größere<br />
Gegenstände von der Fluchttreppe abstürzen.<br />
Gleichzeitig verleihen sie der lebensrettenden<br />
Fluchttreppenkonstruktion eine leichte Optik.<br />
Rohrhandläufe aus Edel<strong>stahl</strong> Rostfrei mit<br />
Qualitätssiegel unterstreichen durch ihre<br />
wahlweise gebürstete, matte oder hochglänzende<br />
Oberfläche diese elegante Wirkung.<br />
Konsequenz auch bei<br />
Verbindungselementen<br />
Handläufe an Fluchttreppen müssen ohne<br />
Unterbrechung über den gesamten Treppenlauf<br />
führen und dürfen an ihrem Ende<br />
weder gebogen noch abgewinkelt sein. Nur<br />
so wird verhindert, dass die Benutzer bei<br />
einer Flucht daran hängenbleiben. Abhängig<br />
von Konstruktion, Einsatzzweck und<br />
geforderter Tragfähigkeit werden für den<br />
Bau von Fluchttreppen Profile oder Bleche<br />
aus warmgewalztem Edel<strong>stahl</strong> Rostfrei ausgewählt.<br />
Die zur statischen Berechnung<br />
notwendigen Kennzahlen halten die Hersteller<br />
für Planer bereit. Unverzichtbar für<br />
eine dauerhafte Korrosionsbeständigkeit<br />
und hochwertige Optik ist, dass bei der<br />
Montage auch alle Verbindungselemente<br />
wie Schrauben, Unterlegscheiben oder<br />
Anker zur Befestigung an der Fassade ausschließlich<br />
aus Edel<strong>stahl</strong> Rostfrei sind. Auf<br />
Nummer sicher gehen Bauherren mit der<br />
Wahl von Fachfirmen, die das international<br />
geschützte Qualitätssiegel tragen dürfen<br />
und sich damit zu sach- und fachgerechter<br />
Umsetzung verpflichten.<br />
Fazit<br />
Fluchttreppen aus Edel<strong>stahl</strong> trotzen der Zerstörung<br />
durch Feuer bei Temperaturen von<br />
über 500 Grad Celsius, bieten auch extremsten<br />
Witterungsbedingungen dauerhaft die<br />
Stirn und sind deshalb in der Not ein Lebensretter<br />
von unbezahlbarem Wert. <br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Januar/Februar <strong>2021</strong> 71
VORSCHAU<br />
IMPRESSUM<br />
Bis zum nächsten Mal<br />
VORSCHAU 3/<strong>2021</strong><br />
Titelthema: Werkstoffe und Produkte<br />
Die Titelstrecke wirft einen Blick jüngst eingeführte<br />
Technologien, Sortimente und Werkstoffe<br />
Politik + Märkte<br />
Organisches Wachstum ohne die Bank –<br />
Stahlverarbeiter setzt zur Finanzierung<br />
auf ein Fintech-Unternehmen.<br />
Wissenschaft + Technik<br />
Wartungsfreie Lösung – Pendel- und Zylinderrollenlager in<br />
einer Stranggießanlage ganz ohne Nachschmierung<br />
Style + Story<br />
Fast vergessener Konstrukteur – Blechschere von<br />
Alfred Trappen als Modell wiederbelebt<br />
Impressum<br />
Quelle: Fraunhofer IWM, Maxx-Studio/Shutterstock<br />
Verlag:<br />
Maenken Kommunikation GmbH<br />
Von-der-Wettern-Straße 25<br />
51149 Köln, info@maenken.com<br />
Geschäftsführung:<br />
René Khestel, Dr. Wieland Mänken<br />
Herausgeber:<br />
Dr. Wieland Mänken (V.i.S.d.P.)<br />
Mitherausgeber:<br />
Stahlinstitut VDEh<br />
Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident<br />
Wirtschaftsvereinigung Stahl,<br />
Vorsitzender Stahlinstitut VDEh<br />
Dr.-Ing. Hans Bodo Lüngen<br />
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied<br />
Stahlinstitut VDEh<br />
Objektleitung:<br />
Wolfgang Locker (verantwortlich)<br />
Tel. +49 2203 3584-182<br />
wolfgang.locker@maenken.com<br />
Redaktion:<br />
Torsten Paßmann (Chefredakteur)<br />
Tel. +49 2203 3584-120<br />
torsten.passmann@<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de<br />
Niklas Reiprich<br />
niklas.reiprich@<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de<br />
Mitarbeit:<br />
Nikolaus Fecht, Fabian Grummes,<br />
Prof. Dr. Günter M. Hoffmann,<br />
David Müller<br />
Gestaltungskonzept:<br />
Christian Talla | Editorial | Corporate,<br />
Communication | www.talla.hamburg<br />
Herausgeberbeirat:<br />
Prof. Dr. Dieter Senk,<br />
Prof. Dr. Norbert Bannenberg,<br />
Dr.-Ing. Hans Bodo Lüngen<br />
Anzeigen:<br />
Wolfgang Locker (verantwortlich)<br />
Tel. +49 2203 3584-182<br />
wolfgang.locker@maenken.com<br />
Marie-Kristin Janßen<br />
Tel. +49 2203 3584-172<br />
marie-kristin.janssen@maenken.com<br />
Susanne Kessler<br />
Tel. +49 2203 3584-116<br />
susanne.kessler@maenken.com<br />
Druck:<br />
D+L Printpartner<br />
Schavenhorst 10, 46395 Bocholt<br />
Zuschriften und Beiträge für<br />
eine eventuelle Veröffentlichung<br />
bitte nur an:<br />
Redaktion „<strong>stahl</strong> + <strong>eisen</strong>“<br />
Maenken Kommunikation GmbH<br />
Von-der-Wettern-Straße 25<br />
51149 Köln, Tel. +49 2203 3584-0<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>@maenken.com<br />
Erscheinungsweise: monatlich<br />
Anzeigenpreise:<br />
Preisliste Nr. 49 vom 1. Januar <strong>2021</strong><br />
Jahresbezugspreis<br />
(inkl. Versandkosten):<br />
Inland € 244,00 inkl. 7% MwSt., persönliche<br />
VDEh-Mitglieder € 173,00 inkl. 7%<br />
MwSt.; Binnenmarktländer – Empfänger<br />
mit Umsatzsteuer-Identifikations-Nr.<br />
€ 274,49, Drittländer: € 295,00,<br />
persönliche VDEh-Mitglieder € 190,00.<br />
Einzelheft € 24,00<br />
Der Abonnementpreis gilt bei einer<br />
Mindestbezugszeit von 12 Monaten.<br />
Abonnementkündigungen sind nur<br />
möglich zum 31. Dezember und müssen<br />
bis zum 15. November beim Herausgeber<br />
eingetroffen sein. Ansonsten verlängert<br />
sich das Abonnement um weitere 12<br />
Monate. Jahresbezugspreis E-Paper für<br />
Print-Abonnenten Inland € 5,00 inkl. 19%<br />
Mwst. Ausland: Binnenmarktländer –<br />
Empfänger mit Umsatzsteuer-Identifikations-Nr.<br />
€ 4,20, Binnenmarktländer –<br />
Empfänger ohne Umsatzsteuer-<br />
Identifikations-Nr. € 5,00<br />
Haftung:<br />
Für Leistungsminderungen durch höhere<br />
Gewalt und andere vom Herausgeber nicht<br />
verschuldete Umstände (z. B. Streik)<br />
können keine Entschädigungsansprüche<br />
von Abonnenten und/oder Inserenten<br />
geltend gemacht werden.<br />
Copyright:<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen<br />
Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich<br />
geschützt. Jede Verwertung<br />
außerhalb der durch das Urherberrechtsgesetz<br />
festgelegten Grenzen ist ohne<br />
Zustimmung des Herausgebers unzulässig.<br />
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,<br />
Übersetzungen, Mikroverfilmungen<br />
und die Einspeicherung und Verarbeitung<br />
in elektronischen Systemen.<br />
Urheberrecht für Autoren:<br />
Mit Annahme des Manuskripts gehen das<br />
Recht zur Veröffentlichung sowie die<br />
Rechte zur Übersetzung, zur Vergabe von<br />
Nachdruckrechten, zur elektronischen<br />
Speicherung in Datenbanken, zur Herstellung<br />
von Sonderdrucken, Fotokopien<br />
und Mikrokopien an den Herausgeber über.<br />
In der unaufge forderten Zusendung von<br />
Beiträgen und Informationen an den<br />
Herausgeber liegt das jederzeit widerrufliche<br />
Einverständnis, die zugesandten<br />
Beiträge bzw. Informationen in Datenbanken<br />
einzustellen, die vom Herausgeber<br />
oder von mit diesem kooperierenden<br />
Dritten geführt werden.<br />
Warenzeichen:<br />
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen,<br />
Warenbezeichnungen, Handelsnamen<br />
oder sonstigen Kennzeichen in dieser<br />
Zeitschrift berechtigt nicht zu der<br />
Annahme, dass diese ohne weiteres von<br />
jedermann frei benutzt werden dürfen.<br />
Vielmehr handelt es sich häufig um<br />
eingetragene Warenzeichen oder gesetzlich<br />
geschützte Kennzeichen, auch wenn<br />
sie als solche nicht eigens gekennzeichnet<br />
sind.<br />
Erfüllungsort:<br />
Köln © <strong>2021</strong> Maenken<br />
Kommunikation GmbH, Köln<br />
Quelle: David Tadevosian/Shutterstock<br />
74 Januar/Februar <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de