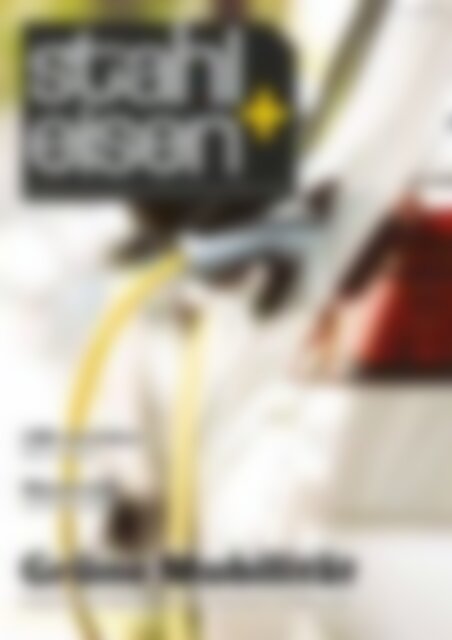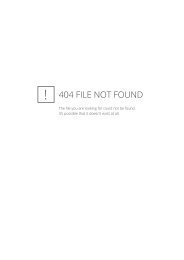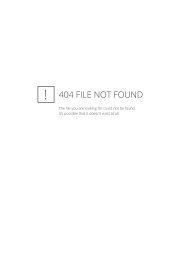stahl + eisen 06/2021 (Leseprobe)
TITELTHEMA AUTOMOTIVE: GRÜNE MOBILITÄT // WEITERE THEMEN: u.a. Mit Wasserstoff zur klimaneutralen Stahlproduktion, Logistik für HBI und DRI, Interview mit Joanna Funck von Ferroso, aus Wissenschaft + Technik: Neue 3D-Laserschneidanlage eröffnet mehr Optionen, Rechtliche Optionen für Abnehmer bei Lieferverzug
TITELTHEMA AUTOMOTIVE: GRÜNE MOBILITÄT // WEITERE THEMEN: u.a. Mit Wasserstoff zur klimaneutralen Stahlproduktion, Logistik für HBI und DRI, Interview mit Joanna Funck von Ferroso, aus Wissenschaft + Technik: Neue 3D-Laserschneidanlage eröffnet mehr Optionen, Rechtliche Optionen für Abnehmer bei Lieferverzug
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nr. 6 | Juni <strong>2021</strong><br />
Magazin für die Herstellung und Verarbeitung von Eisen + Stahl<br />
LME verstehen<br />
Risse vermeiden<br />
Wasserstoff<br />
und Förderprojekte<br />
Grüne Mobilität<br />
Erzeuger und Hersteller kooperieren für „Green Steel“ und Elektroautos
ZEIT FÜR VERÄNDERUNG<br />
FÜR EINE CO<br />
2<br />
-NEUTRALE ZUKUNFT<br />
Technologie-Partner der Stahlindustrie für die<br />
Direktreduktions-Prozesse von morgen<br />
STEULER-KCH GmbH | Berggarten 1 | 56427 Siershahn | GERMANY<br />
Phone: +49 2623 600-409 | E-Mail: info@steuler-kch.de | www.steuler-linings.com
Liebe Leserinnen & Leser,<br />
Aktuelle Nachrichten<br />
finden Sie<br />
fortlaufend auf<br />
<strong>stahl</strong><strong>eisen</strong>.de. Sie<br />
sind Social-Mediaaffin?<br />
Folgen Sie<br />
auf Twitter doch<br />
@<strong>stahl</strong><strong>eisen</strong>_de.<br />
mit Daimler, BMW und Volkswagen sind gleich drei Automobilhersteller<br />
im Dax vertreten, dem Leitindex der Deutschen Börse. Dazu kommt<br />
mit Continental noch ein Automobilzulieferer. Das ist im Wortsinne<br />
„Old Economy“, so wie der Großteil der anderen Index-Werte, aber bis<br />
heute eine Basis des deutschen Wohlstands und außerdem ein wichtiger<br />
Abnehmer von Stahl. Jedoch steht diese Branche massiv unter Druck:<br />
Moderne Autos sind vernetzte Digitalwunder, und hier sind amerikanische und<br />
chinesische Anbieter deutlich voraus; dazu steht auch hier die Dekarbonisierung als politische<br />
forcierte Herausforderung an. Hier müssen die deutschen (und alle anderen europäischen)<br />
Hersteller „liefern“, damit auch in Zukunft Autos auf dem Kontinent gebaut werden.<br />
In der aktuellen Titelstrecke „Automotive“ ab Seite 14 beleuchten wir nach einem kompakten<br />
Überblick einige Maßnahmen speziell der Autobauer. Es geht dabei um kleine, kurzfristige<br />
Schritte auf dem Weg zur Klimafreundlichkeit ebenso wie langfristig geplante. Ebenso werfen<br />
wir zwei Schlaglichter auf einen Hersteller und einen Verarbeiter, die ebenfalls ihre Beiträge<br />
zur Zukunftsfähigkeit der Autoindustrie leisten. In dem Einführungsartikel werfen wir gegen<br />
Ende übrigens auch einen Blick auf das Ende des Produktlebenszyklus. Ein sehr bekannter<br />
Branchenname eröffnet sich neue Geschäftsfelder außerhalb des gewohnten Umfelds und hat<br />
dabei das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien als eine Option entdeckt. Unter dem Strich bin<br />
ich jedenfalls sehr zuversichtlich, dass die Hersteller wie auch die Erzeuger und die Zulieferer<br />
die Mammutaufgabe „Dekarbonisierung“ im Schulterschluss schaffen werden.<br />
Mit „Logistik“ – sowohl innerbetrieblich als auch mit Blick auf die Lieferkette – haben wir ein<br />
zweites Schwerpunktthema in der aktuellen Ausgabe. Wir haben diese Beiträge im Heft noch<br />
einmal durch eine kleine Plakette zusätzlich hervorgehoben. So finden Sie beispielsweise ab Seite<br />
28 einen Fachtext aus dem Hause Aumund, der sich mit dem Heißtransport und der Kühlung von<br />
Direktreduktionsprodukten beschäftigt. Dazu haben wir u.a. mit Joanna Funck von Ferroso über<br />
die Verringerung von Reibungsverlusten zwischen Stahlhändler und Stahlverarbeitern<br />
gesprochen und ein Rechtsanwalt klärt über die Optionen bei Lieferverzug auf.<br />
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!<br />
Torsten Paßmann, Chefredakteur<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Juni <strong>2021</strong> 3
STAHL<br />
EISEN<br />
Inhalt 6 | <strong>2021</strong><br />
Cover:<br />
Die Autobranche<br />
setzt auf E-Mobilität<br />
und „grünen“ Stahl<br />
Quelle: hurricanehank/www.shutterstock.com<br />
NEWS<br />
TERMINE<br />
6 Wirtschaft + Industrie<br />
u.a. mit Saar<strong>stahl</strong>, ArcelorMittal und Fachmessen<br />
10 Klima + Umwelt<br />
u.a. mit voestalpine, Paul Wurth und Hybrit<br />
12 Additive Fertigung<br />
u.a. mit Volkswagen, Fraunhofer und Desktop Metal<br />
16<br />
Green<br />
Steel trifft Elektromobilität<br />
Erzeuger und Hersteller drehen alle Stellschrauben<br />
für Klimafreundlichkeit<br />
TITELTHEMA: AUTOMOTIVE<br />
16 OEM erhöhen Tempo bei der<br />
Dekarbonisierung<br />
Kfz-Hersteller drehen alle Stellschrauben zur<br />
Klimafreundlichkeit<br />
18 Volkswagen setzt auf neue XL-Presse<br />
von Schuler<br />
Ausbau spart 9 000 Lkw-Fahrten ein<br />
20 Verringerte Emissionen in der Lieferkette<br />
Mercedes-Benz und Volvo engagieren sich verstärkt<br />
bei Erzeugern<br />
23 Sandwich-Werkstoff sorgt für mehr Ruhe<br />
Mit einem intelligenten Kniff sorgt thyssenkrupp Steel<br />
für mehr Ruhe im E-Auto<br />
43<br />
LME<br />
verstehen, Risse vermeiden<br />
Herausforderungen beim Widerstandspunktschweißen<br />
moderner hochfester Stähle<br />
POLITIK<br />
MÄRKTE<br />
24 Mit Wasserstoff zur klimaneutralen<br />
Stahlproduktion<br />
BMWi und BMVI bringen Wasserstoff-Großprojekte<br />
auf den Weg<br />
28 Logistik für HBI und DRI<br />
Technologie für den Heißtransport und die<br />
Kühlung von Direktreduktionsprodukten<br />
32 Automatisierung optimiert<br />
innerbetriebliche Logistik<br />
Stahlhändler Weser Stahl setzt auf neues<br />
Lager-Säge-System und einen mannlosen Betrieb<br />
34 „Die Beschaffung birgt mehr<br />
Herausforderungen als die Entsorgung“<br />
Interview mit Joanna Funck von Ferroso<br />
36 Voestalpine dreht operatives Ergebnis<br />
ins Plus<br />
Maßnahmen im Geschäftsjahr 2020/<strong>2021</strong> zeigen<br />
Wirkung<br />
37 Zeichen für konjunkturelle<br />
Aufbruchsstimmung bei Lieferketten<br />
Aktuelle Meldung aus dem BMWi<br />
4 Juni <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
WISSENSCHAFT<br />
TECHNIK<br />
43 Liquid Metal Embrittlement verstehen,<br />
Risse vermeiden<br />
Herausforderungen beim Widerstandspunktschweißen<br />
moderner hochfester Stähle<br />
48 Bessere Fundamente für<br />
Offshore-Windparks als Ziel<br />
Dillinger setzt auf die Zusammenarbeit mit<br />
Wissenschaftlern aus Aachen und Saarbrücken<br />
28<br />
Logistik für HBI und DRI<br />
Technologie für den Heißtransport und<br />
die Kühlung von Direktreduktionsprodukten<br />
52 „Eine Laserquelle für ein breiteres<br />
Stärkespektrum als bisher“<br />
Neue 3D-Laserschneidanlage eröffnet einem<br />
Stahl- und Komponentenbauer mehr Optionen<br />
54 Erzeugnisse und Verfahren<br />
für den Umgang mit Stahl<br />
u.a. mit Enemac, NDC Technologies und<br />
Menzel Elektromotoren<br />
RECHT<br />
FINANZEN<br />
56 Der Nachschub kommt... nicht<br />
Rechtliche Optionen für Abnehmer bei Lieferverzug<br />
BERUF<br />
KARRIERE<br />
58 „Leadership Identity“ als innerer Kompass<br />
Führungskräfte brauchen Orientierung,<br />
um selbstbewusst und selbstsicher zu führen<br />
STYLE<br />
STORY<br />
„Die Beschaffung birgt mehr Herausforderungen“<br />
34 Interview mit Joanna Funck, Ferroso<br />
62 Ein Lehrer und Forscher der<br />
Montanwissenschaften<br />
Vor 150 Jahren starb Julius Weisbach,<br />
Professor an der Bergakademie Freiberg<br />
IMMER<br />
EWIG<br />
3 Editorial<br />
9 Termine<br />
38 Länder + Anlagen<br />
60 VDEh-Personalia<br />
64 People<br />
66 Vorschau + Impressum<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Juni <strong>2021</strong> 5
NEWS + TRENDS<br />
Wirtschaft<br />
Industrie<br />
Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat<br />
Olaf Scholz (SPD) besuchte ArcelorMittal Bremen.<br />
Scholz und Baerbock besuchen ArcelorMittal<br />
Mitte Juni erhielt der Stahlerzeuger ArcelorMittal<br />
gleich zweimal Besuch aus dem<br />
Bundestag: Erst schaute Bundesfinanzminister<br />
Olaf Scholz (SPD) in Bremen vorbei,<br />
ein paar Tage später war es die Oppositionspolitikerin<br />
Annalena Baerbock<br />
(Bündnis90/Die Grünen) in Eisenhüttenstadt.<br />
Während seines Besuchs überzeugte<br />
sich Scholz von den Plänen und Herausforderungen,<br />
um den Weg zum grünen<br />
Stahl erfolgreich zu gehen. Neben<br />
politischen Gesprächen mit der Geschäftsführung<br />
und dem Betriebsrat des<br />
Standorts sowie der IG Metall Bremen<br />
kam er auch mit der Belegschaft des<br />
größten Produktionsstandorts von ArcelorMittal<br />
in Deutschland ins Gespräch. In<br />
Ostbrandenburg machte sich dann auch<br />
Baerbock ein Bild von den Transformationsplänen<br />
für den Industriestandort.Für<br />
die beiden Flach<strong>stahl</strong>werke Bremen<br />
und Eisenhüttenstadt hat Arcelor-<br />
Mittal ein Konzept vorgelegt, um dort<br />
noch vor 2030 rund 3,5 Millionen Tonnen<br />
Stahl klimaneutral zu produzieren und<br />
so mehr als fünf Millionen Tonnen CO 2 -<br />
Emissionen pro Jahr einzusparen.<br />
Saar<strong>stahl</strong> will zwei Standorte von Liberty Steel<br />
in Frankreich übernehmen<br />
Zur Übernahme der beiden französischen Standorte Liberty Ascoval<br />
(in Saint-Saulve) und Liberty Rail Hayange (Hayange) hat Saar<strong>stahl</strong><br />
dem derzeitigen Eigentümer Liberty Steel ein Angebot unterbreitet.<br />
Das Vorhaben zielt darauf ab, das Schienengeschäft neu in<br />
die Unternehmens- und Industriestrategie von Saar<strong>stahl</strong> aufzunehmen,<br />
das Produktportfolio (Lichtbogenofen-Blöcke und -Schienen)<br />
zu erweitern und Zugang zu einer neuen Produktionstechnik<br />
(Elektro-Lichtbogenofen) zu erhalten. „Dieses Vorhaben gliedert<br />
sich nahtlos in die Strategie unserer saarländischen Gruppe ein, im<br />
Hinblick sowohl auf die Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit<br />
als auch die strukturelle Transformation“, so der Vorstandsvorsitzende<br />
von Saar<strong>stahl</strong> Dr. Karl-Ulrich Köhler. Nach erfolgter Integration<br />
soll Hayange einen Beitrag zur europäischen Strategie des<br />
ökologischen Wandels im Bereich Mobilität leisten. Saar<strong>stahl</strong> will<br />
dort qualitativ hochwertige Infrastrukturprodukte herstellen.<br />
Ascoval soll Dreh- und Angelpunkt für grünen Stahl werden.<br />
Messe Düsseldorf: Metallmessen-Quartett in Indien<br />
verschoben<br />
Die Messe Düsseldorf India hat entschieden, das Metallmessen-Quartett wire India, Tube India, METEC India und India Essen Cutting &<br />
Welding ins Jahr 2022 zu verschieben. Die Veranstaltungen, die ursprünglich für den 8. bis 10. September <strong>2021</strong> im Bombay Exhibition<br />
Centre in Mumbai geplant waren, finden jetzt vom 23. bis 25. November 2022 dort statt. Thomas Schlitt, Geschäftsführer der Messe<br />
Düsseldorf India, erklärt: „Unser Ziel ist es nach wie vor, den wirtschaftlichen Aufschwung zu unterstützen, indem wir mit unseren<br />
Messen eine führende Plattform für die sichere und effektive Abwicklung von Geschäften bieten.“ Doch die aktuelle Entwicklung der<br />
Pandemie lasse eine verlässliche Planung in Indien für die nächsten Monate nicht zu und mache es unmöglich, die Indian Metal Fair<br />
im September <strong>2021</strong> durchzuführen. Die Messe Düsseldorf India vertraue nun nach Angaben Schlitts darauf, „dass bis 2022 die globalen<br />
Reisebeschränkungen aufgehoben werden und wir angesichts der internationalen Ausrichtung des Metallmessenquartetts wieder<br />
eine große internationale Beteiligung sehen werden“. Nach der pandemiebedingten Absage der deutschen Ausgaben von wire und<br />
Tube 2020 in Düsseldorf richten die Organisatoren diese Veranstaltungen turnusgemäß ebenfalls im Jahr 2022 aus.<br />
Quellen: ArcelorMittal; Primetals Technologies; Alexander Kirch/www.shutterstock.com<br />
6 Juni <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Weiterer Ausbau der KI-Lösungen bei ArcelorMittal<br />
Bremen<br />
Der Bremer Stahlstandort von ArcelorMittal<br />
Bremen beauftragt erneut das KI-Unternehmen<br />
Smart Steel Technologies und<br />
erweitert damit die SST-Plattform um die<br />
Anwendung SST Rolling AI. Die Plattform<br />
wird live auf alle relevanten Datenquellen<br />
aus dem Warmwalzwerk erweitert. Sie<br />
dient dazu, das Warmwalzwerk durch<br />
automatische Überwachung, Vorhersage<br />
und Live-Empfehlungen zu optimieren.<br />
Mit dem Einsatz soll sich jeder Aspekt der<br />
Produktion fein abstimmen und jegliche<br />
Ineffizienz beseitigen lassen, so Smart<br />
Steel Technologies. ArcelorMittal Bremen<br />
profitiere durch den Einsatz der speziell<br />
für Stahlhersteller entwickelten KI-Datenplattform<br />
in kürzester Zeit von einer weiteren<br />
Qualitätssteigerung und Kostensenkung.<br />
Man habe gute Erfahrungen im<br />
ersten Projekt gesammelt und werde nun<br />
weitere Produkte in den Prozess zum Thema<br />
Produktqualität und Effizienzsteigerung<br />
im Bereich des Warmwalzwerkes<br />
integrieren, heißt es seitens ArcelorMittal<br />
Bremen. Vor Ort sind bereits die Softwareprodukte<br />
SST Casting AI und SST Surface<br />
AI im Einsatz.<br />
Primetals Technologies und NewFer bündeln Kräfte bei<br />
Pelletierung und Aufbereitung von Eisenerz<br />
Im April <strong>2021</strong> unterzeichneten Primetals<br />
Technologies und das deutsche,<br />
2019 gegründete Unternehmen NewFer<br />
eine Kooperationsvereinbarung für die<br />
gemeinsame Entwicklung und Implementierung<br />
von Pelletier- und Aufbereitungsanlagen<br />
für Eisenerz. Die Kooperation<br />
soll das weltweite Angebot<br />
von Primetals Technologies im Bereich<br />
der Pelletiertechnologie von Eisenerz<br />
mit dem Wanderrostverfahren ausweiten.<br />
Zudem sei die Kooperation für<br />
Primetals Technologies „äußerst hilfreich“,<br />
denn die Kompetenz im Anlagenbau<br />
ergänze sich „ausgezeichnet<br />
mit der Erfahrung und dem technischen<br />
Fachwissen der Spezialisten bei<br />
NewFer auf dem Gebiet der Eisenerz-<br />
Pelletierung“, so Friedemann Plaul,<br />
Senior Vice President Iron and Steelmaking<br />
und ECO Solutions bei Primetals<br />
Technologies. Der Anlagenbauer projektiert<br />
Pelletieranlagen mit dem Wanderrost-Verfahren<br />
in gerader und runder<br />
Bauart mit Kapazitäten von einer Million<br />
bis acht Millionen Tonnen pro Jahr.<br />
NewFer wird für Primetals Technologies<br />
verschiedene Unterstützungsleistungen<br />
für die Auslegung und Entwicklung von<br />
Pelletieranlagenprojekten erbringen,<br />
darunter die Rohstoffcharakterisierung<br />
und Chargenrostversuche, die Entwicklung<br />
der Prozesstechnik (wie Wärmeund<br />
Massenbilanzen und sonstige<br />
Hauptprozessparameter) sowie die Unterstützung<br />
bei der Konstruktion der<br />
Brennmaschine.<br />
Thomas Schwalm, Chief Technology Officer<br />
bei NewFer (rechts), und Hans-Jörg<br />
Baumgartner, Pelletier- Technologe bei<br />
Primetals Technologies, an der Primetals-Pelletierversuchsanlage<br />
in Leoben,<br />
Österreich<br />
JSW Steel erhebt Kartellvorwürfe gegen<br />
US-Stahlunternehmen<br />
Die US-Tochtergesellschaften des indischen<br />
Konzerns JSW Steel haben drei der<br />
größten US-Stahlerzeuger unlautere Handelspraktiken<br />
zur Last gelegt: Nucor, U.S.<br />
Steel sowie Cleveland Cliffs inklusive der<br />
jüngst übernommenen AK Steel Holding.<br />
Die Unternehmen sollen sich zu einem<br />
Boykott verschworen haben und sich seit<br />
über drei Jahren weigern, JSW Steel USA<br />
und JSW USA Steel Ohio mit Stahlbrammen<br />
– einem für die Betriebe essenziellen<br />
Vormaterial – zu beliefern. JSW gibt<br />
an, aufgrund des vermeintlichen Kartells<br />
„Gewinne von Hunderten Millionen US-<br />
Dollar“ eingebüßt zu haben. Zudem hätte<br />
der Boykott höhere Preise und somit<br />
erheblichen Schaden für Käufer verursacht<br />
sowie zahlreiche Arbeitsplätze gekostet.<br />
Parth Jindal, Vorstandsmitglied<br />
von JSW Steel USA sagt, die Angeklagten<br />
seien seit langem die dominierenden<br />
Stahlunternehmen in den USA und setzten<br />
wettbewerbswidrige Taktiken gegen<br />
kleinere Produzenten ein, um erfolgreich<br />
zu sein. „Wir haben uns vor ein paar Jahren<br />
in den US-Markt eingekauft und erhebliche<br />
Fortschritte bei der Verbesserung<br />
unserer Anlagen und Leistung gemacht.<br />
Im Jahr 2018 haben wir<br />
angekündigt, erhebliche Investitionen zu<br />
tätigen, um unsere Anlagen weiter auszubauen<br />
und zu verbessern. Diese Unternehmen<br />
haben diese Pläne entgl<strong>eisen</strong><br />
lassen, und deshalb reichen wir heute<br />
diese Klage ein, um selbstbewusst zu reagieren“,<br />
erklärte Jindal in einem Statement<br />
vom 8. Juni. Die Klage wurde am<br />
US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk<br />
von Texas eingereicht.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Juni <strong>2021</strong> 7
TITELTHEMA: AUTOMOTIVE<br />
Einführung<br />
Green Steel<br />
trifft<br />
E-Mobilität<br />
Die Automobil- und die Stahlbranche sind insbesondere<br />
in Deutschland zwei Vorzeigeindustrien– sie sind europaweit<br />
aber auch gemeinsame Treiber der Dekarbonisierung<br />
14 Juni <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Inlandsflüge mögen klimapolitisch unter Druck<br />
stehen, mit deutlich über 90% kommt der Großteil<br />
der CO 2 -Emissionen im Verkehr aber von der<br />
Straße. Von daher stehen in der Öffentlichkeit<br />
vor allem die Hersteller unter Druck, „saubere<br />
Lösungen“ anzubieten. Mit der Stahlbranche<br />
haben sie dabei einen Zulieferer, in der Erzeuger<br />
wie Anlagenbauer ebenfalls an jeder<br />
Stellschraube zur Optimierung drehen. Clevere<br />
Lösungen für die E-Mobilität gibt es dabei<br />
ebenso wie kleine Kooperationen und große<br />
Investments.<br />
Quelle: Smile Fight/www.shutterstock.com<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Juni <strong>2021</strong> 15
TITELTHEMA: AUTOMOTIVE<br />
Einführung<br />
Stahlerzeugern,<br />
Anlagenbauern und<br />
Kfz-Herstellern<br />
bieten sich zahlreiche<br />
Chancen, die<br />
Klimaziele beim<br />
Autbau zu erreichen.<br />
OEM erhöhen das Tempo zu der<br />
Dekarbonisierung<br />
Kfz-Hersteller drehen an allen Stellschrauben, um die Klimafreundlichkeit der Branche zu<br />
erhöhen – Unterstützung erhalten sie von Stahlerzeugern und Zulieferern<br />
AUTOR: Torsten Paßmann<br />
torsten.passmann@<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de<br />
DARUM GEHT’S: Die E-Mobilität ist auf<br />
dem Vormarsch: Unter den Neuzulassungen<br />
in Deutschland steigt der Anteil<br />
von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben<br />
enorm. Das bringt für Automobilhersteller<br />
einen grundlegenden Wandel<br />
mit sich, der sich auch in der gesamten<br />
Zulieferkette bemerkbar macht. Die Perspektiven<br />
für Stahlerzeuger sind dabei<br />
grundsätzlich gut.<br />
Mit Abschluss des Jahres 2019<br />
konnte die Führungsspitze von<br />
Volkswagen noch über die globale<br />
Pole Position jubeln: Gut 10,7 Millionen<br />
Fahrzeuge setzten die Wolfsburger<br />
ab. Toyota als Nummer 2 lag bei 10,55<br />
Millionen und Börsenheld Tesla weit abgeschlagen<br />
bei unter 400 000 Stück. Im<br />
vergangenen Jahr verlief das Geschäft weniger<br />
erfreulich bei VW. Der Absatz sank<br />
um 16,4 % auf gut 9,3 Millionen Fahrzeuge,<br />
der Umsatz fiel um 11,8 % und der<br />
Gewinn brach um 37,1 % auf 8,8 Mrd.<br />
Euro ein. Toyota wurde wieder die Nummer<br />
1 und Tesla ist zwar mit rund 500 000<br />
verkauften Fahrzeugen immer noch ein<br />
Absatzzwerg, steigerte aber die Verkäufe<br />
und hat mit Stand Mitte Juni eine Marktkapitalisierung<br />
von 600 Mrd. USD, während<br />
der Gigant Volkswagen lediglich bei<br />
130 Mrd. Euro liegt. Die Differenz ist dahingehend<br />
von Bedeutung, weil an den<br />
Börsen vergangene Erfolge irrelevant sind<br />
und die Gegenwart nur bedingt eine Rolle<br />
spielt – es zählt allein die Zukunftsperspektive.<br />
Und da hat Tesla als ein Wegbereiter<br />
ansehnlicher, attraktiver und noch<br />
bezahlbarer Elektromobilität einen gewissen<br />
Vorsprung. Auch die Politik stützt<br />
diese Entwicklung.<br />
Politischer Druck<br />
Zwar ist das augenscheinlich noch weit<br />
entfernte Jahr 2050 erst das große Ziel zur<br />
Erreichung der Klimaschutzpläne, aber<br />
Politiker in Deutschland und anderen Ländern<br />
sind in eine Art Überbietungswettbewerb<br />
eingestiegen. Hierzulande wurde<br />
erst Anfang Mai das „Klimaziel für 2030“<br />
von 55 auf 65 Prozent Treibhausgasminderung<br />
gegenüber 1990 angehoben. Zehn<br />
Jahre später sollen es schon 88 Prozent<br />
Minderung sein und die Klimaneutralität<br />
wird bis 2045 angestrebt. Die Stahlbranche<br />
ist entsprechend mehrfach betroffen – sie<br />
muss ihre Emissionen für sich selbst im<br />
Griff haben (Scope 1), als auch gegenüber<br />
den Abnehmerindustrien wie den Automobilisten<br />
(Scope 3), um weiter den wichtigsten<br />
Grundstoff liefern zu können.<br />
Kleine und große Maßnahmen<br />
im VW-Konzern<br />
Die Autobauer drehen entsprechend an<br />
Stellschrauben, um die Umwelt- und Klimafreundlichkeit<br />
kurzfristig zu optimieren<br />
wie auch nachhaltig sicherzustellen. So hat<br />
allein Volkswagen im vergangenen Jahr<br />
rund 2,7 Mrd. Euro in Zukunftstechnologien<br />
investiert und will die Summe im Jahr<br />
2025 auf 16 Mrd. Euro steigern. Im laufenden<br />
Jahr soll der Absatz von E-Autos über<br />
450 000 Exemplare betragen, was konzernintern<br />
zwar gerade einmal (gerundet) 5 Prozent<br />
entspricht, aber den Abstand auf Tesla<br />
sichtbar verringert. Neben dem Ausbau der<br />
Elektromobilität gehört zu den Maßnahmen<br />
auf dem Weg zur bilanziell CO 2 -neutralen<br />
Produktion (VW nennt das „Way to<br />
Zero“) beispielsweise eine hochmoderne<br />
XL-Presse von Schuler, die bis zu 9 000 Lkw-<br />
Fahrten jährlich einsparen soll (siehe Seite<br />
18). Ähnlich sieht es bei der Konzernschwester<br />
Audi aus. Die Marke mit den vier Ringen<br />
hat Mitte Juni erst bekanntgegeben, dass<br />
bereits 2026 das letzte klassische Verbrennermodell<br />
auf den Markt kommen soll.<br />
Angesichts der Investitionszyklen der Branche<br />
ist das der nächstmögliche Zeitpunkt,<br />
um den Wechsel anzugehen. Produktion<br />
und Abverkauf sollen aber noch länger dauern,<br />
derzeit bis 2033, und Geld in die Kassen<br />
bringen. Schon jetzt haben die Ingolstädter<br />
Quellen: SMS group; Mahle<br />
16 Juni <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
aber mit dem Produktionsstart des Modells<br />
Q6 e-tron eine andere kleine Maßnahme<br />
umgesetzt. Mit dem Einsatz der zweiten<br />
Generation der Stahlcoilbeölung Prelube II<br />
soll die Ressourceneffizienz steigen (siehe<br />
Seite 19).<br />
Kooperationen zwischen OEM<br />
und Erzeugern<br />
Volvos elektrische Schwestermarke Polestar<br />
will bis 2030 ein komplett klimaneutrales<br />
Auto auf den Markt bringen – nicht nur<br />
eine Studie, sondern ein Serienmodell. Fredrika<br />
Klarén, Nachhaltigkeitsmanagerin<br />
der Marke, kann zwar weder zum geplanten<br />
Modell noch zur avisierten Vorgehensweise<br />
konkrete Angaben machen, legt aber<br />
immerhin offen, dass Polestar dabei die<br />
Lieferkette im Blick hat. Die „große<br />
Schwester“ Volvo kommuniziert schon offener,<br />
sie setzt auf fossilfreien Stahl aus der<br />
Hybrit-Initiative (siehe Seite 21). Der deutsche<br />
Premiumanbieter Mercedes-Benz<br />
blickt in der Lieferkette ebenfalls nach<br />
Norden: Die schwäbischen Autobauer investieren<br />
in das schwedische Start-up H2<br />
Green Steel, um die Entwicklung von und<br />
Versorgung mit „grünem Stahl“ sicherzustellen<br />
(siehe Seite 20). Dazu kommen natürlich<br />
noch die Bestrebungen aller anderen<br />
Stahlkonzerne, die Erzeugung innerhalb<br />
der Zeitfenster und wirtschaftlich<br />
tragbar umzustellen. Neben dem „großen<br />
Rad“ drehen die Gesellschaften aber auch<br />
so manches „kleine Rad“, um mit eigenen<br />
Entwicklungen ein relevanter Ansprechpartner<br />
zu bleiben. Ein Beispiel ist thyssenkrupp<br />
Steel Europe mit dem Sandwich-<br />
Werkstoff „bondal“ (Seite 22). Der Verbundwerkstoff<br />
mindert die Geräusche im<br />
E-Auto deutlich.<br />
Individuelle Rohre und<br />
3D-Druck-Lösungen für<br />
klimaneutrale Mobilität<br />
Der Wandel bei den Neuzulassungen hin zu<br />
einem immer stärkeren Anteil an Elektrofahrzeugen<br />
(siehe Kasten) macht sich nicht<br />
nur bei den Herstellern, sondern in der ganzen<br />
Zulieferkette der Automobilindustrie<br />
bemerkbar. Eine große Rolle spielt dabei der<br />
Leichtbau: Denn mit dem Gewicht sinkt der<br />
Energiebedarf und die Reichweite steigt.<br />
Der Rohrbiegemaschinenhersteller Schwarze-Robitec<br />
mit Sitz in Köln beobachtet außerdem<br />
einen deutlichen Zuwachs an Aufträgen,<br />
bei denen kein typisches, rundes<br />
Rohr mehr gebogen werden soll. Stattdessen<br />
verlangt die Leichtbauweise nach zunehmend<br />
komplexen, unsymmetrischen<br />
Formen mit vielgestaltigen Querschnitten.<br />
Mit dem Wandel hin zur E-Mobilität weicht<br />
Mit seinem neuen Center für additive Fertigungsverfahren widmet sich der<br />
Automobilzulieferer Mahle dem 3D-Druck als Schlüsseltechnologie für die schnelle<br />
Entwicklung von klimaneutralen Antrieben.<br />
die traditionelle Standard-Rohrbiegemaschine<br />
mit starr vorgegebenen Leistungsparametern<br />
immer mehr der kundenspezifisch<br />
konfigurierbaren, produktabhängigen Spezialmaschine.<br />
Eine andere Lösung bietet der<br />
Automobilzulieferer Mahle an, der ein neuen<br />
Center für additive Fertigungsverfahren<br />
eröffnet hat. Bei komplexen Bauteilen will<br />
das Unternehmen so künftig die Fertigung<br />
von Prototypen von mehreren Monaten auf<br />
wenige Tage verkürzen. Dadurch beschleunige<br />
sich nach eigenen Angaben auch die<br />
Entwicklung klimaneutraler Antriebe, beispielsweise<br />
für die E-Mobilität. Besonders<br />
für die Bereiche Thermomanagement, Mechatronik<br />
und Elektronik sollen künftig<br />
Fertigungsprozesse entwickelt und für die<br />
spätere Serienproduktion qualifiziert werden.<br />
Chancen am Ende des<br />
Produktlebenszyklus<br />
In der komplexen Gemengelage rund um<br />
die Dekarbonisierung gibt es auch Chancen<br />
am Ende des Produktlebenszyklus, wie die<br />
SMS group zeigt. In der Stahl- und NE-Metallindustrie<br />
hat der Anlagenbauer bekanntlich<br />
schon einen guten Ruf, nun will<br />
er diesen mit dem Joint-Venture Primobius<br />
in neue Felder ausdehnen. Konkret: Mit<br />
Neometals aus Australien als Partner soll<br />
Primobius eine neue umweltfreundliche<br />
Elektro auf dem Vormarsch<br />
Recyclingtechnologie auf dem Markt für<br />
Lithium-Ionen-Batterien (LIB) etablieren.<br />
Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen<br />
vor kurzem eine Absichtserklärung<br />
mit einer Tochtergesellschaft des<br />
Stahlunternehmens Stelco Holdings unterzeichnet.<br />
Stelco Inc. plant Kooperationen<br />
mit verschiedenen großen Automobilherstellern<br />
im Bereich Recycling von Altautos<br />
und der Rückgewinnung von Wertstoffen.<br />
Diese sollen in den Produktionskreislauf<br />
zurückgeführt oder auf dem Markt verkauft<br />
werden. Das Primobius-Verfahren<br />
ermöglicht hierfür ein nachhaltiges Recycling<br />
im industriellen Maßstab, über das<br />
der CO 2 -Fußabdruck sowohl von Automobilbauern<br />
als auch von Batteriezellenherstellern<br />
deutlich verringert werden kann.<br />
Fazit und Ausblick<br />
Grundsätzlich stehen alle Branchen unter<br />
Druck, fristgerecht – und trotz unerwarteter<br />
Verschärfungen – die sogenannten Klimaziele<br />
zu erreichen. Losgelöst von den<br />
politischen Rahmenbedingungen sind die<br />
Perspektiven in der Automobilindustrie<br />
und damit für die Stahlbranche als zentraler<br />
Lieferant aber gut: Der Antrieb mag<br />
sich ändern, Stahl bleibt die Grundlage der<br />
Fahrzeuge und derzeit wird an allen Stellschrauben<br />
gedreht, dass „grüne Pkw“ eine<br />
Zukunft haben.<br />
Im Jahr 2020 sanken die Zulassungszahlen um 19,1 Prozent auf 2,9 Mio. Pkw und der<br />
Anteil der Verbrenner sank kumuliert auf 74,8 %. Noch im Jahr 2019 waren mehr als<br />
90 % der in Deutschland neu zugelassenen Pkw diesel- oder benzinbetrieben. Entsprechend<br />
positiv sind die Zahlen auf der Gegenseite. Die Anzahl neu zugelassener<br />
Elektro-Pkw stieg um 2<strong>06</strong>,8 % bzw. 4,9 Prozentpunkte auf 6,7 %. Noch höher waren die<br />
Zuwächse bei den Pkw mit Plug-in-Hybrid mit +342,1 % (jetzt rund 6,9 %Anteil). Verdoppelt<br />
hat sich der Anteil der Pkw mit Hybridantrieb (ohne Plug-in) auf 11,2 %.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Juni <strong>2021</strong> 17
POLITIK<br />
MÄRKTE<br />
Förderpolitik<br />
Mit Wasserstoff zur klimaneutralen<br />
Stahlproduktion<br />
BMWi und BMVI bringen Wasserstoff-Großprojekte auf den Weg<br />
AUTOR: Niklas Reiprich<br />
niklas.reiprich@<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de<br />
DARUM GEHT’S: Mithilfe von Wasserstoff<br />
soll die Stahlindustrie künftig CO 2 -<br />
neutral werden. Zahlreiche Großprojekte<br />
in der Branche, innerhalb derer die<br />
Technologie derzeit erprobt wird, will<br />
die Bundesregierung nun finanziell unterstützen.<br />
Unser Überblick liefert die<br />
wesentlichen Informationen über jene<br />
Stahlunternehmen, deren Forschungsund<br />
Entwicklungsarbeit im Rahmen der<br />
Fördermaßnahme berücksichtigt wird.<br />
Das Bundeswirtschaftsministerium<br />
(BMWi) und das Bundesverkehrsministerium<br />
(BMVI) haben insgesamt 62<br />
Großprojekte ausgewählt, die im Rahmen<br />
eines gemeinsamen Wasserstoffprojekts –<br />
den sogenannten „Important Projects of<br />
Common European Interest (IPCEI)“ – staatlich<br />
gefördert werden sollen. Die Initiative<br />
gilt damit auch als eine wichtige Maßnahme<br />
bei der Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie,<br />
die Deutschland international<br />
zu einem Vorreiter bei dem grünen Energieträger<br />
machen will. „Wir wollen bei Wasserstofftechnologien<br />
die Nummer 1 in der Welt<br />
werden. Dafür bündeln wir unsere Kräfte in<br />
Europa und stoßen durch das erste gemeinsame<br />
europäische Wasserstoffprojekt massive<br />
Investitionen in die Zukunftstechnologie<br />
Wasserstoff an“, erklärt Bundeswirtschaftsminister<br />
Peter Altmaier (CDU). Das sichere<br />
Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze, in<br />
Deutschland wie auch Europa.<br />
Investitionen in Höhe von<br />
33 Milliarden Euro<br />
Für die nun ausgewählten Projekte, die von<br />
der Wasserstofferzeugung, über den Transport<br />
bis hin zu Anwendungen in der Industrie<br />
reichen, wollen die Bundesbehörden<br />
über 8 Milliarden Euro an staatlichen Fördermitteln<br />
zur Verfügung stellen. Rund 4,4<br />
Milliarden Euro kommen dabei aus dem<br />
BMWi, bis zu 1,4 Milliarden Euro steuert das<br />
BMVI bei. Die Vergabe der übrigen Fördermittel,<br />
so heißt es in einer ersten Veröffentlichung,<br />
wird dann auf Länderebene verteilt.<br />
Insgesamt sollen sogar Investitionen in<br />
Höhe von 33 Milliarden Euro ausgelöst werden,<br />
wovon über 20 Milliarden Euro von<br />
privaten Investoren kommen sollen.<br />
„Wir machen damit einen großen<br />
Schritt auf dem Weg hin zur Klimaneutralität<br />
unserer Wirtschaft, betont Altmaier.<br />
Einen zentralen Anwendungsbereich sieht<br />
der Minister in der Stahlindustrie, wo<br />
durch den Einsatz von Wasserstoff mehrere<br />
Millionen Tonnen CO 2 eingespart werden<br />
können. Mit Blick auf den Stahlstandort<br />
Deutschland sei dies „ein wichtiges<br />
Signal für die Transformation in Richtung<br />
grüner Produktionsverfahren“, findet auch<br />
Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung<br />
Stahl. Die Anschubförderung<br />
von wasserstoffbasierten Verfahren<br />
zur Produktion von klimaneutralem<br />
Stahl im Rahmen der IPCEI sei ein<br />
wichtiger Schritt, damit bereits bis 2030<br />
substanzielle CO 2 -Reduktionen erzielt werden<br />
können. Allein, wo konkret werden die<br />
Technologien entwickelt, mit denen dieses<br />
ambitionierte Ziel erreicht werden soll?<br />
1. ArcelorMittal<br />
Bereits im März 2019 hat ArcelorMittal seine<br />
Arbeit an dem Projekt „H2 aus Hamburg<br />
(H2H)“ bekanntgeben. Dabei will der Stahlhersteller<br />
erstmals Wasserstoff großtechnisch<br />
einsetzen, um direktreduziertes Eisenerz<br />
(DRI) für den Produktionsprozess zu<br />
erzeugen. Zu diesem Zweck plant das Unternehmen,<br />
eine weitere Direktreduktionsanlage<br />
in seinem Hamburger Werk zu bauen,<br />
die mit grünem Wasserstoff betrieben werden<br />
soll. Das Investitionsvolumen liegt nach<br />
eigenen Angaben bei 110 Millionen Euro.<br />
Der Bau der neuen DRI-Anlage soll noch<br />
in diesem Jahr beginnen. Zunächst will<br />
ArcelorMittal in der ersten Ausbaustufe<br />
100 000 Tonnen Eisenschwamm mit grauem<br />
Wasserstoff (abgespalten aus Prozessgasen<br />
auf Basis von Erdgas) am Standort in<br />
Hamburg-Waltershof herstellen. In der<br />
zweiten Stufe soll die Demonstrationsanlage<br />
dann mit einer 50 MW Elektrolyseeinheit<br />
dazu beitragen, voraussichtlich 2025<br />
grünen Stahl mit Wasserstoff aus erneuerbaren<br />
Energiequellen zu erzeugen. Mittelfristig<br />
strebt das Unternehmen durch den<br />
Aufbau weiterer Elektrolysekapazitäten<br />
den vollständig klimaneutralen Betrieb der<br />
Anlage in Hamburg an.<br />
Transformationskonzept für<br />
Bremen und Eisenhüttenstadt<br />
Auch am Standort Bremen beabsichtigt ArcelorMittal,<br />
die CO 2- Emissionen zu reduzieren<br />
– zunächst durch das Einsp<strong>eisen</strong> von<br />
Erdgas in den Hochofen. Anschließend, so<br />
lautet der Plan, will das Unternehmen dann<br />
Wasserstoff verwenden, zu dessen klimaneutraler<br />
Produktion ein Elektrolyseur mit<br />
einer anfänglichen Kapazität von 100 und<br />
später 300 MW beitragen soll. In Kombination<br />
dazu soll zunächst eine elektrische<br />
Schrottschmelz-Anlage integriert werden,<br />
um die CO 2 -Emissionen durch die Erhöhung<br />
des Schrottanteils im Roh<strong>eisen</strong> weiter zu<br />
senken. In der finalen Ausbaustufe zum Erreichen<br />
der klimaneutralen Stahlherstellung<br />
soll ein Elektrolichtbogenofen mit Schrotteinsatz<br />
gemeinsam mit Smart-Carbon-Technologien<br />
im Hochofen zum Einsatz kommen.<br />
Alternativ will ArcelorMittal den Hochofen<br />
in der finalen Ausbaustufe ab 2030 vom<br />
Elektrolichtbogenofen mit Schrotteinsatz<br />
und grün erzeugtem DRI ablösen. Ein ähnliches<br />
Transformationskonzept strebt der<br />
Konzern in seinem zweiten deutschen Flach<strong>stahl</strong>werk<br />
in Eisenhüttenstadt an.<br />
Mit der Umsetzung der drei Projekte<br />
will ArcelorMittal bis 2030 bereits mehr<br />
als 6 Millionen Tonnen CO 2 jährlich einsparen.<br />
„Wir begrüßen den Entschluss der<br />
Bundesregierung sehr, unsere innovativen<br />
Projekte zu unterstützen. Als Technologieführer<br />
für klimaneutrale Stahlherstellung<br />
leisten wir mit unseren Vorhaben in Bremen,<br />
Eisenhüttenstadt und Hamburg einen<br />
wichtigen Beitrag dazu, die CO 2 -Emissionen<br />
in unseren deutschen Werken bereits<br />
vor 2030 deutlich zu senken. Die<br />
Förderung unserer wasserstoffbasierten<br />
Verfahren zur Produktion von klimaneutralem<br />
Stahl ist dabei entscheidend“, sagt<br />
Geert Van Poelvoorde, CEO von ArcelorMittal<br />
Europe. Im nächsten Schritt benötige<br />
das Unternehmen die Genehmigung der<br />
EU, damit die Investitionen getätigt werden<br />
können. Mit der finalen Entscheidung<br />
sei bis Anfang 2022 zu rechnen.<br />
2. Stahl-Holding-Saar<br />
Eine gemeinsame Projektidee zur Etablierung<br />
einer grünen Wasserstoffwirtschaft<br />
hat zudem die SHS – Stahl-Holding-Saar<br />
Quelle: Shutterstock; Creos<br />
24 Juni <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Die SHS – Stahl-Holding-Saar hat mit STEAG, Siemens Energy,<br />
Creos und der Saarbahn eine gemeinsame Projektidee entwickelt<br />
Im Mittelpunkt steht die Etablierung einer grenzübergreifenden und perspektivisch grünen Wasserstoffwirtschaft.<br />
(Dillinger und Saar<strong>stahl</strong>) gemeinsam mit<br />
STEAG, Siemens Energy, Creos und der<br />
Saarbahn entwickelt. Das Konsortium verfolgt<br />
einen kollektiven Ansatz mit dem<br />
Planungsziel, das Saarland als Wasserstoffmodellregion<br />
zu etablieren. Die unterschiedlichen<br />
Teilprojekte sollen dabei in<br />
ihrer Gesamtheit einen nachhaltigen Transformationsprozess<br />
sowohl in der Industrie<br />
als auch im Mobilitätssektor anstoßen. Die<br />
saarländische Stahlindustrie mit den Unternehmen<br />
Dillinger und Saar<strong>stahl</strong> als industrieller<br />
Abnehmer nimmt auf diesem Weg<br />
eine Schlüsselrolle ein. Im Rahmen des<br />
Projektes „H2SYNgas“ wird derzeit eine<br />
Technologie an einem Hochofen der Rogesa<br />
Roh<strong>eisen</strong>gesellschaft Saar, einer gemeinsamen<br />
Tochter der beiden lokalen Stahlerzeuger,<br />
entwickelt, welche die Nutzung von<br />
eigenen Prozessgasen und darüber hinaus<br />
von erheblichen Wasserstoffmengen für<br />
den Hochofenprozess ermöglichen soll.<br />
Konkret handelt es sich bei der zu erprobenden<br />
Technologie um die von Paul<br />
Wurth entwickelte Trockenreformierung.<br />
Dafür wird ein aus eigenen Prozessgasen<br />
erzeugtes Synthesegas mit Wasserstoff angereichert,<br />
welches Rogesa dann als Reduktionsmittel<br />
für die Reduktion der Eisenerze<br />
einsetzen will. Auf diese Weise wird Koks<br />
im Hochofenprozess ersetzt und damit CO 2 -<br />
Emissionen vermieden. „Der Einsatz von<br />
Prozessgasen für metallurgische Zwecke<br />
ermöglicht eine Reduzierung der CO 2- -Emissionen<br />
um bis zu 12 Prozent“, erklärt Dr.<br />
Karl-Ulrich Köhler, Vorstandsvorsitzender<br />
von Dillinger und Saar<strong>stahl</strong>. „Unter Verwendung<br />
von Wasserstoff können wir das<br />
CO 2 -Einsparpotential weiter verbessern und<br />
sogar nahezu verdoppeln. Die Schaffung<br />
einer ausreichenden Energieinfrastruktur<br />
ist hierfür Voraussetzung“, ergänzt er.<br />
3. Salzgitter<br />
Ebenso als Zusammenschluss wollen sieben<br />
Unternehmen aus der Initiative „GETH2“<br />
zeigen, wie rasant sich die Planung der nationalen<br />
und europäischen Wasserstoffwirtschaft<br />
entwickelt. Konkret haben sich BP,<br />
Evonik, Nowega, OGE, RWE, Salzgitter<br />
Flach<strong>stahl</strong> und Thyssengas zusammengetan,<br />
um eine grenzüberschreitende Infrastruktur<br />
für Wasserstoff aufzubauen – angefangen<br />
bei der Erzeugung über den Transport<br />
bis hin zur industriellen Nutzung.<br />
In dem geplanten Szenario erzeugt RWE<br />
im emsländischen Lingen über eine Elektrolyse<br />
grünen Wasserstoff, der ab 2024 die<br />
bp Raffinerie in Gelsenkirchen versorgt.<br />
Der Transport erfolgt größtenteils über<br />
bestehende Leitungen des Gasnetzes, die<br />
auf Wasserstofftransport umgestellt werden.<br />
2025 ist die Erweiterung des Netzes<br />
bis zur niederländischen Grenze geplant,<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Juni <strong>2021</strong> 25
POLITIK<br />
MÄRKTE<br />
Logistik<br />
Aumund Hot DRI-Förderer für<br />
250 t/h in Hadeed, Saudi-Arabien<br />
THEMA<br />
LOGISTIK<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
Logistik für HBI und DRI<br />
Technologie für den Heißtransport und die Kühlung von<br />
Direktreduktionsprodukten<br />
AUTOREN: Matthias Moritz, Frank<br />
Reddemann, Aumund Fördertechnik.<br />
www.aumund.com<br />
DARUM GEHT’S: Als weltweiter Zulieferer<br />
für Spezial-Fördertechnik in metallurgischen<br />
Prozessen der Eisen- und<br />
Nicht-Eisen-Hüttenindustrie ist Aumund<br />
Fördertechnik ein Ansprechpartner,<br />
wenn es um Lösungen für das Handling<br />
von heißen, abrasiven und chemisch reaktiven<br />
Schüttgütern geht. Aus der Innensicht<br />
berichten die Autoren, wie sich<br />
das Unternehmen durch den marktgetriebenen<br />
Innovationsdruck im Zuge<br />
strenger energiewirtschaftlicher und<br />
ökologischer Vorgaben in der Stahlindustrie<br />
durch zahlreiche Patente zu einem<br />
Technologieführer für Logistik im<br />
Stahlwerk entwickelt hat.<br />
Die Herstellung von Stahl zeichnet<br />
für rund 7 Prozent der weltweiten<br />
CO 2 -Emssionen verantwortlich. Davon<br />
entfällt ein großer Teil auf die Stahlherstellung<br />
über Eisenerz. Im Fokus stehen<br />
vor allem China, Indien, Japan, Südkorea<br />
und Russland sowie die EU-Länder, die<br />
2018 zusammen 90 Prozent der globalen<br />
CO 2 -Emssionen der Stahlherstellung mit<br />
Kokskohle verursacht haben. Der klimapolitische<br />
und energiewirtschaftliche<br />
Druck auf die Stahlindustrie wächst immer<br />
weiter, und der Trend zur Dekarbonisierung<br />
steigt. An der Entwicklung CO 2 -armer<br />
Produktionsverfahren – wie zum Beispiel<br />
der Ersatz von Kohle durch Strom oder<br />
Wasserstoff sowie die CO 2 -Abscheidung<br />
und -Speicherung bzw. -Verwendung –<br />
Quellen: Aumund<br />
28 Juni <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
wird intensiv gearbeitet. Bereits seit Anfang<br />
der 2000er-Jahre hat sich die Direktreduktion<br />
als großtechnisch verfügbare<br />
Alternative zum klassischen Hochofenverfahren<br />
bewährt. Bei der Direktreduktion<br />
durch Erdgas wird Roh<strong>eisen</strong> aus Eisenerzpellets<br />
gewonnen. Dabei entstehen je nach<br />
Technologie die Produkte DRI (Direct Reduced<br />
Iron) und HBI (Hot Briquetted Iron).<br />
Für das Transportieren – also das Abkühlen<br />
und Chargieren – dieser Produkte im<br />
Herstellungsprozess bieten sich den Betreibern<br />
von Direktreduktionsanlagen sehr<br />
innovative Lösungen. Die weltweite Roh<strong>stahl</strong>produktion<br />
belief sich 2020 auf 1,864<br />
Mrd. t. Dabei betrug der Anteil an Roh<strong>stahl</strong><br />
aus der Direktreduktionstechnologie rund<br />
110 Mio. t bzw. 6 Prozent bei steigender<br />
Tendenz. Bei den Direktreduktionsprodukten<br />
hat DRI einen Anteil von rund 5 Prozent,<br />
1 Prozent entfällt auf HBI.<br />
Erhebliche Produktionssteigerungen<br />
möglich<br />
Anders als bei der klassischen Hochofenroute<br />
mit der Stahlerzeugung im Konverter<br />
kommt bei der Direktreduktion der Elektrolichtbogenofen<br />
zum Einsatz (DR-EAF-Route),<br />
der sowohl DRI als auch HBI verwerten<br />
kann. Bei den eingesetzten Direktreduktionsverfahren<br />
hat sich seit den 1970er-Jahren<br />
die Technologie von Midrex, USA, etabliert.<br />
Dabei werden die Pellets erhitzt und<br />
mit Methan durchgast. Der Sauerstoff wird<br />
reduziert und es entsteht Roh<strong>eisen</strong> in Form<br />
von Eisenschwamm, der in diesem Fall als<br />
DRI bezeichnet wird, und zu qualitativ<br />
hochwertigem und sehr wettbewerbsfähigem<br />
Stahl weiterverarbeitet werden kann.<br />
Einen wichtigen Beitrag dazu leistet die<br />
direkte Verbindung von der Direktreduktionsanlage<br />
zum EAF durch kontinuierliches<br />
Beschicken mit einem Heißgutförderer,<br />
wodurch erhebliche Produktionssteigerungen<br />
und Energieeinsparungen erreicht<br />
werden. Bei der Aumund Hot DRI-Chargierung<br />
wird das heiße DRI vom Midrex-Direktreduktionsschachtofen<br />
durch ein Aumund-Becherzellenband<br />
unter Wärmeisolation<br />
und Inert-Bedingungen direkt in das<br />
Stahlwerk zum EAF transportiert.<br />
Die Herausforderung beim<br />
Hot DRI-Transport<br />
Die wesentlichen Vorteile der Heißchargierung<br />
von DRI in den Lichtbogenofen sind<br />
reduzierter Energieverbrauch und verkürzte<br />
Abstichsequenzen. Temperaturverluste<br />
bei zu transportierenden heißen Materialien<br />
werden am häufigsten an den Transferstellen,<br />
bei der Aufgabe an die Förderanlagen<br />
sowie bei der Materialübergabe an<br />
die Zwischenbehälter zum Schwalltopf<br />
HDRI-Chargieren<br />
Unter gasdichten Bedingungen<br />
Mit dem Aumund-Becherzellenband Typ BZB-HI (HI = für heißes Material in<br />
gasdichter Atmosphäre)<br />
Transport und Kühlung von HBI<br />
und Schmelzgefäß verursacht, jedoch<br />
nicht während des eigentlichen Transportes.<br />
Bei der traditionellen Anwendung mit<br />
großen Körben oder Pfannen gibt es verschiedene<br />
Quellen für den Temperaturverlust:<br />
Die Körbe oder Pfannen werden ohne<br />
Deckel manövriert, was eine erhebliche<br />
Hitzeausstrahlung über die Oberfläche verursacht.<br />
Auch bei der konventionellen<br />
Ofenchargierung durch Öffnen und<br />
Schwenken des Ofendeckels entstehen<br />
hohe Wärmeverluste. Zusätzlich entstehen<br />
Zeitverluste während Öffnungs- und<br />
Schließvorgängen, die zu Lasten des metallurgischen<br />
Betriebs bzw. der Energiezufuhr<br />
gehen. Die Herausforderung beim Transport<br />
von heißem DRI ist nicht nur, dass das<br />
Material heiß ist, sondern, dass in jedem<br />
Zustand ein Kontakt mit der umgebenden<br />
Luft vermieden und deshalb mit Schutzgas<br />
unter inerten Bedingungen gefördert werden<br />
muss.<br />
Abhängig von der Anlagengeometrie,<br />
der Förderlänge und der Förderleistung,<br />
bietet die mechanische Förderung von<br />
heißem Material die adäquateste Lösung<br />
für moderne Anwendungen. Pneumatische<br />
Transportsysteme sind zwar für klei-<br />
Auf einem Aumund-Flachplattenband wird das HBI mit einem Wassernebel<br />
besprüht und produktschonend zum Beispiel von 800 auf 100 °C heruntergekühlt<br />
(HBI-Slow-Cooling).<br />
Grafik: Aumund<br />
Grafik: Aumund<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Juni <strong>2021</strong> 29
POLITIK<br />
MÄRKTE<br />
Länder<br />
Anlagen<br />
4<br />
<br />
Aktueller BOF-Konverter Nr. 2 bei ArcelorMittal Zenica<br />
BOSNIEN UND<br />
HERZEGOWINA<br />
ArcelorMittal Zenica<br />
beauftragt Primetals<br />
Technologies<br />
Der bosnische Stahlerzeuger<br />
ArcelorMittal Zenica hat Primetals<br />
Technologies damit beauftragt,<br />
das Gefäß des BOF-<br />
Konverters Nr. 2 zu ersetzen<br />
und die dazugehörige Ausrüstung<br />
zu liefern. Der Gefäßmantel<br />
und der Tragring des<br />
alten BOF-Konverters Nr. 2<br />
hatten das Ende ihrer Lebensdauer<br />
erreicht, heißt es seitens<br />
Primetals. Bei dem neuen<br />
Aggregat mit 125 Tonnen Kapazität<br />
ist das Unternehmen<br />
für Engineering, Fertigung,<br />
Projektmanagement und Qualitätssicherung<br />
verantwortlich.<br />
Zum Lieferumfang gehören<br />
das BOF-Gefäß, der Tragring,<br />
das wartungsfreie<br />
Aufhängungssystem Vaicon<br />
Link 2.0, Lager und Gehäuse<br />
sowie die Kupplung des Kippantriebs.<br />
Die Ausmauerungsmaschine<br />
und die Vorrichtung<br />
zum Bodenwechsel werden<br />
modifiziert. Außerdem übernimmt<br />
Primetals den Transport<br />
zum vereinbarten Bestimmungsort,<br />
die Schulung<br />
vor Ort und Beratungsleistungen<br />
für die Errichtung und Inbetriebnahme<br />
(sowohl Kaltals<br />
auch Heißinbetriebnahme).<br />
Die Maßnahme wird in<br />
einem offenen Konsortium<br />
mit dem serbischen Unternehmen<br />
GrappS als Montagepartner<br />
durchgeführt. Dieser<br />
ist verantwortlich für die Zerlegung<br />
des aktuellen Konverters,<br />
die Vormontage der neuen<br />
Ausrüstung und die Montage.<br />
Planmäßig wollen die<br />
Partner den neuen Konverter<br />
bis Ende 2022 in Betrieb nehmen.<br />
ArcelorMittal Zenica ist<br />
nach eigenen Angaben der<br />
größte Hersteller von Lang<strong>stahl</strong>produkten<br />
auf dem Balkan<br />
mit einer Produktionskapazität<br />
von nahezu einer Million<br />
Tonnen pro Jahr.<br />
2<br />
CHINA<br />
Panzhihua Steel &<br />
Vanadium baut Warmbreitbandstraße<br />
um<br />
Der chinesische Stahlerzeuger<br />
Panzhihua Steel & Vanadium<br />
hat die SMS group mit einer<br />
umfangreichen Modernisierung<br />
seiner 1 450-mm-Warmbreitbandstraße<br />
(HSM) beauftragt.<br />
Im Lieferumfang der<br />
SMS group enthalten sind<br />
eine Fertigstraße, eine Laminarkühlung<br />
und eine Haspelgruppe,<br />
die jeweils vollständig<br />
erneuert werden. Die SMS liefert<br />
dafür das Engineering<br />
und die Kernkomponenten.<br />
Hinter die existierende Fertigstraße<br />
wird eine komplett<br />
neue Fertigstaffel mit sieben<br />
Walzgerüsten installiert. Diese<br />
sind mit hydraulischen Anstellungen,<br />
hydraulischen<br />
Schlingenhebern sowie CVC<br />
plus-Biege- und Verschiebesystemen<br />
ausgestattet (Continuously<br />
Variable Crown). Ebenfalls<br />
Bestandteil der Lieferung<br />
ist das X-Pact Profile, Contour<br />
and Flatness Prozessmodell<br />
(PCFC). Dies ermöglicht das<br />
Walzen von qualitativ hochwertigen<br />
Materialien mit<br />
höchsten Anforderungen an<br />
die geometrischen Bandabmessungen<br />
und -toleranzen.<br />
Durch diese umfangreiche<br />
Modernisierung der seit 1996<br />
produzierenden Anlage in<br />
Panzhihua in der Provinz Sichuan<br />
will das Unternehmen<br />
wesentlich die Verfügbarkeit<br />
verbessern, die Produktionskapazität<br />
steigern und das<br />
Produktionsspektrum um<br />
dünne Bandabmessungen erweitern.<br />
Die jährliche Produktionskapazität<br />
wird dabei von<br />
heute 2,4 Millionen Tonnen<br />
auf mindestens 3 Millionen<br />
Tonnen erhöht. Die Modernisierung<br />
der gesamten Anlage<br />
wird in nur zwei Stillständen<br />
durchgeführt – zuerst im September<br />
<strong>2021</strong>, dann im Juli<br />
2022. Das erste Warmband<br />
soll im Oktober 2022 gewalzt<br />
werden.<br />
Panzhihua Steel & Vanadium ist mit der von SMS modernisierten<br />
1 450-mm-Warmbreitbandstraße gut gerüstet, um zukünftig<br />
hochfestes und dünnes Warmband herzustellen zu können.<br />
Das Mold-Expert-System von<br />
Primetals Technologies soll<br />
Durchbrüche bei Stranggießanlagen<br />
verhindern und den<br />
Wartungsaufwand reduzieren.<br />
Primetals erhält Endabnahmezertifikat<br />
von<br />
Tangshan Heavy Plate<br />
Im März <strong>2021</strong> hat Tangshan<br />
Heavy Plate das Endabnahmezertifikat<br />
(FAC) für drei Mold-<br />
Expert-Systeme für die<br />
Stranggießanlagen im Werk<br />
Laoting in der chinesischen<br />
Region Tangshan an Primetals<br />
Technologies erteilt. Mit<br />
den neuen Lösungen von Primetals<br />
Technologies soll die<br />
Anlagenverfügbarkeit im<br />
Werk Laoting erhöht und die<br />
Wartungszeit durch zeitnahe<br />
Alarmierung verringert werden.<br />
Neben Durchbruchsvorhersagen<br />
sendet das System<br />
Warnungen bei abnormalen<br />
Gießbedingungen und wertet<br />
das Verhalten und die Verteilung<br />
des Gießpulvers aus.<br />
Durch kontinuierliches Erfassen<br />
von Informationen und<br />
Erfahrungen im Mold-Expert-<br />
System können Durchbrüche<br />
effizienter im Echtbetrieb verhindert<br />
und damit hohe Re-<br />
Quellen: Primetals Technologies (3); SMS group; WS Wärmeprozesstechnik<br />
38 Juni <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
3<br />
2<br />
Das finnische Unternehmen Metso Outotec erteilt Primetals<br />
Technologies die Lizenz für Eisenerz-Pelletieranlagen mit dem<br />
Wanderrost-Verfahren für den indischen Markt.<br />
paraturkosten und Produktionsausfälle<br />
vermieden werden.<br />
Das System liefert Daten<br />
zur Prozessoptimierung und <br />
unterstützt den Bediener bei<br />
seiner Arbeit. Je nach den individuellen<br />
Bedürfnissen des<br />
Kunden kann die Software<br />
einfach skaliert werden. Die<br />
Inbetriebnahme wurde vor<br />
Ort von Primetals Technologies<br />
China sowie Experten<br />
von Primetals Technologies<br />
Österreich, die online zugeschaltet<br />
wurden, durchgeführt.<br />
Trotz Reisebeschränkungen<br />
wurde das Projekt innerhalb<br />
von drei Monaten<br />
realisiert. Vor der Auftragserteilung<br />
wurde eine sechsmonatige<br />
Testinstallation an einer<br />
Anlage durchgeführt und<br />
von Primetals Technologies<br />
betreut. <br />
Fives setzt auf<br />
Brennertechnik von WS<br />
Fortschrittliche Konzepte für<br />
Elektrobandlinien setzen auf<br />
effiziente und emissionsarme<br />
Brennertechnologie, die extrem<br />
niedrige NOx Emissionswerte<br />
gänzlich ohne aufwändige Sekundärmaßnahmen<br />
erreicht.<br />
Besonders Stahlunternehmen<br />
in Asien fordern inzwischen<br />
verstärkt den Einsatz der bestmöglichen<br />
Technologie in ihren<br />
neuen Elektrobandanlagen,<br />
um den Klimazielen gerecht<br />
zu werden und<br />
Umweltauflagen zu erfüllen.<br />
Fives konnte nun bereits mehrere<br />
Projekte für Elektrobandlinien<br />
von Stahlherstellern<br />
aus China für sich gewinnen.<br />
Die zugehörigen Aufträge für<br />
Brennertechnik hat Fives an<br />
die WS Wärmeprozesstechnik<br />
GmbH vergeben. Dank des patentierten<br />
und vielfach prämierten<br />
Flox-Verfahrens und<br />
der jahrzehntelangen Erfahrung<br />
bei WS mit dieser Technologie,<br />
gelinge es in der von<br />
Fives gewählten WS-Brennerkonfiguration<br />
gänzlich ohne<br />
nachgeschaltete SCR selbst die<br />
strengsten Emissionsgrenzwerte<br />
einzuhalten, meldet<br />
WS.<br />
3<br />
Elektrobandlinie mit Flox-Brennern von WS<br />
FINNLAND<br />
Primetals erhält Lizenz<br />
aus Finnland für Eisenerz-<br />
Pelletieranlagen für den<br />
indischen Markt<br />
Metso Outotec und Primetals<br />
Technologies haben einen exklusiven<br />
Lizenzvertrag geschlossen,<br />
der es Primetals<br />
Technologies ermöglicht, die<br />
von Metso angewandte Technologie<br />
zur Eisenerz-Pelletierung<br />
mit dem Wanderrost<br />
Verfahren (Straight Grate Iron<br />
Ore Pelletizing; SG-IOP) für<br />
den indischen Markt zu nutzen.<br />
Durch diese Vereinbarung<br />
wird Primetals Technologies<br />
sein Angebot von Eisenerz-Pelletieranlagen<br />
für<br />
Kunden in Indien weiter ausbauen.<br />
Die Lizenz verleiht Primetals<br />
Technologies das exklusive<br />
Recht, Pelletieranlagen<br />
in Indien zu errichten, die<br />
auf Metso-SG-IOP- Referenzprojekten<br />
mit Rostgrößen von<br />
272 bis 816 m 2 , wie sie in den<br />
letzten Jahrzehnten in Indien<br />
realisiert wurden, basieren.<br />
Durch dieses Angebot wird<br />
das bestehende Portfolio von<br />
Pelletieranlagen, basierend<br />
auf Circular-Pelletizing-Technologie,<br />
ergänzt. Die Lizenzvereinbarung<br />
geht auf das Genehmigungsverfahren<br />
für die<br />
Fusion von Metso und Outotec<br />
in Indien zurück: Im Juni<br />
2020 hatte die indische Wettbewerbskommission<br />
den Zusammenschluss<br />
von Metso Minerals<br />
und Outotec unter der<br />
Bedingung genehmigt, dass<br />
das SG-IOP-Investitionsgütergeschäft<br />
von Metso in Indien<br />
durch einen Technologielizensierungsvertrag<br />
auf einen geeigneten<br />
Käufer übertragen<br />
wird. Die Lizenz berechtigt<br />
Primetals Technologies, Pelletieranlagen<br />
auf Basis der von<br />
Metso entwickelten SG-IOP-<br />
Technologie zu planen, zu<br />
entwickeln, zu liefern und in<br />
Betrieb zu nehmen sowie entsprechende<br />
Serviceleistungen<br />
in Indien zu erbringen. <br />
4<br />
MEXIKO<br />
Nucor-JFE Steel Mexico:<br />
Endabnahme für<br />
Feuerverzinkungslinie<br />
Für die neue in Silao, Mexiko,<br />
errichtete kontinuierliche<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Juni <strong>2021</strong> 39
POLITIK<br />
MÄRKTE<br />
Roh<strong>stahl</strong>herstellung<br />
Roh<strong>stahl</strong>erzeugung nach Regionen<br />
April <strong>2021</strong><br />
Millionen Tonnen<br />
Top Ten der <strong>stahl</strong>produzierenden Länder<br />
April <strong>2021</strong><br />
Millionen Tonnen<br />
% Veränderung<br />
April 21/20<br />
Asien und Ozeanien 125.0 19.2<br />
EU (27) 12.9 42.8<br />
Nordamerika 9.7 38.2<br />
GUS 9.0 20.7<br />
Europa außer EU 4.2 33.9<br />
Südamerika 3.8 70.9<br />
Mittlerer Osten 3.5 15.3<br />
Afrika 1.3 93.9<br />
Total 64 countries 169.5 23.3<br />
% Veränderung<br />
April 21/20<br />
China 97.9 13.4<br />
Indien 8.3 152.1<br />
Japan 7.8 18.9<br />
USA 6.9 43.0<br />
Russland 6.5 e 15.1<br />
Südkorea 5.9 e 15.4<br />
Deutschland 3.4 31.5<br />
Türkei 3.3 46.6<br />
Brasilien 3.1 59.3<br />
Iran 2.5 e 6.4<br />
Die 64 in der Tabelle zusammengefassten<br />
Länder machten 2019 etwa 99 Prozent der<br />
gesamten weltweiten Roh<strong>stahl</strong>produktion<br />
aus. Regionen und Länder, die unter die<br />
Tabelle fallen:<br />
• Afrika: Ägypten, Libyen, Südafrika<br />
• Asien und Ozeanien: Australien, China,<br />
Indien, Japan, Neuseeland, Pakistan,<br />
Südkorea, Taiwan (China), Vietnam<br />
• GUS: Weißrussland, Kasachstan, Moldawien,<br />
Russland, Ukraine, Usbekistan<br />
• Europäische Union (27)<br />
• Europa, Sonstiges: Bosnien-Herzegowina,<br />
Mazedonien, Norwegen, Serbien, Türkei,<br />
Vereinigtes Königreich<br />
• Naher Osten: Iran, Katar, Saudi-Arabien,<br />
Vereinigte Arabische Emirate<br />
• Nordamerika: Kanada, Kuba, El Salvador,<br />
Guatemala, Mexiko, USA<br />
• Südamerika: Argentinien, Brasilien, Chile,<br />
Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Peru,<br />
Uruguay, Venezuela<br />
e - geschätzt. Die Rangliste der Top-10-Erzeugerländer basiert auf dem Gesamtwert seit Jahresbeginn.<br />
Damaszener Stahl<br />
Manfred Sachse, der „große, alte Meister“<br />
und Kenner des Damastschmiedens liefert<br />
aufschlussreiche, neue Recherchen zur<br />
berühmten Solinger Klingenproduktion.<br />
Auch in englischer<br />
Sprache erhältlich:<br />
www.<strong>stahl</strong><strong>eisen</strong>.de/<br />
product/damascussteel/<br />
Damaszener Stahl | Mythos, Geschichte, Technik, Anwendung<br />
€ 79,00<br />
3. erweiterte Auflage | 25,6 x 31,9 cm | 304 Seiten mit zahlreichen<br />
farbigen Abbildungen und technischen Zeichnungen<br />
Entdecken Sie jetzt die dritte, erweiterte Auflage seines erfolgreichen Werks!<br />
Bestellung unter www.<strong>stahl</strong><strong>eisen</strong>.de/product/damaszener-<strong>stahl</strong>/
WISSENSCHAFT<br />
TECHNIK<br />
Liquid Metal Embrittlement<br />
LME VERSTEHEN,<br />
RISSE VERMEIDEN<br />
Beim Widerstandspunktschweißen moderner hochfester Stähle können sogenannte<br />
LME-Risse (Liquid Metal Embrittlement) entstehen. Um die Rissbildung zu verstehen<br />
und schlussendlich zu verhindern, laufen zurzeit zahlreiche Forschungsprojekte.<br />
Das Widerstandspunktschweißen wird zum Fügen von Karosseriekomponenten eingesetzt.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Juni <strong>2021</strong> 43
WISSENSCHAFT<br />
TECHNIK<br />
Liquid Metal Embrittlement<br />
AUTOREN: Max Biegler 1 , Christoph<br />
Böhne 4 , Michael Rethmeier 2,1,3<br />
max.biegler@ipk.fraunhofer.de<br />
1 <br />
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und<br />
Konstruktionstechnik (IPK)<br />
2 <br />
Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb,<br />
TU Berlin<br />
3 <br />
Bundesanstalt für Materialforschung und –<br />
Draufsicht auf eine WPS-Verbindung<br />
mit Rissen<br />
Durch den Widerstandspunktschweißprozess bilden sich Risse, weil<br />
die Zinkbeschichtung mit den Korngrenzen reagiert.<br />
Prüfung (BAM)<br />
4 <br />
Laboratorium für Werkstoff- und Fügetechnik (LWF®),<br />
Universität Paderborn<br />
DARUM GEHT’S: Beim Widerstandspunktschweißen<br />
moderner hochfester<br />
Stähle kann es durch Reaktionen<br />
mit der Zinkschicht zu einer Rissbildung<br />
kommen. Obwohl die Risse nur<br />
in extremen Fällen Einfluss auf die<br />
Leistungsfähigkeit der Schweißung<br />
haben, soll ihre Bildung vermieden<br />
werden, um Qualitätsanforderungen<br />
zu entsprechen. In diesem Artikel<br />
werden die zinkinduzierte Rissbildung<br />
vorgestellt, Einflussfaktoren diskutiert<br />
und Vermeidungsstrategien<br />
beschrieben.<br />
Aufgrund ihres hohen Potenzials<br />
zur Gewichtsreduzierung erfährt<br />
die Automobilproduktion<br />
eine kontinuierliche Zunahme von Bauteilen<br />
aus hochfesten Stählen (Advanced<br />
High Strength Steels (AHSS)). Die<br />
Stahlsorten sind in der Regel verzinkt<br />
für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit<br />
und werden vornehmlich durch<br />
Widerstandspunktschweißen (WPS) in<br />
der Rohbaufertigung verbunden. Das<br />
WPS ist ein äußerst dynamischer Prozess,<br />
bei dem die Bleche durch zwei<br />
Kupferelektroden zusammengedrückt<br />
werden und dann mit einem hohen<br />
Strom in unter einer Sekunde verschmolzen<br />
werden. Dabei kann es in<br />
Reaktion mit der Zinkschicht zur Bildung<br />
von Flüssigmetallversprödung<br />
(Liquid Metal Embrittlement – LME)<br />
kommen. LME ist die Infiltration der<br />
Korngrenzen eines Metalls durch ein<br />
flüssiges Metall niedrigeren Schmelzpunkts,<br />
was zu einer Schwächung der<br />
Korngrenzen und Reduzierung der Duktilität<br />
führt. Als Voraussetzung für die<br />
Bildung von LME ist also ein Stahl mit<br />
anfälliger Legierung und Kornstruktur<br />
sowie die Verfügbarkeit von flüssigem<br />
Zink zu nennen.<br />
Charakterisierung von Rissen<br />
Das Vorhandensein von LME in einem<br />
Schweißpunkt führt nicht unbedingt zu<br />
dessen Funktionsverschlechterung: So<br />
sind die Risslage in Relation zum<br />
Abbildung 1: Zur Bestimmung der Rissneigung kann die Risslänge auf der<br />
Oberfläche nach dem Schweißen vermessen werden. In der Grafik sind Risse<br />
im Elektrodeneindruck und an der sogenannten „Schulter“ der Schweißverbindung<br />
mit gestrichelten Linien nachgezeichnet.<br />
Schweißpunkt sowie die Größe der Risse<br />
ausschlaggebend für einen Einfluss<br />
auf die Tragfähigkeit der Verbindung.<br />
In diesem Zusammenhang ist die Risscharakterisierung<br />
ein wichtiges Werkzeug,<br />
da LME die Bildung von Rissen in<br />
verschiedenen Bereichen einer Widerstandspunktschweißverbindung<br />
verursachen<br />
kann. Häufig wird unterschieden<br />
zwischen Rissen im Elektrodeneindruck,<br />
Rissen an der Schulter außerhalb<br />
des Elektrodeneindrucks und Risse in<br />
der Grenzfläche zwischen den Blechen.<br />
Eine Quantifizierung der Rissintensität<br />
erfolgt üblicherweise durch Messung<br />
der Risseindringtiefe in Querschliffen<br />
oder der Risslänge auf makroskopischen<br />
Bildern der Blechoberfläche (Abbildung<br />
1). Um nun einen Einfluss der<br />
Risse auf die Tragfähigkeit bewerten zu<br />
können, spielen Arten der Belastung,<br />
Kraftfluss und Risslage und -morphologie<br />
eine Rolle, wobei eine gewisse<br />
Menge von Rissen durchaus toleriert<br />
werden kann. In jedem Fall gehen aber<br />
die strengen Qualitätsanforderungen<br />
der Automobilindustrie dahin, dass Risse<br />
vermieden werden müssen: Dafür<br />
muss das Phänomen LME verstanden<br />
und mit geeigneten Maßnahmen verhindert<br />
werden.<br />
Eingangsprüfung: LME forcieren<br />
und Stähle vergleichen<br />
Für anwendungsorientierte Tests der<br />
LME Anfälligkeit eines spezifischen<br />
Stahls gibt es heute bereits eine Reihe<br />
von Testmöglichkeiten. Den Tests ist<br />
gemein, dass sie „ungünstige“ Schweißbedingungen<br />
verwenden, um Rissbildung<br />
im Labor zu forcieren. Das heißt,<br />
es werden beispielsweise hohe Lasten<br />
von außen angelegt, ein sogenanntes<br />
„Schweißen-Unter-Zug“ Setup, siehe<br />
Abbildung 2. Eine weitere Möglichkeit<br />
ist, besonders energieintensive Schweißparameter<br />
mit hohen Strömen und langen<br />
Schweißzeiten zu wählen, um die<br />
Zinkdiffusion künstlich zu erhöhen.<br />
Nach dem Test wird die Oberfläche von<br />
noch aufliegendem Zink befreit und die<br />
Zahl der Risse unter einem Mikroskop<br />
oder im Querschliff vermessen. Mit diesen<br />
Tests lassen sich Materialien vergleichen<br />
und Aussagen vom Typ „Stahl<br />
A ist anfälliger als Stahl B“ treffen. So<br />
Quelle: Fraunhofer IPK<br />
44 Juni <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Setup für das Schweißen unter Zug<br />
Während des Schweißens wird mit einem Hydraulikzylinder eine Kraft auf die Probe aufgebracht.<br />
Abbildung 2: Im Schweißen-unter-Zug-Setup wird die Belastung auf eine Schweißstelle im Karosseriebau nachgestellt. So können<br />
Kräfte, die in der Produktion beispielsweise aus Einspannung, Umformprozess oder Spalten entstehen, im Labor nachgestellt<br />
werden.<br />
kann mit einer Wareneingangsprüfung<br />
sichergestellt werden, dass ein neues<br />
Material nicht anfälliger als ein bestimmter<br />
Toleranzwert ist.<br />
Die Hintergründe der<br />
Riss bildung verstehen<br />
Um die LME-Rissbildung nachhaltig zu<br />
verringern, benötigt es jedoch ein tiefergehendes<br />
Verständnis der Einflussfaktoren.<br />
Bei der Erforschung von LME<br />
ist die Geschwindigkeit und Robustheit<br />
des Widerstandspunktschweißens ein<br />
großes Problem. Während andere automobile<br />
Fügeprozesse wie das Laserschweißen<br />
eine enge Kontrolle der<br />
Randbedingungen benötigen, ist das<br />
WPS in einem sehr großen Prozessfenster<br />
stabil anwendbar. Trotzdem bleibt<br />
es ein hochgradig dynamischer Prozess,<br />
bei dem Kontaktverhältnisse zwischen<br />
den Elektroden und dem Blech, die Stellung<br />
der Schweißzange, etwaige Verformungen<br />
in den Fügepartnern und<br />
Verunreinigungen zu unterschiedlichen<br />
Prozessverläufen und großen Streuungen<br />
führen. Somit ist es rein experimentell<br />
selbst im Labor schwierig, einzelne<br />
Einflussgrößen für LME zu isolieren:<br />
Erhöht man zum Beispiel den Schweißstrom,<br />
um die temperaturabhängige<br />
Zinkdiffusion auf der Oberfläche zu erhöhen,<br />
erzeugt man zugleich eine größere<br />
Schweißlinse mit anderem Tragverhalten<br />
und unterschiedliche Elektrodeneindrücke.<br />
Schritt für Schritt wurden in den letzten<br />
Jahren einzelne Einflussfaktoren im Widerstandspunktschweißen<br />
isoliert und<br />
ihre Wechselwirkung charakterisiert.<br />
So führt eine hohe Temperatur bzw. ein<br />
großer Temperaturintervall mit flüssigem<br />
Zink an der Oberfläche zu erhöhter<br />
Diffusion und vergrößert LME Anfälligkeit.<br />
Weiterhin ist die Belastung des<br />
Punkts von außen maßgeblich: Zugspannungen<br />
beanspruchen die Korngrenzen,<br />
erhöhen Zinkdiffusion und<br />
reißen versprödete Areale auf. Die anfangs<br />
genannten Methoden zur Eingangsprüfung<br />
machen sich die beiden<br />
Phänomene zu nutzen, indem exzessive<br />
Temperaturen oder Lasten aufgebracht<br />
werden.<br />
Mit Simulation in den<br />
Schweißpunkt gucken<br />
Um mit den experimentellen Schwankungen<br />
beim WPS umgehen zu können<br />
und nicht-messbare Größen sichtbar zu<br />
machen, findet die numerische Simulation<br />
Anwendung in der LME-Forschung.<br />
Über die Berechnung des Widerstandspunktschweißens<br />
lassen sich Temperaturen,<br />
mechanische Spannungen und<br />
Dehnungen sowie Gefügeausbildungen<br />
beliebig betrachten und auswerten. Einzig<br />
die Rissbildung an sich kann nicht<br />
berechnet werden, da noch keine verlässlichen<br />
Modelle für die Bildung von<br />
LME vorliegen. Hier zeigt sich der Nutzen<br />
experimenteller Untersuchungen:<br />
Wird eine besondere Rissbildung bei<br />
einer Schweißung beobachtet, kann der<br />
dazugehörige Prozessablauf simulativ<br />
betrachtet werden, um so die Hintergründe<br />
aufzuklären. Abbildung 3 zeigt<br />
die Auswertung von Temperatur, Spannung<br />
und Dehnung kurz vor Ende eines<br />
Punktschweißprozesses an einem AHSS.<br />
Günstige Bedingungen<br />
schaffen, Risse vermeiden<br />
Mit wachsender Kenntnis der Faktoren,<br />
die LME verursachen, können im Umkehrschluss<br />
auch Vermeidungsmethoden<br />
gefunden werden. Als offensichtliche<br />
Möglichkeit ist die weitestgehende<br />
Reduktion der eingebrachten<br />
Energie – also eine Reduktion der<br />
Schweißzeit oder der Stromstärke – zu<br />
nennen. In der Praxis ist diese Möglichkeit<br />
häufig direkt gegenläufig mit Anforderungen<br />
an die Tragfähigkeit der<br />
Verbindung und kann nur sehr begrenzt<br />
verwendet werden. Deutlich<br />
vielversprechender ist es, die Oberflächentemperatur<br />
durch bessere Kühlung<br />
zu verringern: Besonders bei di-<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Juni <strong>2021</strong> 45
STYLE<br />
STORY<br />
Geschichte<br />
Ein Lehrer und Forscher der<br />
Montanwissenschaften an der<br />
Bergakademie Freiberg<br />
Vor 150 Jahren starb Julius Weisbach<br />
AUTOR: Prof. Dr. Ing. habil. Gerd Grabow<br />
DARUM GEHT’S: Für angehende Metallurgen<br />
und Bergleute steht die Bergakademie<br />
Freiberg ganz sicher auf der<br />
„Shortlist” – der historische Ruf und die<br />
Qualität des Lehrkörpers sorgen dafür.<br />
Seinen Beitrag zu diesem Ruf hat Mitte<br />
des 19. Jahrhunderts auch Julius Weisbach<br />
geleistet, wie unser Gastautor,<br />
selbst emeritierter Professor dieser traditionsreichen<br />
Bildungsstätte, aufzeigt.<br />
Weisbach war ein Lehrer und Forscher,<br />
der auf den Gebieten der Mathematik,<br />
Mechanik, Markscheidekunst, Hydraulik<br />
und der Berg- und Hüttenmaschinen<br />
hervorragende Leistungen vollbrachte<br />
und als ein Wegbereiter des gesamten<br />
Maschinenwesens gilt.<br />
Julius Ludwig Weisbach, der am 10.August<br />
18<strong>06</strong> in Mittelschmiedeberg bei<br />
Annaberg geboren wurde, stammte<br />
aus einfachen Verhältnissen und lebte von<br />
Jugend auf in der Atmosphäre der Gruben<br />
und Hütten. Sein Vater war Schichtmeister<br />
auf einem kleinen Hammerwerk, seine<br />
Mutter die Tochter eines Zimmermeisters;<br />
von beiden Seiten bekam er quasi technisches<br />
Erbgut in die Wiege gelegt. Auf die<br />
Dorfschule folgte das Lyzeum in Annaberg,<br />
diesem die Bergschule und anschließend<br />
die Bergakademie in Freiberg, wobei die<br />
geistige Arbeit von einer gründlichen Tätigkeit<br />
im praktischen Bergbau begleitet<br />
war.<br />
Von Freiberg nach Wien und<br />
zurück<br />
Als Weisbach mit 26 Jahren seine Ausbildung<br />
an der Bergakademie beendet hatte,<br />
entsprach er der Anregung des von ihm am<br />
meisten geschätzten Lehrers Friedrich<br />
Mohs zur Weiterführung seines Studiums<br />
in Göttingen, und als dieser Freiberg verlassen<br />
hatte — er wurde nach Wien berufen<br />
— folgte ihm Weisbach dort hin. Als<br />
Weisbach seine Ausbildung für abgeschlossen<br />
hielt, machte er eine halbjährige Studienreise<br />
durch die österreichischen und<br />
Porträtzeichnung von Julius Weisbach<br />
die bayrischen Bergbaugegenden. Dann<br />
kam er nach Freiberg zurück und richtete<br />
an das Oberbergamt das Gesuch um Einstellung<br />
als akademischer Lehrer, wobei er<br />
seine Eignung als Vertreter der Angewandten<br />
Mathematik in den Vordergrund stellte.<br />
Erstes Ergebnis war, dass Weisbach 1832<br />
mit einem Lehrauftrag für Mathematik<br />
versehen wurde. Dann kam nach weiteren<br />
Bemühungen 1834 die endgültige Entscheidung<br />
des Ministeriums, durch die ihm<br />
die durch den Tod des Professors Hecht<br />
freigewordene erste Mathematikerstelle<br />
übertragen wurde über Angewandte Mathematik,<br />
Bergmaschinenlehre und Allgemeine<br />
Markscheidekunst, mit dem „Charakter<br />
als Mathematikus”. Weisbach war<br />
der Bergakademie Freiberg so stark verhaftet<br />
und wurzelte so sehr im Heimatboden,<br />
dass er einen zwischenzeitlich ergangenen<br />
Ruf als Lehrer der Mathematik<br />
und Direktor des damals neu gegründeten<br />
Züricher Polytechnikums ablehnte.<br />
Weisbach als Mathematiker<br />
Wenn man nun von dem, was seine Bedeutung<br />
ausmacht, ein Bild abgeben soll,<br />
so muss natürlich mit dem begonnen<br />
werden, was bereits in den Mittelpunkt<br />
gestellt wurde: mit Weisbachs grundlegender<br />
mathematischer Tätigkeit.<br />
An der Bergakademie bestand seit<br />
ihrer Gründung eine Professur, die<br />
Mathematik, Darstellende Geometrie,<br />
Physik und Bergmaschinenlehre umfasste.<br />
Es handelte sich also ausgesprochen<br />
um Angewandte Mathematik,<br />
die betrieben wurde. In der angewandten<br />
Mathematik hatte Weisbach<br />
schon als Student hervorragende Arbeit<br />
geleistet. Er lässt die Differential- und<br />
Integralrechnung fallen, führt fortan<br />
seine Entwicklung mit elementarer<br />
Mathematik durch und kommt damit<br />
zum Ziel. Er bringt 1860 seine<br />
„Theoretische Wärmelehre” heraus, ein<br />
Buch, welches auf die Ingenieurwelt den<br />
allergrößten Eindruck gemacht hat, das<br />
für seine Zeit ebenso maßgebend gewesen<br />
ist wie Weisbachs „Ingenieur-Mechanik”.<br />
Als er die Vorlesung über Kristallographie<br />
übernommen hatte, lag ihm daran, die<br />
Kristallgestalten seinen Hörern möglichst<br />
anschaulich zu bringen. Das führte ihn<br />
dazu, die axonometrische Darstellung auszubilden.<br />
Er hat 1842 seine erste Veröffentlichung<br />
darüber gebracht; sein Buch „Anleitung<br />
zum axonometrischen Zeichnen”<br />
erschien 1857. Ihm gebührt das Hauptverdienst<br />
bei der Entwicklung der orthogonalen<br />
Axonometrie.<br />
„Vater der Technischen Mechanik”<br />
Er hat den Gesamtbereich der Mechanik<br />
jener Zeit nahezu vollständig überarbeitet<br />
und an vielen Stellen durch eigene Gedanken<br />
zur Weiterentwicklung gebracht. Man<br />
kann ihn ruhig als den „Vater der Technischen<br />
Mechanik” bezeichnen. Er hat auch<br />
auf diesem Gebiet durch die Ausschaltung<br />
schwieriger mathematischer Überlegungen<br />
große Wirkung erzielt. Von Weisbach<br />
erstmalig behandelt worden ist das Gebiet<br />
der „Zusammengesetzten Festigkeit“, der<br />
gleichzeitigen Beanspruchung eines Bauelementes<br />
durch Spannungen der verschiedensten<br />
Art. Seine Versuchseinrichtungen<br />
Quelle: VDI; Unukorno, CC BY-SA 3.0,* via Wikimedia Commons; Gerd Grabow<br />
62 Juni <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
für die Elastizitäts- und Festigkeitslehre<br />
werden in der Weisbach-Sammlung gezeigt.<br />
Er benutzte sie nicht nur als Forscher,<br />
sondern auch in jener Zeit schon zur<br />
Veranschaulichung seiner Vorträge.<br />
Strömungstechniker und<br />
Hydrauliker<br />
Die größte Leistung Weisbachs als Mechaniker<br />
liegt in seinen Arbeiten im Bereich<br />
der Strömungstechnik. Als Hydrauliker vor<br />
allem hat ihn die Mit- und Nachwelt gerühmt.<br />
Wenn man sich fragt, wie es<br />
kommt, dass gerade dieses Gebiet von ihm<br />
besonders gepflegt worden ist, so ergibt<br />
sich die Antwort durch den Begriff der<br />
Zweckforschung. Die wichtigste Energiequelle<br />
für den Bergmann jener Zeit war die<br />
Wasserkraft. Das Weisbach mit seiner ganzen<br />
Energie daranging, die Wasserkraftnutzung<br />
im Sinne seiner Gedanken einer<br />
mechanischen Durchdringung zu erforschen<br />
und zu verbessern, ist ohne weiteres<br />
zu verstehen. Er setzt gleich von Grund auf<br />
an und unterwirft die ganze Vielfalt der<br />
hydraulischen Einrichtungen einer systematischen<br />
Untersuchung. In eingehenden<br />
Veröffentlichungen werden die Ergebnisse<br />
herausgebracht. Man sieht, dass Weisbach<br />
auf hydraulischem Gebiet in bemerkenswerter<br />
Weise, die Theorie mit den Forderungen<br />
der Praxis zu vereinigen gewusst<br />
hat. Auf ihn gehen zahlreiche, seither stets<br />
gültig gebliebene Grundlagen der Strömungsmechanik<br />
zurück. Das Julius Weisbach<br />
dies alles in feste Formen gebracht<br />
hat, ist sein besonderer Verdienst. Die Art,<br />
wie Weisbach zu seinen Ergebnissen gelangt,<br />
kann in vielem auch jetzt noch mustergültig<br />
erscheinen.<br />
Im Jahr 1860 erhielt Julius Weisbach die<br />
Urkunde als erstes Ehrenmitglied des<br />
Vereins Deutscher Ingenieure (VDI)<br />
Forscher und Neuerer im<br />
Markscheidewesen<br />
Es kam im Wesentlichen bei Weisbachs<br />
„Markscheidekunst” darauf an, dass das<br />
bis dahin übliche Arbeiten des Markscheiders<br />
mit Gradbogen und Kompass zur Erhöhung<br />
der Genauigkeit und Sicherheit<br />
der Messungen durch das Arbeiten mit<br />
Theodolit und mit Nivellierinstrumenten<br />
ersetzt wurde. Die damalige Praxis und<br />
auch die Theoretiker leisteten diesem Gedanken<br />
Weisbachs lange energischen Widerstand.<br />
Er hatte große Mühe, sich durchzusetzen,<br />
aber durch die Art, wie er mit<br />
seinen Studenten übte, wie er selbst arbeitete,<br />
wie er das markscheiderische Instrumentarium<br />
der Bergakademie entwickelte,<br />
kam er mehr und mehr zur Beherrschung<br />
der Lage. Die Bewährungsprobe war der<br />
1844 begonnene Bau des Rothschönberger<br />
Stollens, dieser großen Verbindung zwischen<br />
dem Freiberger Revier und der Elbe.<br />
Bei seiner Ausführung wollte Weisbach<br />
von einer markscheiderischen Arbeit im<br />
alten Sinne für die über- und untertägigen<br />
Messungen nichts wissen und setzte sein<br />
Verfahren dagegen. Er bewies durch die<br />
Ergebnisse, die er erzielte, in welchem<br />
Maße die neue Markscheidekunst der alten<br />
überlegen war und führte damit seine Sache<br />
zum Sieg.<br />
Ingenieur und Fachautor<br />
Das Bergmaschinenwesen war anfänglich<br />
keine eigene Disziplin. Es wurde im Rahmen<br />
der Bergbaukunst und der Angewandten<br />
Mathematik vorgetragen. Bis zu Weisbachs<br />
Zeit erscheint es in die Mechanik<br />
eingegliedert. Auch er geht zunächst von<br />
dieser Sachlage aus, bald aber nimmt er die<br />
ausschlaggebende Umstellung vor: Angewandte<br />
Mathematik als unerlässliche<br />
Grundlage und als Mittel zur Überwindung.<br />
Hauptaufgabe aber ist die Maschine.<br />
Für den Handgebrauch hatte Weisbach<br />
schon 1848 in seinem Buch „Der Ingenieur“<br />
eine „Sammlung von Tafeln, Formeln<br />
und Regeln“ bereitgestellt, einen Vorläufer<br />
der „Hütte”. Davon kamen bis 1877 sechs<br />
Auflagen heraus. Insgesamt umfasst sein<br />
literarisches Schaffen 12 Buchveröffentlichungen<br />
und mehr als 60 Einzelabhandlungen,<br />
von denen ein großer Teil in der<br />
durch ihn inspirierten, 1848 gegründeten<br />
Zeitschrift „Der Ingenieur”, dem späteren<br />
„Civilingenieur”, erschienen ist.<br />
Ehrungen und Charakterzüge<br />
Es hat Weisbach nicht an der Anerkennung<br />
seiner Zeitgenossen durch äußere Ehrungen<br />
gefehlt. Titel und Orden wurden ihm<br />
verliehen, die Universität Leipzig ernannte<br />
Denkmal für Julius Weisbach in Freiberg<br />
ihn zum Ehrendoktor, Akademien der Wissenschaft<br />
wählten ihn als Mitglied. Geradezu<br />
als ein Symbol seiner Bedeutung erscheint<br />
es, dass der gegründete Verein<br />
Deutscher Ingenieure, den „großen Lehrer<br />
und Forscher der Ingenieurkunst” zu seinem<br />
ersten Ehrenmitglied erkor.<br />
Alle bewundern Weisbachs weitgespanntes<br />
Lebenswerk als Forscher, Lehrer<br />
und Erzieher, der zu den Wegbereitern<br />
wissenschaftlich begründeter Technik gehört.<br />
Bei aller strengen Pflichterfüllung<br />
erschöpfte sich Weisbach nicht allein in<br />
der Berufsarbeit. Er war er ein heiterer,<br />
frohbewegter Mensch von offenem und<br />
geradem Wesen und viel Herzensgüte, der<br />
Musik, bildende Kunst und schöne Literatur<br />
liebte. Er war ein liebevoller Familienvater.<br />
Die Entwicklung seines Sohnes Albin<br />
betreute er mit sorgsamster Hingebung,<br />
und er erlebte mit Freude, dass dieser 1863<br />
Professor für Mineralogie an der Bergakademie<br />
wurde. Am 24. Februar 1871 ist Julius<br />
Weisbach gestorben.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de Juni <strong>2021</strong> 63
SONDER-<br />
AUSFÜHRUNGEN<br />
ERSATZ<br />
IDENTISCHE<br />
NACHBAUTEN<br />
Industrielle Antriebstechnik seit 1927<br />
Schnell · flexibel · zuverlässig<br />
Elektromotoren für Schwerlastantriebe<br />
in Stahl- und Walzwerken<br />
von Nieder spannung bis Hochspannung<br />
MENZEL ist seit über 90 Jahren Zulieferer für die Schwerindustrie.<br />
Unsere Elektromotoren mit extrem hoher Überlastfähigkeit und mechanischer<br />
Belastbarkeit werden zum Antrieb von Transport- und Arbeitsrollgängen, als<br />
Walzen-, Haspeln- und Kranantriebe aber auch an Hilfsaggregaten wie Gebläsen,<br />
Kompressoren und Pumpen in Stahl- und Walzwerken eingesetzt.<br />
Dabei sind kundenspezifische Ausführungen und Sonderlösungen (zum Beispiel<br />
für spezielle Lastzyklen oder Stoßbelastungen sowie mechanische Anpassungen)<br />
jederzeit möglich.<br />
Als Gehäusematerialien können Guss oder Schweiß<strong>stahl</strong> eingesetzt werden.<br />
Besondere Anforderungen oder Umgebungsbedingungen berücksichtigen wir gerne.<br />
Mehr Infos unter www.menzel-motors.com<br />
• Asynchronmotoren mit<br />
Käfigläufer bis 13.800 V<br />
• Rollgangsmotoren bis 1.000 V<br />
• DC-Walzmotoren nach den<br />
AISE-Normen bis 800 V<br />
• für Netz- und Umrichterbetrieb<br />
• Diverse Baugrößen<br />
• Sämtliche Kühl- und Schutzarten<br />
• Hohe Nenn-, Beschleunigungs- und<br />
Kippmomente<br />
Schnelle Liefer- und Antwortzeiten<br />
MENZEL fertigt nach Kundenwunsch –<br />
auch individuelle Einzelstücke und Kleinstserien.<br />
MENZEL Elektromotoren GmbH | Neues Ufer 19-25 | 10553 Berlin | +49 30 349 922-0 | info@menzel-motors.com
Technologie, Forschung,<br />
Märkte und Menschen!<br />
DER Stahl-Newsletter!<br />
Ihr wöchentlicher Info-Kanal.<br />
Jetzt anmelden: www.<strong>stahl</strong><strong>eisen</strong>.de