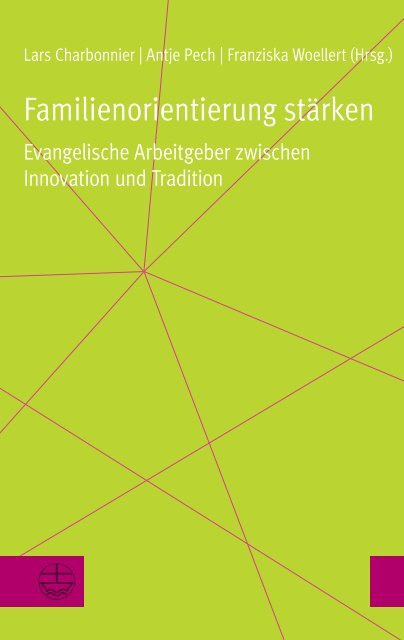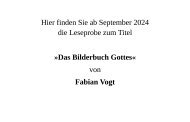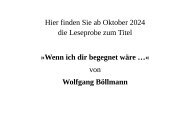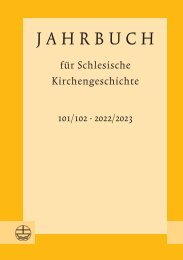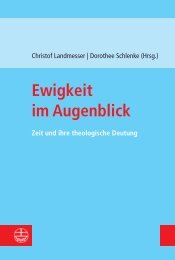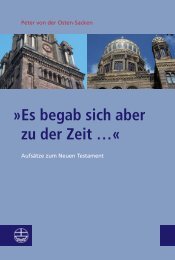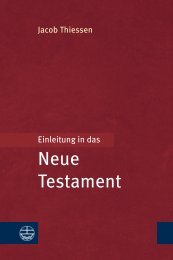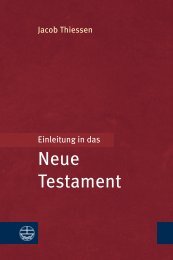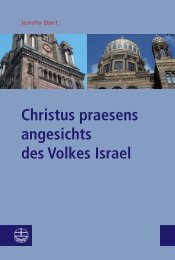Lars Charbonnier | Antje Pech | Franziska Woellert: Familienorientierung stärken (Leseprobe)
Wir leben in einer Zeit mit weitreichenden gesellschaftlichen Veränderungen. In der Arbeitswelt 4.0 werden lange wirksame Glaubenssätze von Führung und Organisationskultur, von Beruf und Karriere, vom Wert der Arbeit und ihrem Sinn infrage gestellt. Auch die Kirche muss sich den Veränderungen stellen, die aus der wachsenden Komplexität ihrer nicht nur rechtlichen Rahmenbedingungen sowie angesichts schrumpfender Mitglieder und schwindender Ressourcen resultieren. Dabei sollte Kirche – und mit ihr die Diakonie – aus ihrem Selbstverständnis heraus sichtbar und hörbar sein, wenn es darum geht, den gesellschaftlichen Wandel aktiv zu gestalten. Vorbilder schaffen, Werte leben und Veränderung gestalten – dies sind auch wesentliche Aspekte für das evangelische Gütesiegel Familienorientierung. Familienorientierte Personalpolitik hat sich als zentraler Ansatzpunkt zur Förderung einer zeitgemäßen Organisations- und Führungskultur bewährt. Diese Publikation gibt Einblick in aktuelle Entwicklungen und erste Erfahrungen im Umgang mit diesen Ansprüchen. Mit Beiträgen von Regina Ahrens, Lars Charbonnier, Cornelia Coenen-Marx, Ute Gerdom, Bettina Hollstein, Margrit Klatte, Ulrich Lilie, Maria Loheide, Antje Pech, Gert Pickel, Steffen Schramm, Kathrin Wallrabe und Franziska Woellert.
Wir leben in einer Zeit mit weitreichenden gesellschaftlichen Veränderungen. In der Arbeitswelt 4.0 werden lange wirksame Glaubenssätze von Führung und Organisationskultur, von Beruf und Karriere, vom Wert der Arbeit und ihrem Sinn infrage gestellt. Auch die Kirche muss sich den Veränderungen stellen, die aus der wachsenden Komplexität ihrer nicht nur rechtlichen Rahmenbedingungen sowie angesichts schrumpfender Mitglieder und schwindender Ressourcen resultieren. Dabei sollte Kirche – und mit ihr die Diakonie – aus ihrem Selbstverständnis heraus sichtbar und hörbar sein, wenn es darum geht, den gesellschaftlichen Wandel aktiv zu gestalten.
Vorbilder schaffen, Werte leben und Veränderung gestalten – dies sind auch wesentliche Aspekte für das evangelische Gütesiegel Familienorientierung. Familienorientierte Personalpolitik hat sich als zentraler Ansatzpunkt zur Förderung einer zeitgemäßen Organisations- und Führungskultur bewährt. Diese Publikation gibt Einblick in aktuelle Entwicklungen und erste Erfahrungen im Umgang mit diesen Ansprüchen.
Mit Beiträgen von Regina Ahrens, Lars Charbonnier, Cornelia Coenen-Marx, Ute Gerdom, Bettina Hollstein, Margrit Klatte, Ulrich Lilie, Maria Loheide, Antje Pech, Gert Pickel, Steffen Schramm, Kathrin Wallrabe und Franziska Woellert.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Lars</strong> <strong>Charbonnier</strong> | <strong>Antje</strong> <strong>Pech</strong> | <strong>Franziska</strong> <strong>Woellert</strong> (Hrsg.)<br />
<strong>Familienorientierung</strong> <strong>stärken</strong><br />
Evangelische Arbeitgeber zwischen<br />
Innovation und Tradition
Vorwort<br />
Die doppelte Lupe:<br />
Wenn nicht jetzt, wann dann?<br />
Um das ohnehin schon einleuchtende Motto »<strong>Familienorientierung</strong><br />
groß machen« ganzheitlich zu belegen und im Alltag –<br />
im wahrsten Wortsinne – anfassbar zu machen, bekam ich vor<br />
einigen Jahren von der Projektleiterin <strong>Franziska</strong> <strong>Woellert</strong> eine<br />
kleine Lupe mit dem Gütesiegel-Motto geschenkt.<br />
Ein Vergrößerungsinstrument für die Herausforderungen,<br />
die zur Entwicklung des Evangelischen Gütesiegels <strong>Familienorientierung</strong><br />
geführt haben:<br />
Die Individualisierung von Lebensentwürfen, eine andere<br />
Weise zu arbeiten – oder besser: das Verhältnis von Leben und<br />
Arbeit zu gestalten, eine immer digitaler werdende Arbeitswelt<br />
und der Mangel an Fach- und Führungspersonal sind einige<br />
der bekannten Gründe, mit einer bewussten und in der Organisation<br />
verankerten familienorientierten Personalverantwortung<br />
auf diese Herausforderungen zu reagieren. Eine Lupe<br />
hilft wirklich, sich besser zu konzentrieren und Klarheit in<br />
die Dinge zu bringen.<br />
Vor etwa zehn Jahren brachten die Ergebnisse einer Studie<br />
des Sozialwissenschaftlichen Instituts ans Licht, dass es in Kirche<br />
und Diakonie durchaus viele Anstrengungen zur Fami -<br />
lienfreundlichkeit gibt. Aber sie bewegten sich oft auf »einer<br />
geradezu selbst familiären und informellen Ebene« 1 , sind kaum<br />
1<br />
Zitat von Gerhard Wegner, in: Rinklake, Thomas / Marchese, Elisa / Mayert,<br />
Andreas / Halfar, Bernd (2012): Familienorientierte Personalpolitik in Kir-<br />
5
Vorwort<br />
strukturell verankert und werden selten als strategische und<br />
organisatorische Ziele in Kirche und Diakonie angesehen. Diese<br />
Erkenntnis hat unter anderem zum Evangelischen Gütesiegel<br />
<strong>Familienorientierung</strong> geführt und inzwischen sichtbar und<br />
spürbar Wirkung entfaltet.<br />
Das Verhältnis von Leben und Arbeiten in Kirche und Diakonie<br />
ist nicht nur ein Faktor individueller Zufriedenheit, Arbeitsmotivation<br />
und Leistungsbereitschaft, sondern auch ein<br />
zentrales Thema evangelischer Verantwortung in kirchlichen<br />
Körperschaften und diakonischen Unternehmen und Werken.<br />
Sinnerfüllt zu arbeiten und zufrieden zu leben sind Kennzeichen<br />
dessen, was die Bibel »Leben in Fülle« nennt.<br />
Beide Aspekte erfordern die feste und dauerhafte Verankerung<br />
von <strong>Familienorientierung</strong> in der Organisationsgrammatik<br />
von Kirche und Diakonie, damit das Gelingen auf Dauer<br />
nicht nur von einzelnen Personen abhängig ist. Insofern war<br />
die zeitweilige Bürogemeinschaft der Führungsakademie mit<br />
dem Evangelischen Gütesiegel <strong>Familienorientierung</strong> für beide<br />
Seiten ein gegenseitig sich befruchtender Lernweg, der seine<br />
Wirkungen bis in die vorliegende Veröffentlichung sichtbar<br />
und lesbar entfaltet. Ich danke an dieser Stelle Dr. Silke Köser<br />
für ihre klaren Impulse und alle Beharrlichkeit auf diesem<br />
Weg.<br />
Und dann noch einmal die Lupe: Die Corona-Pandemie<br />
hat viele Fragen unseres Lebens wie durch ein Brennglas deutlicher<br />
und klarer werden lassen. Davon können wir nicht nur<br />
unsere individuellen Geschichten erzählen, sondern auch viele<br />
Lerngeschichten aus unseren Arbeitszusammenhängen.<br />
che und Diakonie. Sozialwissenschaftliches Institut der EKD. Hannover.<br />
S. 6.<br />
6
Hierzu zählen ganz sicher ein neues Verständnis von Arbeit<br />
im Homeoffice, eine veränderte Meeting-Kultur, die gestiegene<br />
Wertschätzung für Fürsorgearbeit und sogar eine andere Führungskultur,<br />
in der Vertrauen den Vorrang hat.<br />
Also: <strong>Familienorientierung</strong> groß machen! Wenn nicht jetzt,<br />
wann dann?<br />
Peter Burkowski<br />
Berlin im Oktober 2021<br />
Vorwort<br />
7
Inhalt<br />
Einführung<br />
<strong>Familienorientierung</strong> <strong>stärken</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
Evangelische Arbeitgeber zwischen Innovation und Tradition<br />
<strong>Lars</strong> <strong>Charbonnier</strong>, <strong>Antje</strong> <strong>Pech</strong>, <strong>Franziska</strong> <strong>Woellert</strong> (Hrsg.)<br />
Erster Teil:<br />
Trends und Entwicklungen<br />
Familien in der neuen Arbeitswelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />
Maria Loheide und Hanna Pistorius<br />
Betriebliches Familienbewusstsein und Doing Family. . . . . . . . . . . . . 30<br />
Dr. Regina Ahrens<br />
Arbeitswelt 4.0 – Diakonie im digitalen Wandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />
Herausforderungen und Chancen<br />
Ulrich Lilie<br />
Weniger, älter, vielfältiger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59<br />
Wo steht der demografische Wandel heute?<br />
<strong>Franziska</strong> <strong>Woellert</strong><br />
Vom Ehrenamt zu Volunteering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79<br />
Prof. Dr. Bettina Hollstein<br />
9
Inhalt<br />
Zweiter Teil:<br />
Kirche zwischen Tradition und Innovation<br />
Das Personal und der Auftrag der Kirche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />
Einige pointierte Gedanken zum Stand von Organisationsund<br />
Personalentwicklung in der Kirche<br />
Dr. <strong>Lars</strong> <strong>Charbonnier</strong><br />
Engagierte für die Gestaltwerdung des Leibes Christi . . . . . . . . . . . . . 104<br />
Eine kybernetische Perspektive auf das Personal des<br />
nächsten landeskirchlichen Organisationsmodells<br />
Dr. Steffen Schramm<br />
Job vs. Berufung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127<br />
Was will der Nachwuchs in den verkündigenden Berufen?<br />
Prof. Dr. Gert Pickel<br />
Kirche ohne Ehrenamt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139<br />
Cornelia Coenen-Marx<br />
»Catch me if you can«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153<br />
Freiwilligendienste als eine Form der<br />
Nachwuchsgewinnung für Kirche und Diakonie?!<br />
Ute Gerdom<br />
Erwerbs- vs. Fürsorgearbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170<br />
Das Evangelische Gütesiegel <strong>Familienorientierung</strong><br />
als Managementinstrument für eine offene Organisationskultur<br />
<strong>Franziska</strong> <strong>Woellert</strong><br />
Dritter Teil:<br />
Ideen und Erfahrungen aus der Praxis<br />
Vereinbarkeit im Pfarramt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191<br />
<strong>Familienorientierung</strong> als Aufgabe der Personalpolitik<br />
und -begleitung<br />
Margrit Klatte<br />
10
Inhalt<br />
Erfolgreiche Stellenbesetzung in Kirche – Wie geht das?. . . . . . . . . . . 212<br />
Kathrin Wallrabe<br />
Vom Wert des Beginnens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231<br />
<strong>Familienorientierung</strong> aus der Praxis der verfassten Kirche<br />
<strong>Antje</strong> <strong>Pech</strong><br />
Geben und Nehmen als Grundkonsens der Zusammenarbeit. . . . . 257<br />
Interview mit Oliver Latzel, Vorstand Evangelischer<br />
Kirchenkreisverband Berlin Süd-West<br />
<strong>Familienorientierung</strong> ist ein Türöffner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264<br />
Interview mit Semra Başoğlu, Leiterin Stabstelle<br />
Organisationsentwicklung und Unternehmenskommunikation,<br />
Diakonie Altholstein GmbH<br />
Liste der Autorinnen und Autoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272<br />
11
Einführung<br />
<strong>Lars</strong> <strong>Charbonnier</strong>, <strong>Antje</strong> <strong>Pech</strong>,<br />
<strong>Franziska</strong> <strong>Woellert</strong> (Hrsg.)<br />
<strong>Familienorientierung</strong> <strong>stärken</strong><br />
Evangelische Arbeitgeber zwischen Innovation<br />
und Tradition<br />
Wir leben in einer Zeit mit weitreichenden gesellschaftlichen<br />
Veränderungen, in der viele bisher geltende Prämissen, Grenzen<br />
und Normen ins Wanken geraten: Demografischer Wandel,<br />
Individualisierung, Globalisierung und Diversität rütteln<br />
traditionelle soziale Rollenbilder und persönliche Lebensläufe<br />
durcheinander. Technischer Fortschritt und Digitalisierung<br />
ermöglichen uns völlig neue Wege, miteinander in Kontakt<br />
zu treten und unsere verschiedenen Lebensbereiche zu verbinden.<br />
Und in der Arbeitswelt 4.0 werden lange wirksame<br />
Glaubenssätze von Führung und Organisationskultur, von<br />
Beruf und Karriere, vom Wert der Arbeit und ihrem Sinn in<br />
Frage gestellt.<br />
Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat uns vor Augen<br />
geführt, wie schnell sich globale Ereignisse auf unsere eigene<br />
Gesellschaftsstruktur und in unseren individuellen Mikrokosmus<br />
hinein auswirken können. Sie zeigt auch auf, wie wichtig<br />
es ist, den sozialen Zusammenhalt zu <strong>stärken</strong>, um der gefühlten<br />
Entropie etwas entgegensetzen zu können. Doch es<br />
reicht nicht aus, all den Berufsgruppen, die Menschen in der<br />
Versorgung ihrer physischen und psychischen Grundbedürfnisse<br />
unterstützen, in Zeiten der allgemeinen Verunsicherung<br />
zu applaudieren. An der Arbeitssituation von Supermarktan-<br />
13
Einführung<br />
gestellten, Müllmännern und Feuerwehrfrauen, Pädagogen<br />
und Seelsorgerinnen bis hin zu den medizinischen Berufen<br />
und dem Pflegepersonal hat das bisher wenig geändert. Die<br />
Systemrelevanz der Berufsgruppen, die professionelle Care-<br />
Arbeit im weiteren Sinne übernehmen, muss sich in unserem<br />
gesellschaftlichen Hierarchiedenken erst noch durchsetzen,<br />
wenn wir für all diese Aufgaben auch zukünftig qualifizierte<br />
und engagierte Fachkräfte finden möchten. Schon heute bleiben<br />
viele dieser Stellen vakant, sodass Angebote im sozialen<br />
Kontext trotz wachsender Bedarfe in vielen Regionen nur noch<br />
eingeschränkt oder mit geminderter Qualität zu finden sind.<br />
Hier braucht es ein klares gesellschaftspolitisches Bekenntnis,<br />
das zu tatsächlichen Veränderungen führt, und innovative<br />
Gestaltungsräume, um von den aktuellen Entwicklungen<br />
nicht überrannt zu werden.<br />
Diese Entwicklungen gehen an der Evangelischen Kirche<br />
nicht vorbei. Kirche muss sich den Veränderungen stellen, die<br />
aus der wachsenden Komplexität rechtlicher Strukturen, in<br />
der Gesamtzahl zahlenmäßig abnehmender und alternder<br />
Mitglieder, schwindender finanzieller Mittel und dem Fachkräftemangel<br />
resultieren. Angesichts dieser Aufgaben sind die<br />
Stärken eines über Jahrhunderte gewachsenen kirchlichen<br />
Selbstverständnisses gleichzeitig die Schwächen. Veränderungen<br />
passieren im kirchlichen Kontext meist aus einem ba -<br />
sisdemokratischen Verständnis heraus lähmend langsam.<br />
Innovative Ideen treffen auf formale Strukturen, die Entscheidungen<br />
auf größerer Ebene verunmöglichen oder verwässern.<br />
Das hohe Engagement vieler kreativer und einsatzbereiter<br />
Menschen trägt im kleinen Raum, wird aber selten gesamtgesellschaftlich<br />
wahrgenommen.<br />
Dabei kann und sollte Kirche – und mit ihr die Diakonie –<br />
schon aus ihrem Selbstverständnis heraus sichtbar und hörbar<br />
14
Einführung<br />
sein, wenn es darum geht, miteinander neue Ideen zu entwickeln,<br />
um den gesellschaftlichen Wandel zu gestalten. Kirche<br />
kann einerseits einen Raum schaffen, um in einer Zeit der unsicheren<br />
Entwicklungen Orientierung und Halt anzubieten.<br />
Andererseits kann Kirche als Impulsgeberin mit innovativen<br />
Ideen nach vorne schauen, eine Experimentierfläche für gesellschaftlichen<br />
Wandel schaffen und dabei selbst als gutes<br />
Beispiel vorangehen.<br />
Wie das gelingen kann, zeigt beispielhaft das Evangelische<br />
Gütesiegel <strong>Familienorientierung</strong> – ein gemeinsames Angebot<br />
der Evangelischen Kirche und der Diakonie. Vorbilder schaffen,<br />
Werte leben und Veränderung gestalten sind auch hier die wesentlichen<br />
Merkmale, für die das Evangelische Gütesiegel <strong>Familienorientierung</strong><br />
steht. Denn die sichtbare und transparente<br />
Ausgestaltung betriebsinterner Maßnahmen zur Vereinbarkeit<br />
von Beruf und Familie tragen nicht nur dazu bei, Mitar -<br />
beitende zu halten und neue Fachkräfte zu gewinnen. Familienorientierte<br />
Personalpolitik hat sich vor allem als zentraler<br />
Ansatzpunkt zur Förderung einer zeitgemäßen Unternehmens-<br />
und Führungskultur bewährt. Hier kann Kirche zeigen,<br />
dass sie das, was sie predigt, auch im eigenen Umfeld<br />
umsetzt.<br />
Die vorliegende Publikation greift diesen Gedanken auf.<br />
Von unterschiedlichen Perspektivebenen werden die aktuellen<br />
Trends auf dem Arbeitsmarkt diskutiert und mit den Chancen<br />
einer starken familienorientierten Personalpolitik in Kirche<br />
(und Diakonie) in Zusammenhang gebracht. Der erste Teil<br />
gibt einen Überblick über wesentliche Veränderungsprozesse,<br />
die den kirchlichen und sozialen Arbeitsmarkt im Allgemeinen<br />
betreffen. Im zweiten Teil geht es explizit um Fragestellungen<br />
und Lösungsansätze, die sich aus den Veränderungsprozessen<br />
im Kontext kirchlicher Arbeits- und Lebenswelten ergeben.<br />
15
Einführung<br />
Der dritte Teil zeigt anhand von praktischen Beispielen Umgangsweisen<br />
für evangelische Arbeitgebende auf.<br />
Die Publikation ist entstanden aus einer Zusammenarbeit<br />
der Führungsakademie für Kirche und Diakonie (fakd), dem<br />
Evangelischen Gütesiegel <strong>Familienorientierung</strong> und <strong>Antje</strong><br />
<strong>Pech</strong>, Superintendentin des Kirchenbezirkes Löbau-Zittau,<br />
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens. Die Führungsakademie<br />
für Kirche und Diakonie, vertreten durch den<br />
damaligen Geschäftsführer Peter Burkowski und dem jetzigen<br />
Geschäftsführer Dr. <strong>Lars</strong> <strong>Charbonnier</strong>, hat die Entstehungsund<br />
Gestaltungsgeschichte des Evangelischen Gütesiegels <strong>Familienorientierung</strong><br />
von Anfang an begleitet und unterstützt.<br />
Die Leistung und das Engagement von Dr. Silke Köser, Studienleiterin<br />
bei der fakd, sei hier noch besonders hervorgehoben.<br />
Ohne den unermüdlichen Einsatz von Dr. Köser und ihren<br />
festen Glauben an den Erfolg des Zertifizierungsangebotes<br />
würde es das Evangelische Gütesiegel <strong>Familienorientierung</strong><br />
in seiner jetzigen Form nicht geben. <strong>Franziska</strong> <strong>Woellert</strong> leitet<br />
seit 2016 das Evangelische Gütesiegel <strong>Familienorientierung</strong><br />
und hat das Zertifizierungsverfahren maßgeblich gestaltet<br />
und umgesetzt. <strong>Antje</strong> <strong>Pech</strong> hat als Superintendentin des Kirchenbezirkes<br />
Löbau-Zittau 2018/19 an der Pilotphase zum<br />
Evangelischen Gütesiegel <strong>Familienorientierung</strong> teilgenommen<br />
und mit als Erstes bewiesen, dass eine strukturell verankerte<br />
familienorientierte Personalpolitik in allen kirchlichen Strukturen<br />
sinnvoll umgesetzt und gelebt werden kann.<br />
16
Erster Teil:<br />
Trends und<br />
Entwicklungen
Maria Loheide und Hanna Pistorius<br />
Familien in der neuen<br />
Arbeitswelt<br />
1. Familie heute<br />
Die Familie ist der wichtigste Lebensbereich für die Menschen<br />
in Deutschland. Das hat sich trotz aller gesellschaftlicher<br />
Veränderungen in den letzten Jahren nicht geändert. Statistiken<br />
zeigen in den vergangenen 15 Jahren ein nahezu un -<br />
verändertes Bild, wonach für 77 Prozent der Menschen die<br />
Familie der wichtigste Lebensbereich ist, noch vor dem Beruf<br />
und Freunden (BMFSFJ 2020: 35). Was sich jedoch geändert<br />
hat, ist das, was als Familie angesehen und wie sie gestaltet<br />
und gelebt wird. Familie ist nicht mehr nur die<br />
Kernfamilie aus Mutter, Vater und ein bis zwei leiblichen<br />
Kindern. Aus evangelischer Perspektive werden unter Familie<br />
alle Lebensformen gefasst, bei dem Menschen direkte<br />
Verantwortung für andere übernehmen. Der Familienstand<br />
ist dabei irrelevant, und es spielt keine Rolle, welches Geschlecht<br />
die Menschen haben und ob sie sich um Kinder oder<br />
pflegebedürftige Angehörige kümmern. Familie wird als<br />
verlässliche und sorgende Gemeinschaft verstanden, die es zu<br />
<strong>stärken</strong> gilt. Familie bezeichnet Stief- und Patchworkkon -<br />
stellationen, Alleinerziehende, Pflegefamilien, Regenbogenfamilien,<br />
unverheiratete und verheiratete Eltern und komplexe<br />
familiäre Beziehungen gleichermaßen. Dieses Familienbild<br />
wird von einem Großteil der Bevölkerung geteilt (BMFSFJ<br />
2020: 36).<br />
19
Maria Loheide und Hanna Pistorius<br />
Neben der Zusammensetzung der Familien hat sich auch<br />
das Rollenverständnis der Familienmitglieder verändert. Das<br />
klassische Familienbild ist durch das Ideal der bürgerlichen<br />
Familie geprägt, das im 18. Jahrhundert durch die Trennung<br />
von männlicher Erwerbswelt und weiblicher Familiensphäre<br />
entstanden ist. Das klassische Familienbild hat sich im Nachkriegsdeutschland<br />
zum gesellschaftlichen Leitbild entwickelt<br />
(Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 2013: 31ff.). Während<br />
der Mann/Vater nach diesem Leitbild einer Erwerbsarbeit<br />
nachging, übernahm die Frau/Mutter sämtliche Sorgearbeiten<br />
in Familie und Haushalt, wie Organisation des Familienalltags,<br />
Kinderbetreuung, Haushaltsführung und häufig auch Pflege<br />
und Unterstützung von Angehörigen oder Nachbar:innen.<br />
Dieses Bild hat sich in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr<br />
verändert. Im europäischen Vergleich ist in Deutschland der<br />
Wunsch nach einer gleichberechtigteren Aufgabenteilung zwischen<br />
Frauen und Männern überdurchschnittlich hoch ausgeprägt.<br />
Das Rollenbild von Müttern und Vätern hat sich<br />
schrittweise angenähert. Die Erwerbstätigkeit gehört heute<br />
selbstverständlich zum Rollenverständnis von Müttern, und<br />
Verantwortung für die Kinderbetreuung wird von Vätern<br />
heute von der Mehrheit der Bevölkerung selbstverständlich<br />
erwartet (BMFSFJ 2020: 129).<br />
Doch wie sieht die Realität tatsächlich aus? Mütter sind<br />
zunehmend erwerbstätig, allerdings ist die Erwerbsbeteiligung<br />
von Müttern in hohem Maße abhängig von dem Alter ihrer<br />
Kinder. Mütter von Kindern unter drei Jahren waren 2019 nur<br />
zu etwa einem Drittel erwerbstätig. Zudem arbeiteten in dieser<br />
Gruppe mehr als zwei Drittel in Teilzeit. Während die Teilzeitquote<br />
bis zur Volljährigkeit des jüngsten Kindes durch -<br />
gehend zwischen 46 und 51 Prozent liegt, wächst mit zunehmendem<br />
Alter des Kindes die Vollzeitquote der Mütter<br />
20
Familien in der neuen Arbeitswelt<br />
kontinuierlich an, erreicht aber lediglich einen Höchstwert<br />
von 30 Prozent (jüngstes Kind zwischen 15 und 18 Jahre).<br />
Dagegen ist die Vollzeiterwerbstätigkeit für Väter nach wie<br />
vor noch die Regel. Väter sind – fast unabhängig vom Alter des<br />
jüngsten Kindes – deutlich häufiger erwerbstätig als Mütter<br />
(zwischen 81 und 85 Prozent) und das überwiegend in Vollzeit<br />
(zwischen 75 und 81 Prozent). Teilzeitarbeit spielt mit rund<br />
5,8 Prozent unter den erwerbstätigen Vätern weiterhin kaum<br />
eine Rolle (Statistisches Bundesamt 2020).<br />
In dem Maße, in dem Frauen in Erwerbsarbeit einsteigen,<br />
reduzieren Väter ihre Stundenzahl nicht. Dadurch entsteht<br />
die Frage, wer die Sorgearbeit übernimmt, die in der traditionellen<br />
Rollenverteilung von den Frauen ausgeführt wurde.<br />
Denn der Aufwand an Sorgearbeit bleibt bestehen, auch wenn<br />
Frauen einer bezahlten Tätigkeit nachgehen. Solange diese<br />
Frage ungelöst ist, entstehen Probleme in der Vereinbarkeit<br />
von Familie und Beruf.<br />
Eine Möglichkeit zur besseren Vereinbarkeit besteht darin,<br />
die Sorgearbeit in professionelle Hände abzugeben. Heute hat<br />
jedes Kind in Deutschland ab einem Jahr einen Anspruch auf<br />
einen Platz in einer Kindertagesbetreuung. Auch der Bedarf<br />
an Plätzen zur Pflege von pflegebedürftigen Menschen steigt<br />
kontinuierlich an (Statistisches Bundesamt 2021, Bertelsmann<br />
Stiftung 2012: 10f.). Doch mit der Betreuung kleiner Kinder<br />
und der Pflege und Versorgung älterer oder kranker Menschen<br />
ist die Sorgearbeit nicht abgedeckt. Die Kinder müssen morgens<br />
angezogen, in die Kita gebracht und wieder abgeholt,<br />
Arztbesuche müssen organisiert, Geschenke besorgt und Freizeitaktivitäten<br />
geplant werden. Und dabei muss auch die tägliche<br />
Hausarbeit wie Waschen, Putzen, Einkaufen und Kochen<br />
erledigt werden. Diese Tätigkeiten werden immer noch in der<br />
größten Mehrheit von Frauen und Müttern bewältigt. Aller-<br />
21
Maria Loheide und Hanna Pistorius<br />
dings übernehmen auch Väter immer häufiger diese Aufgaben<br />
(BMFSFJ 2020: 129).<br />
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist durch die zunehmende<br />
Erwerbstätigkeit von Müttern ein gesellschafts -<br />
relevantes Thema geworden, doch ist die Vereinbarkeitsfrage<br />
nicht mehr allein ein Frauenthema. Sie betrifft in wachsendem<br />
Maße alle Eltern und zunehmend auch Angehörige, die Pflegeaufgaben<br />
übernommen haben.<br />
Welche wirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz die<br />
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere die Betreuung<br />
von Kindern, hat, haben die Corona-Pandemie und die<br />
damit einhergehenden Schul- und Kitaschließungen sehr eindrücklich<br />
gezeigt. Die Berufstätigkeit ohne reguläre Kinderbetreuung<br />
aufrechtzuerhalten, hat viele Familien vor Heraus -<br />
forderungen gestellt, besonders diejenigen, in denen beide<br />
Elternteile vergleichsweise egalitär berufstätig waren (BMFSFJ<br />
2020: 21ff.). Den Familienalltag zu bewerkstelligen, gelang besonders<br />
gut den Eltern, deren Arbeitgeber:innen unkompliziert<br />
und schnell familienfreundliche Arbeitsbedingungen herstellen<br />
konnten (BMFSFJ 2020: 28).<br />
2. Die neue Arbeitswelt<br />
Die Corona-Pandemie, in der zeitweise sämtliche Betreuungs-,<br />
Bildungs- und Freizeiteinrichtungen für Kinder geschlossen<br />
wurden, hat wie ein Brennglas deutlich gemacht,<br />
welche wirtschaftliche Bedeutung die Vereinbarkeit von<br />
Familie und Beruf hat. Das wurde nicht nur in der breiten<br />
Öffentlichkeit so wahrgenommen, das haben auch die Unternehmen<br />
verinnerlicht: »82 Prozent der Unternehmen sagten,<br />
dass Kinderbetreuung ein zentraler Faktor für die Produktivität<br />
22
Dr. Regina Ahrens<br />
Betriebliches Familienbewusstsein<br />
und Doing Family<br />
1. Einführung<br />
Auf dem Weg in die neue Arbeitswelt gewinnt das Thema Employer<br />
Branding immer mehr an Bedeutung. Der Begriff steht<br />
für den Aufbau einer positiven Arbeitgebermarke und deren<br />
Kommunikation nach innen und außen. Ziel ist es, Beschäftigte<br />
an das Unternehmen beziehungsweise an die Organisation zu<br />
binden und Fachkräfte auf sich aufmerksam zu machen. Ein<br />
zentraler Bestandteil der Employer Brand ist in vielen Organisationen<br />
bereits heute das betriebliche Familienbewusstsein.<br />
Darunter werden all diejenigen Leistungen eines Unternehmens<br />
oder einer Organisation verstanden, die über die gesetzlichen<br />
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie<br />
(zum Beispiel Mutterschutz, Elternzeit, Recht auf Teilzeitarbeit<br />
während der Elternzeit, Kinderkrankentage, staatlich subventionierte<br />
Kinderbetreuungsinfrastruktur) hinausgehen.<br />
Aufgrund demografischer und gesellschaftlicher Entwicklungen<br />
hat sich allerdings das, was wir »Familie« nennen, in<br />
den letzten Jahrzehnten verändert. Familien bestehen nicht<br />
mehr nur aus der klassischen Vater-Mutter-Kind-Konstellation,<br />
sondern sind bunter geworden: Es gibt zum Beispiel immer<br />
mehr Patchwork-Familien, Ein-Eltern-Familien und Regenbogenfamilien.<br />
Gleichzeitig wünschen sich viele Menschen<br />
(vor allem Väter), mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.<br />
Und auch das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ge-<br />
30
Betriebliches Familienbewusstsein und Doing Family<br />
winnt an Bedeutung. Arbeitgebende stehen also vor der Her -<br />
ausforderung, mit ihrem betrieblichen Familienbewusstsein<br />
unterschiedliche Teilzielgruppen (innerhalb der großen Zielgruppe<br />
»Beschäftigte mit Familienpflichten«) adäquat anzusprechen.<br />
Es reicht nicht mehr aus, anhand betriebsinterner<br />
Daten zum Beispiel das Alter der Beschäftigten, den Familienstand<br />
oder die Anzahl der Kinder zu analysieren, um Rückschlüsse<br />
darauf ziehen zu können, wie das betriebliche Familienbewusstsein<br />
effektiv und effizient gestaltet werden kann.<br />
Erfolgsversprechender sind Analysen, die dem Gedanken von<br />
Familie als Herstellungsleistung Rechnung tragen.<br />
Mit dem Konzept des Doing Family stellt dieser Beitrag<br />
einen Ansatz vor, der Familie jenseits der (betrieblichen) Statistik<br />
in den Blick nimmt. Zu Beginn des Beitrags wird zunächst<br />
das Konzept des Doing Family vorgestellt. Darauf folgen<br />
Beispiele, wie in der Forschung Daten zum Doing Family erhoben<br />
werden. Abschließend wird erläutert, worauf Arbeitgebende<br />
bei der (Weiter-)Entwicklung eines betrieblichen Familienbewusstseins<br />
achten sollten – und wie ihnen das Doing-<br />
Family-Konzept dabei helfen kann.<br />
2. Wenn die Statistik nicht ausreicht: Doing Family<br />
als Lösungsansatz<br />
Die Corona-Pandemie hat (erneut) gezeigt, wie wichtig es ist,<br />
Familie differenziert zu betrachten. Dies fängt beim offensichtlichsten<br />
Differenzierungsmerkmal an: dem Geschlecht.<br />
Daten aus dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 zeigen beispielsweise,<br />
dass Väter deutlich stärker von Homeoffice-Regelungen<br />
profitierten als Mütter, da ihnen zu Hause häufiger<br />
ein ungestörter Arbeitsplatz zur Verfügung stand als Müttern<br />
31
Dr. Regina Ahrens<br />
(Zerle-Elsäßer/Buschmeyer/Ahrens 2022). Krankenkassendaten<br />
aus dem Jahr 2020 legen darüber hinaus nahe, dass Frauen im<br />
Corona-Jahr stärkeren psychischen Belastungen ausgesetzt<br />
waren als Männer (DAK 2021; Meyer 2021). Es wurde viel darüber<br />
gemutmaßt, ob die Corona-Pandemie zu Veränderungen<br />
bei der Aufteilung von (unbezahlter) Familienarbeit und (bezahlter)<br />
Erwerbsarbeit zwischen Frauen und Männern geführt<br />
hat. Zahlreiche Studien haben inzwischen gezeigt, dass es während<br />
des ersten Lockdowns zu einer Verfestigung der bereits<br />
vor der Pandemie bestehenden geschlechtsspezifischen Arbeitsaufteilung<br />
gekommen ist (Kreyenfeld et al. 2020; Möhring<br />
et al. 2020; Hank/Steinbach 2020; Kohlrausch/Zucco 2020; Zer -<br />
le-Elsäßer/Buschmeyer/Ahrens 2022; Buschmeyer/Ahrens/Zer -<br />
le-Elsäßer 2021; Ahrens 2021). Denn auch wenn viele Väter, vor<br />
allem solche mit einem niedrigen oder mittleren formalen<br />
Bildungsabschluss, während des ersten Lockdowns mehr Zeit<br />
als vor Beginn der Pandemie mit Hausarbeit und Kinderbetreuung<br />
verbrachten (Kreyenfeld/Zinn 2020), so waren es doch<br />
in der Mehrheit die Mütter, die ihre Erwerbsarrangements<br />
anpassten und den größeren Teil der durch Schul- und Kitaschließungen<br />
entstandenen zusätzlichen unbezahlten Arbeit<br />
übernahmen (Möhring et al. 2020; Kreyenfeld/Zinn 2020;<br />
Hank/Steinbach 2020; Kohlrausch/Zucco 2020).<br />
Diese Daten machen deutlich, dass es nicht ausreicht, Beschäftigte<br />
mit Familienpflichten allein anhand statistischer<br />
Daten zu betrachten und das betriebliche Familienbewusstsein<br />
basierend auf diesen Daten auf- und auszubauen. Denn die<br />
Statistik sagt uns nichts darüber, wie Familie tatsächlich gelebt<br />
wird und mit welchen Herausforderungen ihre Mitglieder es<br />
zu tun haben, wie stark sie durch die tägliche Anforderung,<br />
Beruf und Familie zu vereinbaren, belastet sind etc. Dieses<br />
Wissen ist aber für Arbeitgebende fundamental, wenn sie ihre<br />
32
Betriebliches Familienbewusstsein und Doing Family<br />
Beschäftigten effektiv und effizient bei der Vereinbarkeit von<br />
Beruf und Familie unterstützen möchten. Effektivität bedeutet<br />
in diesem Zusammenhang, dass es dem Arbeitgeber beziehungsweise<br />
der Arbeitgeberin möglich ist, anhand vorliegender<br />
Daten die (Teil-)Zielgruppen, die für die Umsetzung des<br />
betrieblichen Familienbewusstseins relevant sind, zu identifizieren.<br />
Effizienz bedeutet hier hingegen, dass diese (Teil-)Zielgruppen<br />
zudem entsprechend ihrer tatsächlichen Bedarfe<br />
adressiert und die betrieblichen Leistungen auch in Anspruch<br />
genommen werden können. So wird vermieden, dass Leistungen<br />
(weiter-)entwickelt werden, die von den Beschäftigten gar<br />
nicht gebraucht, entsprechend auch nicht in Anspruch genommen<br />
und im schlimmsten Fall sogar als »Marketing-Gag«<br />
wahrgenommen werden.<br />
Ein Ansatz, der dabei helfen kann, diese Effektivität und Effizienz<br />
zu erreichen, ist das Doing Family (Jurczyk 2014). Das<br />
Konzept des Doing Family trägt der Tatsache Rechnung, dass<br />
Familie nicht automatisch aufgrund von Verwandtschafts -<br />
beziehungen »passiert«, sondern vielmehr eine Herstellungsleistung<br />
ist, die von den Familienmitgliedern (all-)täglich erbracht<br />
werden muss. Verwandtschafts- und Haushaltsgrenzen<br />
spielen dabei eine untergeordnete Rolle: Auch eine Nachbarin,<br />
die regelmäßig und dauerhaft in die Kinderbetreuung in volviert<br />
ist, kann zum Beispiel von den Eltern der betreffenden Kinder<br />
als Familienmitglied gewertet werden. Das gleiche gilt für das<br />
Phänomen der Co-Elternschaft (oder auch Co-Parenting), bei<br />
dem zwei (oder mehr) Erwachsene, die nicht in einer romantischen<br />
Beziehung zueinander stehen, sich entscheiden, gemeinsam<br />
ein Kind großzuziehen. Gleichzeitig kann es sein, dass der<br />
Kontakt beispielsweise zu biologischen Eltern oder Geschwistern<br />
unterbrochen oder ganz eingestellt wird, diese Beziehungen<br />
also im Alltag keine Rolle mehr spielen. Familie wird im Doing<br />
33
Dr. Regina Ahrens<br />
Family also stärker über die gelebte Realität definiert als über<br />
Verwandtschaft. Verwandtschaft ist somit weder eine notwendige<br />
noch eine hinreichende Bedingung für Familie. Familie<br />
ist vielmehr ein Beziehungsgefüge, in dem Menschen Verantwortung<br />
füreinander übernehmen – unabhängig von Verwandtschaftsbeziehungen<br />
und Haushaltsgrenzen.<br />
Die Herstellungsleistung und das »Ergebnis sozialer Konstruktionsprozesse«<br />
(Jurczyk 2014: 119), die Familienmitglieder<br />
tagtäglich erbringen, werden im Doing-Family-Konzept unterteilt<br />
in das Vereinbarkeits- und Balancemanagement und in die<br />
sinnhafte Konstruktion eines gemeinschaftlichen Beziehungsgefüges.<br />
Mit dem Vereinbarkeits- und Balancemanagement sind die<br />
zahlreichen logistischen Abstimmungsprozesse innerhalb von<br />
Familien gemeint. Unter der sinnhaften Konstruktion eines<br />
gemeinschaftlichen Beziehungsgefüges wird die Herstellung<br />
von Intimität und einem Wir-Gefühl verstanden (Jurczyk 2018;<br />
Morgan 2011; Daly 2003). Doing Family betrachtet Familie also<br />
als Prozess und untersucht Praktiken und Interaktionen auf<br />
der Mikroebene, d. h. auf der Ebene der einzelnen Familienmitglieder.<br />
Dabei ist es stark geprägt vom Konzept des Doing<br />
Gender, denn es setzt »Männlichkeit und Weiblichkeit ebenso<br />
wenig mit Männern und Frauen gleich [...] wie Familie mit<br />
genetisch-biologischer Verwandtschaft, auch wenn es jeweils<br />
Überschneidungsmengen gibt beziehungsweise geben kann«<br />
(Ahrens/Buschmeyer/Zerle-Elsäßer 2022: 74). Viele Untersuchungen<br />
zum Doing Family setzen daher auch bei nicht-heteronormativen<br />
Familien (zum Beispiel Stieffamilien, Regenbogenfamilien)<br />
an, weil sich hier besonders gut zeigen lässt,<br />
wie Familie jenseits von vorgegebenen Normen gelebt wird.<br />
Wie zahlreiche Studien zeigen, setzen Mütter und Väter<br />
diese Herstellungsleistung unterschiedlich um. Dies äußert<br />
sich zum Beispiel dadurch, dass Mütter häufig als »Manage-<br />
34
Ulrich Lilie<br />
Arbeitswelt 4.0 –<br />
Diakonie im digitalen Wandel<br />
Herausforderungen und Chancen<br />
Es liegt auf der Hand: Die Digitalisierung verändert unsere<br />
Gesellschaft. Grundlegend. Und damit verändert sie auch die<br />
Arbeitsfelder von Kirche und Diakonie. Technologischen<br />
Fortschritt hat es zwar immer schon gegeben, aber das atemberaubende<br />
Tempo, die Disruptivität, mit der die Digitalisierung<br />
sich ihren Weg bahnt und Gestalt und Gestaltung der<br />
Gesellschaft in allen Lebensbereichen neu organisiert, ist beispiellos.<br />
Die Corona-Krise wirkt derzeit noch wie ein zusätzlicher<br />
Beschleuniger. Sie hat sehr viele Menschen gleichzeitig in den<br />
Modus des digitalen Selbstversuchs gezwungen – auch in der<br />
Diakonie. Unerfahrenheit, Fehlerfreundlichkeit und steile<br />
Lernkurven haben in Arbeitsprozessen seitdem eine andere<br />
Selbstverständlichkeit gewonnen. Digitale Tools ermöglichten<br />
und ermöglichen Erfahrungen mit Arbeits- und Kommunikationsformen,<br />
die den Primat der Präsenz am Arbeitsplatz<br />
aufgeweicht haben. Sie halfen, »über Nacht« althergebrachte<br />
Gewohnheiten aufzulösen, Unternehmenskulturen zu verändern<br />
und neue unbekannte Wege zu erproben.<br />
Die krisenhaften Umstände erforderten schnelles Reagieren,<br />
regelmäßiges Informieren und gute Absprachen. Das hat<br />
uns alle getroffen – ob als Vorständin eines Verbandes oder als<br />
Mitarbeiter in der Familienberatung. Und wir alle haben die<br />
52
Arbeitswelt 4.0 – Diakonie im digitalen Wandel<br />
Erfahrung gemacht, dass die Ergebnisse sich oft sehen lassen<br />
konnten. Nicht perfekt vielleicht, aber sehr brauchbar, um<br />
weiterzumachen. Ohne Digitalisierung wäre das schwieriger<br />
gewesen.<br />
Gleichzeitig ist es nicht zuletzt diese Disruptivität, die<br />
Befürchtungen vor einem individuellen, aber auch institutionellen<br />
Kontrollverlust über Technologien oder digitale Systeme<br />
auslöst. Auch in den Unternehmen und Einrichtungen der<br />
Diakonie fällt es vielen schwer, offen und unvoreingenommen<br />
an diese Prozesse heranzugehen. Und noch schwerer fällt, sich<br />
ihnen anzuvertrauen. Nur: Mit der Digitalisierung ist es wie<br />
beim Schwimmen – man muss ins Wasser, auch, wenn man<br />
noch lernt.<br />
Dennoch sind die Bedenken selbstverständlich ernst zu<br />
nehmen. Ich persönlich halte auch die Chancen der Digitalisierung<br />
zwar für sehr hoch, aber die zu erwartenden Umwälzungen<br />
bergen eben gleichzeitig erhebliche Risiken: Eine viel<br />
diskutierte und zu Recht auch umstrittene Studie der Organisation<br />
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung<br />
(OECD) prognostiziert, dass fast die Hälfte aller Arbeitsplätze<br />
der 32 Staaten, die an der Untersuchung teilgenommen<br />
haben, durch Algorithmen und Maschinen ganz oder teilweise<br />
bedroht, in jedem Fall von fundamentalen Veränderungen betroffen<br />
sein werden. Und nicht jede neue Stelle in der Digitalwirtschaft<br />
kann wieder mit den Personen besetzt werden, deren<br />
bisherige Tätigkeit entfällt. Es geht um Qualifikationen<br />
mit hohen Anforderungsprofilen. Am härtesten treffen wird<br />
es Menschen, die im industriellen »Low Skill«-Bereich arbeiten.<br />
Ohne Zweifel zieht der digitale Wandel erhebliche soziale Veränderungen<br />
nach sich.<br />
Der prominente deutsche Soziologe Andreas Reckwitz<br />
spricht in diesem Zusammenhang von einer neuen Klassen-<br />
53
Ulrich Lilie<br />
gesellschaft mit einem sich verfestigenden Drittel der Bevölkerung,<br />
die zukünftig von prekären oder mehreren Mini-Jobs<br />
in der neuen Unterschicht leben müssen und keine realen Aufstiegschancen<br />
haben. Die Verwerfungen, die mit diesen Entwicklungen<br />
verbunden sind, sind neben den materiellen Folgen<br />
vor allem kulturelle und politische Abwertungsprozesse,<br />
die die zunehmende politische Spaltung und populistische<br />
Tendenzen auch in unsrem Land erklären helfen. Dass sie nicht<br />
zu grundlegenden Verwerfungen werden, ist Teil auch der<br />
diakonischen Verantwortung. Sich dem Prozess der Digitalisierung<br />
aber einfach zu verweigern, ist keine Option. Es gilt<br />
vielmehr, ihn teilhabe- und chancengerecht zu gestalten.<br />
Die Chancen, diesen Umbruch aus unserem eigenen sozialethischen<br />
Verständnis so mitzugestalten, dass die Digitalisierung<br />
für möglichst viele Menschen zu einem echten Gewinn<br />
wird, sind enorm. Aufgabe der Diakonie wird es sein, gemeinsam<br />
mit anderen Aufmerksamen diesen Prozess so zu begleiten,<br />
dass die sozialen und kulturellen Folgen stets im Blick<br />
bleiben und niemand zurückgelassen wird.<br />
Unsere Gesellschaft befindet sich schon längst auf dem<br />
Weg dieser unumkehrbaren und tiefgreifenden Transformation.<br />
Und darum sind ihre Institutionen, der Staat, die Zivilgesellschaft<br />
– und in ihr eben auch die Diakonie – mehr denn<br />
je gefordert, die Gratwanderung zwischen Bewahren und Gestalten<br />
einerseits und der Fähigkeit zu schnellen und tiefgreifenden<br />
Veränderungen andererseits, auch was Geschäftsmodelle<br />
und Angebote angeht, zu meistern. Ein Zurück gibt es<br />
nicht mehr. Gerade um der Menschen willen.<br />
Eine große Anzahl diakonischer Einrichtungen hat sich<br />
längst auf den Weg gemacht, diese Chancen für ihre Unternehmen,<br />
für Klient:innen und Mitarbeitenden zu nutzen. Das<br />
belegt beispielweise die Studie »Erfolgsfaktor Digitalisierung.<br />
54
Arbeitswelt 4.0 – Diakonie im digitalen Wandel<br />
Auf dem Weg zur Sozialwirtschaft 4.0«, die im Jahr 2020 von<br />
der Bank für Sozialwirtschaft vorgestellt wurde (Bank für<br />
So zialwirtschaft 2020).<br />
In Kliniken und stationären Einrichtungen können digitale<br />
Helfer dazu beitragen, den Arbeitsalltag des Personals wie der<br />
Klienten und Bewohnerinnen zu vereinfachen – sei es durch<br />
Unterstützung mit Pflegerobotern, durch die digitale Erfassung<br />
von freien Betten oder elektronische Krankenakten. Auch<br />
die flexiblere Gestaltung von Arbeitszeiten, die bessere Planung<br />
von Touren, unkompliziertere Teamabsprachen oder die Möglichkeit,<br />
Dokumentationen ortsunabhängig durchzuführen,<br />
helfen Zeit und Informationen zu gewinnen. Wo das gelingt,<br />
werden die Pflegenden entlastet, was wieder den Patient:innen<br />
zugute kommt.<br />
Digitale Vernetzung ermöglicht insgesamt ein nie gekanntes<br />
Ausmaß an interaktiven und direkten Kommunikationsmöglichkeiten<br />
und für manche Tätigkeiten neue Möglich -<br />
keiten ortsunabhängigen oder zeitversetzten Arbeitens.<br />
Entsprechend stellen die Digitalisierung und die damit verbundenen<br />
grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen<br />
vor zahlreiche neue ethische, fachliche sowie organisatorische,<br />
kommunikative und kulturelle Herausforderungen. Und zwar<br />
gleichzeitig. Sich damit nicht auseinanderzusetzen wäre fahrlässig.<br />
1 Aber es braucht Kriterien.<br />
Für mich hat sich in der ethischen Perspektive die schlichte<br />
Prämisse bewährt, dass die Technik (wie auch die Ökonomie<br />
1<br />
Der V3D macht darauf aufmerksam, dass sich die Organisations- und Personalentwicklung<br />
in der Diakonie ändern müssen. Die vier Handlungsfelder<br />
Arbeitszeit & Selbstorganisation, Agiles Arbeiten, Wissen & Qualifikation<br />
und Kommunikation im Unternehmen geraten hier verstärkt in den Focus<br />
(Bundesverband diakonischer Einrichtungsträger (V3D) 2021).<br />
55
<strong>Franziska</strong> <strong>Woellert</strong><br />
Weniger, älter, vielfältiger<br />
Wo steht der demografische Wandel heute?<br />
Über den demografischen Wandel in Deutschland wurde in<br />
den letzten zwei Jahrzehnten so viel geschrieben und diskutiert,<br />
dass der Eindruck entstehen könnte, inzwischen sei alle<br />
Brisanz aus dem Thema gewichen. Man könnte meinen, es<br />
seien alle wichtigen Weichen gestellt, um mit den aus der Entwicklung<br />
der Bevölkerungsstruktur resultierenden Herausforderungen<br />
umgehen zu können – als hätten wir das Gröbste<br />
überstanden, ohne groß Federn lassen zu müssen.<br />
Doch das Tückische an demografischen Trends ist, dass sie<br />
zwar frühzeitig erkennbar sind, sich aber so langsam vollziehen,<br />
dass sich ihre Auswirkungen erst über Jahrzehnte hinweg<br />
zeigen. Probleme, die sich derart lange hinziehen und erst<br />
künftige Generationen betreffen, werden in unserer gesellschaftspolitischen<br />
Wahrnehmung oft an den Rand gedrängt.<br />
So passiert es immer wieder, dass wir uns gefühlt ad hoc mit<br />
Herausforderungen beschäftigen, die eigentlich schon lange<br />
bekannt sind. Im Kontext der demografischen Entwicklung<br />
ist der Pflegenotstand unter dem Brennglas der Corona-Pandemie<br />
ein Beispiel dafür. Niemand, der oder die sich mit dem<br />
Pflegesystem in Deutschland schon einmal eingehend beschäftig<br />
hat, wird von der aktuellen Situation überrascht sein. In<br />
der breiten Gesellschaft kam die Sorge um die ausreichende<br />
Versorgung von kranken oder schwachen Mitmenschen jedoch<br />
erst zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 richtig an.<br />
Diejenigen, die plötzlich in ihren Wohnungen und Häusern<br />
59
<strong>Franziska</strong> <strong>Woellert</strong><br />
festsaßen, klatschten den »Helden« in den Kliniken und Pflegeheimen<br />
Beifall. Zu einer spürbaren Verbesserung der Arbeitsbedingungen<br />
des Pflegepersonals oder gar zu weitreichenden<br />
neuen Ansätzen, um dem wachsenden Bedarf an<br />
Pflegekräften in Zukunft besser begegnen zu können, hat dies<br />
allerdings bisher nicht geführt. Dabei ist die gesamtgesellschaftliche<br />
Neuorganisation von Fürsorgeaufgaben eine der<br />
wesentlichen Herausforderungen, die der demografische Wandel<br />
mit sich bringt.<br />
Schon vor 30 Jahren, nämlich 1992, beauftragte die Bundesregierung<br />
eine Enquête-Kommission, um die Folgen der<br />
demografischen Entwicklung auf die Gesellschaft zu untersuchen.<br />
In den darauffolgenden zehn Jahren erstellte diese<br />
Kommission verschiedene Gutachten mit zum Teil aufrüttelnden<br />
Ergebnissen und Empfehlungen. Doch es dauerte weitere<br />
zehn Jahre, bis die Bundesregierung 2012 eine erste Demografiestrategie<br />
mit eher beschreibendem als innovativem<br />
Charakter vorlegte.Die dort genannten Handlungsfelder und<br />
Ziele wurden zwar bis 2015 weiterentwickelt und etwas geschärft.<br />
Doch das inzwischen schon ein wenig in die Jahre gekommene<br />
Dokument liest sich noch immer so, als ließe sich<br />
dem demografischen Wandel im Wesentlichen mit kleineren<br />
Anpassungsmaßnahmen begegnen, die zwar etwas Anstrengung<br />
bedürfen, ohne aber grundsätzlich etwas ändern zu müssen<br />
(BMI 2017).<br />
Dabei wird das, was uns demografisch erwartet, zu viel<br />
größeren Umwälzungen führen, als den meisten vermutlich<br />
bewusst ist. Und auch, wenn die ersten Anzeichen davon schon<br />
erkennbar sind: der eigentliche Wandel steht uns erst noch<br />
bevor.<br />
60
Weniger, älter, vielfältiger<br />
1. Daten und Fakten zum demografischen Wandel<br />
in Deutschland<br />
Vorhersagen zur demografischen Zusammensetzung einer<br />
Bevölkerung basieren auf Annahmen zur natürlichen Bevölkerungsentwicklung,<br />
also den Geburten- und Sterbezahlen,<br />
sowie der Nettozuwanderung. Dabei gilt die natürliche Bevölkerungsentwicklung<br />
als eigentlicher Treiber langfristiger<br />
Veränderungen, während Zu- und Abwanderungsbewegungen<br />
kurzfristigen Schwankungen unterworfen sind. Im Folgenden<br />
werden die drei Faktoren etwas genauer beleuchtet.<br />
Entwicklung der Lebenserwartung im<br />
gesellschaftlichen Kontext<br />
Ein Blick auf die Entwicklung der Lebenserwartung in<br />
Deutschland zeigt ein für westliche Industrieländer recht typisches<br />
Bild: Sie steigt seit Jahrzehnten kontinuierlich an.<br />
Konnte ein 1920 in Deutschland geborenes Mädchen durchschnittlich<br />
mit 64,7 und ein Junge mit 57,5 Lebensjahren rechnen,<br />
waren es für um 1970 geborene Kinder schon 83,7 respektive<br />
78,2 Lebensjahre. Ein heute geborenes Mädchen lebt sogar<br />
durchschnittlich 86,9 und ein Junge 82,9 Jahre (Destatis 2021a).<br />
Damit haben die Deutschen in nur einem Jahrhundert mehr<br />
als 20 Lebensjahre dazugewonnen! Und nicht nur werden die<br />
Menschen älter, sie leben auch gesünder und erhalten sich<br />
diese Gesundheit oft bis ins hohe Alter hinein. Die Wahrscheinlichkeit,<br />
an alterstypischen Krankheiten wie Demenz zu<br />
erkranken, steigt erst mit dem 80. Lebensjahr deutlich an<br />
(Amrhein et al. 2015). Ab diesem Alter steigt auch der Anteil<br />
der Pflegebedürftigen: Sind bei den 70- bis 75-Jährigen nur 7,6<br />
Prozent pflegebedürftig, sind es bei den 80- bis 85-Jährigen<br />
61
<strong>Franziska</strong> <strong>Woellert</strong><br />
schon 26,4 Prozent und bei den Menschen im Alter ab 90 Jahren<br />
76,3 Prozent (Destatis 2020a).<br />
Abbildung 1: Altersaufbau der deutschen Bevölkerung<br />
Die sogenannte Bevölkerungspyramide Deutschlands ist schon lange<br />
keine Pyramide mehr, sondern hat eher die Form eines Weihnachtsbaums.<br />
Die breiten »Zweige« werden durch die geburtenstarken Jahrgänge<br />
der Nachkriegszeit (= Babyboomer) geformt, während der schmalere<br />
»Stamm« auf die seit Jahrzehnten rückgängigen Geburtenzahlen<br />
zurückzuführen ist. In Folge altert die deutsche Gesellschaft stetig, wie<br />
hier der Vergleich der Bevölkerungsstruktur von 1990 und 2019 zeigt.<br />
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) (2020b).<br />
Durch den Anstieg der Lebenserwartung leben immer mehr<br />
ältere Menschen in Deutschland. Schon heute liegt der Anteil<br />
der Bevölkerung über 64 Jahre bei 22 Prozent. 2030 wird er auf<br />
26 Prozent und 2060 auf 30 Prozent steigen. Das heißt, dass<br />
62
Weniger, älter, vielfältiger<br />
dann in Deutschland nahezu jede dritte Person 65 Jahre und<br />
älter ist. Jede neunte Person wird sogar das 80. Lebensjahr überschritten<br />
haben, anteilig etwa doppelt so viele wie heute (Destatis<br />
2021b). In Folge wird es auch immer mehr Pflegebedürftige<br />
geben. 1999 wurden 2,02 Millionen Pflegebedürftige<br />
gezählt. 20 Jahre später hat sich diese Zahl auf 4,13 Millionen<br />
pflegebedürftige Personen verdoppelt (ein Teil dieses Anstiegs<br />
geht auf die 2017 veränderten Pflegestufen zurück). Die Prognosen<br />
gehen aufgrund der fortschreitenden Alterung von weiterwachsenden<br />
Zahlen aus. Eine große Herausforderung wird<br />
die Versorgung der älteren Menschen. Heute werden vier von<br />
fünf der Pflegebedürftigen in ihrer Familie versorgt, dabei<br />
überwiegend von Frauen, zwei Drittel davon ohne Hilfe eines<br />
ambulanten Pflegedienstes (Destatis 2021c). Doch immer mehr<br />
Menschen leben im Alter allein und können nicht auf die Hilfe<br />
aus der Familie zurückgreifen. Dadurch wächst die Nachfrage<br />
nach professionellen Pflegedienstleistungen stetig. Allein von<br />
2005 bis 2019 stieg die Anzahl der in Heimen vollstationär versorgten<br />
Pflegebedürftigen um 24,5 Prozent, bei den ambulanten<br />
Diensten sogar um 108 Prozent (Destatis 2020c).<br />
Die sozialen Dienstleister wie Pflegeheime oder ambulante<br />
Pflegedienste haben schon jetzt mit einem enormen Personalengpass<br />
zu kämpfen, der sich aufgrund der demografischen<br />
Entwicklung weiter verschärfen wird. Laut den Analysen der<br />
Bundesagentur für Arbeit blieben im Jahr 2020 offene Stellen<br />
für Altenpflegefachkräfte im Bundesdurchschnitt 212 Tage<br />
lang unbesetzt. Das wundert nicht, wenn man bedenkt, dass<br />
in diesem Jahr auf 100 offene Stellen nur 33 arbeitslose Altenpflegekräfte<br />
gemeldet waren, trotz einem leichten Anstieg aller<br />
in der Pflege Beschäftigten (BGM 2021). Das Institut der Deutschen<br />
Wirtschaft berechnete 2018, dass bis 2035 eine halbe Million<br />
Pflegekräfte gebraucht werden – ein Plus von 44 Prozent<br />
63
Prof. Dr. Bettina Hollstein<br />
Vom Ehrenamt zu Volunteering 1<br />
1. Vom Strukturwandel des Ehrenamts<br />
Unsere Gesellschaft wandelt sich. Darüber besteht in der Regel<br />
Einigkeit. Keine Einigkeit besteht hingegen in der Diagnose,<br />
worin dieser Wandel genau besteht. In Bezug auf das Ehrenamt<br />
gibt es die These vom Strukturwandel des Ehrenamts 2 , der zufolge<br />
wir es hier vor allem mit einem von den Handlungsmotiven<br />
der Einzelnen weitgehend unabhängigen gesellschaftlichen<br />
Prozess zu tun hätten. Die These besagt, dass ein Wandel von<br />
einem gemeinwohlorientierten, langfristigen Ehrenamt altruistisch<br />
gesonnener Ehrenamtlicher in Traditionsverbänden<br />
(wie den Kirchen) zu einem projektbezogenen, kurzfristigen,<br />
bürgerschaftlichen Engagement eigennutzorientierter Individuen<br />
in Non-Profit-Organisationen stattfindet (Beher et al.<br />
2000). Diese Entwicklung, die von einigen Autoren bedauert 3 ,<br />
von anderen begrüßt wird, wird in der Regel als quasi notwendige<br />
Folge von gesellschaftlichen Modernisierungspro-<br />
1<br />
Ich greife in diesem Beitrag auf Erkenntnisse zurück, die ich in meinem<br />
Buch »Ehrenamt verstehen« ausführlicher entwickelt habe (Hollstein 2015).<br />
2<br />
Entfaltet wurde diese These u. a. in der Studie von Karin Beher, Reinhard<br />
Liebig und Thomas Rauschenbach: Strukturwandel des Ehrenamts (Beher/<br />
Liebig/Rauschenbach 2000).<br />
3<br />
Aus feministischer Perspektive diskutiert diesen behaupteten Wandel kritisch<br />
Gisela Notz (Notz 1999).<br />
79
Prof. Dr. Bettina Hollstein<br />
zessen dargestellt. Modernisierung der Gesellschaft besteht<br />
in dieser Perspektive in der Verknüpfung von Prozessen der<br />
zunehmenden Individualisierung, Säkularisierung und Ökonomisierung.<br />
Verdeutlicht wird dieser Wandel durch die<br />
Veränderung der Begriffe, mit denen dieses Phänomen beschrieben<br />
wird. Die altruistischen, normen- beziehungsweise<br />
wertorientierten Ehrenamtlichen werden zu eigennutzorientierten<br />
aktiv Engagierten.<br />
Tatsächlich kann man in Deutschland für das 20. Jahrhundert<br />
einen Zerfall von sozio-moralischen Milieus beobachten,<br />
etwa der religiösen – katholischen wie evangelischen – Milieus<br />
oder des Arbeitermilieus. Diese sozialen und weltanschau -<br />
lichen Gemeinschaften, in die die Menschen hineingeboren<br />
wurden, die ihre Sinnsysteme und ihre Weltbilder prägten<br />
und eine Orientierung in der Lebensführung boten, haben<br />
sich seit den 1970er Jahren aufgelöst. Menschen sind nicht<br />
mehr an ihr Ursprungsmilieu gebunden und können andere<br />
Lebenswege einschlagen. Damit ist auch ein Zugewinn an individueller<br />
Freiheit verbunden, da diese Milieus nicht nur Sicherheit<br />
in einer Gemeinschaft boten, sondern auch beengend<br />
und einschränkend wirken konnten.<br />
Ein Ausgangspunkt für diese These des Strukturwandels<br />
des Ehrenamts ist die Diagnose einer allgemeinen Individualisierung<br />
von Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim 4 . Individualisierung<br />
wird hier verstanden als Abbau traditionaler<br />
Bindungen an Milieus und Weltanschauungen und Entstehung<br />
einer Multioptionsgesellschaft in Bezug auf Lebensfüh-<br />
4<br />
»Individualisierung meint zum einen die Auflösung vorgegebener sozialer<br />
Lebensformen [...]« (Beck/Beck-Gernsheim 1994: 11). »Individualisierung,<br />
so gesehen, ist eine gesellschaftliche Dynamik, die nicht auf einer freien<br />
Entscheidung der Individuen beruht.« (Beck/Beck-Gernsheim 1994: 14).<br />
80
Vom Ehrenamt zu Volunteering<br />
rung, Lebensstile, Glaubensfragen, Weltbilder etc. In Bezug<br />
auf das Ehrenamt diagnostiziert daher Ludgera Vogt einen<br />
Wandel vom normativ (oft religiös) orientierten Ehrenamt zu<br />
einem nutzenorientierten Engagement vor allem bei Jüngeren,<br />
die u. a. eine kreative Selbstverwirklichung in geselligen Situationen<br />
mit Erlebnisqualität anstrebten (Vogt 2005: 51). Während<br />
das traditionelle Ehrenamt häufig milieugebunden in<br />
dauerhaften Organisationsformen quasi ein Leben lang erbracht<br />
werde, sei das nutzenorientierte Engagement kurzfristig<br />
angelegt. Dies befördere kurzfristigere Projektformen eines<br />
fluktuierenden bürgerschaftlichen Engagements, worauf etwa<br />
Freiwilligenagenturen reagierten, die in den letzten Jahren<br />
verstärkt entstanden sind. Zugleich führe diese Entwicklung<br />
zu einer steigenden sozialen Ungleichheit, da neuere professionell<br />
organisierte Projektformen des Engagements eine größere<br />
Organisationsfähigkeit erfordern und somit vor allem<br />
durch gebildete Schichten nutzbar seien – im Gegensatz zu<br />
traditionellen Formen des Ehrenamts, die für alle Mitglieder<br />
eines sozialen Milieus Engagementangebote bereithielten<br />
(Vogt 2005).<br />
Obwohl die Beobachtung von der Auflösung sozialer Milieus<br />
korrekt ist, scheint mir die These vom Strukturwandel<br />
des Ehrenamts zu einfach (vgl. auch Joas/Adloff 2002). Um dies<br />
zu verdeutlichen, soll im Folgenden das Handeln von Ehrenamtlichen<br />
genauer in den Blick genommen und gezeigt werden,<br />
wie sich unterschiedliche Handlungsmotive miteinander<br />
verschränken. Aus dieser Analyse ergeben sich dann auch Folgen<br />
für die Gestaltung ehrenamtlichen Engagements in modernen<br />
Gesellschaften.<br />
81
Prof. Dr. Bettina Hollstein<br />
2. Handlungsmodelle ehrenamtlichen<br />
Engagements<br />
Die These vom Strukturwandel des Ehrenamts geht davon<br />
aus, dass im traditionellen Ehrenamt Werte die wesentlichen<br />
Motivatoren für Engagement sind. Für ehrenamtliches Engagement<br />
wird häufig von altruistischen Werten (etwa der christlichen<br />
Nächstenliebe) ausgegangen, die das Handeln der Engagierten<br />
bestimmen. Werte werden kulturell geprägt. Für<br />
unsere westliche, neuzeitliche Kultur hat Charles Taylor die<br />
Herausbildung von drei spezifischen Moralquellen beschrieben,<br />
die moderne Werte bestimmen (Taylor 1996 [1994]).<br />
(a) Die historisch zuerst entstandene Moralquelle ist die theistische<br />
(also auf Religion bezogene), die in der jüdisch-christlichen<br />
Tradition wurzelt. Im Mittelalter etwa enthielten alle<br />
überzeugenden Moralquellen einen Bezug zu Gott. Aber auch<br />
noch im 18. Jahrhundert war eine religiöse Ordnung der Deutungshorizont,<br />
der Werte wie Autonomie, Familie, Wohlwollen<br />
bestimmte. Die religiösen Moralquellen haben durch das Entstehen<br />
von alternativen Moralquellen ohne religiösen Bezug<br />
an Selbstverständlichkeit eingebüßt. Dennoch sind sie auch<br />
heute noch vorhanden und gerade im Bereich des sozialen Ehrenamts<br />
eine wichtige Motivationsquelle für Menschen, die<br />
in ihrem Engagement ihre religiös-moralischen Vorstellungen<br />
von Nächstenliebe, Solidarität und Hilfe für andere verwirklichen.<br />
(b) Als eine alternative Quelle der Moral hat sich in der Neuzeit<br />
eine rationalistische, nutzenorientierte Vorstellung entwickelt.<br />
Durch die vernünftige Realisierung des eigenen Glücks soll<br />
zugleich das Wohl der Allgemeinheit erreicht werden. Mit<br />
dem Siegeszug dieser Moralquelle ist u. a. die Zivilisierung,<br />
82
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der<br />
Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten<br />
sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.<br />
© 2022 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig<br />
Printed in Germany<br />
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.<br />
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne<br />
Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere<br />
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung<br />
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.<br />
Das Buch wurde auf alterungsbeständigem Papier gedruckt.<br />
Cover: Mario Moths, Marl<br />
Satz: Steffi Glauche, Leipzig<br />
Druck und Binden: Hubert & Co., Göttingen<br />
ISBN 978-3-374- 07104-3 // eISBN (PDF) 978-3-374- 07105-0<br />
www.eva-leipzig.de