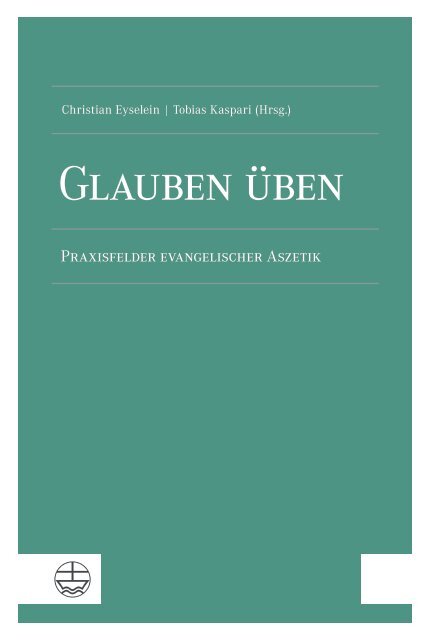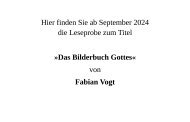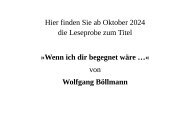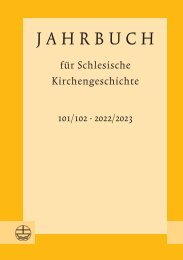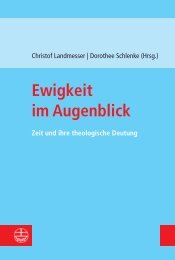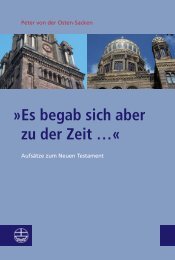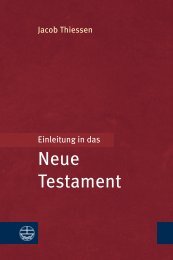Christian Eyselein | Tobias Kaspari (Hrsg.): Glauben üben (Leseprobe)
Die Beiträge dieser Festschrift zum 80. Geburtstag von Christel Keller-Wentorf widmen sich dem Üben konkreter Formen christlicher Religionspraxis und damit einem Lebensthema der Jubilarin: „Üben“ wird als anthropologische Konstante in den verschiedenen Feldern gelebten Glaubens sichtbar gemacht. Dadurch sind sie im Diskurs der Aszetik verortet und gewinnen gleichzeitig ihre Relevanz in der aktuellen kirchlichen Debatte: Wie kann christliche Religion im Heute Gestalt gewinnen? Die Beiträge spiegeln die vielfältigen Interessensgebiete der Jubilarin und die Vielgestaltigkeit der aszetischen Praxisfelder wider, indem sie Aspekte des Gottesdienstes, der Predigt, der Kasualpraxis, der Liturgie, der Seelsorge, des geistlichen Lebens und der Pastoraltheologie auf die Frage nach ihrer gestaltenden Kraft im Glaubensvollzug hin orientieren.
Die Beiträge dieser Festschrift zum 80. Geburtstag von Christel Keller-Wentorf widmen sich dem Üben konkreter Formen christlicher Religionspraxis und damit einem Lebensthema der Jubilarin: „Üben“ wird als anthropologische Konstante in den verschiedenen Feldern gelebten Glaubens sichtbar gemacht. Dadurch sind sie im Diskurs der Aszetik verortet und gewinnen gleichzeitig ihre Relevanz in der aktuellen kirchlichen Debatte: Wie kann christliche Religion im Heute Gestalt gewinnen? Die Beiträge spiegeln die vielfältigen Interessensgebiete der Jubilarin und die Vielgestaltigkeit der aszetischen Praxisfelder wider, indem sie Aspekte des Gottesdienstes, der Predigt, der Kasualpraxis, der Liturgie, der Seelsorge, des geistlichen Lebens und der Pastoraltheologie auf die Frage nach ihrer gestaltenden Kraft im Glaubensvollzug hin orientieren.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Christian</strong> <strong>Eyselein</strong> | <strong>Tobias</strong> <strong>Kaspari</strong> (<strong>Hrsg</strong>.)<br />
<strong>Glauben</strong> <strong>üben</strong><br />
Praxisfelder evangelischer Aszetik
Wir wünschen,<br />
dass ihr euch ernstlich bemüht,<br />
nicht allein in der Kirche das Wort Gottes zu hören,<br />
sondern auch in euren Häusern nachzulesen<br />
und euch zu beschäftigen in dem Gesetz des Herrn;<br />
denn auch da ist Christus<br />
und allenthalben ist er dem nah,<br />
der ihn sucht.<br />
Origenes<br />
in Levit. cap. 16<br />
hom. 9
Vorwort<br />
Diese Festschrift ist aus Anlass ihres 80. Geburtstages Christel Keller-Wentorf<br />
gewidmet, der leidenschaftlichen Praktikerin christlichen <strong>Glauben</strong>s, die sich in<br />
ihrem Beruf und ihrer Berufung als Theologin in unterschiedlichen Arbeitsfeldern<br />
im Laufe ihres Lebens der Gestaltwerdung des christlichen <strong>Glauben</strong>s verschrieben<br />
hat. Zeitlebens hat sie auch gegen Widerstände um das evangelische<br />
Profil gelebten Christentums in ihrer Kirche gerungen, um es deutlich sichtbar zu<br />
machen und nichtimFluss gefälliger Anpassung zum Verschwinden zu bringen.<br />
Viele Pfarrerinnen und Pfarrer verdanken ihr eine aszetische Prägung, systematisches<br />
Durchdenken des <strong>Glauben</strong>s und das Auftun eines Schatzes geistlichen<br />
Lebens, wie er besondersinder Geschichte und den Schriften der AltenKirche zu<br />
finden ist. Die Gründung des Evangelischen Exerzitiums, seiner Geistlichen<br />
Gemeinschaft und des Instituts für Evangelische Aszetik in Neuendettelsau gehen<br />
wesentlich auf ihr Wirken zurück. Wir ehren sie mit dieser Dankesgabe als<br />
geistliche Lehrerin,Professorin, Pfarrerin undWegbegleiterin, die in ihrer Kirche<br />
immer den Hunger nach dem erfahrbaren und lebendigen Christuswachgehalten<br />
hat.<br />
Diese Festschrift wäre ohne großzügige Druckkostenzuschüsse nicht zustande<br />
gekommen. Wir danken der Augustana Hochschulstiftung, der Evangelischen<br />
Kirche in Hessen und Nassau und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen<br />
Kirche Deutschlands, die mit ihren namhaften Zuwendungen das<br />
Entstehen dieses Sammelbandes ermöglicht haben. Wir bedanken uns bei Dr.<br />
Annette Weidhas und dem Team der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig für die<br />
freundliche und bestimmte Führung bei der Entstehung dieses Buches.<br />
Neuendettelsau und Riegelsberg an Ostern 2022<br />
<strong>Christian</strong> <strong>Eyselein</strong><br />
<strong>Tobias</strong> <strong>Kaspari</strong>
Inhalt<br />
Vorwort .................................................. 6<br />
Einleitung ................................................ 9<br />
Oswald Bayer<br />
Nietzsche und das Kreuz<br />
Ein Streitgespräch mit Paulus ................................. 13<br />
Chu-hsien Chen<br />
Professors’ Mirrors<br />
Let’s take aglance at the twinkling stars ......................... 19<br />
<strong>Christian</strong> <strong>Eyselein</strong><br />
VonZugehörigkeit und Glaube<br />
Spiritualität Russlanddeutscher ................................ 31<br />
Br. Franziskus Christoph Joest<br />
Gemeinsames Leben – verbeult und gesegnet<br />
Wie Kommunitäten im Scheitern wachsen (können) ................ 41<br />
Renate Jost<br />
G*ttesverehrung<br />
Widerstand und Hebammendienste ............................. 47<br />
<strong>Tobias</strong> <strong>Kaspari</strong><br />
Durchbetete Anfechtung<br />
Versuch über »Gottes Heimsuchung« in Zeiten der Not .............. 53<br />
Konstanze Kemnitzer<br />
to be continued …<br />
Serialität als Grundaspekt der ars immersionis .................... 75<br />
Gerhard Knodt<br />
»Habt acht auf euch selbst … «(Apostelgeschichte 20,28)<br />
Interiorität als Aufgabe pastoraler Bildung ....................... 89
8 Inhalt<br />
Stefan Kunz<br />
Christliche Mystik<br />
Ein geistlicher Übungsweg ................................... 111<br />
Bettina Opitz-Chen<br />
<strong>Glauben</strong> leben<br />
Zeitlos im Kontext .......................................... 125<br />
Klaus Raschzok<br />
Ein aszetischer Zugang zur Homiletik<br />
Die »Predigtlehre« (1971) von Rudolf Bohren als geistliche<br />
Übungsanleitung ........................................... 133<br />
Ulrike Scherf<br />
Heilsame Unterbrechungen<br />
Ein-Üben inGeistliches Leiten im Anschluss an die Benediktsregel und<br />
das Salutogenesekonzept von Aaron Antonovsky ................... 153<br />
Manfred Seitz(†)<br />
Zugänge zu Spiritualität und Übung<br />
Ein Lehrbrief .............................................. 165<br />
Reinhard Thöle<br />
Das Passionale von 1905 für die Landeskirche Hannovers<br />
Ein Modell aszetischer Hermeneutik ............................ 171<br />
Autorinnen und Autoren ..................................... 183
Einleitung<br />
Christel Keller-Wentorfwurde in ihrer Theologie wesentlich geprägt durch ihren<br />
Doktorvater Carl Heinz Ratschow (1911–1999). Wersie selbst als theologische<br />
Lehrerin,Predigerin und Praktikerin des christlichen<strong>Glauben</strong>s erlebt, wird diese<br />
Prägung deutlich erkennen. Sie besteht nicht in erster Linie in dem Verweis auf<br />
die Literatur ihres Lehrers, sondern in ihrer strukturierten, systematisch-theologisch<br />
fundierten Denkart, die sie von Ratschow gelernt hat: die Frage danach,<br />
wie es um die Lebenswelt der gegenwärtigen Menschen bestellt ist, der ungeschönte<br />
Blick auf den Zustand der Kirchen und Gemeinden, das Thema der<br />
Religionund der Religionen, das betende Stehen vor dem Gott Israels, dem Vater<br />
Jesu Christi, in jeder Anfechtung und ein stets aszetischer, nach Praxis, Konkretion<br />
und Gestaltwerdung fragender Zugang, der für die oftmals schon verstaubten<br />
Moden der Praktischen Theologie nicht empfänglich ist. Ratschows<br />
Impuls war nicht die einfache Weitergabe seiner Einsichten, sondern die Förderung<br />
der eigenen Gestaltwerdung der Schülerin als unangepasster Persönlichkeit,<br />
die in allen Wandlungen der Zeiten und theologischen Fragestellungen<br />
die christlicheSubstanz festgehalten hat als Schatz im Acker: auf dem geistlichen<br />
Übungsweg des Lebensder Gestalt des Herrn ähnlicher zu werden (2. Kor 3,18).<br />
Wo der Lehrer sich selbst aufgibt im Lehren und damit überflüssige Kopien seiner<br />
selbst abweist, ist das Ziel erreicht: Die Schülerin wird selbst zur Lehrerin und<br />
leitet zur Gestaltwerdung weiterer Schüler, Predigerinnen und Theologen an.<br />
Eine theologische Lebensbewegung ist entstanden:<br />
Christel Keller-Wentorfwurde am 29. Juni 1942 in Hamburg geboren. 1964–<br />
1970 studierte sie Theologie und Musikwissenschaft inMarburg und Mainz.<br />
1970 legte sie ihr erstes theologisches Examen vor der Prüfungskommission der<br />
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ab undabsolvierte dann bis 1972 ihr<br />
Vikariat in der Versöhnungsgemeinde inWiesbaden und am Theologischen<br />
Seminar in Friedberg. Nach dem Zweiten Theologischen Examen 1972 war sie<br />
Spezialvikarin in der GossnerMission. 1972 heiratete sie Peter Keller. Nachihrer<br />
Ordination 1973 verwaltete sie als Pfarrvikarin die Pfarrstelle in Wiesbaden-<br />
Sonnenberg. 1975–1977 wurde sie zur Erstellung ihrer Dissertation bei Carl
10 Einleitung<br />
Heinz Ratschow beurlaubt. 1977–1981 war sie Inhaberin der Schulpfarrstelle am<br />
Ernst-Ludwig Gymnasium in Bad Nauheim. 1981–1983 verwaltete sie die<br />
Pfarrstelle in Heilsberg/Bad Vilbel. Ihre Dissertation wurde 1981 vom Fachbereich<br />
Evangelische Theologie der Philipps-Universität Marburg angenommen<br />
und erschien1984 bei De Gruyter unter dem Titel: »Schleiermachers Denken. Die<br />
Bewußtseinslehre in Schleiermachers philosophischer Ethik als Schlüssel zu<br />
seinem Denken«. 1983–1989 war sie Inhaberin des Studentenpfarramtes an der<br />
Justus-Liebig-Universität in Gießen und 1985–1991 Lehrbeauftragte für Systematische<br />
Theologie am Fachbereich Evangelische Theologie der Johann-Wolfgang-Goethe<br />
Universität Frankfurt am Main. 1986 und 1987 gab sie zusammen<br />
mit Martin Repp die beiden Aufsatzbände bei De Gruyter heraus: »Carl Heinz<br />
Ratschow, Vonden Wandlungen Gottes. Beiträge zur Systematischen Theologie/<br />
Carl Heinz Ratschow, Vonder Gestaltwerdung des Menschen. Beiträge zu Anthropologie<br />
und Ethik«.<br />
1991 wurde sie als Professorin für Homiletik und Liturgik an das Theologische<br />
Seminar Friedberg der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau berufen<br />
und gab ihr 1989 begonnenes Vorhaben auf, eine Habilitationsschrift zur<br />
Grundlegung einer christlichenGestaltlehre zu verfassen. 1992 wurde sie in die<br />
Achte Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau berufen,<br />
der sie bis 1998 angehörte. Ab 1997 war sie Inhaberin einer Sonderstelle<br />
»Profilierung evangelischer Verkündigung im ökumenischen Dialog« beim<br />
Konfessionskundlichen Institut in Bensheim. Ab 1999 war sie Kirchliche Dozentin<br />
im Hochschuldienst für Homiletik und Liturgik am Fachbereich Evangelische<br />
Theologie der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. In Mainz bot sie<br />
regelmäßig Lehrveranstaltungen zur Theologie und Praxis des Gebets an, des<br />
geistlichen Lebens und der Spiritualität der Wüstenmütter, der Wüstenväter<br />
sowie der Schriftauslegung in der Alten Kirche. Vonmanchen Teilen des Kollegiums<br />
belächelt, nahmen doch viele Studentinnen und Studenten, die die<br />
»aszetische Lücke« imStudium persönlich wahrgenommen haben, diese Lehrveranstaltungen<br />
an. Was sich im Evangelischen Exerzitium in die Form der<br />
Lehrbriefe fügte, wurde so didaktisch imStudium erprobt, korrigiert oder erweitert.<br />
In einem von ihr erarbeiteten Curriculum für die homiletische und liturgische<br />
Ausbildung am Theologischen Seminar Friedberg nimmt Christel Keller-<br />
Wentorf 1996 schon Bezug darauf, was später im 1999 gegründeten »Evangelischen<br />
Exerzitium e.V. – Zentrum für geistliche Theologie und christliche Lebensgestaltung«<br />
bestimmend werden sollte: leiblich fundierte Einübung und<br />
Ausübung des Christentums als Ort seiner Gestaltwerdung, d. h. die konkrete<br />
Praxis gelebten <strong>Glauben</strong>s. 1996 schreibt sie in dem unveröffentlichten Curriculum:<br />
»Der Gottesdienst als leibliche Gestaltwerdung: Grundsätzlich wird der<br />
Zusammenhang von Körper und Gebet in der Liturgie bedacht, Gebetsgebärden<br />
werden im religionsgeschichtlichen Zusammenhang skizziert und geübt. In
Einleitung 11<br />
Kleinstgruppen wird dann im Talar in verschiedenen Kirchenräumen die Choreographie<br />
des Gottesdienstes erarbeitet und als nonverbale Botschaft erkannt.<br />
Eine Ahnung der Leiberfahrung der Liturgie entsteht. Wir werden intensiv von<br />
einem Dresdner Choreographen und Tänzer in Wahrnehmung und Erfahrung<br />
unseres Körpers als Ausdruck unserer ganzen Person ausgebildet.« Selbstverständlichgehörte<br />
auch die Einübung in das Gespräch der Schwestern und Brüder<br />
zu diesem Lehrplan, »und zwar vor allem das geistlich-theologische Gespräch, in<br />
dem wir versuchen, <strong>Glauben</strong> miteinander zu teilen und <strong>Glauben</strong>s- und Lebenspraxis<br />
einander mitzuteilen.«<br />
Seit 1999 veranstaltet das Evangelische Exerzitium (www.evangelischesexerzitium.de)<br />
Studienkurse als Lernwege zum gestalteten <strong>Glauben</strong>. Aus der<br />
Erfahrung zunehmender Sprach- und Gestaltlosigkeit des <strong>Glauben</strong>s in der<br />
evangelischen Kirche hat sich Christel Keller-Wentorf zusammen mit Weggefährten<br />
beharrlich auf den Weggemacht, die Praxis des <strong>Glauben</strong>s wieder ins<br />
Leben zu holen. Ihre Kontakte zu P. Andreas Falkner SJ und das Einleben in die<br />
Ignatianischen Exerzitien waren dabei ebenso inspirierend, wie der Austausch<br />
mit Manfred Seitz, <strong>Christian</strong> Zippert und Karl-Heinz Michel.<br />
Mit dem Kloster Volkenroda der Jesusbruderschaft hat das Evangelische<br />
Exerzitium einen profilierten Ort, an dem sich wissenschaftliches Bedenken des<br />
<strong>Glauben</strong>s in ökumenischer Aufgeschlossenheit mit seiner lebensmäßigen Ausübung<br />
in Gottesdienst und Alltag verbindet. Geistliche Substanz für das entstehende<br />
Exerzitium fand Christel Keller-Wentorf im Studium der Regula Benedicti,<br />
der Betrachtung des Katechumenats der Alten Kirche und der altkirchlichen<br />
Schriftauslegung. Sie hat ihre eigene Übungslehre im Anschluss an Otto Friedrich<br />
Bollnow entwickelt. Wesentlich wurden ihr die Pflege des betrachtenden<br />
Gebetes und der lectio divina.Auch die Gründung einer Geistlichen Gemeinschaft<br />
im Evangelischen Exerzitium, die zur vielfältigen Welt der evangelischen Kommunitäten<br />
zählt, geht auf ihre Initiative zurück. Nach längeren Vorbereitungen<br />
wagten es 11 Mitglieder des Exerzitiums auf der Mitgliederversammlung 2005<br />
sich zu einer »Geistlichen Gemeinschaft des Evangelischen Exerzitiums« zusammenzufinden.<br />
Im Zusammenhang der Tauferinnerung verpflichteten sie sich,<br />
ihrem persönlichen und gemeinsamen Leben eine verpflichtende geistliche<br />
Ordnung zu geben, ihr Leben also unter die »Geistliche Ordnung des Evangelischen<br />
Exerzitiums« zu stellen.<br />
2007 konnte das Institut für Evangelische Aszetik an der Augustana-Hochschule<br />
Neuendettelsau gegründet werden (www.aszetik-institut.de), wesentlich<br />
verbunden mit Person und Lehrstuhl von Klaus Raschzok, der das Institut gemeinsam<br />
mit Manfred Seitz, Christel Keller-Wentorf und Gerhard Knodt ins<br />
Leben rief. Später stieß noch der Ostkirchenkundler Reinhard Thöle zum Leitungsteamhinzu.<br />
Träger des Instituts ist das Evangelische Exerzitium mit Sitz im<br />
Kloster Volkenroda in Thüringen. Seit seiner Gründung verantwortet das Institut<br />
ein kontinuierliches Angebot von Lehrveranstaltungen aus dem Themenbereich
12 Einleitung<br />
evangelischer Frömmigkeit und ihrer Praxis, bietet Studientage und Vortragsveranstaltungen<br />
an, wirkt bei Pastoralkollegskursen mit und verfolgt eigene<br />
Forschungsprojekte. Es hat sich zum Ziel gesetzt, das Fach »Evangelische<br />
Aszetik« im wissenschaftlichen Diskurs zu etablieren und als Teildisziplin der<br />
Praktischen Theologie zu vermitteln. Es möchte das evangelische Profil geistlichen<br />
Lebens und aszetischer Forschung in ökumenischer Orientierung stärken.<br />
Die Gestaltlehre des christlichen <strong>Glauben</strong>s in Schriftstudium, Gebet, Meditation,<br />
Gottesdienst, Kommunität, geistlicher Regel, Ritus, alltäglichem Tun, Beruf, Lebensphasen,<br />
Altern und Todwird ebensoreflektiert wie das Zeugnis der Christen<br />
in der Welt, die Frage des Fastens bzw. des Verzichts oder die Bedeutung des<br />
Martyriums, auch im Hinblick auf die sich gegenwärtig rapid verändernden<br />
Kommunikationsmöglichkeiten und -bedingungen.
Oswald Bayer<br />
Nietzsche und das Kreuz<br />
Ein Streitgesprächmit Paulus 1<br />
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft<br />
des heiligen Geistes sei mit euch allen!<br />
Den Predigttext aus dem ersten Kapitel des Ersten Korintherbriefes haben<br />
wir vorher schon in der Schriftlesung gehört (1.Kor 1,18–25); ich hebe jetzt nur<br />
die Verse 22 und 23 heraus:<br />
»[…] die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber<br />
predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine<br />
Torheit.« Womöglich noch schärfer und exklusiver heißt es kurz darauf im zweiten<br />
Kapitel (V.2): »Ich will unter euch nichts […]wissen als allein Jesus Christus und zwar<br />
als den Gekreuzigten.«<br />
Friedrich Nietzsche, der Pfarrerssohn und radikale Christentumskritiker, soll<br />
heute im Experiment einer Dialogpredigt gehört werden. In »Jenseits von Gut und<br />
Böse«, dem »Vorspiel einer Philosophie der Zukunft«, sagt er:<br />
»Die modernen Menschen mit ihrer Abstumpfung gegen alle christliche Nomenklatur,<br />
fühlen das Schauerlich-Superlativische nicht mehr nach, das für einen antiken<br />
Geschmack in der Paradoxie der Formel ›Gott am Kreuze‹ lag. Es hat bisher noch<br />
niemals und nirgendwo eine gleiche Kühnheit im Umkehren, etwas gleich Furchtbares,<br />
Fragendes und Fragwürdiges gegeben wie diese Formel: sie verhieß eine<br />
Umwertung aller Werte.« 2<br />
1<br />
2<br />
1. Kor 1,18–25, gepredigt am 29. Oktober 2019 in der Tübinger Stiftskirche.<br />
Friedrich Nietzsche, Werke in drei Bänden, hg.v. Karl Schlechta, München 1965, II, 610<br />
(46): Jenseits von Gut und Böse, 1886. Vgl. II, 781 (8), Zur Genealogie der Moral, 1887:<br />
»Gehört es nicht in die geheime Kunst […] das anverlockender, berauschender, betäubender,<br />
verderbender Kraft jenem Symbol des ›Heiligen Kreuzes‹ gleichkäme, jener<br />
schauerlichen Paradoxie eines ›heiligen Kreuzes‹, jener unausdenkbaren letzten äußersten<br />
Grausamkeit und Selbstkreuzigung Gottes zum Heile des Menschen.«
14 Nietzsche und das Kreuz<br />
Nietzsche trifft damit ins Schwarze. Die Kreuzesstrafe galt der nichtchristlichen<br />
Antike als mors turpissima, 3 als dieschändlichste Todesstrafe, von der auch nur<br />
zu sprechen tabuisiert war. Eine Kreuzigung gar mit Gott in eine positive Verbindung<br />
zu bringen, war indiskutabel, ja lächerlich, eine bare Eselei, »Torheit für<br />
die Griechen«, sagt Paulus, und äußerster Skandal für die Juden: eine unerträgliche<br />
Blasphemie, denn nach dem Wort der Tora ist der, der am Kreuze hängt,<br />
von Gott verflucht und verworfen: »Verflucht ist jeder,der am Holze hängt.« (Dtn<br />
21,23; vgl. Gal 3,13); deshalbwurde ja Jesus Christus in seinen Christen von dem<br />
Pharisäer Paulus auch verfolgt.<br />
Nietzsche hatte ein Gespür für die Kühnheit, vielleicht sollte man sogar sagen:<br />
für die Tollkühnheit, ja: den Wahnsinn der Christen, in dem Gekreuzigten<br />
keinen anderen als Gott selbst zu sehen. Darin geschieht in der Tat eine »Umwertung<br />
aller antikenWerte« – doch nichtnur aller antiken Werte, sondern auch<br />
der heute immer noch geltenden: Ruhm, Geld, Gier, Gewalt und wie die Götter alle<br />
heißen.<br />
Die mit der Kreuzigung Jesu Christi geschehene radikale Wende, die Umkehrung<br />
sieht Nietzsche – freilich weniger bei Jesus selbst als bei seinen<br />
Nachfolgern, besondersbei Paulus – zunächst ganz negativ: nicht etwa als Ja zum<br />
Leben, sondern als unüberbietbares Nein zum Leben: als Schwäche, als Unfähigkeit,<br />
Feind sein zu können, als mangelnden, gebrochenen Willen zur Macht,<br />
als Realitätsflucht, als Ressentiment der zu kurz Gekommenen, der Verlierer.<br />
Gott sei<br />
»zum Widerspruch des Lebens abgeartet, stattdessen Verklärung und ewiges Ja zu sein!<br />
In Gott dem Leben, der Natur, dem Willen zum Leben die Feindschaftangesagt! Gott<br />
die Formel für jede Verleumdung des ›Diesseits‹,für jede Lüge vom ›Jenseits‹!InGott<br />
das Nichts vergöttlicht, der Wille zum Nichts heiliggesprochen!« 4<br />
Dabei steht für Nietzsche das Kreuz Jesu nicht im Gegensatz zum Judentum.<br />
Vielmehrgelte: »das Christentum ist einzig aus dem Boden zu verstehen, aus dem<br />
es gewachsen ist – es ist nicht eine Gegenbewegung gegen den jüdischen Instinkt,<br />
es ist dessen Folgerichtigkeit selbst, ein Schluß weiter in dessen furchteinfließender<br />
Logik.« 5 Diese Logik waltete in Israel keineswegs von Anfang an; sie sei<br />
erst mit dem babylonischen Exil entstanden. Zu ihrer letzten Steigerung bzw.<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Vgl. Martin Hengel, Mors turpissima crucis. Die Kreuzigung in der antiken Welt und die<br />
»Torheit« des »Wortes vom Kreuz« (in: Rechtfertigung. FS für Ernst Käsemann zum<br />
70. Geburtstag, hg.v. Johannes Friedrich/ Wolfgang Pöhlmann/ Peter Stuhlmacher,<br />
1976, 125–184), besonders: Cicero Contra Verrem 2,5 165: crudilissimum deterriumque<br />
supplicium; Origenes zu Mt 27,22f. (GCS. 38, 259).<br />
Der Antichrist, Werke (s. Anm. 2) in 3Bänden, hg.v. Karl Schlechta, Bd. II, 1178 (18).<br />
Ebd. II, 1183.
Nietzsche und das Kreuz 15<br />
Vertiefung freilich fand sie erst im Kreuz Jesu. Gleichwohl war es eben das Volk<br />
Israel, das »für seinen Instinkt eine letzte Formel« fand, »die logisch war bis zu<br />
ihrer Selbstverneinung: esverneinte, als Christentum, noch die letzte Form der<br />
Realität, das ›heilige Volk‹«; 6 war es doch international.<br />
Nochmals: Das Kreuz Jesu Christi widerspricht nach Nietzsche dem, was das<br />
Leben stark macht. Der gekreuzigte Gott ist die »Auflehnung gegen das Leben«,<br />
»Gegenbegriff und Verurteilung des Lebens«. 7 Deshalb lautet Nietzsches<br />
Kampfruf: »Dionysos gegen den Gekreuzigten«! 8 »Dionysos gegen den ›Gekreuzigten‹:<br />
dahabt ihr den Gegensatz«. 9 Nietzsche sieht in dem griechischen Gott<br />
»die religiöse Bejahung des Lebens, des Ganzen, nicht verleugneten und halbierten<br />
Lebens; (typisch, daß der Geschlechtsakt Tiefe, Geheimnis, Ehrfurcht<br />
erweckt).« 10 »Ist der heidnische Kult nicht eine Form der Danksagung und der<br />
Bejahung des Lebens? Müßte nicht sein höchster Repräsentant« – Gott also –<br />
»eine Apologie und Vergöttlichung des Lebens sein? Typus [auch] eines die<br />
Widersprüche und Fragwürdigkeiten des Daseins in sich hineinnehmenden und<br />
erlösenden Geistes!« 11<br />
Wir sehen: Der dem Gekreuzigten entgegengesetzte Dionysos ist kein naiv<br />
vitalistischer Bursche. Er ist vielmehr »der leidende Dionysus der Mysterien,<br />
jener die Leiden der Individuation an sich erfahrende Gott, von dem wundervolle<br />
Mythen erzählen, wie er als Knabe von den Titanen zerstückelt worden sei« 12 –<br />
»zerstückelt«, also nicht ohne die Erfahrung der Zerstörung und des Todes. 13<br />
Fasst man das Dionysische in diesem »Gott« als Leben Bejahendes und zugleich<br />
Leidendes, 14 als »Gott und Mensch«, 15 dann bleibt es zwar überraschend<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
Ebd. II, 1189.<br />
Antichrist II (s. Anm. 4), 968.<br />
Ebd. II, 1150; III, 738ge.<br />
Ebd. III, 773 (aus dem Nachlass der Achtziger Jahre).<br />
Ebd. a. a. O.<br />
Ebd. a. a. O.<br />
Ebd. I, 61 (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik).<br />
John Updike, Rabbit Reduce, New York 1988, 162: »Als jemand zu Rabbit sagt: ›Gott ist<br />
sowohl im Tiger als im Lamm‹,antwortet Rabbit: ›Ja. Gott zerfleischt sich gerne selbst.‹«<br />
Zweierlei Leiden! Wir Antipoden II, 1047. Vgl. III, 493; III, 550. Äußerst wichtig zum<br />
Verständnis Nietzsches ist seine Unterscheidung zweier Arten von »Leiden« (II, 1047:<br />
vgl. Anm. 15: Aphorismus »Wir Antipoden«): Es gebe »zweierlei Leidende, einmal die an<br />
der Überfülle des Lebens Leidenden, welche eine dionysische Kunst wollen und ebenso<br />
eine tragische Einsicht und Aussicht auf das Leben – und sodann die an der Verarmung<br />
des Lebens Leidenden: Leiden kann Ausdruck von Schwäche oder aber Ausdruck von<br />
Stärke sein. Zur Überfülle des Leidens: Oswald Bayer/ <strong>Christian</strong> Knudsen, Kreuz und<br />
Kritik. Johann Georg Hamanns Letztes Blatt. Text und Interpretation. Tübingen, 1983,<br />
111.<br />
Antichrist II (s. Anm. 4), 244 f.; vgl. II, 1047.
16 Nietzsche und das Kreuz<br />
und erstaunlich, ist aber nicht ganz unverständlich, dass das radikale Nein zum<br />
Gekreuzigten keineswegs Nietzsches letztes Wort ist. Es ist und bleibt zwar das<br />
Hauptwort. Aber in diesem lauten und nicht zu überhörenden Hauptwort steckt<br />
doch verborgen als leise Hoffnung, als verzweifelte Hoffnung gegen alle Hoffnung,<br />
dass dieses Nein nicht das Letzte sei. Vorallem in den nach dem Ausbruch<br />
des Wahnsinns 1889 entstandenenmit Recht so genannten »Wahnsinnblättern«<br />
findet Nietzschezwar nicht im Christentum des Paulus, wohl aber bei Jesus dem<br />
Gekreuzigten selbst ein bewundernswertes Ja zum Leben, eine Stärke, etwas<br />
auszuhalten, durchzustehen, nicht zu fliehen, sondern der Realität Paroli zu<br />
bieten. 16 So steht Dionysos nicht mehr gegen den Gekreuzigten, sondern ist mit<br />
ihm innig verbunden. Die Zeitansage unseres Gottesmordes 17 – »wir haben ihn<br />
getötet« 18 – ist nicht mehr Nietzsches letztes Wort. Gerade durch den Gekreuzigten<br />
wird Gott zum neuen großen Jawort des Lebens – nicht, wie zuvor, dessen<br />
pure Verneinung.<br />
Sowohl der Gottesmord wie auch die Wiederkehr, die Rehabilitation Gottes<br />
sind die Ansage eines »tollen« Menschen, eines Wahnsinnigen, jedenfalls eines<br />
Narren. Und damit ist Nietzsche – ob er will oder nicht – bei dem von ihm gar<br />
nicht geschätzten Paulus, der um Christi willen zum »Narren« geworden ist (1.<br />
Kor 4,10; vgl. 1. Kor 3,18), wie denn das von ihm bezeugte Wort vom Kreuz der<br />
Welt und ihren Weisen eine »Torheit« (1. Kor 1,18) ist, eine Narrheit.<br />
Ich frage:Ist Nietzsche in seinem Ringenmit dem Gekreuzigten 19 denn nicht<br />
dessen Geheimnis auf der Spur?Ist er denn nicht im Recht, wenn er gegen ein in<br />
der faktischen Christentumsgeschichte durchaus anzutreffendes masochistisches<br />
und sadistisches Missverständnis des Gekreuzigten und gegen die klaglose<br />
Hinnahme von Leiden kämpft? Hat er denn nicht – freilich auf seine Weise –<br />
letztlich gesehen, dass der Gekreuzigte nicht nur das Leben hingibt, sondern in<br />
seiner Hingabe zutiefst bejaht, nicht nur das geschlachtete Opferlamm ist, sondern<br />
als solches der Löwe von Juda (Apk 5): Löwe als Lamm, Lamm als Löwe, nicht<br />
nur der, der sein Leben verliert, sondern es für alle gewinnt, nicht nur der<br />
ohnmächtige Mensch in der Krippe und am Kreuz, sondern als solcher der allmächtige<br />
Gott, der tote Pfahl des Kreuzes der lebendige Baum des Lebens, dessen<br />
Blätter nie verwelken, kurz, mit dem Katechismus gesprochen: »wahrhaftiger<br />
Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren, und zugleich wahrhaftiger Mensch, von der<br />
Jungfrau Maria geboren«, »gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben<br />
und begraben, niedergefahren zur Hölle«.<br />
Auf Friedrich Nietzsche, den Pfarrersohn und radikalen Christentumskritiker,<br />
der heute auf dieser KanzelimStreitgespräch mit PauluszuWort kommt, zu<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
»In dir ist Freude in allem Leide …« (EG 398). Vgl. Anm. 14.<br />
Die fröhliche Wissenschaft, 125.<br />
Ebd., 125.<br />
Vgl. EG 93: »Nun gehören unsre Herzen…«.
Nietzsche und das Kreuz 17<br />
hören und mit ihm zu streiten, lohnt sich. Nietzsche kann uns ins Staunen und<br />
Fragen bringen, so dass wir aufgestört werden und unser gewohntes Bild nicht<br />
länger für selbstverständlich halten: »›Gott am Kreuz‹«! 20 »Es hat bisher noch<br />
niemals und nirgendwo eine gleiche Kühnheit im Umkehren, etwas gleich<br />
Furchtbares, Fragendes und Fragwürdigesgegeben«! 21 Es gilt zu erkennen, dass<br />
nicht nur jene Juden und Griechen – also: alle Welt – zur Zeit des Paulus das Wort<br />
vom Kreuz für ein Skandalon und füreine Torheit hielten, sondern dass auch wir<br />
heute nicht nur abgebrüht und gleichgültig diesem Skandal und dieser Torheit<br />
gegenüberstehen, sondern auch aktiv – wie einst Petrus – die Göttlichkeit des<br />
Leidens Jesu verkennen und deshalb von Jesus als Satan angefahren werden<br />
müssen: »Weg von mir, Satan! Du bist mir ein Ärgernis; denn du meinst nicht, was<br />
göttlich, sondern was menschlich ist« (Mt 16,23). Das Leiden Jesu nicht zu wollen<br />
(Mk 8,33) 22 undGott nicht am Kreuz,sondern am Kreuz vorbeizusuchen, ist zwar<br />
menschlich, allzu menschlich, aber eben – wie wir es uns auch heute klar und<br />
scharf in aller Klarheit und Schärfe gesagt sein lassen müssen – etwas Satanisches,<br />
das nur Gott selbst als der Heilige Geist überwinden kann.<br />
Das Wort vom Kreuz als Gottes »Macht und Weisheit« (1. Kor 1,24) zu erkennen,<br />
anzunehmen und darauf zuvertrauen: das ist allein Gottes Werk, das<br />
Wunder, das Gott der Heilige Geist wirkt. »Ich glaube«, um nochmals mit dem<br />
Katechismus zu bekennen, »daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an<br />
Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommenkann […]« Verheißen<br />
aber ist mir, mit Nietzsche geredet, die »Kühnheit im Umkehren«. Kühn kehrte<br />
Luther um: »Kehr’s um«! predigt Luther. Nicht: »Mitten wir im Leben sind /mit<br />
dem Todumfangen« (EG 518). Vielmehr: Kehr’s um: Mitten im Tode sind wir im<br />
Leben! 23<br />
Mitten in Deiner Traurigkeit empfängst Du Trost. Mitten imZweifel Gewissheit.<br />
Mitten indrückender Sorge Freiheit. Mitten inder Angst den Mut, das<br />
Leben zu bejahen und selbst den schweren Stein wie Sisyphus auf den steilen<br />
Berg zu schleppen, von dem er doch wieder herabrollt. Der tote Kreuzespfahl wird<br />
dir so zum lebendigen Lebensbaum, dessensaftige Blätter nie verwelken. Es ist in<br />
der Tat paradox: Im Nein des furchtbaren und entehrenden Kreuzestodes Jesu<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
S. Anm. 2.<br />
Ebd.<br />
»Ja, wir danken deinen Schmerzen; /ja, wir preisen deine Treu; /ja, wir dienen dir von<br />
Herzen; /ja, du machst einst alles neu.« (EG 93, Friedrich von Bodelschwingh 1938).<br />
WA 11,141, zu Z. 22/29: »media vita in mortes kers umb media morte in vita sumus<br />
(Predigt über Lk 1,39–56; 2. Juli 1523. Vgl. WA 43,219,37 (»media morte in vita sumus«);<br />
WA 40 III,496,16 f.; WA 12,609,17 f. Dieses Lutherwort kühner Umkehrung findet sich<br />
auf Gerhard Ebelings Grabstein – nicht nur als Wort; es bestimmt die Gestalt des gehauenen<br />
Steines.
18 Nietzsche und das Kreuz<br />
verbirgt sich Gottes gewaltiges Ja zum Leben, das mit Ostern aufstrahlt und mit<br />
Pfingsten einleuchtet.<br />
Ist dieses Paradox denn nicht der helle Wahnsinn? 24 Oder aber die Weisheit<br />
Gottes und rettende Gotteskraft, die uns alles gibt, was wir zum Leben und<br />
Sterben brauchen? Amen.<br />
Liturgische Anmerkungen<br />
Nach dem Eingangslied (EG 324, 1–3: »[…]dass uns, oVater nicht von dir allein<br />
gegeben wird?«) und zur Hinführung auf den Psalm 22 (EG. Wü 709 und 710):<br />
Gott gibt nicht nur. Er nimmt auch,verbirgt sich unter seinem Gegenteil, rückt in<br />
die Ferne, scheint uns zu verlassen. Das wollen wir ihm klagen, indem wir im<br />
Wechsel Psalm 22 beten, der für diese Woche vorgesehen ist.<br />
Im Anschluss das Eingangsgebet: Ich will deinen Namen kundtun undinder<br />
Gemeinde dich rühmen, Herr! Denn du hast mein Elend nicht verachtet. Du hast<br />
dein Antlitz vor mir nicht verborgen, und als ich zu dir schrie, hörtest du es. In<br />
wieviel Not hast du nicht, gnädiger Gott, über mir Flügel gebreitet! Dafür sage ich<br />
dir Lob und Dank. Oft aber kann ich dir nicht danken. Du bist mir fern, weggerückt,<br />
als fragst du nichts nach mir, als fragst du nicht nach denen, die deine<br />
Hilfe brauchen. Bist du tot? Warum greifst du denn nicht ein? Warum greifst du<br />
nicht durch? Warum herrschen immer noch Geld, Gier und Gewalt? Warum<br />
herrscht immer noch ein ungezügelter Finanzkapitalismus? Warum schweigst<br />
du? Hast du uns verlassen? Bist du von uns weggegangen?<br />
Schriftlesung: 1. Kor 1,18–25. Lied: EG 381,1–4. Lied nach der Predigt »Gott,<br />
du gingst fort« (4 Strophen). Fürbitten: Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du<br />
Friedrich Nietzsche zum Stachel im Fleisch der Kirche gemacht hast, um uns,<br />
dem Kreuz Abgestumpften, aufzuwecken, damit wir in dem Kreuz Jesu Christi<br />
den Toddes Todes als das großeJazum Leben, als größte Freiheit entdecken. Du<br />
gibst uns alles im Kreuz. (Es folgt wörtlich der Text von Athina Lexutt, in: Alles<br />
hängt am Kreuz, 25 Meditation zum Erntedankfest. Hinzugefügt ist: […] und das<br />
Kreuz für andere auf uns nehmen, bis dein Taganbrichtund wir dich ohne Klage,<br />
ohne Zweifel und Anfechtung loben dürfen. Erhöre uns, wenn wir es wagen, dich<br />
jetzt schon als unseren Vater anzurufen.<br />
24<br />
25<br />
Vgl. Acta 26,24: »Festus mit lauter Stimme: ›Paulus, du bist wahnsinnig!‹«.<br />
Athina Lexutt/ Elisabeth Neumeister OSB, Alles hängt am Kreuz. Eine Annäherung in<br />
Wort und Bild, Leipzig/Paderborn 2018.
Chu-hsien Chen<br />
Professors’ Mirrors<br />
Let’s take aglance at the twinkling stars<br />
Happy 80th birthday to dear Christel! For your wonderful life career as the<br />
Professor of <strong>Christian</strong> Theology, Iwould like tohonor you with some selected<br />
mirrors 1 of the ancient excellent thinkers, writers, teachers and professors in the<br />
culture history of the Middle States (). 2<br />
Ages passed, however, these looking glasses are still shining bright to reflect<br />
the thoughts and imaginations ofteachers in Taiwan, where one might discover<br />
that the »authentic« Confucian moral values and ideas of education have been<br />
practiced against the tide from the West. Surprisingly enough, Taiwanese now<br />
might be called the rare survivorsofthe reverence for teachers and education in<br />
the modern world; many of them are still observing the dogma of »One day my<br />
teacher, my father/ mother lifelong.« (It-jit ûisu, it-seng ûi hū.)<br />
1What is ateacher?<br />
1.1 . (, )<br />
Su chiá, só-í thoân-tō, siū-gia p, kai-he kiā. (Hân Jú, Su Soat)<br />
Ateacher is the one who proclaims the Tao, 3 imparts professional knowledge, and<br />
1<br />
2<br />
3<br />
They are mainly selected from In tāi-le ked., Kó-tāiKek-giân Kéng-kù Soán (A Selection of<br />
Ancient Aphorisms); Lâu Sū chhong and Kok Khe-lâm ed. &trans., Tiong-kok Kó-tāiKengtián<br />
Bêng-kù (Gems of Ancient Chinese Wisdom).<br />
»Middle States« (Tiong-kok, )means the countries located in the middle of the land,<br />
yet this geographical term had changed to »China« on the Russian-Cheng Empire Treaty<br />
of Nerchinsk in 1689. Since the sayings here collected are all appeared in the books<br />
before the 17th century so that Middle States is applied in this text.<br />
Tao()literally denotes aroad, way, method, theory, doctrine etc. Here the word »Tao« is<br />
perceived as Confucian doctrines of ethics and political philosophy of the Most Great and<br />
Holy Teacher by the kings and emperors of the ancient Middle Kingdom. Since 1949 the
20 Professors’ Mirrors<br />
resolves doubts for his students<br />
(Hân Jú, On Teachers) 4<br />
1.2 ()<br />
Sèng-jîn bû siông-su. (Hân Jú, Su Soat)<br />
The holy man did not exclusively study with one teacher.<br />
(Hân Jú, On Teachers) 5<br />
1.3 ()<br />
Sam-jîn hêng pit-iú ngó su. (Hân Jú, Su Soat)<br />
Among one’s friends’ circle, there is always someone able to teach me:<br />
(Hân Jú, On Teachers) 6<br />
1.4 (, )<br />
Bû-kùi bû-chiān, bû-tióng bû-siàu, tō chi só-chûn, su chi só -chûn iā. (Hân Jú, Su<br />
Soat)<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Taiwan Government has promulgated Confucius’ birthday, 29th September, as Teacher’s<br />
Day, anational holiday. On this day, the model teachers will be awarded by the<br />
Government in recognition of their well succeeded works.<br />
Hân Jú (,768–824) was an Imperial Doctor of Tông, and agreat writer, thinker and<br />
philosopher in the Great Empire Tông (). Among his countless writings, On<br />
Teachers ()had deeply influenced Han people’sreverence on their teachers and also<br />
highly valued education and study. As an important thinker, he had acted as the pioneer<br />
of the formation of Neo Confucianism and thus proclaimed Confucian doctrines in opposition<br />
to Buddhist dogmas. His represent works have been edited as 40 volumes entitled:<br />
Anthology of Mr. Chhiong-le’s Works ().<br />
»The holy man« is here denoting Confucius (551–479 B.C.), who is honored »the Later<br />
Most Great and Holy Teacher« by the kings and emperors of the ancient Middle States.<br />
Since 1949 Taiwan Government promulgated Confucius’ birthday, 29th September, as<br />
Teacher’sDay, anational holiday. On this day, the model teachers will be awarded by the<br />
Government in recognition of their successful works. Confucius was ahumble man who<br />
had studied with many great teachers, including Lao-tze; even he had tried to get answers<br />
from children and less learned teachers as well.<br />
»Among one’s friends’ circle« original text is ›‹ (sam-jîn hêng) literally means<br />
»three persons are walking together.«
Professors’ Mirrors 21<br />
Regardless of the one who is nobel or mean,young or old, where is the Tao, 7 there<br />
is my teacher:<br />
(Hân Jú, On Teachers)<br />
1.5 (, )<br />
Su íchit-gî, iúísek-gî, su-iú chiá, ha k-būn chi chu iā. (Li Seng, Se-au gōa-chip)<br />
Afruitful studying will depend on teachers and friends, the former advises you to<br />
resolve doubts and the later analyses them.<br />
(Li Seng, Later Supplement Anthology of Se-au) 8<br />
1.6 (, )<br />
Keng-su ī gū, jîn-su lân cho. (Su-Má Kong, Chu-tī Thong-kàm)<br />
It is easier tohave anexcellent professor 9 in academia than to meet avirtuous<br />
model 10 professor.<br />
(Su-Má Kong, Comprehensive Mirror in Aid of Governance) 11<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
The Taoisthe essential principle of philosophical and religious Taoism, however here the<br />
Taoisbasically denoting Confucian doctrine of benevolence and morality of formation of<br />
gentlemen, sorry not for gentlewomen, and humane society.<br />
Li Seng (1785–1860), an Imperial Doctor of Chheng, writer and politician. Se-au Gōachip,<br />
»Se-au« is Li’s secondary name, »gōa-chip« is an eight-volume work of the later<br />
supplement anthology of his writings.<br />
»An excellent professor in academia«, original Han text is »keng-su« (), literally<br />
means ateacher of Confucian classics.<br />
»A virtuous model professor« original Han text is »jîn-su« (), literally means ateacher<br />
and model for people, namely »su-piáu, «.<br />
Su-Má Kong (1019–1086 AD) was an Imperial Doctor of Song and officer, and the chief<br />
editor of Chu-tī Thong-kàm, i.e., Comprehensive Mirror in Aid of Governance, totally in<br />
294 volumes, which chronically recorded the history of the Middle Kingdom from 403 BC<br />
to 959 AD. Significantly, these volumes had served as the mirrors to reflect reasons of<br />
rising and falling of the states, and to show the images of the brilliant or foolish officers or<br />
emperors of each kingdom.
22 Professors’ Mirrors<br />
1.7 ()<br />
Un-kò jî ti sin, khó-í ûi-su ih.Khóng-chú, Lūn-gú<br />
One can get new understanding from the old matters which can be ateacher. 12<br />
(Confucius, The Analects) 13<br />
2Their importance<br />
2.1 ()<br />
Thian, Tē, Kun, Chhin, Su. (Sûn-chú, Lé-lūn)<br />
There are five kinds of Holy beings: Heaven, Earth, Emperor,Parents and Teacher.<br />
(Sûn-chú, On Rites) 14<br />
2.2 ()<br />
It-jit ûisu, chiong-sin ûi hū. (Su-Má Chhian, Sú-kì Thiong-nî Tē-chú Lia t-toān)<br />
He who teaches me for one day is regarded asmyfather for the rest of my life:<br />
(Su-Má Chhian, Historical Records: Biography of Confucius’ Disciples) 15<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
»New understanding from the old matters«, original text is ,itliterally means<br />
by reviewing the »old« to know something »new«. This might be understood as abasic<br />
formula of Confucian scholars’ viewpoints of History and Reality.<br />
For »Confucius« ()please see note 3. The Analects (), the first book of The Four<br />
Books, is arecord of the dialogue between Confucius and his students, which had been<br />
recorded and edited by Confucius’ disciples, published in the early five century BC.<br />
Sûn-chú (313–238 B.C.) was born in the State of Tiō (), who was awell-known<br />
thinker, writer, philosopher, politician, and arepresentative person of Confucianism in<br />
the later period of the Han Empire. In his writing, On Rites, Sûn-chú emphasized that the<br />
importance of the Heaven, Earth, Emperor, Parents, and Teacher ()are »five<br />
holy beings«, among these five »kings and teachers are regarded as the roots of stable<br />
governance«. Moreover, these five Han characters are sculptured on awooden tablet<br />
standing on the divine-table to receive regular sacrifices according to folk calendar.<br />
Su-Má Chhian (145–c. 91 BC) was awell-known historian and writer, and his Historical<br />
Records has been highly recognized as acanonical work. It is noteworthy that the saying<br />
has become apopular proverb and could perfectly reflect Taiwanese peoples’ attitude<br />
towards their teachers. According to the Historical Records, after Confucius died Master<br />
Hā (), his disciple, was staying in atent besides the grave during three years of<br />
mourning his teacher’sdeath, that episode actualizes the mentality of »teacher one day,<br />
father life long«.
Professors’ Mirrors 23<br />
2.3 ()<br />
Hoân ha kchi tō,giâm-su uî-lân; su-giâm,jiân-aū tō-chun. Tō-chun, jiân-aū bîn ti<br />
kèng-ha k. (Lé-kì, Ha k-kì)<br />
The most difficult thing of apromising way of studyistofind strict teachers, for<br />
them the students could have reverence towards the Tao. Then people can be<br />
aware of intellect and learning:<br />
(Book of Rites, Record of Learning) 16<br />
2.4 , , (, )<br />
Kok chiong heng, pit kùi-su jî tiōng hū;kok chiongbông, pit chiān-su jî kheng-hū.<br />
(Sûn-chú, Tāi-lio k)<br />
Acountry where teachers are highly respected will prosper, but the country<br />
where their teachers are despised:<br />
(Sûn-chú, ASummary) 17<br />
2.5 , (, )<br />
Hui sêng-sim khoán-khè, put-chiok-í kiat su-iú. (Kat Hông, Phāu-phok-chú)<br />
Without all the heated fellowship, there is no possible way to build aproper band<br />
for teachers and students.<br />
(Kat Hông, Phāu-phok-chú) 18<br />
16<br />
17<br />
18<br />
Book of Rites,ananonymous work, is acollection of the miscellanies of ceremonial rites<br />
and music of the Warring States (c. 475–221 BC,) and the early Han (202 BC) periods. It is<br />
believed, Tè Sèng ( , Unknown Date), aConfucian scholar, edited the book. The<br />
»Record of Learning« isone of its chapters, which contains essays about the history of<br />
institutes, theories and experiences of teaching and learning of these areas.<br />
Sûn-chú, please see note 13; »A Summary«, is the collection of Sûn-chú’s articles about<br />
education, ethics, and the notes of the dialogue with his students.<br />
Kat Hông (283–343) is asignificant Taoist thinker and writer, who had great contributions<br />
to Taoist alchemy, elixirs, and demonology. »Phāu-phok-chú«isthe book title and<br />
his personal secondary name as well. The book is divided into two parts, Esoteric<br />
Chapters () and Exoteric Chapters (). The former investigates topics such as<br />
techniques to achieve immortality (), alchemy, meditation, breathing exercises,<br />
herbology, demons and mythical beings, and magic talismans (); the later discuss<br />
issues about Confucianism, legalism, government, politics, philosophy, literature, and<br />
attached his autobiography.
24 Professors’ Mirrors<br />
3Their expected ability<br />
3.1 (, )<br />
Tāi-jîn put hôa, kun-chú bū-sit. (Ông Hû, Chhiám-hu Lūn)<br />
An excellent person speaks without ostentation, and she behaves practically.<br />
(Ông Hû, Chhiám-hu Lūn) 19<br />
3.2 ()<br />
Hak jû ngiû-mô, sêng jû lîn-kak. (Ông Èng-lîn, Khùn-ha kKì-bûn)<br />
Academic knowledge is inexhaustible but few succeed.<br />
(Ông Èng-lîn, All About 20 Difficulties in Learning) 21<br />
19<br />
20<br />
21<br />
Ông Hû (90–165) was agreat learned Confucian scholar of the Han Empire. However,<br />
being the son of the concubine, he had never been called to the public service but he lived<br />
in seclusion. The book entitled »Chhiám-hu Lūn«, literally meaning »diver’s discourse«,<br />
makes it ametaphor for his life situation of withdrawing himself from society, then from<br />
where he was diving he was piercing up the hot issues of the society. With this attitude, he<br />
worked out this ten-volume well-accepted book, which contained, for example, problems<br />
of the people in the frontier, social corruptions, unjust evaluation of civic official promotion,<br />
politico-economic problems etc. Because his argument was profound and constructive,<br />
he was regarded as the representative thinker among his contemporaries.<br />
The saying literally goes as »Learning is like cow hair; achievement, the horns of akî-lîn«,<br />
here the »cow hair«, ( ngiû-mô)metaphorically means »countless in numbers«, and<br />
»the horns of akî-lîn«, amythical animal Chimera, parabolically pertains to the extremely<br />
scanty being. Thus »ngiû-mô lîn-kak« (), is an allegory of the difficult journey<br />
for becoming an excellent professor.<br />
Ông Èng-lîn (1223–1296) was an Imperial Doctor of Song and officer of the Ministry of<br />
Rites. He retired to his hometown in 1276, when the country was subjugated to Gôan<br />
Empire. Since then he had started to give lectures on Confucian classics and ancient<br />
history till he went to eternal rest. Dr. Ông was avoluminous writer, who wrote some 600<br />
volumes related to many fields. The saying here is selected from the book entitled: All<br />
About Difficulties in Learning (), in which he contributed his critical viewpoints<br />
on the mistakes made by predecessors in the field of nature, geography, history, politics<br />
and classic literatures etc. Furthermore, among his great number of academic monographs,<br />
achildren’s literacy booklet, The Three-Character Scripture () has been<br />
broadly benefiting Han people’sliteracy and reading, since the early 12th century it has<br />
been the most well-known children’s book.
Professors’ Mirrors 25<br />
3.3 (, )<br />
E k-ki jî bû kàu, chek kīn ûkhîm-siū. (Bēng-chú, Tîn Bûn-kong Siōng)<br />
Aprofessor who livesinease and comfort without continuing deeper research in<br />
her profession, is no more than an animal.<br />
(Bēng-chú, Duck Tîn Pt. I) 22<br />
3.4 , , (<br />
, )<br />
Kim sui khek-bo k, jî chui-choan put-khó-í hoa ttêng-lîm; chúi sui sèng-hóe, jî<br />
chin-kap put-chiok-í kiù hûn-san. (Kat Hông, Phāu-phok-chú)<br />
Although metal is harder than wood,forests cannot be cut down by an iron needle;<br />
water can extinguish fire, yet aglass of water cannot put out awildfire on the<br />
hills. 23<br />
(Kat Hông, Phāu-phok-chú) 24<br />
3.5 , (, )<br />
Thian-tē bû choân-kong, sèng-jîn bû choân-lêng, bān-bu tbûchoân-iōng. (Lia tGūkhò,<br />
Lia t-chú)<br />
Neither Heaven nor Earth has perfect functions, no holy man is almighty, and no<br />
22<br />
23<br />
24<br />
Bēng-chú (372–289 BC), next to Khóng-chú (), was horned as the second stage of the<br />
Middle States. His potent effect on moral philosophy and political thinking were theories<br />
of original goodness of human nature, instinctive moral sense, and benevolent<br />
government, etc. Besides, Bēng-chú is also the name of the book, edited by Bēng-chú’s<br />
disciples in 251–150 BC, together with The Great Learning, The Doctrine of the Mean,<br />
and the Analects are finally edited by acelebrated Neo-Confucian Professor Chu Hi (,<br />
1130–1200) under the name of The Four Books ()in 1190. Since then the book had<br />
been acompulsory subject of the Imperial Examinations. So far as »Tîn Bûn-kong Siōng«<br />
means the first part of the chapter of the Duke Tîn, which recorded the Duke Tîn asking<br />
for advice from Bēng-chú on how to practice benevolent politics and build up ajustice<br />
society.<br />
Metaphorically, this saying emphasized that aprofessor’s learning should not only<br />
specialize in atiny issue but she/he should also be equipped with encyclopedic knowledge.<br />
Please see note 18.
26 Professors’ Mirrors<br />
creature isofall-round usefulness.<br />
(Lia tGū-khò, Lia t-chú) 25<br />
3.6 , ()<br />
Kèng bû kiàn-chhû chi chōe, tō bû bêng-kò chi oàn. (Hân Hui, Koan-hēng)<br />
Amirror is innocent, though it reflects dirt on one’s face; the Tao should not be<br />
hated, even though it discloses one’s ill behavior.<br />
(Hân Hui, Behavioral Observation) 26<br />
4Their ideal personality<br />
4.1 ()<br />
Ta t-jîn bû put-khó, bông-kí ài chhong-seng. (Ông Ûi, Chēng Pâng Lô sī Koan)<br />
An intellectual is able to adjust herself in any kind of situation; she forgets her<br />
advantages but gives her love to human beings.<br />
(Ông Ûi, To Mr. Pâng Lô sī Koan) 27<br />
25<br />
26<br />
27<br />
Lia tGū-khò (450–375 BC) was known as Lia t-chú, living in the Warring States period<br />
(475–221 BCE). He was the pioneer of philosophical Taoism, who had proclaimed<br />
doctrines of an inactive view of life, discipline of tranquil state of mind, and pursuing<br />
transcendence and returning to nature.<br />
Hân Hui (281–233 BCE), aprince of the state of Han, who is astatesman and philosopher,<br />
the most important representative of the Legalist school during the Warring States period.<br />
His political theory decisively impacted emperors’ attitudes of governing, which<br />
practice legalism under the name of Confucianism (). Consequently, most of<br />
the Emperors of Middle States have been activating stern laws and rules to regulate<br />
people rather than policy of benevolence. The Behavioral Observation is achapter title of<br />
the book of Hân-hui-chu, in which Han Hui argued that the reasons for people’s misconducts<br />
and suffering are caused by their arrogant, self-righteous, pretentious deeds.<br />
And the ways to liberate oneself from the sufferings are, firstly, awareness that human<br />
beings are not almighty, and secondly, justifying oneself by practicing the Tao.<br />
Ông Ûi (701–761) was an Imperial Doctor of Tông and as aminister he was one of the<br />
representatives of greater poets in the period of Tông. All of his life, Ông Ûi made himself<br />
awell-known painter and poet, moreover, ascholar of Zen Buddhism. »ToMr. Pâng Lô sī<br />
Koan« was the poem that the poet composed for his friend Pâng Koan () who was<br />
going to take anew official post and gave him the best wishes for being awise and<br />
virtuous officer.
Professors’ Mirrors 27<br />
4.2 ()<br />
Tāi-jîn chiá, put sit kî chhiah-chú chi sim. (Bēng-chú, Lī-lô Hā)<br />
Agreat professor keeps her heart like anewborn baby’s.<br />
(Bēng-chú, Lī-lô Pt. 2) 28<br />
4.3 (, )<br />
Kun-chú thí kî-giân jî kò kî-hêng. (Khóng-chú, Lūn-gú)<br />
It is ashame for aprofessor to talk too much but act too less.<br />
(Khóng-chú, The Analects) 29<br />
4.4 ()<br />
Phāu chin-châi chiá, jîn put-ti put-un. (Ông Bûn-lo k, Chin-châi lūn)<br />
When agenuine learned professor is not fully recognized by her colleagues, she<br />
doesn’t feel not being irritated.<br />
(Ông Bûn-lo k, On agenuine able person) 30<br />
4.5 ()<br />
Kun-chú thí kî-giân jî kò kî-hêng. (Khóng-chú, Lūn-gú)<br />
Professors ofdifferent commitment in Tao cannot work together harmoniously.<br />
(Khóng-chú, The Analects) 31<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
Bēng-chú, please see note 22. As for Lī-lô Hā means the second section of the chapter Lī-lô,<br />
that is the chapter title and amythical clairvoyant as well. The subject of this chapter<br />
declared Bēng-chú’stheory of political ethics, which advocated an ideal king should hold<br />
his pure heart like ababy, and lying at this good human nature an efficacious politician<br />
could be expected.<br />
Please see note 3, 5, 13.<br />
Ông Bûn-lo k(1532–1605) was acounty officer and ascholar of Beng Empire; after his<br />
dismissal, he open his residence and gathered his friends and students for regular talking.<br />
Here the topic »Chin-châi lūn« means »On agenuine able person«. It was said that<br />
Professor Ông had been very much frustrated for all his talent that was unrecognized.<br />
Here Taomight be understood as »idea, intention, value commitment, or type of thinking<br />
etc.«, though it is usually interpreted as the metaphysical and moral ethical system of<br />
Confucianism, or philosophical Taoism.
28 Professors’ Mirrors<br />
4.6 ()<br />
Bûn-jîn siong kheng, chū-kó jî jîan. (Chô Phi, Lūn bûn)<br />
Professors like to disparage one another, from ancient times till now.<br />
(Chô Phi, On Text and Meaning) 32<br />
4.7 ()<br />
Put-heng kî gē, put-lêng lo k-ha k. (Lé-kì, Ha k-kì)<br />
Ascholar who is not interested in her subject, will not be able to appreciate her<br />
study.<br />
(Book of Rites, Record of Learning) 33<br />
5Their attitudes towards students<br />
5.1 (, )<br />
Iú-kàu bû lūi. (Khóng-chú, Lūn-gú)<br />
Come to me, Confucius said, those who want to study. 34<br />
(Confucius, The Analects) 35<br />
32<br />
33<br />
34<br />
35<br />
Chô Phi (187–226) was the Founding Emperor of the Chô-Gūi State, in the Three<br />
Kingdoms period (208–280). There was hardly an emperor like Chô Phi who had excellent<br />
contributions in literature, in which he was the first author of literary criticism,<br />
entitled Research into Originality of Text and Meaning (). Besides, he had<br />
composed agreat number of poems and essays which had extended the two volumes<br />
Anthology of Emperor Gūi-bûn (). It is noteworthy that the saying, Bûnjîn<br />
siong kheng (), is still truly spelling out the secret of the reason of disharmony<br />
among professors.<br />
Please see note 16.<br />
This is my free translation, surely an imitation of Jesus Christ’scalling (Mat. 11:28), since<br />
Isensed it would be more able to demonstrate Confucius’ idea of education than afaithful<br />
literally rendering, for example, »In teaching there should be no distinction of classes«.<br />
(http://lubcc14.blogspot.com › by-tiffany-christy_9855).<br />
Please see note 3, 5, 13, 29.
Professors’ Mirrors 29<br />
5.2 (, )<br />
Jîn chi hoān, chāi hò-ûi jîn-su. (Bēng-chú, Lī-lô Siōng)<br />
An awful professor has habits like being keen to lecture anyone as her innocent<br />
student. (Bēng-chú, Lī-lô Pt. I) 36<br />
5.3 ()<br />
(Khóng-chú, Lūn-gú)<br />
The way of wisdom is keeping on what you know and facing what you do not<br />
know. (Conducius, The Analects) 37<br />
5.4 (, )<br />
Tē-chú put-pit put-jû su, su put-pit hiân-û tē-chú. (Hân Jú, Su Soat)<br />
Students are not necessarily inferior to their professors, nor professors better<br />
than their students.<br />
(Hân Jú, On Teachers) 38<br />
5.5 , (, )<br />
Soan-hū iû-lêng ùi hō-seng, tiōng-hu bī-khó kheng siàu-liân. (Lí Pe k, Siōng LÍ Iong)<br />
Even Confucius, the greatest teacher, respects younger students, how dare you<br />
professor despise young one.<br />
(Lí Pe k, Submit to County Magistrate LÍ Iong) 39<br />
36<br />
37<br />
38<br />
39<br />
What’s wrong, if one is keen to instruct people? The comments of ordinary people may<br />
characterize such abehaviour as arrogance, haughtiness, and self-importance. Beyond<br />
that Confucianists could reckon such abehavior as surpassing the proper manner of<br />
being ateacher, namely to respect each other by properly controlling one’sgolden mouth<br />
because the Tao ofthe teacher is invaluable.<br />
Please see note 28. Here »Siōng« means »the first part« of the chapter, and »Hā«, the<br />
second part.<br />
Please see note 4.<br />
Lí Pe k(701–762) was the most famous poet in Tông State; he had been praised as »the<br />
Immortal Poet, ( )« who handed down 1,100 poems which are fully manifested with<br />
romanticist elegant beauty. Here the quotation was picked from the poem of Lí Pe k,<br />
»Submit to County Magistrate LÍ Iong«, in which he satirized Magistrate LÍ who did not<br />
properly hosted him as ayoung poet and literature. As for LÍ Iong (678–747) was an
30 Professors’ Mirrors<br />
5.6 , (, )<br />
Chúi chì-chheng chek bô-hî, lâng chì-chhat chek bô-tô. (Lé-kì, Chú Tiu Mn gJipkoa<br />
Phian)<br />
Crystal clear water raises no fish; an overly vigorous professor recruits no students.<br />
(Book of Rites, Master Tiun on Officers) 40<br />
6Afterword<br />
Perhaps one would be bored if looking at mirrors too long and too often. Here Chuhian<br />
composed apoem for Christel to wish of her agraceful and abundant life:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Kèng-lí koan-hêng hû gán-chêng,<br />
sêng- ìbêng-iá chin-sit seng;<br />
chim-te kEng-e kchhiá it-chhiàu,<br />
pat-sûn kàu-siū jû-ia tchêng.<br />
Figure’s image is emerging while you’re looking at the mirror,<br />
Let your sincerity brighten the shadow occuring in real life;<br />
Presenting you some ancient aphorisms Ibeg you aknowing smile,<br />
Many happy returns and be cheerful with an 80 y’s young professor.<br />
References<br />
1982<br />
(In Tāi-le ked., Kó-tāiKek-giân Kéng-kù Soán (ASelection of AncientAphorisms).<br />
2012<br />
(Lâu Sū-chhong and Kok Khe-lâm ed. &trans., Tiong-kok Kó-tāi Keng-tián Bêngkù<br />
(Gems of Ancient Chinese Wisdom).<br />
40<br />
officer of Tông State and the most renounced calligrapher, yet historians criticized him<br />
for being proud and despising his younger contemporaries.<br />
Please see note 16.
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der<br />
Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten<br />
sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.<br />
© 2022 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig<br />
Printed in Germany<br />
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.<br />
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne<br />
Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für<br />
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung<br />
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.<br />
Das Buch wurde auf alterungsbeständigem Papier gedruckt.<br />
Cover: Zacharias Bähring, Leipzig<br />
Satz: 3w+p, Rimpar<br />
Druck und Binden: Hubert & Co., Göttingen<br />
ISBN 978-3-374-07161-6 // eISBN (PDF) 978-3-374-07162-3<br />
www.eva-leipzig.de