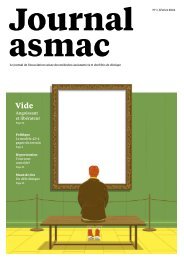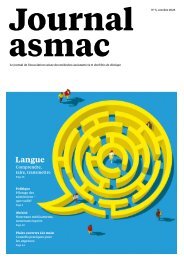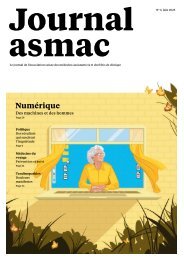vsao Journal Nr. 6 - Dezember 2022
Licht - Von Zellen, Käfern und Szenen Politik - Arztberuf unter Druck Immunsuppressiva - Möglichkeiten und Grenzen bei Tumoren Rheumatologie - Management der Gicht
Licht - Von Zellen, Käfern und Szenen
Politik - Arztberuf unter Druck
Immunsuppressiva - Möglichkeiten und Grenzen bei Tumoren
Rheumatologie - Management der Gicht
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>vsao</strong><br />
<strong>Nr</strong>. 6, <strong>Dezember</strong> <strong>2022</strong><br />
<strong>Journal</strong><br />
Das <strong>Journal</strong> des Verbandes Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte<br />
Licht<br />
Von Zellen, Käfern<br />
und Szenen<br />
Seite 30<br />
Politik<br />
Arztberuf unter Druck<br />
Seite 6<br />
Immunsuppressiva<br />
Möglichkeiten und Grenzen<br />
bei Tumoren<br />
Seite 48<br />
Rheumatologie<br />
Management der Gicht<br />
Seite 51
Allgemeine<br />
Innere Medizin<br />
24. – 28.01.2023 Basel<br />
40 h<br />
06. – 10.06.2023 Zürich<br />
39 h<br />
Innere Medizin<br />
20. – 24.06.2023 Zürich<br />
39 h<br />
Hausarzt<br />
Fortbildungstage<br />
09. – 10.03.2023 St. Gallen<br />
23. – 24.03.2023 Bern<br />
14 h<br />
Anästhesiologie<br />
und Intensivmedizin<br />
16. – 17.05.2023 Zürich<br />
16 h<br />
Gynäkologie<br />
24 h<br />
27. – 29.04.2023 Zürich<br />
Neurologie<br />
16 h<br />
12. – 13.05.2023 Zürich<br />
Nephrologie<br />
14 h<br />
23. – 24.06.2023 Zürich<br />
Ophthalmologie 15 h<br />
08. – 09.06.2023 Zürich<br />
Pädiatrie<br />
24 h<br />
26. – 28.04.2023 Zürich<br />
Pneumologie<br />
14 h<br />
12. – 13.05.2023 Zürich<br />
Psychiatrie und<br />
Psychotherapie<br />
04. – 06.05.2023 Zürich<br />
Rheumatologie<br />
09. – 10.06.2023 Zürich<br />
Urologie<br />
12.05.2023 Zürich<br />
24 h<br />
12 h<br />
6 h<br />
Update Refresher<br />
Information / Anmeldung<br />
Tel.: 041 567 29 80 | info@fomf.ch<br />
www.fomf.ch<br />
Hybrid: Teilnahme vor Ort oder via Livestream<br />
Beste Prognosen<br />
für Ihr<br />
Familienglück.<br />
Sie stehen mitten im Leben, verwirklichen<br />
Ihre Ziele und gründen eine Familie.<br />
Schützen Sie sich vor Erwerbsausfall und<br />
sichern Sie Ihr Altersguthaben – damit<br />
Ihre Liebsten jederzeit gut versorgt sind.<br />
Machen Sie den Spar-Check:<br />
va-genossenschaft.ch<br />
Risikoschutz<br />
Vorsorge<br />
Partner von
Inhalt<br />
Licht<br />
Von Zellen, Käfern und Szenen<br />
Coverbild: Stephan Schmitz<br />
Editorial<br />
5 Licht ins Dunkel<br />
Politik<br />
6 Wege nicht versperren<br />
10 Keine Schwächung des<br />
Berufsgeheimnisses<br />
12 Ruhiges Ende des Jubiläumsjahres<br />
Weiterbildung /<br />
Arbeitsbedingungen<br />
14 Reform der ärztlichen Weiterbildung<br />
in der Westschweiz<br />
16 Wie die Alten sungen …<br />
19 Auf den Punkt gebracht<br />
<strong>vsao</strong><br />
20 Happy Birthday, <strong>vsao</strong>!<br />
22 Impressionen vom Jubiläumsfest<br />
24 Neues aus den Sektionen<br />
28 <strong>vsao</strong>-Inside<br />
29 <strong>vsao</strong>-Rechtsberatung<br />
Perspektiven<br />
48 Aktuelles aus der Immunologie:<br />
Immuntherapie zur Behandlung<br />
von Sarkomen<br />
51 Aus der «Praxis»: Die Gicht und ihr<br />
Management in der Praxis<br />
57 Im Einsatz in der Schweiz<br />
mediservice<br />
58 Briefkasten<br />
60 Versicherungsschutz im Netz – auch<br />
für Private<br />
62 Digitale Transformation im<br />
Gesundheitswesen<br />
64 Kochen für Gaumen und Gesundheit<br />
Rindscarpaccio für festliche Stunden<br />
66 Impressum<br />
Fokus: Licht<br />
30 Lichtschalter für Zellen<br />
34 Verbot zeigt erste Wirkung<br />
38 Leuchtfeuer der Natur<br />
42 Ins richtige Licht gesetzt<br />
44 Helle Nächte<br />
Anzeige<br />
CH-3860 Meiringen<br />
Telefon +41 33 972 81 11<br />
www.privatklinik-meiringen.ch<br />
Lebensqualität<br />
Ein Unternehmen der Michel Gruppe<br />
Ärztliche Leitung:<br />
Prof. Dr. med. Thomas J. Müller<br />
Wo Patienten auch Gäste sind.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 3
«Wir übernehmen, wo<br />
andere an Grenzen stossen.»<br />
Dr. med. E. Fischer, Oberärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie<br />
In der UPD im Teilzeitpensum jungen Menschen<br />
helfen geht wunderbar. Jetzt bewerben: upd.jobs
Editorial<br />
Licht ins<br />
Dunkel<br />
Catherine Aeschbacher<br />
Chefredaktorin <strong>vsao</strong> <strong>Journal</strong><br />
1873 berichteten die «Illustrated London News» enthusiastisch<br />
über eine sensationelle Neuheit: elektrisches Licht. Eine<br />
Maschine mit der Kraft von lediglich zweieinhalb Pferdestärken<br />
erzeuge in 260 Fuss Höhe einen Lichtschein, der von überall<br />
zu sehen sei. Am Ende des Textes entwirft der <strong>Journal</strong>ist eine Vision<br />
von hell erleuchteten Städten und Dörfern. 150 Jahre später gehen<br />
wir spätabends irritiert durch die Stadt: Leuchtreklamen sind aus und<br />
Schaufensterbeleuchtungen gedimmt, das Bundeshaus liegt im Dunkeln.<br />
Der ungewohnte Eindruck ist beinahe unheimlich. Dass nachts<br />
die Lichter brennen, war bislang eine Selbstverständlichkeit.<br />
Wenn der Mensch die Nacht zum Tage macht, bringt das andere<br />
Lebewesen in Bedrängnis. Davon zeugt unser Fokus-Beitrag zur Lichtverschmutzung.<br />
Unter dem Stichwort «Licht» beleuchten wir weitere<br />
Themen wie die Optogenetik, die Steuerung zellulärer Aktivitäten<br />
durch Licht oder die Gefahren durch Laserpointerattacken. Auch<br />
beschäftigen wir uns mit den märchenhaften Glühwürmchen sowie<br />
der Bedeutung des Lichts im Theater. Dazwischen eingestreut finden<br />
sich Bilder von Nordlichtern, die unser Redaktionsmitglied Anna<br />
Wang aufgenommen hat.<br />
Vermehrt Licht ins Dunkel terroristischer Aktivitäten möchte auch<br />
der Bundesrat bringen durch die Revision des Nachrichtendienstgesetzes.<br />
Für Ärztinnen und Ärzte ist die damit verbundene Aufweichung<br />
des Arztgeheimnisses allerdings höchst fragwürdig. Darüber<br />
und über die aktuellen Entwicklungen beim Zulassungsstopp berichten<br />
wir im Politikteil. Ebenso über die Herbstsitzung des Zentralvorstandes<br />
<strong>vsao</strong> und die Delegiertenversammlung von mediservice<br />
<strong>vsao</strong>-asmac.<br />
Das zu Ende gehende Jahr stand im Zeichen des <strong>vsao</strong>-Jubiläums.<br />
Coronabedingt wurden nicht 75 Jahre, sondern 77 Jahre <strong>vsao</strong> gefeiert.<br />
Eine Nachlese mit Bildern vom grossen Jubiläumsfest befindet sich<br />
in der Rubrik «<strong>vsao</strong>». Und wer den diesjährigen Laufbahnkongress<br />
medifuture – einen Anlass der Superlative – verpasst hat, erhält eine<br />
Kurzfassung im Teil «Weiterbildung/Arbeitsbedingungen».<br />
Allen Krisen zum Trotz steht die festliche, lichterfüllte Zeit bevor.<br />
Die Redaktion des <strong>vsao</strong> <strong>Journal</strong>s dankt Ihnen, verehrte Leserinnen<br />
und Leser, an dieser Stelle herzlich für Ihr Interesse an unserem<br />
<strong>Journal</strong>. Und wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen ein frohes, helles<br />
Weihnachtsfest sowie ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 5
Politik<br />
Wege nicht<br />
versperren<br />
Im Januar 2023 tritt die EDI-Verordnung über die regionalen Versorgungsgrade<br />
in Kraft. Damit haben die Kantone die Grundlage, um die Zahl der Ärztinnen<br />
und Ärzte zu begrenzen, die in einem Fachbereich zulasten der OKP tätig<br />
sein dürfen. Es bleibt aber weiterhin viel Spielraum, um die Begrenzung moderat<br />
zu gestalten und negative Auswirkungen zu vermeiden.<br />
Philipp Thüler, Leiter Politik und Kommunikation / stv. Geschäftsführer <strong>vsao</strong><br />
Der Weg in die freie Praxis darf nicht zum Nadelöhr werden. Kantone müssen ihren Spielraum nutzen, um negative Auswirkungen<br />
der Zulassungssteuerung zu vermeiden.<br />
Ärztinnen und Ärzte wie auch<br />
andere Berufsgruppen, die<br />
zulasten der obligatorischen<br />
Krankenpflegeversicherung<br />
(OKP) tätig sein möchten, benötigen eine<br />
Zulassung vom Kanton, auf dessen Gebiet<br />
sie sich niederlassen wollen. Die Voraussetzungen<br />
für die Zulassung sind im Krankenversicherungsgesetz<br />
(KVG) und in der<br />
Krankenversicherungsverordnung (KVV)<br />
geregelt. Unter anderem gehört dazu eine<br />
mindestens dreijährige Tätigkeit an einer<br />
anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte<br />
im beantragten Fachgebiet –<br />
wobei diesbezüglich bereits ein Vorschlag<br />
für Ausnahmeregelungen für bestimmte<br />
Fachgebiete in Diskussion ist.<br />
Zusätzlich und um eine Überversorgung<br />
in einzelnen Fachgebieten zu verhindern,<br />
können bzw. müssen die Kantone<br />
die Anzahl zugelassener Ärztinnen und<br />
Ärzte begrenzen, die im ambulanten Bereich<br />
Leistungen zulasten der OKP erbringen<br />
dürfen. Die Begrenzung soll über die<br />
Definition von Höchstzahlen für Ärztinnen<br />
und Ärzte in bestimmten Fachgebieten<br />
geschehen. Wie diese Höchstzahlen<br />
bestimmt werden, ist in der Höchstzahlenverordnung<br />
geregelt, die seit dem 1. Juli<br />
2021 in Kraft ist.<br />
Bild: Adobe Stock<br />
6<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Politik<br />
Drei Faktoren bestimmen die<br />
Höchstzahl<br />
Gemäss dieser Verordnung müssen die<br />
Kantone für die Bestimmung von Höchstzahlen<br />
zunächst das bestehende Angebot<br />
in einem oder mehreren Fachgebieten berechnen,<br />
und zwar in Vollzeitäquivalenten.<br />
Bereits dies ist eine Herausforderung,<br />
denn es ist aufgrund der verfügbaren Daten<br />
nicht immer klar, wie viele Stunden<br />
ein Arzt oder eine Ärztin in welchem Fachgebiet<br />
tätig ist.<br />
Wenn diese Zahl ermittelt ist, muss sie<br />
ins Verhältnis zum Versorgungsgrad gesetzt<br />
werden. Dieser Versorgungsgrad ist<br />
in der Verordnung des EDI über die regionalen<br />
Versorgungsgrade festgehalten, die<br />
am 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Die Berechnungsmethode<br />
der Versorgungsgrade<br />
wurde bereits mehrfach kritisch bewertet,<br />
auch vom <strong>vsao</strong> in verschiedenen Stellungnahmen.<br />
Sie soll schon bald ein erstes Mal<br />
und danach regelmässig überarbeitet werden.<br />
Auch die Datengrundlagen, die für<br />
die Berechnung benötigt werden, sollen<br />
verbessert werden.<br />
Zudem können die Kantone für die<br />
Bestimmung der Höchstzahlen einen Gewichtungsfaktor<br />
vorsehen, mit dem sie<br />
Umstände berücksichtigen, die bei der<br />
Berechnung des Versorgungsgrads nicht<br />
berücksichtigt werden konnten, zum Beispiel<br />
eine schweizweite Unter- oder Überversorgung<br />
im entsprechenden Fachgebiet<br />
oder ein Mehrbedarf durch Tourismus.<br />
Es sind also drei Faktoren bestimmend:<br />
– der Versorgungsgrad in diesem Fachgebiet<br />
und diesem Kanton, der vom Bund<br />
berechnet und in der entsprechenden<br />
Verordnung publiziert wird,<br />
– das bestehende Angebot an Ärztinnen<br />
und Ärzten in einem Fachgebiet, das<br />
vom Kanton in Vollzeitäquivalenten bestimmt<br />
wird,<br />
– der Gewichtungsfaktor, der vom Kanton<br />
festgelegt wird.<br />
Ein fiktives Berechnungsbeispiel könnte<br />
wie folgt aussehen: Im Kanton Thurgau<br />
sind im Fachgebiet Psychiatrie und Psychotherapie<br />
Ärztinnen und Ärzte im Umfang<br />
von 32 Vollzeitäquivalenten (VZÄ)<br />
ambulant tätig. Der vom Bund berechnete<br />
Versorgungsgrad beträgt für dieses Fachgebiet<br />
in diesem Kanton 105 Prozent. Der<br />
Kanton rechnet zum Gewichtungsfaktor<br />
einen Toleranzbereich von 10 Prozent hinzu.<br />
Er rechnet zusätzlich 20 Prozent hinzu,<br />
da Fachpersonen in diesem Fachgebiet<br />
von einer schweizweiten Unterversorgung<br />
von 20 Prozent ausgehen. Der Gewichtungsfaktor<br />
beträgt damit 1.3.<br />
Die Höchstzahl wird nun wie folgt bestimmt<br />
werden: 32 (VZÄ) / 1.05 (Versorgungsgrad)<br />
* 1.3 (Gewichtungsfaktor) = 40<br />
(Höchstzahl)<br />
Im Kanton Thurgau dürfen damit gemäss<br />
diesem fiktiven Beispiel im Fachgebiet<br />
Psychiatrie und Psychotherapie Ärztinnen<br />
und Ärzte maximal im Umfang von<br />
40 VZÄ tätig sein. Da das bestehende Angebot<br />
32 VZÄ entspricht, kann der Kanton<br />
weitere Ärztinnen und Ärzte zulassen, die<br />
ein entsprechendes Gesuch stellen und<br />
die Voraussetzungen erfüllen.<br />
Ab Januar, wenn die Verordnung über<br />
die regionalen Versorgungsgrade in Kraft<br />
ist, können die Kantone gemäss dieser Methode<br />
Höchstzahlen bestimmen. Sie müssen<br />
dies bis spätestens am 1. Juli 2025 für<br />
mindestens ein Fachgebiet in mindestens<br />
einer Region tun.<br />
Regelmässige Überprüfung und<br />
Anpassung<br />
Was heisst das nun für den <strong>vsao</strong> und seine<br />
Mitglieder? Im besten Fall ändert sich<br />
nicht viel. Das Gesetz und die Verordnung<br />
lassen den Kantonen genügend Spielraum.<br />
So können die gesetzlichen Vorgaben<br />
des Gesetzes erfüllt werden, ohne<br />
dass dies eine negative Auswirkung auf<br />
Ärztinnen oder Patienten hätte.<br />
Deshalb gilt es nun aufmerksam zu<br />
verfolgen, was in den einzelnen Kantonen<br />
mit den Bundesvorgaben gemacht wird.<br />
Wird überhaupt etwas gemacht? Wie werden<br />
das bestehende Angebot und der Gewichtungsfaktor<br />
bestimmt? Und vor allem:<br />
Wie entwickeln sich die Datengrundlagen<br />
und Berechnungsmethoden? Die Verordnung<br />
verlangt nämlich explizit, dass die<br />
Versorgungsgrade und die Höchstzahlen<br />
regelmässig überprüft und angepasst werden<br />
müssen. Es ist deshalb wichtig, den<br />
jeweils aktuellen Stand im Blick zu haben<br />
und nötigenfalls zu reagieren.<br />
Negative Auswirkungen möglich<br />
Der <strong>vsao</strong> ist im Kontakt mit den Sektionen<br />
und beobachtet mit diesen genau, was in<br />
den Kantonen geschieht. In Basel sind bereits<br />
im Rahmen der Übergangsbestimmungen<br />
Höchstzahlen für acht Fachgebiete<br />
definiert worden. Die Folgen eines<br />
Zulassungsstopps sind auf keinen Fall zu<br />
unterschätzen. Einerseits kann es für Patientinnen<br />
und Patienten schwierig werden,<br />
eine Ärztin oder einen Arzt zu finden,<br />
andererseits wirkt sich ein Stopp auch auf<br />
anderen Ebenen aus: Für Ärztinnen und<br />
Ärzte in Weiterbildung wie auch für Studierende<br />
oder junge Menschen, die sich<br />
überlegen, ein Medizinstudium in Angriff<br />
zu nehmen, wirkt die Aussicht auf eine<br />
eingeschränkte Wahlfreiheit bezüglich<br />
Spezialisierung und Niederlassung alles<br />
andere als motivierend.<br />
Dazu kommt, dass auch der Karriereweg<br />
in den Spitälern schwieriger wird, da<br />
es aufgrund eines Zulassungsstopps zu eigentlichen<br />
Staus kommen kann. Erfahrene<br />
Oberärzte oder leitende Ärztinnen arbeiten<br />
länger als normalerweise üblich im<br />
Spital, da der Weg in die freie Praxis ver-<br />
Achtung: Sektionswechsel und Reduktionsgesuche<br />
frühzeitig einreichen<br />
Im Februar versendet das <strong>vsao</strong>-Zentralsekretariat jeweils die Jahresrechnungen für<br />
die Mitgliederbeiträge. Die Sektionszugehörigkeit und allfällige Beitragsreduktionen<br />
haben einen Einfluss auf den Rechnungsbetrag. Deshalb müssen Sektionswechsel<br />
oder Reduktionsgesuche für das Jahr 2023 bis spätestens am 31. Januar 2023 beim<br />
<strong>vsao</strong>-Zentralsekretariat eingereicht werden. Später eingereichte Gesuche oder Sektionswechsel<br />
können nur noch in begründeten Härtefällen für das Rechnungsjahr 2023<br />
berücksichtigt werden. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!<br />
ReMed: wenn Sie Hilfe brauchen<br />
ReMed ist die Beratungs- und Hilfsstelle der FMH, an die sich Ärztinnen und Ärzte<br />
in Not wenden können. Gemäss ReMed-Leiter Peter Christen melden sich im Vergleich<br />
zu früher deutlich mehr jüngere Ärztinnen und Ärzte, die in Spitälern arbeiten.<br />
Dies oft wegen zusätzlichen Drucks und Angst vor einem Jobverlust, aber auch, weil<br />
Beruf und Familienleben sich nur schwer vereinbaren lassen oder wegen zwischenmenschlicher<br />
Probleme am Arbeitsplatz. ReMed kann helfen, steht allen Ärztinnen<br />
und Ärzten zur Verfügung und ist über die 24-Stunden-Hotline 0800 07 36 33 oder<br />
per E-Mail (remed@hin.ch) erreichbar.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 7
Politik<br />
sperrt ist und «verstopfen» so den Weg für<br />
junge Assistenzärztinnen und -ärzte, die<br />
nachrücken möchten. Dies kann auch zu<br />
einer Reduktion der Weiterbildungsstellen<br />
führen. Ein weiterer bestimmt unerwünschter<br />
Nebeneffekt eines Zulassungsstopps<br />
ist der Markt für Zulassungen, der<br />
entsteht. Leitet der Kanton keine geeigneten<br />
Gegenmassnahmen ein, führt die Verknappung<br />
der Zulassungen dazu, dass diese<br />
gehandelt werden. Ein Praxis- und Zulassungsinhaber,<br />
der seine Praxis aufgibt,<br />
kann diese inkl. Zulassung an den Meistbietenden<br />
verkaufen, wenn der Kanton<br />
dies nicht unterbindet. Dies erschwert<br />
jungen, weniger finanzstarken Ärztinnen<br />
und Ärzten den Weg in die Praxis.<br />
Die Sektionen und der <strong>vsao</strong> haben<br />
nun die wichtige Aufgabe, die nächsten<br />
Schritte der Kantone genau zu beobachten,<br />
im richtigen Moment und mit den<br />
richtigen Argumenten zu intervenieren<br />
und auch die zukünftigen Überarbeitungen<br />
der Berechnungsmodelle kritisch zu<br />
begleiten.<br />
Future Women Physicians<br />
Die Medizin wird weiblich! Der Frauenanteil steigt, sowohl im Medizinstudium als<br />
auch in der Ärzteschaft. Trotzdem adaptieren sich traditionelle Führungskulturen<br />
nur langsam und weibliche Rollenmodelle in Kaderfunktionen bleiben rar.<br />
Wir wollen dies ändern!<br />
In Zusammenarbeit mit Dr. med. Christina Venzin von College M bieten wir deshalb<br />
seit Anfang <strong>2022</strong> die interaktiven «Future Women Physicians»-Workshops für Ärztinnen<br />
der Zukunft an. Assistenz- und Oberärztinnen finden in den Workshops Gelegenheit,<br />
sich mit den eigenen Karrierevorstellungen und Ambitionen auseinanderzusetzen.<br />
Gleichzeitig werden versteckte Stolpersteine aufgedeckt und kreative Lösungsansätze<br />
diskutiert.<br />
Mit «Future Women Physicians» bauen wir zudem ein schweizweites Netzwerk<br />
von Ärztinnen für Ärztinnen auf, um gemeinsam mehr erreichen zu können. In diesem<br />
Rahmen finden Alumni-Anlässe mit weiteren Inputreferaten statt, erstmals am<br />
23. Januar 2023 in Bern.<br />
Schaffen wir gemeinsam weibliche Vorbilder in Führungspositionen!<br />
Save the Date: Für 2023 sind zwei weitere Workshops geplant!<br />
– 13. Februar 2023 in Bern<br />
– 25. September 2023 (Ort noch offen)<br />
Weitere Informationen folgen unter www.college-m.ch oder www.<strong>vsao</strong>.ch.<br />
@<strong>vsao</strong>asmac<br />
8<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Ihre Bedürfnisse<br />
im Mittelpunkt<br />
Visitationen<br />
Bewertungen, Löhne, Arbeitszeiten,<br />
Kitas, Jobs - und noch viel<br />
mehr: medicus ist das umfassende<br />
Portal für Ihre Karriere. Dort<br />
finden Sie die optimal zu Ihnen<br />
passende Stelle!<br />
Die Spitäler und <strong>vsao</strong>-Sektionen<br />
bieten Ihnen wichtige Informationen<br />
zu den Arbeitsbedingungen. Den<br />
wichtigsten Beitrag leisten jedoch<br />
Sie: Bewerten Sie anonym Ihren<br />
bisherigen Arbeitgeber. Damit<br />
helfen Sie anderen – und profitieren<br />
selber von deren Erfahrungen.<br />
www.medicus.ch<br />
Wie gut ist die Weiterbildung in<br />
den Kliniken? Dieser Frage gehen<br />
die Visitationen auf den Grund. Zu<br />
den Expertenteams gehört immer<br />
jemand vom <strong>vsao</strong>. Die Besuche vor<br />
Ort dienen dazu, Verbesserungsmöglichkeiten<br />
zu erkennen. Denn<br />
Sie als unser Mitglied sollen von<br />
einer hohen Weiterbildungsqualität<br />
profitieren.<br />
Falls Sie selber Visitationen<br />
begleiten möchten: eine E-Mail<br />
an visitationen@<strong>vsao</strong>.ch, und<br />
Sie erfahren mehr!<br />
www.<strong>vsao</strong>.ch/visitationen<br />
Feedback-<br />
Pool<br />
Für Sie als Mitglied ist sie zentral:<br />
die Weiterbildung. Deshalb fühlen<br />
wir unserer Basis mit Umfragen<br />
regelmässig den Puls dazu. Dank<br />
dieses Feedback-Pools können wir<br />
unsere Verbandsarbeit gezielt auf<br />
Ihre Anliegen ausrichten.<br />
Wollen Sie mitmachen?<br />
Dann schreiben Sie an<br />
sekretariat@<strong>vsao</strong>.ch.<br />
www.<strong>vsao</strong>.ch/studien-undumfragen<br />
Arztberuf<br />
und Familie<br />
• Wie bringe ich Familie, Freizeit und<br />
Beruf unter einen Hut?<br />
• Wie steige ich nach der Babypause<br />
wieder ein?<br />
• Wie meistere ich die täglichen<br />
Herausforderungen?<br />
Antworten auf solche Fragen erhalten Sie<br />
als <strong>vsao</strong>-Mitglied bei unserem kostenlosen<br />
Coaching. Die Beratung erfolgt telefonisch<br />
durch die Fachstelle UND.<br />
044 462 71 23<br />
info@fachstelle-und.ch<br />
www.<strong>vsao</strong>.ch/telefoncoaching
Politik<br />
Keine Schwächung des<br />
Berufsgeheimnisses<br />
Der Bundesrat möchte das Nachrichtendienstgesetz revidieren,<br />
um auf die veränderte Bedrohungslage zu reagieren – ein sicherlich<br />
berechtigtes Anliegen. Die gleichzeitig vorgesehene Schwächung<br />
des ärztlichen Berufsgeheimnisses ist aber unverhältnismässig<br />
und muss unbedingt verhindert werden.<br />
Yvonne Stadler, Leiterin Recht / stv. Geschäftsführerin <strong>vsao</strong><br />
Das Berufsgeheimnis ist ein fester Bestandteil der Arzt-Patienten-Beziehung. Seine Schwächung beeinträchtigt auch das Vertrauen<br />
von Patientinnen und Patienten in die Ärzteschaft.<br />
Bild: Adobe Stock<br />
10<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Politik<br />
Der Bundesrat hat am 18. Mai<br />
<strong>2022</strong> die Vernehmlassung für<br />
die Revision des Nachrichtendienstgesetzes<br />
(NDG) eröffnet.<br />
Die Vernehmlassungsfrist dauerte<br />
bis am 9. September <strong>2022</strong>. Schwerpunkte<br />
der Revision sind die Ausweitung der<br />
genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen<br />
zur Aufklärung von gewaltextremistischen<br />
Aktivitäten, die Neuregelung<br />
der Datenhaltung des Nachrichtendienstes<br />
des Bundes (NDB) und die<br />
Übertragung der Aufgaben der unabhängigen<br />
Kontrollinstanz für die Funk- und<br />
Kabelaufklärung an die Aufsichtsbehörde<br />
über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten.<br />
Damit reagiert der Bundesrat auf<br />
die Entwicklung der Bedrohungslage der<br />
letzten Jahre.<br />
Was aber hat nun die Revision des<br />
NDG mit dem <strong>vsao</strong> zu tun? Wer sich die<br />
Zeit nimmt, die Revision einer genaueren<br />
Betrachtung zu unterziehen und dabei die<br />
Interessen der Ärztinnen und Ärzte im Fokus<br />
hat, stösst schnell auf Art. 28 Abs. 2<br />
NDG. Dieser besagt, dass nach geltendem<br />
Recht genehmigungspflichtige Beschaffungsmassnahmen<br />
gegenüber einer Drittperson<br />
dann nicht angeordnet werden,<br />
wenn diese Drittperson einer der in Art.<br />
171–173 Strafprozessordnung genannten<br />
Berufsgruppe angehört. Das sind jene Berufsgruppen,<br />
die ein Zeugnisverweigerungsrecht<br />
haben bzw. dem Berufsgeheimnis<br />
unterstehen, also – unter anderem<br />
– Ärztinnen und Ärzte sowie ihre<br />
Hilfspersonen. Die Revision sieht nun vor,<br />
diese Ausnahme zu streichen. Damit<br />
könnte der NDB die Erlaubnis erhalten,<br />
sich Zugriff auf die Computer oder die Telefonie<br />
einer Arztpraxis zu verschaffen,<br />
sofern zu den Patientinnen und Patienten<br />
der Praxis eine im Sinne des NDB verdächtige<br />
Person gehört.<br />
Nicht zur Stellungnahme eingeladen<br />
Das ärztliche Berufsgeheimnis ist damit<br />
direkt von der Revision des Nachrichtendienstgesetzes<br />
betroffen und droht empfindlich<br />
geschwächt zu werden. Umso erstaunlicher<br />
ist es, dass im Rahmen des<br />
Vernehmlassungsverfahrens weder die<br />
FMH noch der <strong>vsao</strong> vom zuständigen Departement<br />
für Verteidigung, Bevölkerungsschutz<br />
und Sport (VBS) zur Stellungnahme<br />
eingeladen wurden. Die FMH<br />
reichte trotzdem fristgerecht eine Stellungnahme<br />
ein, deren Sichtweise der <strong>vsao</strong><br />
voll und ganz teilt.<br />
Der <strong>vsao</strong> stützt sich bei seinen Überlegungen<br />
auf das in der Bundesverfassung<br />
festgeschriebene Recht. Und sieht in der<br />
Schwächung des Berufsgeheimnisses eine<br />
Bedrohung für die Arzt-Patienten-Beziehung.<br />
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung<br />
ist das Berufsgeheimnis gemäss<br />
Art. 321 StGB ein «wichtiges Rechtsinstitut<br />
des Bundesrechts. Es fliesst aus<br />
dem verfassungsmässigen Anspruch auf<br />
Privatsphäre (Art. 13 BV, Art. 8 EMRK) und<br />
dient dem Schutz des besonderen Vertrauensverhältnisses<br />
zwischen Arzt und<br />
Patient.» Ärztinnen und Ärzte haben für<br />
Sachverhalte, die der Schweigepflicht unterstehen,<br />
ein gesetzlich vorgesehenes<br />
Zeugnisverweigerungsrecht.<br />
Das Berufsgeheimnis bezweckt den<br />
Schutz von hochsensiblen Patientendaten.<br />
Der Patient oder die Patientin muss<br />
auf diesen Schutz vertrauen können, ansonsten<br />
die Qualität und der Erfolg einer<br />
Behandlung gefährdet sind. So hält das<br />
Bundesgericht zu Recht fest, dass eine<br />
Einschränkung des Berufsgeheimnisses<br />
nur in konkreten Einzelfällen und unter<br />
ganz bestimmten Bedingungen möglich<br />
ist. Dabei ist immer das Verhältnismässigkeitsprinzip<br />
zu wahren.<br />
Die Parlamentsdebatte steht noch aus<br />
Wenn nun Abs. 2 von Art. 28 NDG gestrichen<br />
wird, wird das Recht des Patienten/<br />
der Patientin auf Selbstbestimmung bezüglich<br />
seiner/ihrer Patientendaten ausgehebelt.<br />
Es besteht die konkrete Gefahr,<br />
dass Patientinnen oder Patienten aufgrund<br />
der Befürchtung, ihr Gespräch mit<br />
dem Arzt oder der Ärztin werde mitgehört,<br />
sich gegen eine nötige Therapie entscheiden.<br />
Zudem können durch solche nachrichtendienstlichen<br />
Massnahmen Daten<br />
von Patientinnen oder Patienten offengelegt<br />
werden, die in keiner Art und Weise<br />
verdächtigt werden.<br />
Definitiv entschieden ist aber noch<br />
nichts. Der Bundesrat wird nun die eingegangenen<br />
Antworten aus der Vernehmlassung<br />
studieren und den Vorschlag zur Revision<br />
des NDG gegebenenfalls entsprechend<br />
anpassen. Diese neue Version wird<br />
er dann dem Parlament vorlegen, wobei<br />
eine Parlamentsdebatte dazu voraussichtlich<br />
frühestens im Sommer 2023 stattfinden<br />
wird. Der <strong>vsao</strong> bleibt am Thema dran<br />
und wird gemeinsam mit der FMH und<br />
weiteren gleichgesinnten Organisationen<br />
alles daransetzen, dass das Berufsgeheimnis<br />
unangetastet bleibt.<br />
@<strong>vsao</strong>asmac<br />
Anzeige<br />
CH-6083 Hasliberg Hohfluh<br />
Telefon +41 33 972 55 55<br />
www.rehaklinik-hasliberg.ch<br />
Ein Unternehmen der Michel Gruppe<br />
· Neue Station für internistische<br />
und onkologische Rehabilitation<br />
Chefarzt:<br />
Dr. med. Salih Muminagic, MBA<br />
Wo Patienten auch Gäste sind.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 11
Politik<br />
Ruhiges Ende des<br />
Jubiläumsjahres<br />
Weiterbildung, Arbeitsbedingungen, Zulassungssteuerung – die Themen<br />
sind nicht neu, aber dauerhaft aktuell und beschäftigten die Delegierten des<br />
Zentralvorstands auch an der diesjährigen Herbstsitzung. Zudem wählten<br />
sie den <strong>vsao</strong>-Präsidenten Angelo Barrile und alle Mitglieder<br />
des Geschäftsausschusses für eine weitere Amtszeit.<br />
Catherine Aeschbacher, Chefredaktorin <strong>vsao</strong> <strong>Journal</strong>. Bild: Severin Nowacki.<br />
<strong>vsao</strong>-Vizepräsidentin Nora Bienz führte durch die Herbstsitzung des Zentralvorstands. Die Kernthemen des Verbands,<br />
Gesundheitspolitik, Arbeitsbedingungen und Weiterbildung, standen auch diesmal im Zentrum der Beratungen.<br />
Der Zentralvorstand <strong>vsao</strong> (ZV)<br />
ist erfahrungsgemäss kein<br />
Gremium, in dem regelmässig<br />
die Fetzen fliegen und die<br />
Wogen hochgehen. Aber so einmütig wie<br />
an der Herbstsitzung vom 26. November<br />
war die Stimmung unter den Delegierten<br />
noch selten. Alle Entscheide fielen einstimmig.<br />
Das war vielleicht ein bisschen<br />
der Freude geschuldet, dass der ZV wieder<br />
vor Ort stattfand, ganz ohne Masken<br />
und Abstand, wie früher eben. Indes wohl<br />
ebenfalls wegen der Tatsache, dass keine<br />
wirklich umstrittenen Geschäfte auf der<br />
Traktandenliste standen.<br />
Zielvorgaben bestimmt<br />
«Das sind die Ziele des <strong>vsao</strong>, und das ist der<br />
Weg», fasste Simon Stettler, Geschäftsführer<br />
<strong>vsao</strong>, die Verbandsstrategie 2023–2026<br />
zusammen. Das Enddokument konnte<br />
nun durch den ZV verabschiedet werden,<br />
nachdem es den Weg durch verschiedenste<br />
Gremien genommen hatte. Erarbeitet<br />
wurde die Strategie von einer Kerngruppe,<br />
die sich aus Sektionsvertreterinnen und<br />
-vertretern unterschiedlich grosser Sektionen<br />
und aller Sprachregionen, dem<br />
<strong>vsao</strong>-Präsidenten Angelo Barrile, einem<br />
Mitglied des Geschäftsausschusses (GA)<br />
sowie Simon Stettler zusammensetzte.<br />
Diese Zusammensetzung garantierte eine<br />
breite Abstützung. Die Sektionen hatten<br />
ihrerseits eine ganze Reihe von Möglichkeiten,<br />
um sich aktiv zu beteiligen. Die Ziele<br />
überraschen nicht, ändern sich doch die<br />
Anliegen der Mitglieder in den kommenden<br />
vier Jahren nicht fundamental. Im<br />
Vordergrund stehen die Arbeitsbedingungen<br />
und die Weiterbildung. Der <strong>vsao</strong> wird<br />
weiterhin auf kantonaler und nationaler<br />
Ebene aktiv sein, um den Anliegen der jungen<br />
Ärzteschaft Gehör zu verschaffen. Er<br />
setzt sich für eine qualitativ hochstehende<br />
Weiterbildung ein, die innert nützlicher<br />
Frist absolviert werden kann, ebenso für<br />
12<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Politik<br />
vernünftige Arbeitsbedingungen und die<br />
Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf.<br />
Selbst wenn der Fokus auf diesen grossen<br />
Handlungsfeldern liegt, ist die Strategie<br />
nicht in Stein gemeisselt. Sollten neue Herausforderungen<br />
auftreten, wird der Verband<br />
adäquat reagieren. Eine Möglichkeit,<br />
die durchaus real ist, wie uns die Coronapandemie<br />
eindrücklich gezeigt hat.<br />
Fahrt mit ungewissem Ausgang<br />
Vielleicht war die ruhige Stimmung am ZV<br />
nicht zuletzt dadurch bedingt, dass zwar<br />
gesundheitspolitisch einschneidende Veränderungen<br />
in Gang gesetzt wurden, das<br />
Ziel der Reise aber unklar ist. So etwa, was<br />
die Zulassungssteuerung betrifft. Momentan<br />
liegt der Ball bei den Kantonen, die<br />
Höchstzahlen festlegen müssen. Wobei sie<br />
das für ein oder mehrere Fachgebiete oder<br />
in bestimmten Regionen tun können. Der<br />
Spielraum der Kantone, die Zulassungssteuerung<br />
mehr oder weniger rigid umzusetzen,<br />
ist folglich recht gross. Viele Kantone<br />
haben sich noch nicht festgelegt; Basel<br />
und Genf, wohl nicht zuletzt wegen der<br />
Grenzlage, haben bereits Einschränkungen<br />
vorgenommen. Der <strong>vsao</strong> hat nur begrenzt<br />
Möglichkeiten, um einzugreifen,<br />
versucht aber zum Vorteil seiner Mitglieder<br />
zu agieren (s. S. 6).<br />
Ebenfalls noch nicht ganz klar ist die<br />
Umsetzung des «Projet Réformer», welches<br />
die Weiterbildung in der Westschweiz besser<br />
strukturieren will. Die Absicht, die Kooperation<br />
zwischen den Weiterbildungsstätten<br />
zu verbessern oder die Weiterzubildenden<br />
durch ein Mentoringprogramm zu<br />
unterstützen, überzeugt auf den ersten<br />
Blick. Wie stark aber ein solches Programm<br />
in die Freiheit, seine Weiterbildung selbst<br />
zu planen, eingreift, bleibt abzuwarten.<br />
Der <strong>vsao</strong> ist trotz einer gewissen Skepsis im<br />
Führungsgremium des Projekts vertreten.<br />
Nicht zuletzt, da eine solche Reform nicht<br />
auf die Romandie begrenzt sein muss, sondern<br />
in der übrigen Schweiz Schule machen<br />
könnte (s. S. 14).<br />
Eine hochstehende Weiterbildung ist<br />
nur im Rahmen vernünftiger Arbeitsbedingungen<br />
möglich. Das ist zwar eine<br />
Platti tüde, aber keineswegs gelebte Normalität.<br />
Deshalb stellte die Sektion Zürich<br />
den Antrag, die Weiterbildungsordnung<br />
mit einem Zusatz zu versehen, wonach eine<br />
Weiterbildungsstätte nur anerkannt<br />
würde, wenn auch das Arbeitsgesetz und<br />
seine Verordnungen eingehalten würden.<br />
Eine solch umfassende Forderung hätte<br />
wenig Chancen, angenommen zu werden,<br />
zumal die Überprüfung für das SIWF kaum<br />
zu bewerkstelligen wäre. Der <strong>vsao</strong> Schweiz<br />
schlägt deshalb vor, konkrete und kontrollierbare<br />
Ansprüche zu formulieren und<br />
mit dem SIWF abzustimmen. Diese könnten<br />
anlässlich der Visitationen auch überprüft<br />
werden. Dieses Vorgehen wurde von<br />
den Delegierten gutgeheissen.<br />
Der <strong>vsao</strong> ist federführend in der Arbeitsgruppe<br />
42h +. Die Arbeitswoche soll<br />
42 Stunden Dienstleistung an den Patienten<br />
plus vier Stunden strukturierte Weiterbildung<br />
beinhalten. Momentan sind<br />
verschiedene Erhebungen in der Pipeline,<br />
beispielsweise eine Umfrage bei den Sektionsjuristinnen<br />
und -juristen zu bestehenden<br />
Arbeitszeitregelungen oder eine Befragung<br />
aller Spitäler zu den Zeiterfassungssystemen.<br />
Zudem läuft – die eher<br />
harzige – Suche nach Kliniken, welche<br />
42h + bereits eingeführt haben und Vorbildfunktion<br />
übernehmen könnten.<br />
Einen weiter gehenden Blick auf die<br />
Dinge warf Federico Mazzola, <strong>vsao</strong>-Vertreter<br />
in der FMH-Arbeitsgruppe «Planetary<br />
Health». Er ging auf die bisher erzielten Erfolge<br />
ein, beispielsweise auf das Toolkit für<br />
Arztpraxen, welches in Entwicklung ist und<br />
auch auf die Spitäler zugeschnitten werden<br />
soll. Anschliessend zeigte er das Potential<br />
für weitere Massnahmen auf und ermunterte<br />
die Sektionen, vermehrt auf den Klimaschutz<br />
zu achten und Strategien zu entwickeln,<br />
um Emissionen zu reduzieren.<br />
Schwarze und rote Zahlen<br />
Das Jubiläumsjahr, 77 Jahre <strong>vsao</strong>, neigt<br />
sich dem Ende zu. In diesem Zeitraum lief<br />
auch die Mitgliederkampagne – mit Erfolg.<br />
Die Zahlen der Neueintritte <strong>2022</strong> liegen<br />
deutlich über jenen vom Vorjahr. Nun<br />
sollen die Massnahmen bis auf weiteres<br />
eingestellt oder in geringerem Masse weitergeführt<br />
werden, wobei die Kampagne<br />
jederzeit wieder hochgefahren werden<br />
kann. Unabhängig davon wird die Präsenz<br />
in den sozialen Medien ausgebaut. Die<br />
Delegierten stimmten dem Vorgehen zu;<br />
einige Sektionen werden aber weiterhin<br />
Plakate beziehen, um sie in den Spitälern<br />
oder an Anlässen aufzuhängen.<br />
Der <strong>vsao</strong> wächst seit Jahren, das ist<br />
sehr erfreulich, bringt aber auch einen<br />
Mehraufwand mit sich. Im Weiteren nehmen<br />
die Aufgaben, Dienstleistungen, Engagements<br />
und Aktionen, die der <strong>vsao</strong><br />
Schweiz auf verschiedensten Ebenen leistet,<br />
zu. Die Ausgaben überschreiten gemäss<br />
Budget 2023 die Einnahmen entsprechend<br />
um 200000 Franken. Ob ein Verlust<br />
in dieser Grössenordnung wirklich eintritt,<br />
bleibt jedoch abzuwarten, da sehr zurückhaltend<br />
budgetiert wurde. Zudem kann<br />
dieses Minus problemlos aufgefangen werden,<br />
da ausreichend Rückstellungen getätigt<br />
wurden. Dennoch stellt sich die Frage,<br />
ob über eine Erhöhung des Mitgliederbeitrags<br />
nachgedacht werden muss, besonders<br />
weil dieser seit mehr als einem Jahrzehnt<br />
unverändert geblieben ist. Aus verschiedenen<br />
Gründen will der <strong>vsao</strong> Schweiz<br />
damit jedoch noch zuwarten. Die ZV-Delegierten<br />
nahmen das Budget und den unveränderten<br />
Mitgliederbeitrag an.<br />
Da die Legislatur zu Ende geht, mussten<br />
die Mitglieder des Geschäftsausschusses<br />
sowie der <strong>vsao</strong>-Präsident Angelo Barrile<br />
wiedergewählt werden. Alle Bisherigen<br />
stellten sich zur Wahl und wurden einstimmig<br />
in ihren Ämtern bestätigt.<br />
DV mediservice: kurz und knapp<br />
«Kurz und knapp, etwas norddeutsch, wo<br />
ich ursprünglich herkomme», werde die<br />
Delegiertenversammlung von mediservice<br />
<strong>vsao</strong>-asmac werden, kündigte Daniel<br />
Schröpfer, mediservice-Präsident, an.<br />
Und er hielt Wort. Marc Schällebaum, Geschäftsführer<br />
der Dienstleistungsorganisation,<br />
orientierte kurz über den Geschäftsgang.<br />
Momentan befindet sich der<br />
Praxisordner in französischer Sprache, ein<br />
Desiderat, in der Produktion. Ebenso hat<br />
mediservice in der Romandie neu einen<br />
Praxiscoach für alle, die den Gang in die<br />
Praxis antreten wollen. Die von mediservice<br />
beantragte Statutenänderung, welche<br />
es vereinfacht, Praxisgemeinschaften ab<br />
sofort gesamthaft zu versichern, wurde<br />
diskussionslos angenommen. Auch das<br />
Budget, welches erstmals einen Verlust in<br />
der Höhe von 185 000 Franken vorsieht,<br />
wurde einstimmig angenommen. Das Minus<br />
kommt durch das Wegfallen eines Versicherungspartners<br />
zustande. Dank der<br />
Rückstellungen in den Vorjahren kann es<br />
problemlos getragen werden und sollte in<br />
absehbarer Zukunft wettgemacht werden.<br />
Zu reden gab für einmal nur das <strong>vsao</strong> <strong>Journal</strong>,<br />
insbesondere wegen dessen Erscheinungsart.<br />
Die hohen Papierpreise sowie<br />
ökologische Anliegen veranlassten die Delegierten<br />
zur Frage, ob das <strong>Journal</strong> künftig<br />
nur noch online erscheinen solle. Marc<br />
Schällebaum versicherte den Delegierten,<br />
dass solche Pläne bereits geprüft und diskutiert<br />
werden. An der DV von mediservice<br />
im kommenden April werde das Thema<br />
traktandiert und im Gegensatz zu heute<br />
werde dann auch ausreichend Zeit für<br />
Diskussionen eingeplant. Einen endgültigen<br />
Entscheid stellte Schällebaum für die<br />
DV im November 2023 in Aussicht.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 13
Weiterbildung / Arbeitsbedingungen<br />
Reform der ärztlichen<br />
Weiterbildung in der<br />
Westschweiz<br />
Die Westschweizer Kantone wollen die ärztliche Weiterbildung stärker koordinieren<br />
und steuern. Damit soll einerseits die Qualität verbessert, aber auch<br />
die Zahl der Weiterbildungsplätze reguliert werden. Der <strong>vsao</strong> begleitet das<br />
Projekt kritisch. Ein aktueller Stand der Dinge mit Wertung.<br />
Yvonne Stadler, Leiterin Recht / stv. Geschäftsführerin <strong>vsao</strong><br />
Philipp Thüler, Leiter Politik und Kommunikation / stv. Geschäftsführer <strong>vsao</strong><br />
Vom individuell zusammengestellten Curriculum zum vorgespurten Weg?<br />
Die Westschweizer Kantone wollen mehr Struktur in der ärztlichen Weiterbildung.<br />
Es ist hinlänglich bekannt, dass<br />
die Organisation der ärztlichen<br />
Weiterbildung diverse Knackpunkte<br />
mit sich bringt. So ist<br />
zum Beispiel die Koordination zwischen<br />
den einzelnen Weiterbildungsstätten oft<br />
wenig entwickelt. Auch die Betreuung<br />
von Assistenzärztinnen und -ärzten während<br />
ihrer Weiterbildungszeit ist nicht<br />
selten ungenügend, oft wird die strukturierte<br />
Weiterbildung nicht oder nur ungenügend<br />
angeboten. Dazu kommt die Zulassungssteuerung,<br />
mit der die Kantone<br />
neu ein Instrument zur Verfügung haben,<br />
um die Zahl der in einzelnen Fachgebieten<br />
tätigen Ärztinnen und Ärzte zu regulieren.<br />
Diese kann dazu führen, dass auch<br />
Stellen für Assistenzärztinnen und -ärzte<br />
in Zukunft weniger werden.<br />
Die Konferenz der Westschweizer Gesundheits-<br />
und Sozialdirektorinnen und<br />
-direktoren (CLASS) vergab 2015 ein Mandat<br />
zur Reform der medizinischen Weiterbildung.<br />
Sie strebte ein Instrument zur<br />
Regulierung der medizinischen Weiterbildung<br />
und zur gleichzeitigen Verbesserung<br />
von deren Effizienz an. So entstand<br />
die Organisation «Réformer», was für<br />
«Réorganisation de la formation post-graduée<br />
en médecine en Suisse romande»<br />
(Reorganisation der medizinischen Weiterbildung<br />
in der Westschweiz) steht. Verantwortlich<br />
für die Organisation Réfor-<br />
Bild: Adobe Stock<br />
14<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Weiterbildung / Arbeitsbedingungen<br />
mer sind die Gesundheitsdirektionen<br />
der Kantone Neuenburg, Jura, Wallis,<br />
Freiburg, Genf und Waadt.<br />
Mit Réformer möchten die Westschweizer<br />
Kantone folgende Ziele erreichen:<br />
– Die Entscheidungen über die Anzahl<br />
der Weiterbildungsplätze pro Fachgebiet<br />
und Jahr in den sechs Westschweizer<br />
Kantonen sollen auf der Ebene der<br />
kantonalen Gesundheitsdirektionen gefällt<br />
werden.<br />
– Die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung<br />
sollen durch ein Mentoringprogramm<br />
unterstützt werden.<br />
– Durch einen Feedbackmechanismus<br />
werden Informationen über die Studiengänge<br />
gesammelt und eine demografische<br />
Datenbank erstellt.<br />
– Die Kommunikation und Kooperation<br />
zwischen den verschiedenen Weiterbildungsstätten<br />
soll gestärkt werden.<br />
Geführt wird Réformer durch ein Gremium,<br />
das aus den Leiterinnen und Leitern<br />
der Gesundheitsämter der sechs Kantone<br />
besteht sowie aus zwei Vertreterinnen und<br />
Vertretern von Weiterbildungsstätten und<br />
einem Vertreter des <strong>vsao</strong>.<br />
Umfassendes Informationssystem<br />
In einer ersten Projektphase wurde ein<br />
mögliches Informationssystem definiert,<br />
welches die Koordination der medizinischen<br />
Weiterbildung ermöglichen soll.<br />
Zudem wurden Fragen betreffend die Organisation<br />
im Allgemeinen und die Finanzierung<br />
geklärt. In der zweiten Projektphase<br />
begann die operative Umsetzung:<br />
Die Réformer-Organisation wurde<br />
aufgebaut. In der dritten Projektphase ab<br />
<strong>2022</strong> werden erste Daten zu Weiterbildungsgängen<br />
und Ärztinnen und Ärzten<br />
in Weiterbildung gesammelt. Während<br />
der vierten Projektphase – ab 2025 – soll<br />
die Réformer-Organisation voll funktionsfähig<br />
sein.<br />
Wenn alles so läuft, wie von den Kantonen<br />
angestrebt, werden sich junge Medizinerinnen<br />
und Mediziner ab 2025 in<br />
der Westschweiz an eine zentrale Stelle<br />
wenden können, um sich für eine Weiterbildung<br />
in ihrem gewünschten Fachgebiet<br />
einzuschreiben. Diese können sie dann –<br />
sofern ein Platz verfügbar ist – in der vorgesehenen<br />
Zeit in den vorgesehenen Weiterbildungsstätten<br />
absolvieren. Allerdings<br />
steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest, ob<br />
dies tatsächlich umgesetzt werden kann<br />
und ob das System für junge Medizinerinnen<br />
und Mediziner obligatorisch oder optional<br />
sein wird. Die konkreten Auswirkungen<br />
der Reform für die Assistenzärztinnen<br />
und -ärzte sind deshalb aktuell<br />
nicht abschätzbar. Klar ist aber, dass ein<br />
stärker reguliertes System für Medizinerinnen<br />
und Mediziner Vorteile, aber auch<br />
gewichtige Nachteile bringen würde.<br />
Die Rolle des <strong>vsao</strong><br />
Der <strong>vsao</strong> wurde von der Projektleitung<br />
gebeten, in den verschiedenen Arbeitsgruppen<br />
rund um die Umsetzung des<br />
Projekts mitzuwirken. Der <strong>vsao</strong> steht der<br />
angestrebten stärkeren staatlichen Kontrolle<br />
über die Weiterbildung sowie der<br />
zunehmenden Steuerung und Beschränkung<br />
der Weiterbildungsplätze sehr kritisch<br />
gegenüber. Gleichzeitig ist es jedoch<br />
wichtig, bei einem Projekt, das vom <strong>vsao</strong><br />
nicht verhindert werden kann, Einblick<br />
und Mitspracherecht zu haben. Darum ist<br />
der <strong>vsao</strong> seit Sommer 2020 im Führungsgremium<br />
durch Patrick Mangold, Sektionsjurist<br />
der Sektionen Waadt und Jura,<br />
vertreten. Zusätzlich setzen wir uns dafür<br />
ein, dass Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung<br />
in den verschiedenen thematischen<br />
und fachspezifischen Arbeitsgruppen<br />
des Projektes vertreten sein werden<br />
und die Interessen der jungen Ärzteschaft<br />
dort einbringen können. Diese Arbeitsgruppen<br />
sind noch nicht aktiv, mit Ausnahme<br />
der Arbeitsgruppe zum Informationssystem,<br />
die ihre Arbeit schon beinahe<br />
abgeschlossen hat.<br />
Um die angestrebte Koordination zwischen<br />
den Weiterbildungsstätten und den<br />
Überblick über die Ärztinnen und Ärzte in<br />
Weiterbildung zu ermöglichen, wird ein<br />
Informationssystem entwickelt, das bald<br />
einsatzbereit sein soll. Die Arbeitsgruppen<br />
der einzelnen Fachrichtungen werden<br />
demnächst ihre Arbeit aufnehmen<br />
und sich in regelmässigen Abständen über<br />
die schrittweise Umsetzung der Reform<br />
austauschen.<br />
Die Umsetzung der Reform hat also<br />
bereits begonnen, ab 2025 soll das System<br />
voll funktionsfähig sein. Es ist anzunehmen<br />
(oder zu befürchten), dass dieses Projekt<br />
aus der Westschweiz Signalwirkung<br />
für die gesamte Schweiz haben wird.<br />
«Je kürzer, desto besser» gilt nicht<br />
Der <strong>vsao</strong> wird die Entwicklung weiterhin<br />
so eng wie möglich begleiten, um die Interessen<br />
der Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung<br />
zu schützen. Es muss den Beteiligten<br />
bewusstwerden, dass bei der ärztlichen<br />
Weiterbildung der Grundsatz «Je<br />
kürzer, desto besser» nicht gilt. Natürlich<br />
will niemand freiwillig zu lange als Assistenzärztin<br />
oder Assistenzarzt arbeiten. Indes<br />
ist ein zusätzliches Weiterbildungsjahr<br />
kein verlorenes Jahr, weder für die<br />
Betroffenen noch für das Spital oder das<br />
Gesundheitswesen. Schliesslich erbringen<br />
Assistenzärztinnen und -ärzte während<br />
eines beachtlichen Teils ihrer Arbeitszeit<br />
Dienstleistungen für Patientinnen<br />
und Patienten. Die Weiterbildung<br />
macht nur einen kleinen Teil ihrer Arbeit<br />
im Spital aus. Und je erfahrener sie sind,<br />
desto selbständiger und effizienter arbeiten<br />
sie. Zusätzliche Weiterbildungsjahre,<br />
allenfalls auch in einem anderen als dem<br />
angestrebten Fachgebiet, erweitern den<br />
Horizont und sind deshalb ebenfalls wichtige<br />
Erfahrungen.<br />
Es ist zudem kaum möglich, den zukünftigen<br />
Bedarf an Fachärztinnen und<br />
Fachärzten auf rund zehn Jahre hinaus<br />
abzuschätzen. Eine Beschränkung der<br />
Weiterbildungsplätze gestützt auf eine<br />
solch ungenaue Prognose ist weder seriös<br />
noch sinnvoll. Zumal es sich wie gesagt<br />
um Arbeitsplätze handelt. Diese können<br />
nicht einfach jährlich gekürzt oder ausgebaut<br />
werden. Eine gewisse Flexibilität in<br />
der ärztlichen Weiterbildung ist ebenso<br />
wertvoll wie sinnvoll. So haben wir weiterhin<br />
Ärztinnen und Ärzte, welche am Ende<br />
in der von ihnen gewählten Fachrichtung<br />
abschliessen und arbeiten können. Die<br />
Möglichkeit, im selbstgewählten Fachgebiet<br />
arbeiten zu können, ist für Motivation<br />
und Verweildauer im Beruf unheimlich<br />
wichtig. Davon profitieren die Spitäler, die<br />
Patientinnen und Patienten und am Ende<br />
das gesamte Gesundheitswesen.<br />
Weitere Infos zu Réformer finden Sie unter<br />
https://re-former.ch/, beim Zentral sekreta<br />
riat (stadler@<strong>vsao</strong>.ch) oder bei Patrick<br />
Mangold, dem Sektionsjuristen für die<br />
Sektionen Waadt und Jura<br />
(https://patrickmangold.ch).<br />
@<strong>vsao</strong>asmac<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 15
Weiterbildung / Arbeitsbedingungen<br />
Wie die Alten<br />
sungen …<br />
… so zwitschern die Jungen nicht mehr.<br />
Das zeigte sich am Laufbahnkongress medifuture in Bern.<br />
Arbeit ist nicht mehr die alles dominierende Komponente<br />
im Leben der jungen und angehenden Ärztinnen und Ärzte.<br />
Eines aber verbindet die Generationen:<br />
die Leidenschaft für die Medizin.<br />
Catherine Aeschbacher, Chefredaktorin <strong>vsao</strong> <strong>Journal</strong><br />
Gespräch zwischen Generationen: Der damalige <strong>vsao</strong>-Präsident Anton Seiler kämpfte vor 50 Jahren für einen angemessenen Lohn.<br />
Die heutige <strong>vsao</strong>-Vizepräsidentin Nora Bienz setzt sich vor allem für vernünftige Arbeitszeiten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein.<br />
(v. l. n. r.: Moderatorin Katharina Locher, Anton Seiler, Nora Bienz)<br />
Bilder: Fotografik 11<br />
16<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Weiterbildung / Arbeitsbedingungen<br />
Gegen 450 Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer, 50 Aussteller,<br />
darunter Spitäler und<br />
Fachgesellschaften jeder Grössenordnung<br />
sowie Organisationen und<br />
Dienstleister im Gesundheitsbereich –<br />
das bedeutete Full House im Berner Kongresszentrum<br />
Wankdorf. medifuture <strong>2022</strong><br />
sprengte in vieler Hinsicht die vertrauten<br />
Dimensionen. So erwies sich der Entscheid<br />
der Veranstalter <strong>vsao</strong> und mediservice<br />
<strong>vsao</strong>-asmac, eine zweite Etage zu<br />
mieten, im Nachhinein als absolut berechtigt.<br />
Unverändert war hingegen die<br />
Qualität und die Vielfalt der Referate.<br />
Aber von Anfang an.<br />
Nicht Zeit, sondern Geld<br />
Ein gewisses Erstaunen über die Ansprüche<br />
der Jungen kann Anton Seiler nicht<br />
ganz verbergen. Der 82-jährige Arzt war<br />
1970 zum Präsidenten des <strong>vsao</strong> gewählt<br />
worden. Ihm und seinen Mitstreitern (es<br />
waren fast ausschliesslich Männer) ging<br />
es allerdings weniger um die Arbeitszeit.<br />
«Das Spital verlangte Arbeitswille und<br />
Arbeitsfreude, und wir wollten möglichst<br />
viel Erfahrung sammeln», fasst Seiler die<br />
damaligen Arbeitsbedingungen zusammen.<br />
Die 800 Franken Lohn hingegen<br />
waren selbst für anspruchslose Assistenzärzte<br />
deutlich zu wenig. So setzte sich der<br />
<strong>vsao</strong> denn auch in erster Linie für angemessene<br />
Löhne ein. Ein Vorkämpfer für<br />
die Sache war übrigens ein <strong>vsao</strong>-Mitglied<br />
aus Basel namens Guido A. Zäch, der<br />
nachmalige Begründer des Paraplegiezentrums<br />
Nottwil. Und doch, die Arbeitszeit<br />
habe schon eine Rolle gespielt. Eine<br />
60-Stunden-Woche war vor mehr als<br />
50 Jahren ein erstrebenswertes Ziel.<br />
Die aktuelle <strong>vsao</strong>-Vizepräsidentin<br />
Nora Bienz betont, dass bis heute die<br />
gesetzlich vorgegebene Arbeitszeit von<br />
50 Stunden nicht eingehalten werde. Der<br />
<strong>vsao</strong> mache sich für eine «42-Stunden-<br />
Woche plus» stark. 42 Stunden Dienstleistung<br />
an den Patienten pro Woche plus<br />
vier Stunden strukturierte Weiterbildung.<br />
Auf den Einwand von Anton Seiler, ob in<br />
dieser Zeit ausreichend Erfahrung gesammelt<br />
werden könne, führt Nora Bienz den<br />
Erfahrungsgewinn der viel höheren Fallzahlen<br />
aufgrund der viel kürzeren Liegezeit<br />
an. Und wenn man die Zeit vermehrt<br />
am Patientenbett statt am Telefon oder<br />
hinter dem Computer verbringen würde,<br />
würde die Lernkurve ebenfalls nochmals<br />
steigen, fügt sie hinzu. Der Abbau von<br />
Bürokratie gehört deshalb ebenfalls zu<br />
den wichtigsten Zielen des <strong>vsao</strong>. Einigkeit<br />
Von Ärzteschwemme kann keine Rede sein. Eine Vielzahl von Spitälern und Kliniken wie auch<br />
Fachgesellschaften buhlen um die junge Ärztegeneration.<br />
über die Generationen hinweg herrscht jedoch<br />
in zwei Punkten: in der Liebe zur Medizin<br />
und in der Überzeugung, dass man<br />
neben dem Beruf einen Ausgleich braucht.<br />
Planung ist die halbe Miete<br />
Als Anton Seiler in den sechziger Jahren<br />
studierte, sassen mit ihm rund 60 Personen<br />
im Hörsaal. Medizin sei ein Fach ohne<br />
Zukunft, es drohe Arbeitslosigkeit aufgrund<br />
der sich abzeichnenden Ärzteplethora,<br />
waren die Studierenden gewarnt<br />
worden. Wenn Christoph Hänggeli das<br />
hört, muss er lachen. Von Ärzteschwemme<br />
kann nicht die Rede sein. «Man kann<br />
sich eigentlich nicht falsch entscheiden.<br />
Sie werden überall gebraucht», ermuntert<br />
der Leiter des SIWF das Publikum. Auf<br />
dem Weg zum Facharzttitel kann man<br />
aber einiges falsch machen. Fehler, die<br />
durch sorgfältige Planung vermieden werden<br />
können. In der Schweiz müssten alle<br />
ihre Weiterbildung selbst organisieren,<br />
das schaffe Freiheit, bringe aber auch Verantwortung.<br />
Beispielsweise die genaue<br />
Abklärung, ob die Anstellung auch die<br />
angestrebte Weiterbildung biete oder das<br />
exakte Führen des e-Logbuchs, erklärt<br />
Hänggeli.<br />
Derzeit befindet sich die ärztliche<br />
Weiterbildung in einer grundlegenden<br />
Transformation. Anstelle von Zeit oder<br />
Zahlen rücken die EPAs ins Zentrum; sie<br />
geben Auskunft, ob eine bestimmte Fähigkeit<br />
auf einem bestimmten Niveau erworben<br />
wurde. Im Laufe der nächsten<br />
zehn Jahre sollen laut Christoph Hänggeli<br />
die Weiterbildungsprogramme entsprechend<br />
angepasst werden. Aber unabhängig<br />
vom Programm gilt, dass man sich<br />
besser einmal zu viel beim SIWF rückversichert,<br />
damit der Weg zum Facharzttitel<br />
nicht unnötig verlängert wird.<br />
Schnurgerade oder mit Umweg<br />
Manche Berufswege sind vorgezeichnet,<br />
andere verlaufen kurvig. Für den Hausarzt<br />
Cyrill Bühlmann war die Berufswahl<br />
beinahe genetisch bedingt. Der Vater war<br />
Hausarzt, die drei Kinder traten in seine<br />
Fussstapfen, wenn auch Cyrill Bühlmann<br />
als einziger denselben Fachbereich wählte.<br />
Er übernahm zusammen mit seiner<br />
Frau, die ebenfalls Ärztin ist, die väterliche<br />
Praxis. Aber es drängte die beiden<br />
nach einer Neuausrichtung. Gemeinsam<br />
mit vier andern Ärztinnen und Ärzten<br />
bauten sie ein veritables Ärztezentrum<br />
auf, das ein breites medizinisches Spektrum<br />
abdeckt. Für Cyrill Bühlmann besteht<br />
der Reiz in der Nähe zu den Patienten,<br />
die er über lange Zeit begleitet. Vom<br />
Säugling bis zum Greis sehe er jeden Tag<br />
alles. Er kenne seine Fähigkeiten, aber<br />
auch seine Grenzen. Folglich sei es wichtig,<br />
ein gutes Netzwerk von Spezialisten<br />
zu haben. Der Vorteil einer Gemeinschaftspraxis<br />
sei nebst dem Austausch<br />
mit den Kolleginnen und Kollegen die<br />
zeitliche Abdeckung, die es erlaube, Teil-<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 17
Weiterbildung / Arbeitsbedingungen<br />
zeit zu arbeiten oder unbelastet in die<br />
Ferien zu gehen. Wer in die Praxis gehe,<br />
sehe sich mit neuen Herausforderungen<br />
wie Per sonalführung, Finanz wesen usw.<br />
konfrontiert. Das Risiko der Selbständigkeit<br />
sei jedoch überschaubar. «Man kann<br />
es wagen», ermuntert Cyrill Bühlmann<br />
abschliessend die Zuhörerinnen und Zuhörer.<br />
Bereits im Gymnasium packte Natalia<br />
Conde die Liebe zum Theater. Nach der<br />
Matur führte ihr Weg folgerichtig an die<br />
Schauspielakademie Basel. Im Anschluss<br />
folgten Engagements im In- und Ausland.<br />
Nach zehn Jahren war Natalia Condes<br />
Leidenschaft fürs Theater spürbar abgekühlt.<br />
Zudem war sie mittlerweile Mutter<br />
von drei Töchtern. Gleichzeitig erwachte<br />
eine alte Liebe zu neuem Leben: die Medizin.<br />
Mit Begeisterung absolvierte sie<br />
schnurgerade das Studium. Der eher zufällige<br />
Start als Assistenzärztin in der<br />
Gynäkologie erwies sich als Glückstreffer.<br />
Heute ist Natalia Conde leitende Ärztin<br />
an der Frauenklinik des Zürcher Stadtspitals<br />
Triemli. Ganz hat sie die Bühne nicht<br />
verlassen, in der Freizeit arbeitet sie bei<br />
einem Jugend theater mit. Und in der Öffentlichkeit<br />
war sie auf den Plakaten des<br />
BAG während der Corona-Pandemie zu<br />
sehen: als Schauspielerin, die eine Ärztin<br />
spielt, die Ärztin ist. Womit sich der Reigen<br />
schliesst.<br />
Blick in die Zukunft<br />
Wie sehen Mitglieder der Jugendfraktionen<br />
diverser Fachgesellschaften ihre Zukunft?<br />
Wie werden sie in 20 Jahren arbeiten?<br />
In verschiedenen Punkten sind sich<br />
die Chirurgin Giulia Frigerio, der Psychiater<br />
Fabian Kraxner und der Neurologe David<br />
Schreier einig: Die Arbeit wird nicht<br />
ausgehen und viele neue Chancen kommen<br />
hinzu. Ebenso wird Teilzeitarbeit wesentlich<br />
verbreiteter sein.<br />
«Die Neurologie entwickelt sich seit<br />
Jahren vom vorwiegend diagnostischen<br />
zum therapeutischen Fach. Und da bereits<br />
heute 30 bis 40 Prozent aller Notfälle neurologischer<br />
Natur sind, wird die Neurologie<br />
vermehrt Teil der Grundversorgung<br />
werden. Spezialisierte Neurozentren werden<br />
sich auf einzelne Krankheitsbilder<br />
konzentrieren», prognostiziert David<br />
Schreier. Fabian Kraxner sieht den Einbezug<br />
der Künstlichen Intelligenz voraus.<br />
«Blended Care», d.h. die Integration von<br />
Online-Interventionen in die reguläre<br />
Psychotherapie, werde beispielsweise alltäglich.<br />
Das Potential von KI werde in Zukunft<br />
vielfältig genutzt, ist er sicher.<br />
Dass Teilzeitarbeit künftig keine Ausnahme,<br />
sondern die Regel sein wird, wenigstens<br />
in bestimmten Lebensabschnitten,<br />
unterstreichen auch die Arbeitspsychologin<br />
Julia Frey und die Onkologin<br />
Marie-Claire Flynn. Hier muss bei den<br />
Verantwortlichen ein Umdenken stattfinden,<br />
sind sie überzeugt. Julia Frey belegt<br />
dies mit den Resultaten ihrer Studie zur<br />
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.<br />
Heute sind das hohe Arbeitspensum, die<br />
unregelmässigen Einsatzpläne und die<br />
fehlende Vereinbarkeit die wichtigsten<br />
Gründe des Berufsausstiegs. Auch entscheide<br />
sich die Generation Y beim Konflikt<br />
Beruf versus Familie für die Familie.<br />
Dies im Gegensatz zu früheren Generationen.<br />
«Es tut sich etwas und es hat sich etwas<br />
getan», hält Marie-Claire Flynn fest.<br />
«Zunehmend arbeiten auch Männer mit<br />
reduzierten Pensen, das ist eine gute Entwicklung»,<br />
fügt sie an. Sie rät, bereits bei<br />
der Wahl des Fachgebiets die Frage der<br />
Vereinbarkeit einzubeziehen. Und falls<br />
man an die Grenze komme, solle man sich<br />
mit andern austauschen. Denn meist gehe<br />
es den andern genauso.<br />
Nichts für Idealisten<br />
Fest auf dem Boden der Realität verankert<br />
sind Frank Urbaniok, Professor für Forensische<br />
Psychiatrie, und PhD Martin<br />
Schneider, Spezialist für Global Health<br />
und Humanitäre Medizin. Wer mit Sexualund<br />
Gewaltstraftätern arbeitet, darf sich<br />
keine Illusionen über sein Gegenüber machen.<br />
Es gehe darum, Straftaten zu verhindern<br />
und die Gefährlichkeit eines Täters<br />
einzuschätzen. «99 Prozent kommen irgendwann<br />
wieder raus», sagt Urbaniok.<br />
Früher wurde der Opferschutz stark vernachlässigt;<br />
seit rund 20 Jahren hat ein<br />
Umdenken stattgefunden. Und ja, durch<br />
exakte Analyse der Persönlichkeit des Täters<br />
und seiner Taten könne man sehr<br />
wohl etwas machen. Wenn auch keine<br />
Heilung zustande komme, so wenigstens<br />
ein langfristiges Risikomanagement.<br />
«Wer die Welt retten will, soll besser<br />
zuhause bleiben», stellt Martin Schneider<br />
klar. Als Arzt war er in Kriegs- und Katastrophengebieten<br />
rund um den Erdball tätig.<br />
Für solche Einsätze braucht es Menschen<br />
mit mehreren Jahren Berufserfahrung,<br />
bestenfalls in Tropenmedizin,<br />
Sprachkenntnissen, Anpassungsfähigkeit<br />
und Resilienz. Wer einen humanitären<br />
Einsatz leisten will, muss auch Zeit mitbringen,<br />
wenigstens ein halbes Jahr. Und<br />
noch ein Wermutstropfen: Die Familie<br />
darf nicht mit. Entscheidet man sich jedoch,<br />
die humanitäre Medizin zu seinem<br />
Beruf zu machen, sieht es punkto Familiennachzug<br />
anders aus. Erfüllt man in der<br />
Regel doch vornehmlich Koordinationsaufgaben,<br />
die nicht unbedingt vor Ort<br />
stattfinden.<br />
Für welchen Weg sich die Anwesenden<br />
am medifuture <strong>2022</strong> auch entscheiden<br />
mögen, hoffentlich können sie wie<br />
Frank Urbaniok nach 30 Jahren im Beruf<br />
noch immer sagen: «Es ist ein Hammerjob.»<br />
Dank<br />
An dieser Stelle danken wir allen<br />
Sponsoren und Ausstellern, namentlich<br />
der Luzerner Psychiatrie (lups),<br />
welche den Wettbewerb gesponsert hat,<br />
ganz herzlich für ihre Unterstützung.<br />
Ebenso danken wir den Referentinnen<br />
und Referenten. Ohne sie wäre medifuture<br />
<strong>2022</strong> nicht zustande gekommen.<br />
Der nächste Laufbahnkongress findet<br />
am 4. November 2023 wiederum<br />
im Stadion Wankdorf in Bern statt.<br />
18<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Weiterbildung / Arbeitsbedingungen<br />
Stiefkind<br />
Bild: zvg<br />
Man kann nicht nicht kommunizieren. Diesen Satz<br />
haben wir wohl alle schon einmal gehört. Wieso<br />
bringe ich ihn hier also? Weil Kommunikation in<br />
der ärztlichen Weiterbildung Teil der allgemeinen<br />
Lernziele ist, und diese werden leider allzu oft stiefmütterlich<br />
behandelt.<br />
Die allgemeinen Lernziele wurden vor einigen Jahren in<br />
die Weiterbildungsordnung (WBO) bzw. einen Anhang<br />
derselbigen ausgelagert. So gerieten sie<br />
wohl leider etwas in Vergessenheit. Dabei<br />
sind sich wohl alle einig, dass Themen wie<br />
Kommunikation, ethische Entscheidungsfindung,<br />
Leadership, Team- und<br />
Konfliktmanagement unheimlich<br />
wichtige Aspekte im Arztberuf sind.<br />
In einer Umfrage unter Weiterbildungsstättenleiterinnen<br />
und -leitern<br />
verortete allerdings über die<br />
Hälfte der Befragten Defizite in diesem<br />
Bereich. Wie kommt das?<br />
Ich glaube, es liegt daran, dass<br />
wir uns schwerer tun in der Vermittlung<br />
von sogenannten Soft Skills. Sie<br />
sind nicht greifbar, sind schwieriger zu<br />
erklären. Bei manuellen Tätigkeiten ist das<br />
wesentlich einfacher: Man wird beispielsweise<br />
schnell einen Konsens bzw. eine Umschreibung<br />
einer guten Intubation finden (beim ersten Versuch<br />
keinen Zahnschaden, korrekte Platzierung etc.). Auch die<br />
Erklärungen gestalten sich wesentlich einfacher, schliesslich<br />
handelt es sich um konkrete Bewegungen und Griffe. Aber wie<br />
wird gute Kommunikation definiert? Und wie erkläre ich sie<br />
jemandem?<br />
In einem Workshop am diesjährigen MedEd-Symposium<br />
des SIWF bestätigte sich die Bedeutung der allgemeinen Lernziele<br />
und im Besonderen auch der Kommunikation deutlich.<br />
In der Diskussion, wer denn nun für die Vermittlung zuständig<br />
sei, waren sich alle einig, dass alle Stakeholder eine gewisse<br />
Verantwortung haben. Angefangen bei den Universitäten über<br />
die Weiterbildungsstätten bis hin zu Fachgesellschaften und<br />
SIWF. Es bleibt die Frage der konkreten Umsetzung.<br />
Gewisse Grundlagen können in der Theorie vermittelt<br />
werden (Basler Studierende aus den vergangenen Jahren<br />
werden sich gut an das WWSZ von Prof. Langewitz erinnern).<br />
Leben in die Sache kommt aber erst durch Zuhören und<br />
Auf den<br />
Punkt<br />
gebracht<br />
Nachahmen – Stichwort Vorbild. Haben wir hier zu wenig gute<br />
Vorbilder? Ich glaube nicht. Ich fürchte eher, dass wir uns im<br />
Alltag zu wenig Zeit nehmen (können), um einerseits dieser<br />
Vorbildrolle gerecht zu werden und um andererseits oft genug<br />
zuhören und dann schrittweise nachahmen zu können.<br />
Zudem bin ich der Meinung, dass die Weiterbildung heute<br />
zu stark auf harte fachliche Eckdaten und Fertigkeiten<br />
fokussiert ist. Die Formung einer Arztpersönlichkeit,<br />
das Einleben in die berufliche Rolle hat<br />
an Bedeutung verloren. In Zukunft sollen<br />
die allgemeinen Lernziele in den EPAs<br />
(Entrustable Professional Activities)<br />
Platz finden. Allerdings werden sie<br />
wohl auch dort nur dann Beachtung<br />
finden, wenn wir ihnen im Alltag<br />
Bedeutung beimessen.<br />
Wir haben einen wunderschönen<br />
Beruf, der durch und durch<br />
menschlich ist und sich nicht auf<br />
theoretisches Wissen und roboterartig<br />
ausgeführte manuelle Tätigkeiten<br />
reduzieren lässt. Versuchen<br />
wir, ihn wieder so zu leben, sonst<br />
schaffen wir uns selber ab.<br />
Patrizia Kündig,<br />
Mitglied des Geschäftsausschusses <strong>vsao</strong>,<br />
Leiterin Ressort Weiterbildung<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 19
<strong>vsao</strong><br />
Happy Birthday,<br />
<strong>vsao</strong>!<br />
Ein prägender Teil des <strong>vsao</strong>-Jahrs <strong>2022</strong> waren die Aktivitäten<br />
rund um das 77-Jahr-Jubiläum des Verbands mit dem <strong>vsao</strong>-Mobil und<br />
einem unvergesslichen Jubiläumsfest. Ein kurzer Rückblick.<br />
Philipp Thüler, Leiter Politik und Kommunikation / stv. Geschäftsführer <strong>vsao</strong><br />
Eine genussvolle Pause und direkte Kontakte: Das <strong>vsao</strong>-Mobil macht auf seiner Tour de Suisse halt vor einem Spital.<br />
Bild: <strong>vsao</strong><br />
20<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
<strong>vsao</strong><br />
75<br />
wird man nicht alle<br />
Tage – sondern auch als<br />
<strong>vsao</strong> nur einmal im (Verbands-)Leben.<br />
Deshalb<br />
hatten wir uns für das Jubiläumsjahr<br />
2020 einiges einfallen lassen. Doch es<br />
kam, wie es mit Corona kommen musste;<br />
die meisten Pläne wurden durchkreuzt.<br />
Das Jubiläum wollten wir aber auf keinen<br />
Fall ausfallen lassen, deshalb haben wir<br />
<strong>2022</strong> die Schnapszahl 77 gefeiert. So<br />
konnten etliche der Ideen für das Jubiläumsjahr<br />
doch noch umgesetzt werden,<br />
und der runde Geburtstag wurde gebührend<br />
gewürdigt.<br />
Grund zu feiern gab und gibt es mehr<br />
als genug. Seit der Gründung 1945 hat der<br />
<strong>vsao</strong> vieles erreicht. Die erste Forderung<br />
des Verbands bestand schlicht darin, den<br />
Assistenzärztinnen und -ärzten einen<br />
Lohn zu bezahlen. Dies konnte bereits<br />
1947 als erfüllt betrachtet werden, die Arbeitsbedingungen<br />
bleiben aber bis heute<br />
ein zentrales Thema, auch wenn zwischenzeitlich<br />
weitere Erfolge erzielt werden<br />
konnten, allen voran die Unterstellung<br />
unter das Arbeitsgesetz im Jahr 2005<br />
und damit die Einführung der (theoretischen)<br />
Obergrenze von 50 Wochenarbeitsstunden.<br />
Die Tragweite dieses Erfolgs wird<br />
erst richtig deutlich, wenn man sich vor<br />
Augen führt, dass wir noch 1998 mit dem<br />
sogenannten «Bleistiftstreik» die Begrenzung<br />
der Wochenarbeitszeit auf 65 Stunden<br />
forderten. Es ist also etwas gegangen<br />
in all den Jahren, und das wurde gebührend<br />
gewürdigt.<br />
Emotionaler Höhepunkt war unzweifelhaft<br />
das Jubiläumsfest, das Ende August<br />
im Berner Bierhübeli mit einigen<br />
hundert Gästen über die Bühne ging. Zahlreiche<br />
Ehrenmitglieder und prägende Persönlichkeiten<br />
waren unter den Gästen, bei<br />
Speis und Trank fand ein reger Austausch<br />
von Geschichten, Anekdoten und Erfahrungen<br />
statt, bevor das Fest vom Kabarettisten<br />
Massimo Rocchi richtig lanciert<br />
wurde. Ihm gelang es in seiner unnachahmlichen<br />
Art, das mehrsprachige Publikum<br />
mit seinen ebenfalls vielsprachigen<br />
Nummern abzuholen. Danach standen<br />
Musik und Tanz mit DJ Kai auf dem Programm,<br />
er lockte fast alle Gäste auf die<br />
Tanzfläche, so dass wir uns am Ende von<br />
vielen fröhlichen und zufriedenen Gesichtern<br />
verabschieden konnten.<br />
<strong>vsao</strong> on tour<br />
Im Jubiläumsjahr wollten wir als gesamtschweizerischer<br />
Verband auch die Verbindungen<br />
in die verschiedenen Landesteile<br />
pflegen. Deshalb fanden diverse Sitzungen<br />
des Geschäftsausschusses in diesem<br />
Jahr nicht wie üblich in Bern statt, sondern<br />
in St. Gallen, in Chur, in Bellinzona,<br />
in Biel und in Olten. Leider nicht geklappt<br />
hat die Sitzung in Lausanne (Corona …),<br />
diese wird aber 2023 nachgeholt. Auch so<br />
gelang es, einen grossen Teil der Sektionen<br />
zu besuchen und die gegenseitige Verbundenheit<br />
zu stärken.<br />
Im Sommer tourte zudem das<br />
<strong>vsao</strong>-Mobil durch die Schweiz. Ein Bus,<br />
mit dem wir für jeweils einen Tag vor Spitälern<br />
haltmachten und uns den jungen<br />
Ärztinnen und Ärzten vorstellten. Stationen<br />
waren die Kantonsspitäler St. Gallen,<br />
Chur, Olten und Luzern, das Spitalzentrum<br />
Biel, das Universitätsspital Zürich,<br />
das Spital Sitten, das Ospedale Regionale<br />
di Lugano, das Hôpital Riviera-Chablais in<br />
Rennaz sowie die Hôpitaux universitaires<br />
de Genève.<br />
Die Aktion erwies sich trotz wechselndem<br />
Wetterglück als voller Erfolg. Hunderte<br />
junge Ärztinnen und Ärzte fanden<br />
den Weg zu uns, um einen offerierten Imbiss<br />
zu geniessen und bei Interesse mehr<br />
über unsere Dienstleistungen, Ziele und<br />
Erfolge zu erfahren.<br />
Kampagne zur Mitgliedergewinnung<br />
Teil des Jubiläumsjahrs war auch die Mitgliederkampagne,<br />
die Anfang <strong>2022</strong> startete.<br />
In der ganzen Schweiz hingen in der<br />
Nähe von Spitälern während dreier Phasen<br />
Plakate mit sechs verschiedenen Sujets,<br />
mit denen wir auf die Dienstleistungen<br />
des <strong>vsao</strong> aufmerksam machten. Dieselben<br />
Sujets wurden auch auf Social Media<br />
genutzt. Zudem führten wir ein<br />
elektronisches Anmeldeformular ein, um<br />
den Aufnahmeprozess zu vereinfachen,<br />
und Mitglieder erhielten für jedes Neumitglied,<br />
das dank ihnen zum <strong>vsao</strong> kam, eine<br />
kleine Prämie. Die Neumitglieder wurden<br />
mit den coolen, nachhaltig produzierten<br />
<strong>vsao</strong>-Jubiläumssocken beschenkt, die uns<br />
hoffentlich noch oft begegnen werden.<br />
Auf die nächsten 77 Jahre!<br />
Das einzige Element des Jubiläumsjahrs,<br />
das bereits 2020 fertiggestellt und publiziert<br />
wurde, waren die Jubiläumsvideos<br />
mit dem damaligen Präsidium und der Geschäftsleitung<br />
des Verbands. Die Videos<br />
sind immer noch aktuell und sehenswert,<br />
schauen Sie selbst auf der <strong>vsao</strong>-Website:<br />
https://<strong>vsao</strong>.ch/<strong>vsao</strong>-jubilaeum-<strong>2022</strong>.<br />
Wir bedanken uns bei allen, die am<br />
gelungenen Jubiläumsjahr mitgewirkt haben,<br />
bei den Mitgliedern, die mitfeierten,<br />
den Rednerinnen und Rednern, den vielen<br />
Helferinnen und Helfern beim Fest<br />
und der Tournee des <strong>vsao</strong>-Mobils, den<br />
zahlreichen Gastgeberinnen und Gastgebern<br />
in den Sektionen. Herzlichen Dank<br />
und auf die nächsten 77 Jahre!<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 21
<strong>vsao</strong><br />
Impressionen vom<br />
Jubiläumsfest<br />
Bilder: Dominic Brügger<br />
22<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
<strong>vsao</strong><br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 23
<strong>vsao</strong><br />
Neues aus<br />
den Sektionen<br />
Basel<br />
Ausblick auf 2023<br />
Am Samstag, 22. Oktober, fand die alljährliche<br />
Strategie-Retraite des Vorstands<br />
statt. Die Vorstandsmitglieder trafen sich,<br />
um die kurz- und mittelfristigen Massnahmen<br />
für den VSAO Basel zu definieren. Im<br />
nächsten Jahr richtet sich der Fokus auf<br />
die Kommunikation und den Austausch<br />
mit den Mitgliedern. Ab 2023 organisiert<br />
der VSAO Basel neu Networkingmöglichkeiten<br />
für Mitglieder und Nichtmitglieder<br />
in ungezwungenem Rahmen. Genaue Angaben<br />
über Ort und Zeitpunkt finden sich<br />
auf der Website und im Newsletter. Wie<br />
jedes Jahr wird im Spätfrühling die Mitgliederversammlung<br />
stattfinden, genauer<br />
am Donnerstag, 11. Mai 2023. Diese bietet<br />
auch im kommenden Jahr nebst den üblichen<br />
Traktanden wieder einen interessanten<br />
Kulturteil, der den Mitgliedern Einblick<br />
in kulturelle oder gesellschaftliche<br />
Highlights in Basel verschafft. Ein grosser<br />
Teil der Verbandsarbeit wird sich 2023<br />
ausserdem der Politik widmen.<br />
Der schönste Beruf der Welt<br />
Es ist geschafft!<br />
Am Freitag, 28. Oktober, lud der<br />
VSAO Basel zum bestandenen<br />
Staatsexamen ein. Über 120 junge<br />
Ärztinnen und Ärzte haben gemeinsam<br />
mit dem Basler VSAO-Vorstand<br />
bis spät in die Nacht gefeiert.<br />
Nach einem Apéro begrüsste VSAO-Geschäftsleiterin<br />
Claudia von Wartburg die<br />
Gäste im Restaurant Safran Zunft im Herzen<br />
von Basel. Im Rahmen eines Podiumsgespräches<br />
gaben erfahrene Ober- und<br />
Assistenzärzte dem jungen Publikum<br />
Tipps und Infos zum Spitalalltag. Während<br />
des Abends ergaben sich tolle Gespräche<br />
zwischen den Gästen und den<br />
Vorstandsmitgliedern vom VSAO Basel.<br />
Auf dem Podium trafen sich Dr. med.<br />
Dr. med. dent. Miodrag Savic, Oberarzt der<br />
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie im<br />
Universitätsspital Basel und Präsident des<br />
VSAO Basel, PD Dr. med. Michel Röthlisberger,<br />
Oberarzt Neurochirurgie und Spinale<br />
Chirurgie im Universitätsspital Basel,<br />
und Florian Frehner, Assistenzarzt Chirurgie<br />
im Kantonsspital Liestal/ Bruderholz<br />
sowie Vorstandsmitglied des VSAO Basel.<br />
Durch das Gespräch führte VSAO-Kommunikationsleiterin<br />
Jenny Settembrini.<br />
Die Podiumsteilnehmer teilten mit<br />
den jungen Ärztinnen und Ärzten wertvolle<br />
Erfahrungen aus ihrer Assistenzarztzeit<br />
und gaben Empfehlungen zu Karrierestart<br />
und Weiterbildungen. Dr. Michel<br />
Röthlisberger informierte über Weiterbildungsmöglichkeiten<br />
im Ausland, und<br />
Dr. Miodrag Savic erklärte, wie der VSAO<br />
Interessierte dabei unterstützt.<br />
Um die jungen Medizinerinnen und<br />
Mediziner motiviert in ihre Zukunft blicken<br />
zu lassen, haben die drei erfahrenen<br />
Chirurgen zum Schluss darauf hingewiesen,<br />
wie schön dieser Beruf trotz den vielen<br />
in den Medien stets thematisierten Herausforderungen<br />
ist.<br />
So beendete Dr. Savic das Gespräch<br />
mit dem Satz: «Es ist so erfüllend, wenn<br />
man abends nach Hause kommt und<br />
weiss, dass man etwas Gutes gemacht hat.<br />
Arzt bleibt der schönste Beruf der Welt.»<br />
Politcoaching<br />
Wenn wir weiterhin ein anerkannter Akteur<br />
im Schweizer Gesundheitswesen<br />
bleiben wollen, dann braucht es mehr Mitglieder,<br />
die sich politisch engagieren. Gemeinsam<br />
mit dem Dachverband unterstützt<br />
der VSAO Basel jedes Mitglied, das<br />
als Kandidatin oder Kandidat bei den kantonalen<br />
Wahlen antreten möchte und bietet<br />
neu ein professionelles Politcoaching<br />
an. Voraussetzung: Das VSAO-Mitglied<br />
muss auf einer offiziellen Wahlliste stehen.<br />
Auskünfte und Anmeldungen: sekretariat@<strong>vsao</strong>-basel.ch,<br />
Anmeldefrist: 16.<br />
Januar 2023.<br />
Jenny Settembrini, Kommunikationsleiterin<br />
VSAO Basel<br />
24<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
<strong>vsao</strong><br />
Bern<br />
Workshop für Dienstplanerinnen<br />
und Dienstplaner<br />
Am 26. Oktober <strong>2022</strong> fand unser erster<br />
Workshop für Dienstplanerinnen und<br />
Dienstplaner statt. Es nahmen rund<br />
20 Personen aus der ganzen Schweiz teil<br />
und nutzten die Gelegenheit, sich Wissen<br />
anzueignen und sich mit Kolleginnen und<br />
Kollegen auszutauschen.<br />
Wir führen den Anlass am 19. Januar<br />
2023 nochmals durch.<br />
Brüten Sie oft stundenlang nach Feierabend<br />
über dem Dienstplan der Abteilung<br />
und sehen am Schluss nur noch<br />
PEP-Symbole, die vor den Augen im Kreis<br />
tanzen? Möchten Sie wissen, wie Teilzeitarbeit<br />
sinnvoll in den Dienstplan integriert<br />
werden kann? Sind Sie manchmal<br />
unsicher, wie die Stolpersteine bei der Planung<br />
und korrekten Umsetzung des Arbeitsgesetzes<br />
vermieden werden können?<br />
Interessiert es Sie, wie ein korrekter<br />
Dienstplan aussehen könnte? Dann sind<br />
Sie am kostenlosen Dienstplanworkshop<br />
des VSAO Bern genau richtig.<br />
Simon Schneider (Rechtsanwalt und<br />
stellvertretender Geschäftsführer VSAO<br />
Bern), Dr. med. Philipp Rahm (Dienst planberater<br />
<strong>vsao</strong>) und Susanne Nüesch (Spitalfachärztin<br />
UNZ Inselspital, Verantwortliche<br />
Dienstplanung der Assistenzärztinnen<br />
und -ärzte) sorgen für ein spannendes<br />
Programm und stehen selbstverständlich<br />
für Fragen sehr gerne zur Verfügung.<br />
Datum:<br />
Donnerstag, 19. Januar 2023,<br />
18.30 bis 21 Uhr, mit Verpflegung<br />
Durchführungsort:<br />
Sitzungszimmer <strong>vsao</strong>, Bollwerk 10,<br />
3011 Bern (direkt beim Bahnhof Bern)<br />
Anmeldung bis am 11. Januar 2023 auf<br />
www.<strong>vsao</strong>-bern.ch<br />
Janine Junker, Geschäftsführerin VSAO Bern<br />
MV 2023<br />
Save the Date:<br />
Mitgliederversammlung 2023<br />
27. April 2023, 19 Uhr, im PROGR Bern<br />
Bild: zvg<br />
Dienstplanworkshop vom 26. Oktober <strong>2022</strong>.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 25
<strong>vsao</strong><br />
Zürich /<br />
Schaffhausen<br />
Erfolgreiches erstes «Time<br />
To Cut»-Karriereseminar<br />
Der VSAO Zürich hat mit dem «Time To<br />
Cut»-Karriereseminar ein neues Format<br />
ins Leben gerufen. Das Seminar richtet<br />
sich primär an Assistenz- und Oberärztinnen<br />
und -ärzte chirurgischer Fächer und<br />
soll ihnen dabei helfen, ihre chirurgische<br />
Laufbahn vorausschauend zu planen. Sei<br />
es dank konkreter Tipps und Erfahrungsberichte<br />
von erfahrenen Kaderärztinnen<br />
und -ärzten oder bei praktischen Handson-Trainings<br />
chirurgischer Verfahren an<br />
Simulatoren.<br />
Die Premiere des «Time To Cut»-Karriereseminars<br />
fand am 1. Oktober an der Universität<br />
Zürich statt. Über 70 chirurgische<br />
Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte<br />
sowie Medizinstudierende nahmen am Seminar<br />
teil. In den Referaten erhielten die<br />
angehenden Chirurginnen und Chirurgen<br />
Einblick in die Laufbahn von erfahrenen<br />
Kaderärztinnen und -ärzten. Was waren die<br />
Hürden und was waren die Meilensteine,<br />
welche zum Erfolg geführt haben? Ergänzt<br />
wurde das Ganze durch inspirierende Podiumsdiskussionen<br />
und praktische Handson-Trainings,<br />
bei denen die Teilnehmenden<br />
unter anderem mit einer Lupenbrille<br />
das mikrochirurgische Nähen erlernen<br />
konnten. Auch die Versorgung von Frakturen<br />
und wertvolle Inputs zum klinischen<br />
Teaching kamen nicht zu kurz.<br />
Neben dem persönlichen Austausch<br />
und Networking erhielten die Anwesenden<br />
viele praktische Tipps und persönliche Erfolgsrezepte<br />
für die Gestaltung der beruflichen<br />
Karriere mit auf den Weg.<br />
Wir danken allen Referentinnen, Referenten<br />
und Teilnehmenden für die Mitgestaltung<br />
des lehrreichen Tages. Ebenso<br />
den Sponsoren Ethicon, Johnson & Johnson<br />
Medtech, Mülleroptik, Reavita, Synthes<br />
und VirtaMed für das Ermöglichen der<br />
Hands-on-Trainings. Wir freuen uns auf<br />
die Fortsetzung 2023!<br />
Bilder: <strong>vsao</strong><br />
26<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
<strong>vsao</strong><br />
Vorankündigung:<br />
After-Work-Apéro mit politisch<br />
engagierten Ärztinnen und Ärzten<br />
Am Donnerstag, 19. Januar 2023, findet<br />
der beliebte After-Work-Apéro, organisiert<br />
vom VSAO Zürich, in der Chiffon Bar in<br />
Zürich statt.<br />
Neben Austausch und Networking in<br />
entspannter Atmosphäre stehen dieses<br />
Mal politisch engagierte und für den Kantonsrat<br />
kandidierende Medizinerinnen<br />
und Mediziner im Fokus. Wir hoffen, dass<br />
einige Kandidierende auch persönlich anwesend<br />
sein werden, damit Ihr Euch während<br />
des Apéros mit ihnen austauschen<br />
und über die von ihnen vertretenen politischen<br />
Anliegen und Kernbotschaften diskutieren<br />
könnt. Wir fördern politisch aktive<br />
Ärztinnen und Ärzte, denn nur so können<br />
wir unseren Anliegen direkt Gehör<br />
verschaffen.<br />
Deshalb unterstützen wir Medizinerinnen<br />
und Mediziner, die für die Kantonsratswahlen<br />
im Februar 2023 kandidieren.<br />
Bitte meldet Euch bei uns unter kommunikation@<strong>vsao</strong>-zh.ch,<br />
damit wir Euch<br />
auf unseren Kanälen porträtieren und ein<br />
Politcoaching oder eine Plattform am After-Work-Event<br />
im Januar 2023 anbieten<br />
können. Falls Ihr jemanden kennt, der/die<br />
kandidiert, leitet ihm/ihr bitte diese Information<br />
weiter.<br />
Am After-Work-Apéro eingeladen<br />
sind übrigens alle Assistenz- und Oberärztinnen<br />
und -ärzte wie auch Medizinstudierende.<br />
Wir freuen uns auf einen regen<br />
Austausch!<br />
Dominique Iseppi, Kommunikationsassistentin,<br />
VSAO Zürich<br />
Bilder: <strong>vsao</strong><br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 27
<strong>vsao</strong><br />
<strong>vsao</strong>-Inside<br />
Florim Loshi<br />
Wohnort: Spiez<br />
Beim <strong>vsao</strong> seit: Januar <strong>2022</strong><br />
Der <strong>vsao</strong> in drei Worten:<br />
Offen, modern, engagiert<br />
Wenn Florim Loshi im<br />
Büro ist, gibt es immer<br />
etwas zu lachen – seine<br />
gute Laune und sein<br />
herzhaftes, sympathisches Lachen sind<br />
ansteckend. Diese gute Stimmung<br />
verbreitet er seit Januar <strong>2022</strong> im <strong>vsao</strong>-<br />
Zentralsekretariat, allerdings nur an den<br />
wenigen Tagen, die in seinem kleinen<br />
Pensum vorgesehen sind. Die meiste Zeit<br />
verbringt der 23-Jährige an der Uni Bern,<br />
wo er im siebten Semester Jus studiert.<br />
Die Wahl des Studienfachs fiel ihm<br />
leicht, wie er selber sagt: «Während sich<br />
andere mit der Berufswahl schwertun,<br />
stand es für mich schon früh fest, dass<br />
ich Jus studieren möchte. So habe ich<br />
mich ohne grosses Zögern fürs Jus-<br />
Studium immatrikuliert und den Entscheid<br />
seither nie bereut – das Recht<br />
fasziniert mich.» Mit dieser Leidenschaft<br />
ist er im Zentralsekretariat als Projek t-<br />
assistent Recht genau am richtigen Ort.<br />
Bei seiner Arbeit unterstützt er die<br />
Leiterin Recht Yvonne Stalder, koordiniert<br />
die Rechtsbeiträge für das <strong>vsao</strong><br />
<strong>Journal</strong>, klärt diverse Rechtsfragen ab<br />
und wickelt Rechtsschutz gesuche<br />
von Mitgliedern ab.<br />
Die Arbeit für den <strong>vsao</strong> gefällt ihm<br />
besonders gut, weil er in einem juristischen<br />
Arbeitsbereich Arbeitserfahrung<br />
sammeln kann, und dies im Dienste<br />
einer sinnvollen Sache. «Ich kann mit<br />
meiner Arbeit hier etwas bewirken<br />
und dazu beitragen, Verbesserungen<br />
für die Assistenz- und Oberärztinnen<br />
und -ärzte herbeizuführen», sagt er.<br />
Am meisten schätzt er den grossen Praxisbezug:<br />
«Ich habe es in meinem<br />
Arbeitsalltag oft mit rechtlichen Fragen<br />
rund um Themen wie Arbeitsgesetz,<br />
Diskriminierung und Datenschutz zu tun.<br />
Das Spannende dabei ist, dass es sich<br />
stets um konkrete Fragen aus der Praxis<br />
handelt, das ist ein toller Ausgleich<br />
zur theorielastigen Lehre an der Uni.»<br />
Für sein jugendliches Alter verfügt<br />
Florim Loshi bereits über viel Arbeitserfahrung.<br />
Nach dem Zivildienst, den der<br />
Spiezer im Regionalgefängnis Thun absolvierte,<br />
war er während zweieinhalb<br />
Jahren beim kantonalen Amt für Justizvollzug<br />
als Sachbearbeiter angestellt.<br />
Trotzdem sei er beim Start an der neuen<br />
Arbeitsstelle beim <strong>vsao</strong> «angemessen<br />
nervös» gewesen, wie er sagt. Das Team<br />
habe ihn aber warm empfangen und er<br />
habe sich rasch wohlgefühlt. Er sei von<br />
Anfang an eingebunden worden und<br />
konnte so schnell überall mit anpacken<br />
und helfen.<br />
Nach dem Abschluss des Bachelor-<br />
Studiums möchte Florim Loshi direkt<br />
den Master anhängen. Danach kann er<br />
sich eine Zukunft als Anwalt vorstellen:<br />
«Bis dahin ist es mit Praktika und Prüfungen<br />
aber noch ein weiter Weg.» Nebst<br />
dem Recht pflegt Florim eine weitere<br />
grosse Leidenschaft: das Tanzen. Wenn<br />
er nicht an der Uni ist oder im <strong>vsao</strong>-Büro,<br />
ist es deshalb gut möglich, dass er über<br />
die Tanzfläche wirbelt, sei es bei einem<br />
Cha-Cha-Cha, einem Salsa oder auch<br />
einem langsamen Walzer. Vielleicht hat<br />
er sich aber auch gerade in ein gutes<br />
Buch vertieft oder er trifft sich auf ein<br />
gemütliches Bier mit Freunden.<br />
Bild: zvg<br />
28<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
<strong>vsao</strong><br />
<strong>vsao</strong>-Rechtsberatung<br />
Meine Überstunden<br />
wurden gestrichen!<br />
Bild: zvg<br />
Ich arbeite seit ungefähr sechs<br />
Monaten im Spital mit einer<br />
50-Stunden-Woche. Ich erfasse<br />
regelmässig meine Stunden<br />
(Startzeit, Endzeit, Pausen) mit der<br />
dafür vom Spital zur Verfügung gestellten<br />
Software. Vergangenen Monat habe<br />
ich 30 Überstunden gemacht. Nach<br />
Abschluss des Monats habe ich jedoch<br />
festgestellt, dass nur 10 Stunden in<br />
diesem Monat verbucht worden waren<br />
und mein Überstundensaldo «nur»<br />
70 Stunden zählte (anstatt 90). Meine<br />
Vorgesetzten haben mich über diese<br />
Reduktion nicht informiert. Erst als ich<br />
die von mir ausgefüllte Abrechnung mit<br />
derjenigen verglichen habe, die ich nach<br />
Abschluss des Monats erhalten habe,<br />
ist mir diese Differenz aufgefallen.<br />
Wenn es die Umstände erfordern, ist der<br />
Arbeitnehmer verpflichtet, Überstunden<br />
im Interesse des Arbeitgebers zu leisten.<br />
Er muss dies insbesondere tun, wenn es<br />
sein Arbeitgeber von ihm verlangt.<br />
Überstunden können auch auf Initiative<br />
des Arbeitnehmers geleistet werden, d.h.<br />
ohne dass es der Arbeitgeber ausdrücklich<br />
verlangt. Wenn der Arbeitgeber weiss,<br />
dass Überstunden geleistet werden, und<br />
er diese nicht ablehnt, kann der Arbeitnehmer<br />
davon ausgehen, dass sein<br />
Arbeitgeber diese genehmigt, genauso wie<br />
wenn er diese selber angeordnet hätte.<br />
Dabei spielt es keine Rolle, ob diese<br />
Stunden notwendig sind oder nicht. Hat<br />
der Arbeitgeber hingegen keine Kenntnis<br />
von den geleisteten Überstunden, muss<br />
der Arbeitnehmer dies unverzüglich<br />
melden, damit der Arbeitgeber organisatorische<br />
Massnahmen treffen kann, um in<br />
Zukunft weitere Überstunden zu vermeiden<br />
oder zu genehmigen. Ohne Meldung<br />
durch den Arbeitnehmer können diese<br />
nicht berücksichtigt werden. Wenn der<br />
Arbeitgeber die gemeldeten Überstunden<br />
beanstandet, stellt sich die Frage der<br />
Notwendigkeit dieser Überstunden,<br />
d.h. ob diese für das reibungslose Funktionieren<br />
des Betriebs unerlässlich waren<br />
oder im offensichtlichen Interesse des<br />
Betriebs geleistet wurden.<br />
Zu beachten ist auch, dass es im<br />
Streitfall dem Arbeitnehmer obliegt zu<br />
belegen, dass die geleisteten Stunden<br />
diese Bedingungen erfüllen. Zusätzlich<br />
muss er auch einen Beleg für die Anzahl<br />
geleisteter Überstunden erbringen.<br />
Was passiert nun mit meinen<br />
Überstunden?<br />
In Ihrem Fall ist zu klären, ob das Spital<br />
die von Ihnen geleisteten Stunden<br />
abgelehnt hat. Da Sie Ihre Arbeitsstunden<br />
regelmässig mit der zur Verfügung<br />
gestellten Software erfassen, musste dem<br />
Spital bekannt sein, dass Sie Überstunden<br />
leisteten. Es stellt sich also die Frage,<br />
ob Ihre Stunden bewilligt wurden und,<br />
falls dies nicht der Fall ist, ob diese<br />
notwendig waren.<br />
Dabei müssen Sie zwischen den<br />
Stunden, die in den ersten sechs Monaten,<br />
und denjenigen, die im vergangenen<br />
Monat geleistet wurden, unterscheiden.<br />
Während der ersten sechs Monate<br />
Ihrer Tätigkeit konnten Sie nach Treu und<br />
Glauben davon ausgehen, dass das Spital<br />
angesichts seiner fehlenden Reaktion Ihre<br />
Stunden genehmigte. Ihre Stunden<br />
müssen daher kompensiert werden, sei es<br />
mit Zeit oder Geld, unabhängig von der<br />
Frage, ob sie notwendig waren.<br />
Für die Stunden, die Sie im vergangenen<br />
Monat geleistet haben, können Sie<br />
nicht mehr nach Treu und Glauben davon<br />
ausgehen, dass das Spital diese genehmigte,<br />
da Sie festgestellt haben, dass Ihre<br />
Überstunden anlässlich des Abschlusses<br />
nicht vollständig verbucht worden sind<br />
(10 Stunden anstelle von 30). Andererseits<br />
hätte das Spital sich vehement wehren<br />
sollen, wenn es der Ansicht war, dass<br />
diese 20 Stunden nicht nötig waren.<br />
Zudem hätte es organisatorische Massnahmen<br />
treffen müssen, um weitere<br />
Überstunden zu vermeiden. Ihre Vorgesetzten<br />
haben Ihnen jedoch nichts<br />
mitgeteilt, und Sie müssen nach wie vor<br />
so viele Überstunden leisten. Ich empfehle<br />
Ihnen deshalb, dies direkt mit Ihren<br />
Vorgesetzten und der Personalabteilung<br />
zu besprechen.<br />
Ich habe aber für die ersten sechs<br />
Monate keine Kopie der jeweiligen<br />
Abrechnungen aufbewahrt.<br />
Ich weiss daher nicht mehr, wie viele<br />
Überstunden ich geleistet habe und<br />
auch nicht, ob das Spital Überstunden<br />
gestrichen hat.<br />
Da es ein Informatiktool für die Zeiterfassung<br />
gibt, können Sie diese Abrechnungen<br />
nachträglich verlangen. Mit der<br />
Software muss jede Erfassung und jede<br />
Änderung nachvollziehbar sein. Sie<br />
können daher die Abrechnung vor und<br />
nach deren Validierung vergleichen. Wie<br />
bereits erwähnt, muss Ihre Stundenabrechnung<br />
berücksichtigt werden (und<br />
nicht nur die 60 Stunden, die das Spital<br />
während der ersten sechs Monate<br />
abgerechnet hat).<br />
Zusammengefasst kann man also<br />
sagen, dass es unabhängig vom konkreten<br />
Fall sehr hilfreich sein kann, «Printscreens»<br />
oder Fotos Ihrer Stundenabrechnungen<br />
zu machen, bevor Sie diese<br />
zwecks Abrechnung übermitteln. Falls Sie<br />
dann in den Abrechnungen Differenzen<br />
feststellen, besprechen Sie diese direkt<br />
mit Ihren Vorgesetzten und der Personalabteilung.<br />
Joël Vuilleumier,<br />
Rechtsanwalt und Sektionsjurist<br />
der Sektion Neuenburg<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 29
Fokus<br />
Lichtschalter<br />
für Zellen<br />
Einzelne Zellen gezielt ansteuern und Prozesse auslösen – und das ohne<br />
invasive Techniken? Die Optogenetik macht es möglich.<br />
Dank ihr können zelluläre Aktivitäten durch Licht gesteuert werden.<br />
Wenn auch der Weg bis zu einer breiten Anwendung in der<br />
Humanmedizin noch lang ist, erste Erfolge sind da.<br />
Dr. Johannes Oppermann, Enrico Peter, Rodrigo Gaston Fernandez Lahore, Prof. Dr. Peter Hegemann,<br />
Experimental Biophysics, Humboldt Universität zu Berlin<br />
Bild: Wikipedia, Dartmouth Electron Microscope Facility, Dartmouth College<br />
30<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Spricht man über Optogenetik<br />
muss man eigentlich bei Algen<br />
beginnen. Genauer gesagt bei<br />
der einzelligen Grünalge<br />
Chlamydomonas reinhardtii. Dieser kleine<br />
Organismus ist in der Lage, seine<br />
Schwimmrichtung in Abhängigkeit von<br />
der Intensität und Richtung des einfallenden<br />
Lichts zu ändern. So werden stets<br />
möglichst optimale Bedingungen für die<br />
Photosynthese gewährleistet. Direkt von<br />
der Alge abgeleitete, lichtinduzierte und<br />
schnelle Ströme wurden bereits Anfang<br />
der 1990er Jahre als Grundlage dieses<br />
Verhaltens identifiziert und deuteten darauf<br />
hin, dass Lichtwahrnehmung und<br />
passive Ionenleitung in einem Protein<br />
vereint sind [1]. Die Identifizierung dieses<br />
Moleküls, das seither als Kanalrhodopsin<br />
(engl.: Channelrhodopsin) bekannt ist,<br />
benötigte zwar weitere zehn Jahre Arbeit<br />
[2, 3], markiert aber einen Grundstein für<br />
das rasante Wachstum der Optogenetik.<br />
Genisolierung<br />
virale<br />
Infektion<br />
in vitro<br />
Was ist Optogenetik?<br />
In der Optogenetik werden Gene lichtaktivierbarer<br />
Proteine (in diesem Kontext<br />
auch «optogenetische Werkzeuge» genannt)<br />
in Zellen eingebracht. Diese Proteine<br />
können daraufhin genutzt werden, um<br />
gezielt Prozesse in der Zelle zu manipulieren,<br />
ein Konzept, das schon von Francis<br />
Crick vorgeschlagen wurde [4]. Da sich<br />
Licht präzise in Raum und Zeit steuern<br />
lässt, kann man auch die optogenetisch<br />
anvisierten zellulären Prozesse mit ähnlich<br />
hoher Genauigkeit kontrollieren.<br />
Mittlerweile gibt es eine grosse Vielfalt optogenetischer<br />
Werkzeuge. Das Meistverwendete<br />
ist aber immer noch das Kationen-leitende<br />
Kanalrhodopsin aus der Alge<br />
C. reinhardtii.<br />
Die lichtaktivierte, passive Leitung<br />
von Ionen macht es zum idealen Auslöser<br />
elektrischer Signale, zum Beispiel in Neuronen<br />
oder Myokardiozyten. Die so initiierte<br />
Depolarisation des Gewebes reicht in<br />
der Regel aus, um Aktionspotentiale zu<br />
induzieren. Und es gibt weitere Vorteile:<br />
Oft lassen sich optogenetische Werkzeuge<br />
gezielt und ohne Toxizität in verschiedene<br />
Gewebearten einbringen. Zudem bietet<br />
Licht die Möglichkeit, den untersuchten<br />
Vorgang nicht invasiv zu steuern und zu<br />
untersuchen. Optogenetik ist daher nicht<br />
nur für Experimente in kultivierten Zelllinien<br />
vorteilhaft, sondern bietet sich besonders<br />
für In-vivo-Experimente an, die<br />
häufig in Mäusen, Würmern, Fliegen und<br />
Zebrafischen durchgeführt werden.<br />
Forschung und Anwendung<br />
Das Prinzip der Optogenetik wurde erstmals<br />
im Jahr 2002 im Labor von Gero Miesenböck<br />
angewendet. Mittels dreier Proteine<br />
aus der Sehkaskade der Taufliege<br />
konnte die Aktivität kultivierter Neuronen<br />
gesteuert werden [5]. Dies wurde wenig<br />
später durch die Verwendung des Kanalrhodopsins<br />
[6, 7] jedoch drastisch vereinfacht<br />
und sorgte für die zügige Verbreitung<br />
der Optogenetik, um grundlegende<br />
Forschungsfragen zunächst in der Neurobiologie<br />
zu verfolgen und zu beantworten.<br />
Hierdurch hat sich eine fruchtbare<br />
Kooperation verschiedener wissenschaftlicher<br />
Disziplinen ergeben. Im Bestreben,<br />
das Kanalrhodopsin auf molekularer<br />
in vivo<br />
Anregung<br />
Unterdrückung<br />
Verhalten<br />
In der Optogenetik werden Gene lichtaktivierbarer Proteine aus mikrobiellen Organismen<br />
(hier eine Grünalge) mittels Viren in erregbare Zellen wie zum Beispiel Neuronen eingebracht.<br />
Dies ermöglicht die Anregung oder Unterdrückung von Aktionspotentialen in vitro und das<br />
Studium des daraus resultierenden Verhaltens in vivo.<br />
t<br />
V<br />
Ebene zu verstehen, modifizieren Biophysiker<br />
gezielt Eigenschaften des Proteins.<br />
Viele der so entwickelten Kanalrhodopsin-Varianten<br />
werden wiederum von Neurobiologen<br />
für immer detailliertere Fragestellungen<br />
als optogenetische Werkzeuge<br />
genutzt. In den letzten Jahren haben Bioinformatiker<br />
zudem vermehrt Metagenom-Datenbanken<br />
durchsucht, um bisher<br />
unbekannte optogenetische Werkzeuge<br />
aufzuspüren. Der bisher grösste Meilenstein<br />
ist in dieser Hinsicht sicherlich<br />
die Entdeckung Kalium-leitender Kanalrhodopsine<br />
[8]. Diese erlauben, im Gegensatz<br />
zum stimulierenden Kanalrhodopsin<br />
aus C. reinhardtii, eine dem<br />
natürlichen (tierischen) System nachempfundene<br />
und effiziente Unterdrückung<br />
neuronaler Aktionspotentiale. Neben den<br />
Neurowissenschaften findet die Optogenetik<br />
mittlerweile auch in vielen weiteren<br />
Forschungsgebieten Anwendung [9], und<br />
dank der Durchbrüche in der Grundlagenforschung<br />
bietet sie auch Potential als therapeutisches<br />
Werkzeug. Neben einem optogenetischen<br />
Defibrillator [10] und einem<br />
optischen Cochlea-Implantat [11] ist es<br />
besonders erwähnenswert, dass es vor<br />
Kurzem gelungen ist, einem durch Retinitis<br />
pigmentosa erblindeten Menschen zu<br />
rudimentärem Sehen zu verhelfen [12].<br />
Ein Blick in die Zukunft<br />
Als Therapie wäre die Optogenetik klassischen<br />
Methoden der Neuromodulation<br />
theoretisch um einiges voraus. Die Verwendung<br />
elektrischer oder magnetischer<br />
Stimulation, besonders wenn sie nicht invasiv<br />
erfolgt, erlaubt nur eine minimale<br />
räumliche Kontrolle, da alle Zellen im<br />
erzeugten Feld stimuliert werden [13–15].<br />
Optogenetische Therapien dagegen ermöglichen<br />
eine Zelltyp-spezifische und<br />
sogar subzelluläre Kontrolle [16]. So<br />
liessen sich zum Beispiel zuverlässig Kanalopathien<br />
[17] behandeln. Aber auch die<br />
Therapie neurodegenerativer Erkrankungen<br />
könnte erleichtert werden und sogar<br />
eine Kombination mit Psychotherapien<br />
ähnlich den konventionellen Hirnstimulationsverfahren<br />
wäre vorstellbar [18].<br />
Es gibt jedoch bedeutende Hürden für<br />
die Anwendung optogenetischer Werkzeuge<br />
im menschlichen System [19]. Zuallererst<br />
bedarf es einer sicheren Gentherapie-Methode,<br />
die zielgerichtet die Gene<br />
der lichtsensitiven Proteine in den Zielzellen,<br />
aber nicht in deren Genom integriert.<br />
Gentherapie ist bereits für einige wenige<br />
monogenetische Erkrankungen in der EU<br />
zugelassen [20]. Jedoch entwickelt sich<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 31
Fokus<br />
das Feld nur langsam weiter, da die Anwendung<br />
oft schwierig und risikobehaftet<br />
ist und als ethisch problematisch erachtet<br />
wird [21]. Während optogenetische Therapien<br />
abseits des zentralen Nervensystems<br />
bereits geglückt sind [12], stellt das<br />
menschliche Gehirn eine weitere Hürde<br />
dar, da es sehr gross und für sichtbares<br />
Licht nur schwer durchdringbar ist. Abhilfe<br />
könnten optogenetische Werkzeuge<br />
schaffen, die durch rotes bis nahinfrarotes<br />
Licht aktivierbar sind [22]. Abgesehen davon<br />
gibt es technische Herausforderungen,<br />
wie zum Beispiel die Bio- und Immunkompatibilität<br />
zu gewährleisten. Die<br />
Lichtquellen müssen klein und leistungsstark<br />
sein, ohne sich zu stark zu erhitzen.<br />
Bei tiefer Implantation wäre zudem die<br />
Entwicklung einer Fernsteuerung dieser<br />
Implantate für einen minimalinvasiven<br />
Einsatz sinnvoll.<br />
Zusätzlich wirft die rasant steigende<br />
Diversität und Qualität optogenetischer<br />
Werkzeuge die Frage auf, ob ein nachträglicher<br />
Austausch der therapeutischen<br />
Werkzeuge im Patienten möglich sein<br />
wird, um bestehende Behandlungen weiterzuentwickeln.<br />
Dies wäre vermutlich<br />
nur durch die Verwendung der CRISPR/<br />
Cas-Genschere oder die Entwicklung temporär<br />
effektiver Gentherapien möglich.<br />
Fazit<br />
Die Entdeckung des Kanalrhodopsins vor<br />
rund 20 Jahren hat die Entwicklung der<br />
Optogenetik stark beschleunigt. Besonders<br />
in der Grundlagenforschung findet<br />
diese noch junge Disziplin immer mehr<br />
Anwendung. Aber auch Potential für die<br />
Verwendung im medizinischen Kontext<br />
ist vorhanden. Bis zur weit verbreiteten<br />
optogenetischen Therapie ist es trotz vielversprechender<br />
erster Ergebnisse jedoch<br />
noch ein weiter Weg.<br />
Literatur<br />
[1] Harz, H., Nonnengässer,<br />
C. & Hegemann, P. The Photoreceptor<br />
Current of the Green Alga<br />
Chlamydomonas. Philosophical<br />
Transactions: Biological Sciences<br />
338, 39–52 (1992).<br />
[2] Nagel, G. et al. Channelrhodopsin-1:<br />
A Light-Gated Proton<br />
Channel in Green Algae. Science<br />
296, 2395–2398 (2002).<br />
[3] Nagel, G. et al. Channelrhodopsin-2,<br />
a directly light-gated<br />
cation-selective membrane channel.<br />
Proceedings of the National Academy<br />
of Sciences 100, 13940–13945<br />
(2003).<br />
[4] Crick, F. The impact of<br />
molecular biology on neuroscience.<br />
Philosophical Transactions of the<br />
Royal Society of London. Series B:<br />
Biological Sciences 354, 2021–2025<br />
(1999).<br />
[5] Zemelman, B. V., Lee, G.<br />
A., Ng, M. & Miesenböck, G. Selective<br />
Photostimulation of Genetically<br />
ChARGed Neurons. Neuron 33,<br />
15–22 (2002).<br />
[6] Boyden, E. S., Zhang, F.,<br />
Bamberg, E., Nagel, G. & Deisseroth,<br />
K. Millisecond-timescale, genetically<br />
targeted optical control of neural<br />
activity. Nature Neuroscience 8,<br />
1263–1268 (2005).<br />
[7] Nagel, G. et al. Light<br />
Activation of Channelrhodopsin-2<br />
in Excitable Cells of Caenorhabditis<br />
elegans Triggers Rapid Behavioral<br />
Responses. Current Biology 15,<br />
2279–2284 (2005).<br />
[8] Govorunova, E. G. et<br />
al. Kalium channelrhodopsins<br />
are natural light-gated potassium<br />
channels that mediate optogenetic<br />
inhibition. Nature Neuroscience<br />
1–8 (<strong>2022</strong>) doi:10.1038/s41593-022-<br />
01094-6.<br />
[9] Emiliani, V. et al.<br />
Optogenetics for light control of<br />
biological systems. Nature Reviews<br />
Methods Primers 2, 55 (<strong>2022</strong>).<br />
[10] Nyns, E. C. A. et al. An<br />
automated hybrid bioelectronic<br />
system for autogenous restoration<br />
of sinus rhythm in atrial fibrillation.<br />
Science Translational Medicine 11,<br />
(2019).<br />
[11] Dieter, A., Keppeler,<br />
D. & Moser, T. Towards the optical<br />
cochlear implant: optogenetic<br />
approaches for hearing restoration.<br />
EMBO Molecular Medicine 12,<br />
e11618 (2020).<br />
[12] Sahel, J.-A. et al. Partial<br />
recovery of visual function in a<br />
blind patient after optogenetic therapy.<br />
Nature Medicine 27, 1223–1229<br />
(2021).<br />
[13] Vetter, C. Tiefe Hirnstimulation:<br />
Verbesserte Motorik,<br />
verändertes Wesen. Deutsches Ärzteblatt<br />
international 109, 758–759<br />
(2012).<br />
[14] Reis, J. & Fritsch, B.<br />
Transkranielle elektrische Hirnstimulation.<br />
Aktuelle Neurologie 44,<br />
561–567 (2017).<br />
[15] Siebner, H. R. et al.<br />
Transcranial magnetic stimulation<br />
of the brain: What is stimulated? –<br />
A consensus and critical position<br />
paper. Clinical Neurophysiology<br />
140, 59–97 (<strong>2022</strong>).<br />
[16] Guru, A., Post, R. J., Ho,<br />
Y.-Y. & Warden, M. R. Making Sense<br />
of Optogenetics. International <strong>Journal</strong><br />
of Neuropsychopharmacology<br />
18, pyv079 (2015).<br />
[17] Lerche, H., Mitrovic, N.,<br />
Jurkatt-Rott, K. & Lehmann-Horn.<br />
Ionenkanalerkrankungen –<br />
allgemeine Charakteristika und<br />
Pathomechanismen. Deutsches<br />
Ärzteblatt international 97, 6 (2000).<br />
[18] Deutsche Gesellschaft<br />
für Psychiatrie und Psychotherapie,<br />
Psychosomatik und Nervenheilkunde<br />
e. V. Hirnstimulationsverfahren.<br />
Hirnstimulationsverfahren<br />
https://www.dgppn.de/die-dgppn/<br />
referate/hirnstimulationsverfahren.<br />
html (<strong>2022</strong>).<br />
[19] White, M., Mackay, M.<br />
& Whittaker, R. G. Taking Optogenetics<br />
into the Human Brain:<br />
Opportunities and Challenges in<br />
Clinical Trial Design. Open Access<br />
<strong>Journal</strong> of Clinical Trials 12, 33–41<br />
(2020).<br />
[20] Kirschner, J. & Cathomen,<br />
T. Gene Therapy for Monogenic<br />
Inherited Disorders: Opportunities<br />
and Challenges. Deutsches<br />
Ärzteblatt international (2020)<br />
doi:10.3238/arztebl.2020.0878.<br />
[21] Committee for the<br />
Medicinal Products for Human Use.<br />
Reflection paper on quality, non-clinical<br />
and clinical issues related to<br />
the development of recombinant<br />
adeno-associated viral vectors.<br />
European Medicines Agency (2010).<br />
[22] Lehtinen, K., Nokia, M.<br />
S. & Takala, H. Red Light Optogenetics<br />
in Neuroscience. Frontiers in<br />
Cellular Neuroscience 15, (<strong>2022</strong>).<br />
32<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Das <strong>Journal</strong> des Verbandes Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte<br />
<strong>Nr</strong>. 3, Juni 2021<br />
Seite 27<br />
Kardiologie<br />
Neue Therapien für die<br />
kardiale Amyloidose<br />
Seite 36<br />
Hämatologie<br />
Neoplasien ohne<br />
Chemotherapie behandeln?<br />
Seite 39<br />
Politik<br />
Arbeitszeiten müssen sinken<br />
Seite 6<br />
Anzeige<br />
Ein Engagement des Verlegerverbandes SCHWEIZER MEDIEN für die Schweizer Fachpresse – q-publikationen.ch<br />
«Wir werben in Schweizer<br />
Fach- und Spezialmedien,<br />
weil sie online und offline<br />
clever vernetzen.»<br />
SUSAN BAUMGARTNER HALDER,<br />
Managing Director<br />
Prodigious & Publicis Emil Zürich<br />
Agenturen der Publicis Groupe<br />
Publikation<br />
<strong>vsao</strong><br />
<strong>Journal</strong><br />
Darum inserieren wir in Fach- und Spezialmedien: In Medien mit dem Q-Label sprechen<br />
Sie Ihre Zielgruppen direkt an. Ohne Streuverluste. So steigern Sie die Werbewirkung und senken die Kosten.<br />
Q-PUBLIKATIONEN: FOKUSSIERT – KOMPETENT – TRANSPARENT<br />
<strong>vsao</strong> <strong>Journal</strong> – Das <strong>Journal</strong> des Verbandes Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte – FACHMEDIEN,<br />
<strong>vsao</strong>@fachmedien.ch<br />
Langeweile<br />
Ein spannendes Gefühl
Fokus<br />
Verbot zeigt<br />
erste Wirkung<br />
Laserpointer können buchstäblich ins Auge gehen.<br />
Bis vor einigen Jahren wurden Pointer immer wieder eingesetzt,<br />
um Piloten oder Automobilistinnen zu blenden. Auch im Sport<br />
oder auf Schulhöfen sorgten solche Attacken für Probleme.<br />
Seit 2019 ist ein Verbot von speziell starken Laserpointern in Kraft.<br />
Yannik Waeber, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Sektion nichtionisierende Strahlung und Dosimetrie,<br />
Bundesamt für Gesundheit BAG<br />
Bild: Adobe Stock<br />
34<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Abbildung: zvg<br />
Laserstrahlung kann im Bereich<br />
der Netzhaut Verbrennungen,<br />
Löcher oder Blutungen verursachen,<br />
welche zu bleibenden Augenschäden<br />
führen können. Da das Auge<br />
über keine Schmerzrezeptoren verfügt,<br />
werden solche Verletzungen nicht akut<br />
bemerkt. Es existieren deshalb vergleichsweise<br />
wenig Daten über Augenschäden,<br />
die durch Laserunfälle verursacht wurden.<br />
Dies führt dazu, dass die von Laserstrahlung<br />
ausgehende Gefahr verharmlost<br />
wird. Auch ohne bleibende Augenschäden<br />
können Blendungen mit Laserstrahlen<br />
zu kurzzeitigen Verlusten des<br />
Sehsinns führen. Dies kann insbesondere<br />
im Strassen- wie auch im Flugverkehr zu<br />
gefährlichen Situationen oder zu Unfällen<br />
führen. Vor diesem Hintergrund trat<br />
in der Schweiz am 1. Juni 2019 eine gesetzliche<br />
Regelung in Kraft, welche ausschliesslich<br />
in Innenräumen die Nutzung<br />
von ungefährlichen Laserpointern der<br />
Klasse 1 zu Zeigezwecken erlaubt.<br />
Seit Juni 2019 führt das Bundesamt<br />
für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) Kontrollen<br />
im Warenverkehr und bei Personen<br />
durch und beschlagnahmt Laserpointer.<br />
Anschliessend prüft und klassifiziert das<br />
Bundesamt für Gesundheit (BAG) diese<br />
Geräte. Entspricht ein importierter Laserpointer<br />
nicht den Anforderungen der<br />
Klasse 1 gemäss der in der Schweiz geltenden<br />
Norm, so wird der Import zur Anzeige<br />
gebracht. Bis Ende Juni dieses Jahres wurden<br />
in 559 Fällen 866 Geräte beschlagnahmt.<br />
Über die Hälfte der importierten<br />
Geräte betrafen die Klasse 3B, gefolgt von<br />
der Klasse 3R. Diese starke Zunahme der<br />
Fälle ist auf Anpassungen im Kontrollverfahren<br />
des Warenverkehrs durch das BAZG<br />
zurückzuführen, wodurch mehr Sendungen<br />
kontrolliert und dadurch deutlich<br />
mehr Laserpointer abgefangen wurden.<br />
2019 wurden vermehrt Laserpointer<br />
als Katzenspielzeug importiert, um diese<br />
dann weiterzuverkaufen, weshalb Geräte<br />
der Klasse 2 stärker vertreten waren. Tendenziell<br />
werden aktuell eher einzelne,<br />
stärkere Geräte importiert, und die Leistung<br />
der als Spielzeug angebotenen Laserpointer<br />
nimmt weiterhin zu; die Klassen<br />
3B und 3R bilden klar den Hauptanteil der<br />
vermessenen Geräte.<br />
Weniger Blendungen von Pilotinnen<br />
und Piloten<br />
Gemäss einer Erhebung des Bundesamts<br />
für Zivilluftfahrt (BAZL) wurden von 2013<br />
bis 2019 schweizweit jährlich zwischen 100<br />
und 150 Laserblendungen von Pilotinnen<br />
Abbildung 1. Blendungen von Pilotinnen und Piloten und Flugbewegungen.<br />
* Für <strong>2022</strong> wurden die Daten aus dem 1. Quartal erhoben.<br />
Tabelle 1. Durch den Zoll beschlagnahmte Geräte zwischen 1.6.2019* und 30.6.<strong>2022</strong>**.<br />
Klasse 2019* 2020 2021 <strong>2022</strong>** Total<br />
Klasse 1 2 1 2 2 7<br />
Klasse 2 29 6 8 51 94<br />
Klasse 3R 22 18 22 178 240<br />
Klasse 3B 31 109 84 218 442<br />
Klasse 4 2 14 9 1 26<br />
n/a 32 25 0 0 57<br />
Total 118 173 125 450 866<br />
Fälle 63 136 92 268 559<br />
Tabelle 1 zeigt die Anzahl dieser beschlagnahmten Geräte aufgeschlüsselt nach deren Laserklasse.<br />
und Piloten gemeldet. Seither gehen die<br />
Blendungen zurück, im Mittel um rund 10<br />
Prozent pro Jahr (vgl. Abbildung 1).<br />
2020 sowie 2021, nach Inkrafttreten<br />
der neuen Gesetzgebung, sank die Zahl<br />
der gemeldeten Blendungen durch Laser<br />
jeweils auf 33, was einem Rückgang von<br />
über 50 Prozent entspricht. Es ist dabei<br />
hervorzuheben, dass 2020 bedingt durch<br />
die Covid-19-Pandemie die Flugbewegungen<br />
im Linien- und Charterverkehr um<br />
nahezu zwei Drittel zurückgingen (Flugbewegungen<br />
für Helikopter sind nicht<br />
aufgeführt). 2021 haben die Flugbewegungen<br />
wieder um 15 Prozent zugenommen,<br />
doch die Anzahl gemeldeter Blendungen<br />
blieb für 2021 auf dem niedrigeren Stand<br />
von 2020. Da sich die Pandemie weiterhin<br />
auf die Anzahl der Flugbewegungen auswirkt,<br />
lässt sich aus den im 1. Quartal dieses<br />
Jahres erhobenen Daten noch kein<br />
Trend erkennen.<br />
Weniger Unfälle mit Laserpointern<br />
Gemäss Erhebungen der Schweizerischen<br />
Unfallversicherungsanstalt SUVA sank die<br />
Zahl der gemeldeten Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle<br />
in Zusammenhang mit La-<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 35
Fokus<br />
Abbildung 2. Ein beschlagnahmter Laserpointer der Klasse 4.<br />
serpointern bis 2018 – also unmittelbar vor<br />
Inkrafttreten der neuen Gesetzgebung –<br />
und blieb seither auf ähnlich tiefem Niveau.<br />
Auffällig dabei ist insbesondere der<br />
Rückgang der Nichtbetriebsunfälle um<br />
fast 65 Prozent.<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen,<br />
dass die Verfahrensoptimierungen des<br />
Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit<br />
für die Sicherstellung von Laserpointern,<br />
Wirkung zeigt. Es werden deutlich mehr<br />
Laserpointer während des Imports sichergestellt<br />
(vgl. Abbildung 2).<br />
Bezüglich Laserklassen der sichergestellten<br />
Geräte lässt sich ein Trend zu höheren<br />
Leistungen von Klasse 2 hin zu Klasse<br />
3B erkennen. Die Anzahl Geräte der<br />
Klasse 4 ist eher rückläufig.<br />
Die Blendungen im Flugverkehr sowie<br />
die Unfälle mit Laserpointern nehmen<br />
tendenziell ab. Es scheint, dass sich bereits<br />
vor Inkrafttreten des Gesetzes aufgrund<br />
der Diskussionen um den Missbrauch<br />
von Laserpointern die Anzahl<br />
Blendungen reduziert haben.<br />
Anzeige<br />
ZERTIFIZIERT FÜR<br />
HOHE QUALITÄT:<br />
<strong>vsao</strong><br />
<strong>Journal</strong><br />
<strong>Nr</strong>. 5, Oktober <strong>2022</strong><br />
Das <strong>Journal</strong> des Verbandes Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte<br />
Publikation<strong>2022</strong><br />
KOMPETENT<br />
TRANSPARENT<br />
Das Gütesiegel für Qualität<br />
• Etabliert und anerkannt mit fokussierter Leserschaft<br />
• Inhaltlich kompetent und publizistisch unabhängig<br />
• Werbung ohne Streuverlust<br />
Form<br />
Rechnen, fliegen, gestalten<br />
Seite 16<br />
Politik<br />
Gesperrte Betten – Handeln<br />
tut not<br />
Seite 6<br />
Diabetes<br />
Neue Therapieformen<br />
Seite 30<br />
Vitamine/Mineralstoffe<br />
Ernährung bei<br />
Diabetes mellitus<br />
Seite 39<br />
220527_<strong>vsao</strong>_5_#DE_(01-02)_UG.indd 1 26.09.22 10:38<br />
www.ihrepublikation.ch<br />
WWW.Q-PUBLIKATIONEN.CH<br />
Bild: zvg<br />
36<br />
Q_Titel_Inserat_180x133mm.indd 1 07.02.18 14:48<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Aurora borealis<br />
Bild: <strong>vsao</strong>, Anna Wang<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 37
Fokus<br />
Geschöpfe wie aus dem Märchen. In ihrem<br />
kurzen Erwachsenenleben bringen gewisse<br />
Leuchtkäfer nicht nur ihre Artgenossen zum<br />
Schwärmen, sondern verzaubern auch die<br />
Menschen.<br />
Leuchtfeuer<br />
der Natur<br />
Ihr Blinken hat etwas Märchenhaftes.<br />
Glühwürmchen – oder genauer gesagt Leuchtkäfer – erzeugen Licht<br />
in völliger Dunkelheit. Wie entsteht diese Biolumineszenz?<br />
Wozu dient sie? Und wie schaffen es gewisse Arten,<br />
rhythmisch aufzuleuchten?<br />
Andreas Diethelm, Zellbiologe, Umweltberater<br />
Die Schlacht von Shiloh war<br />
eine der blutigsten des Sezessionskriegs.<br />
Am 7. April 1862<br />
war das Schlachtfeld, ein<br />
sumpfiger Wald am Tennessee River, mit<br />
fast 3500 Toten übersät; die mehr als<br />
16 000 Verwundeten waren tagelang Regen<br />
und Kälte ausgesetzt.<br />
An Wundinfektion starben weit mehr<br />
Soldaten als an direkter Geschosswirkung.<br />
Manche der offenen Wunden haben in der<br />
Nacht grünbläulich geschimmert. Unter<br />
den davon Betroffenen gab es deutlich<br />
mehr Überlebende. Da man das Phänomen<br />
und den Zusammenhang nicht deuten<br />
konnte – die Wirkung des Penicillium-<br />
Schimmelpilzes wurde erst 66 Jahre später<br />
allgemein bekannt –, sprach man vom<br />
«angels glow». Das Mysterium konnte<br />
2001 doch noch auf natürliche Weise erklärt<br />
werden – von zwei US-Gymnasiasten:<br />
Die Besiedlung der Wunden durch das<br />
einzig bekannte nicht marin lebende<br />
Leuchtbakterium, Photorhabdus lumine-<br />
Bilder: Adobe Stock<br />
38<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
scens. Dieses lebt im Darm eines entomopathogenen<br />
Nematoden. Die Fadenwürmer,<br />
die eigentlich auf der Pirsch nach<br />
bodenlebenden Insektenlarven sind, gelangen<br />
mit Erde in die Wunde, wo sie das<br />
Bakterium, anstatt ins Blut einer erbeuteten<br />
Larve, irrtümlich in die menschliche<br />
Wunde erbrechen. P. luminescens scheidet<br />
nun einen Cocktail von Verdauungsenzymen<br />
und Toxinen aus, Letztere töten<br />
ausser der Beute auch um Nahrung konkurrierende<br />
Bakterien, verhindern so die<br />
Wundinfektion und retteten schliesslich<br />
dadurch die verletzten Soldaten. Die kalte<br />
Witterung war ein weiterer Glücksfall:<br />
P. luminescens überlebt bei normaler Körpertemperatur<br />
nämlich nicht. Bleibt die<br />
Frage nach dem Nutzen des Leuchtens für<br />
das Bakterium, wenn es nicht auf Kanonenfutter<br />
gerät. Eine eher behelfsmässige<br />
Hypothese lautet: Die besiedelte und damit<br />
leuchtende Insektenlarve dient als Köder<br />
für weitere Beute.<br />
Schwer erklärbares Leuchten<br />
Was es mit dem Zweck des Leuchtens von<br />
Bakterien, Pilzen und Tieren auf sich hat,<br />
lässt sich nur schwer allgemein formulieren.<br />
Eine populäre Hypothese postuliert<br />
die Genese des Leuchtens als Nebenerscheinung<br />
eines Stoffwechselwegs früher<br />
anaerober Lebensformen zur Entsorgung<br />
von Sauerstoff. Als sich vor etwa 3,5 Milliarden<br />
Jahren Cyanobakterien als erste<br />
Direktverwerter des Sonnenlichts entwickelten,<br />
war das bisherige Leben von der<br />
Oxidation durch den bei der Photosynthese<br />
freiwerdenden molekularen Sauerstoff<br />
bedroht. Jene Organismen konnten<br />
den sich in der Atmosphäre anreichernden<br />
Sauerstoff aber nicht metabolisieren,<br />
dieser war Gift für sie.<br />
Wie dem auch sei und war, Lichtsignale<br />
eignen sich zur Übertragung von<br />
Nachrichten, die verhaltensrelevante Informationen<br />
enthalten, dabei geht es<br />
um Orientierung, um Verständigung, um<br />
Koordination, allgemein um Erkennung –<br />
um das A und O des Lebens also. Konkret<br />
helfen die Lichtsignale etwa bei der Nahrungs-<br />
oder Partnersuche, zum Anlocken<br />
von Beute, bei der Flucht vor Räubern sowie<br />
bei der Verteidigung gegen diese oder<br />
einfach zu deren Abschreckung.<br />
Licht im Dunkeln<br />
Lumineszenz – kaltes Licht – geht von<br />
Leuchtpigmenten lebender Organismen<br />
oder technischer Systeme aus, die durch<br />
Strahlung zum Leuchten angeregt werden,<br />
sie phosphoreszieren oder fluoreszieren.<br />
Im Unterschied dazu zeigt sich Biolumineszenz<br />
auch in völliger und anhaltender<br />
Dunkelheit. Wie ist das möglich?<br />
Der Fettkörper (Corpus adiposum),<br />
neben Speichergewebe ein stoffwechselaktives<br />
Organ in der Leibeshöhle vieler<br />
Gliederfüsser, ist in den Abdominal segmenten<br />
vieler Leuchtkäfer als Leuchtorgan<br />
ausgebildet, welches aus Photocyten<br />
besteht. In diesen spezialisierten Zellen<br />
katalysiert das Enzym Luciferase die chemische<br />
Reaktion, welche den Farbstoff<br />
Luciferin in Oxyluciferin umsetzt. Vorgängig<br />
wird das Molekül durch den Energieträger<br />
ATP aktiviert. Die Oxidation des<br />
entstandenen Konjugats durch molekularen<br />
Sauerstoff führt zu einem hochgespannten<br />
Vierringheterozyklus, der zwei<br />
Sauerstoffatome in Form einer Peroxigruppe<br />
enthält. Dieses Intermediat ist<br />
überaus reaktiv und zerfällt unter CO 2<br />
-Abspaltung,<br />
wobei Oxyluciferin im angeregten<br />
Zustand gebildet wird. Bei dessen<br />
Entspannung in den Grundzustand emittiert<br />
das Molekül Licht, welches der energetischen<br />
Differenz der beiden Zustände<br />
entspricht. Zusammengefasst: Luciferin +<br />
ATP + O 2<br />
Oxyluciferin + AMP + CO 2<br />
+ Licht.<br />
Für eine effektive Leuchtwirkung lenken<br />
Salzkristalle das produzierte Licht, analog<br />
dem Spiegel des Leuchtturms, aus der<br />
Zelle nach aussen.<br />
Beim skizzierten Mechanismus scheint<br />
es sich um einen generellen Prozess der<br />
Lichterzeugung in der Natur zu handeln.<br />
Die Erforschung der Biochemie hinter<br />
dem autonomen Leuchten der unterschiedlichsten<br />
Organismen nahm vor<br />
mehr als 70 Jahren ihren Anfang. Luciferasen<br />
treten in 17 unterschiedlichen Stämmen<br />
und mindestens 700 vorwiegend<br />
marinen Gattungen auf. Die technische<br />
Herstellung von Biolumineszenzsystemen<br />
zur Erforschung des Reaktionsmechanismus<br />
ist aufgrund der komplexen molekularen<br />
Struktur des Luciferins, beispielsweise<br />
dem von Leuchtkäfern, aber recht<br />
aufwändig.<br />
Medizinische Anwendung<br />
Anderseits hat Biolumineszenz die klassischen<br />
Untersuchungstechniken von Enzymmechanismen<br />
in den letzten 30 Jahren<br />
revolutioniert. Was mit der Klonierung<br />
von Luciferasegenen begann, entwickelte<br />
sich mit dem Imaging zum Universalwerkzeug<br />
für eine breite Palette von Fragestellungen<br />
in der biologischen und medizinischen<br />
Grundlagenforschung. Luciferasen<br />
dienen als Detektoren zur Untersuchung<br />
der Genregulation, wie auch zur Analyse<br />
zellulärer Signalwege oder von Proteininteraktionen<br />
und Proteinstabilität. Die<br />
Messung des ATP-Gehalts ermöglicht,<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 39
Fokus<br />
Stoffwechselaktivität beziehungsweise<br />
Via bilität von Zellen zu ermitteln. In der<br />
Umweltanalytik lassen sich Bakterien auf<br />
Oberflächen nachweisen. Mit rekombinanten<br />
Luciferasen und neuen Substraten<br />
hat man höhere Lichtausbeuten erzielt,<br />
ein hochsensitiver Luciferasereporter ermöglicht<br />
nun auch das Arbeiten unter<br />
physiologischen Bedingungen und bei endogenen<br />
Expressionsleveln.<br />
Atem anhalten, blinken<br />
Die Leuchtreaktion ist bei mehrzelligen<br />
Organismen nervös gesteuert, sie erfolgt<br />
in der Regel diskontinuierlich. Für Leuchtkäfer<br />
konnte nachgewiesen werden, dass<br />
sie auf exogene und auf endogene Einflüsse<br />
mit willkürlichen oder unwillkürlichen<br />
Nervenimpulsen reagieren. Zum<br />
Aufleuchten unterbricht die Atmung in<br />
den Mitochondrien, den zellulären Energiezentralen.<br />
Dadurch setzt Sauerstoff die<br />
Leuchtreaktion in Gang. Als Transmitter<br />
fungiert Stickstoffmonoxid. Dieses wird,<br />
wie der Leuchtstoff und das Enzym, in<br />
den Photozyten bereitgestellt. Leuchtkäfer<br />
verstehen sich aufs Energiesparen,<br />
denn viele Arten besitzen weder einen<br />
Verdauungstrakt noch Fresswerkzeug. Sie<br />
zehren als adulte Käfer, während der<br />
wenige Wochen dauernden Fortpflanzungszeit,<br />
von den Fettreserven, die sie<br />
sich in ihrem jahrelangen Vorleben als<br />
Larven und Schneckenräuber angefressen<br />
haben. Daher bewegen sie sich und leuchten<br />
sie nur wenn nötig. Auf Grund der<br />
kurzen Halbwertszeit von Stickstoffmonoxid<br />
hält der Effekt nur kurze Zeit an.<br />
Innerhalb eines Sekundenbruchteils wird<br />
die Sauerstoffzufuhr unterbrochen, das<br />
Licht geht wieder aus und die Zellatmung<br />
wieder an.<br />
Gemeinsam auf Partnersuche<br />
Leuchtkäfer senden typischerweise periodische<br />
Blinksignale oder Lichtblitze aus.<br />
Der Blinkrhythmus und das Anordnungsmuster<br />
der Leuchtorgane sind artspezifisch,<br />
so kann die eigene Art erkannt werden,<br />
dort, wo unterschiedliche Arten einen<br />
Lebensraum gemeinsam nutzen. Bei<br />
einigen Arten sind die Männchen in der<br />
Lage, ihr Blinken zu synchronisieren,<br />
nachdem sie scharenweise ein gut einsehbares<br />
Gehölz angeflogen haben. Diese magische<br />
Lightshow wird an Flussufern Südostasiens<br />
geboten. Auch im amerikanischen<br />
Great-Smoky-Mountains-Nationalpark<br />
ist das Phänomen eine beliebte<br />
Touristenattraktion. Die Käfer blinken etwa<br />
zwei Mal pro Sekunde nach ihrer inneren<br />
Uhr. Lange wurde gerätselt, welche<br />
Funktion dieses erstaunliche Verhalten<br />
haben könnte. Mit einem aufwändigen<br />
Versuchsaufbau konnten US-Forscher unlängst<br />
nachweisen, dass die Weibchen die<br />
synchron blinkenden Männchen bei weitem<br />
besser erkennen, als wenn diese ungeordnet<br />
blinken würden.<br />
Wie aber entsteht aus ungeordnetem<br />
Durcheinander Tausender Individuen ein<br />
synchrones Blinken? Befindet sich ein<br />
Taktgeber im Schwarm, dem alle folgen?<br />
Nein. Vielmehr sieht sich jeder Käfer veranlasst,<br />
die innere Uhr, nach der er blinkt,<br />
ein wenig vorzustellen, wenn er den Nachbarn<br />
blinken sieht. Auf diese Weise soll ein<br />
Riesenschwarm in Gleichtakt geraten? Ja,<br />
so unglaublich wie einfach. Zunächst entstehen<br />
auf diese Weise gemeinsam blinkende<br />
Gruppen, dann entstehen daraus<br />
Wellen, die sich allmählich glätten bis<br />
ganze Lichterbäume stundenlang lautlos<br />
pulsieren. Wahrlich eine unübersehbare<br />
Einladung an die über sie hinweg fliegenden<br />
Weibchen!<br />
Kontakt: era__@web.de<br />
Mehr zum Thema unter:<br />
www.glühwürmchen.ch<br />
Anzeige<br />
Partnervermittlung mit Charme<br />
persönlich · seriös · kompetent<br />
Löwenstrasse 25, 8001 Zürich<br />
044 534 19 50<br />
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.<br />
Kathrin Grüneis<br />
40<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Aurora borealis<br />
Bild: <strong>vsao</strong>, Anna Wang
Fokus<br />
Ins richtige Licht<br />
gesetzt<br />
Licht im Theater ist mehr als Beleuchtung. Licht ist ein wesentlicher<br />
Bestandteil einer Inszenierung. Gefühle, Atmosphären,<br />
das Vergehen der Zeit und vieles mehr kann mit der richtigen Farbgebung<br />
und Lichtführung ausgedrückt werden. Und verstärkt beim<br />
Publikum oftmals unbemerkt das Erlebnis.<br />
Fiona Zolg, geprüfte Meisterin der Veranstaltungstechnik, Fachrichtung Beleuchtung<br />
Licht im Theater ist für mich –<br />
neben der augenscheinlichen<br />
Rolle des Erhellens und Beleuchtens<br />
– die Unterstützung<br />
der Emotionen in der Inszenierung. Etwas<br />
kann grell, kalt, unfreundlich ausgeleuchtet<br />
werden oder Wärme und Geborgenheit<br />
ausstrahlen. Dazwischen gibt es<br />
unendlich viele Farben, dank denen beim<br />
Publikum – meist unbewusst – unterschiedlichste<br />
Gefühle wachgerufen werden<br />
können.<br />
Um also einer Inszenierung oder einer<br />
bestimmten Szene den richtigen «Ton» zu<br />
geben, ist es wichtig, die richtige Farbkorrektur<br />
zu wählen. Die Farbtemperatur wird<br />
durch eine leichte Verschiebung des Lichtes<br />
in eine kühlere (bläulich, grünlich)<br />
oder wärmere (gelblich, rosig) Richtung<br />
korrigiert. Diese Verschiebung wird von<br />
den Zusehenden oft nicht bewusst wahrgenommen.<br />
Es ist mehr ein Gefühl, das im<br />
Raum entsteht und im Idealfall die Idee<br />
der Szene subtil unterstützt bzw. verstärkt,<br />
ohne dabei plump zu wirken.<br />
Neben der Farbkorrektur ist die Wahl<br />
der Lichtrichtung eine weitere wichtige<br />
Entscheidung. Oft leuchte ich eine Szene<br />
regelmässig aus und setze dann ein Führungslicht.<br />
Das ist eine Lichtquelle, die<br />
den wesentlichen Anhaltspunkt für die<br />
Stimmung der Szene vermittelt. Das Führungslicht<br />
kann natürliches Licht wie Sonneneinstrahlung<br />
oder alltägliche Beleuchtung<br />
(Stehlampe) imitieren oder die Änderung<br />
der Tageszeit oder das Vergehen der<br />
Zeit allgemein anzeigen.<br />
Je nach Szene setze ich zusätzlich ein<br />
Spitzlicht, also eine Lichtquelle, die dem<br />
zu beleuchtenden Objekt eine Tiefenzuordnung<br />
ermöglicht. Zum Beispiel ein<br />
Licht von hinten und oben, um die Konturen<br />
von Körpern und Objekten herauszuheben.<br />
Typischerweise wird im klassischen<br />
Ballett oft mit beidseitigem Seitenlicht<br />
beleuchtet, um die Körper der Tänzerinnen<br />
zu modellieren.<br />
Das Spiel mit der Lichtrichtung kann<br />
im zeitgenössischen Tanz deutlich stärker<br />
angewandt werden als im Sprechtheater.<br />
Während im Tanz der Körper als Ganzes<br />
dem Ausdruck dient, ist im Sprechtheater<br />
die Mimik wichtig, entsprechend sollte das<br />
Gesicht regelmässig ausgeleuchtet sein.<br />
Licht in «Für immer und nie»<br />
In diesem Artikel zeige ich Bilder der<br />
Tanzproduktion «Für immer und nie» von<br />
Kumpane, in der das Licht richtig spielen<br />
darf und ein eigenständiger Player ist. Die<br />
Fotos stammen von der Bühnenbildnerin<br />
Angelica Paz Soldan und werden von<br />
Kumpane zur Verfügung gestellt. Die<br />
Tanzcompanie Kumpane mit den Kernfiguren<br />
Tina Beyeler (Choreographie und<br />
Performance) und Andri Beyeler (Autor<br />
und Dramaturg) arbeitet an der Schnittstelle<br />
von modernem Tanz und Sprechtheater<br />
(www.kumpane.ch).<br />
Farbnuancen werden in dieser Fotoserie<br />
eher zu Farben. Dies geschieht durch<br />
den direkten Vergleich. Im Theater interpretiert<br />
das Auge die Bühne relativ schnell<br />
als farblos, weil ein Vergleich fehlt.<br />
Die Erarbeitung dieses Lichtkonzeptes<br />
beginnt für mich mit dem Erstgespräch<br />
mit der künstlerischen Leiterin und Choreographin<br />
Tina Beyeler. Von ihr erfahre<br />
ich das Thema, den Eindruck, den sie mit<br />
der Inszenierung erreichen will, und mit<br />
welchen Bildern, Texten und Aspekten des<br />
Themas sie die Zuschauer auf welche Art<br />
berühren möchte. Dazu kommen visuelle<br />
Aspekte: Wie viele Performerinnen in welchen<br />
Kostümen auftreten und – für mich<br />
zentral – vor welchem Bühnenbild. In der<br />
Regel baut die Bühnenbildnerin ein Modell,<br />
damit alle die Farben- und Grössenverhältnisse<br />
sehen können.<br />
Als Nächstes folgen Probenbesuche.<br />
Es ist meine grundsätzliche Aufgabe, die<br />
Szene im Proberaum zu interpretieren und<br />
entsprechende Rückschlüsse für das Licht<br />
zu ziehen. Am Schluss der Proben zeichne<br />
ich einen Lichtplan, der vor Ort im Theater<br />
realisiert wird. Während der Endproben –<br />
das sind Proben, die im eingerichteten<br />
Theater stattfinden – werden die ganzen<br />
technischen Abläufe erarbeitet, angepasst<br />
und geübt. Dann ist das Lichtkonzept bereit<br />
und wird dokumentiert, um auf Gastspielen<br />
wiederholt werden zu können.<br />
42<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Das Stück «Für immer und nie» beginnt mit einer schlafenden<br />
Person. Das Blau steht für die Nacht, deutlich sieht man die<br />
Person, welche in ihrem Bett liegt. Hier wird die Tänzerin mit<br />
klarem Lichtfokus herausgehoben.<br />
Die Szene entwickelt sich weiter, das Bühnenbild wird verändert<br />
und belebt, die Tänzerinnen eignen es sich an. Hier sieht man<br />
die Bühne neutral beleuchtet, die Zuschauer können sich einen<br />
Überblick verschaffen, die Bühne kennen lernen, ebenso die<br />
Figuren und die Requisiten.<br />
In dieser Inszenierung findet ein gemütlicher Abend statt – das<br />
Licht ist freundlich –, aber irgendwann entwickelt sich ein Streit,<br />
bei dem das Licht mit einem leicht grünlichen Schleier ergänzt<br />
wird. Die Wärme entweicht aus dem Raum, die Spannung wird<br />
visualisiert, wahrnehmbar, ohne sich aufzudrängen. Es wird<br />
vom Publikum nicht aktiv wahrgenommen, dass das Licht den<br />
Vorgang auf der Bühne verstärkt, aber irgendwann fällt vielleicht<br />
auf, dass neue Emotionen den Raum erfüllen. Alles erscheint<br />
kühler, farbloser. Was hier mit dem Grün deutlich sichtbar ist,<br />
etabliert sich in der Realität über Minuten und wird nicht als<br />
Wechsel wahrgenommen.<br />
In dieser Szene ist die Lichtrichtung von starker Bedeutung.<br />
Einerseits wird die Bühnenfläche mit Gegenlicht in kaltem Licht<br />
ausgeleuchtet (Spitzlicht), andererseits wird die hintere Wand<br />
vom Boden vorne links dunkelblau angeleuchtet. Erkannt werden<br />
kann die Lichtrichtung über die Schatten. Der grosse Schatten<br />
an der Wand kommt von der sitzenden Tänzerin, welche noch<br />
einen zweiten klaren Schatten in Richtung Zuschauerraum wirft.<br />
Dieser wird vom Gegenlicht geschaffen.<br />
Fotos: zvg<br />
Dies ist eine Farbspielerei. Durch eine additive Farbmischung<br />
(die Mischung der Farben ist heller als die einzelnen Farben) wird<br />
eine hellblaue Wand erzeugt: Das geschieht durch die Mischung<br />
von Grüngelb und Blau, wie an den Schatten deutlich erkennbar<br />
ist. In der Inszenierung wird eine innere Zerrissenheit dargestellt<br />
und durch das Licht unterstützt. Die Tänzerin agiert dabei teilweise<br />
auch mit ihren Schatten, wie bei einer Art Schattenboxen.<br />
Dies ist der versöhnliche Schluss der Inszenierung. Was hier als<br />
starke Einfärbung in Rosa erscheint, geschieht durch die Linse<br />
der Kamera. Das Auge interpretiert die Bühne in der Realität eher<br />
als farblos, aber weich und freundlich.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 43
Fokus<br />
Kunstlicht macht die Nächte immer heller – das<br />
kann das Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen.<br />
Hier das nächtliche Baden (AG).<br />
Helle Nächte<br />
Trotz der derzeitigen Sparmassnahmen wird die Dunkelheit<br />
zunehmend aus der Nacht gedrängt. Wo Flutlicht und Leuchtreklamen<br />
sich ausbreiten, wird es heller und heller. Die Lichtverschmutzung<br />
hat Folgen für Menschen, Tiere und Pflanzen. Doch es gibt Strategien,<br />
um sie einzudämmen.<br />
Ümit Yoker<br />
Die Leuchtreklame am Bahnhof<br />
oder das Flutlicht der<br />
Sportanlage, der Fernsehturm<br />
oder die blinkende<br />
Weihnachtsgirlande der Nachbarin: Wenn<br />
wir die Nacht beleuchten, spüren das<br />
Menschen, Tiere und Pflanzen. Die Lichtverschmutzung<br />
nimmt weltweit jedes<br />
Jahr um zwei bis sechs Prozent zu, wahrscheinlich<br />
rascher als jede andere Form<br />
von Umweltverschmutzung, wie es in einer<br />
Publikation des Bundesamtes für Umwelt<br />
heisst.<br />
Wie sich Lichtverschmutzung auswirkt,<br />
lässt sich heute kaum abschätzen.<br />
Was zu viel Licht in der Nacht mit uns und<br />
anderen Lebewesen macht, hängt nicht<br />
nur davon ab, wie intensiv dieses scheint,<br />
wie es sich zusammensetzt oder wie lange<br />
und wo es eingesetzt wird, sondern auch<br />
davon, wie lichtempfindlich und anpassungsfähig<br />
Organismen sind.<br />
Fest steht: Licht in der Nacht bringt<br />
Ökosysteme aus dem Gleichgewicht. «Die<br />
Lichtverschmutzung verändert, wie Arten<br />
interagieren und sich Artengemeinschaften<br />
zusammensetzen», sagt die Ökologin Eva<br />
Knop, Privatdozentin an der Universität Zürich<br />
und Teamleiterin am Forschungszentrum<br />
Agroscope. Denn viele physiologische<br />
Vorgänge wie das Wachstum oder der Stoffwechsel<br />
sind dem natürlichen Rhythmus<br />
von Tag und Nacht angepasst.<br />
Zugvögel in Eile, Ratten mit<br />
Schwermut<br />
Wenn der Dunkelheit weniger Raum<br />
bleibt, dürfte die Biodiversität abnehmen<br />
und die Homogenisierung weiter fort-<br />
Bild: Adobe Stock<br />
44<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
schreiten. Will heissen: Häufige, besonders<br />
anpassungsfähige Tier- und Pflanzenarten<br />
werden noch häufiger, seltene noch<br />
seltener. Leiden dürften vor allem jene<br />
Arten, deren Leben sich nach Sonnenuntergang<br />
abspielt. Das sind viele: Fast<br />
zwei Drittel aller wirbellosen Tiere sind in<br />
der Dämmerung oder nachts aktiv. Bei den<br />
Wirbeltieren ist es ein Drittel. Dazu gehören<br />
alle Fledermäuse und beinahe alle<br />
Amphibien. Obwohl es noch wenig gesicherte<br />
Erkenntnisse zu den Folgen künstlichen<br />
Lichts auf Flora und Fauna gibt,<br />
sind einzelne Wirkungen bekannt.<br />
So stellte man zum Beispiel schon in<br />
den 1930er-Jahren fest, dass direkt von<br />
Strassenlaternen beschienene Äste im<br />
Frühjahr früher austreiben und im Herbst<br />
später Laub abwerfen, was sie anfälliger<br />
für Frost und Schäden macht. Ist es nachts<br />
zu hell, bleibt sehr lichtempfindlichen<br />
Fledermäusen wie etwa der Kleinen Hufeisennase<br />
weniger Zeit für die Beutesuche,<br />
Zugvögel kommen zu früh in ihrem<br />
Brutgebiet an und Ratten entwickeln Symptome<br />
einer Depression.<br />
Künstliches Licht beeinflusst selbst<br />
Lebewesen, die ausschliesslich am Tag aktiv<br />
sind, wie Eva Knop und ihr Team nun<br />
nachweisen konnten: Werden Wiesen<br />
nachts von einer Strassenlampe beschienen,<br />
benehmen sich tagaktive Insekten<br />
anders: Wildbienen, Fliegen und Käfer bestäuben<br />
bestimmte Pflanzen wie Baldrian,<br />
Kohldistel und Einjähriges Berufkraut<br />
deutlich seltener, wenn diese künstlichem<br />
Licht ausgesetzt waren. Der violett blühende<br />
Wald-Storchschnabel hingegen bekommt<br />
nach einer Nacht im Laternenschein<br />
zwar gleich häufig Besuch, zieht<br />
aber mehr Käfer und weniger Fliegen an.<br />
tiv macht. «Solch vermeintlich kleine Veränderungen<br />
könnten sich langfristig auf<br />
den Bestand von Wildpflanzen auswirken<br />
und eventuell auch auf den Ertrag von<br />
landwirtschaftlichen Kulturen», gibt Knop<br />
zu bedenken. Bisher fehlen dazu jedoch<br />
die Daten.<br />
Wenn die natürliche Ordnung durch<br />
Kunstlicht durcheinandergerät, ist das<br />
nicht für alle betroffenen Lebewesen ein<br />
Nachteil. So gab es im Experiment von<br />
Knop auch Pflanzen, die profitierten: Die<br />
Wilde Möhre etwa wurde nun deutlich<br />
häufiger bestäubt, vor allem Fliegen fanden<br />
sie anziehender. Doch die Vorteile<br />
heller Nächte sind nicht immer von Dauer:<br />
Beleuchtete Garageneinfahrten und Fassaden<br />
erleichtern so mancher Spinne die<br />
Beutesuche – einige nehmen jedoch angesichts<br />
des üppigen Angebots dann so<br />
schnell an Umfang zu, dass sie ihre eigene<br />
Häutung nicht mehr überleben.<br />
Anzeige<br />
Beeinträchtigter Schlaf<br />
Die wenig lichtscheue Zwergfledermaus<br />
findet an Strassenlaternen zwar mehr Falter,<br />
als sie fressen kann. Wenn aber ihr<br />
Speiseplan nur noch aus diesen besteht,<br />
geht ihr bald der Nachschub an Faltern<br />
aus. Und der Singvogel im Stadtpark, der<br />
morgens schon lange vor seinen Kollegen<br />
aus dunkleren Gegenden potenzielle Partnerinnen<br />
bezirzt, zeugt zwar früher und<br />
mehr Nachwuchs, dafür kommt dieser<br />
nicht dann zur Welt, wenn auch am meisten<br />
Nahrung verfügbar wäre.<br />
Auch wir Menschen spüren die Folgen,<br />
wenn die Nacht zunehmend zum Tag<br />
wird. «Licht mit hohem Blauanteil kann<br />
den Schlaf beeinträchtigen und Stoffwechselprozesse<br />
stören», sagt Eva Knop.<br />
Wir gehen später ins Bett, schlafen weniger<br />
tief und lang, der Körper schüttet weniger<br />
Melatonin aus. Dieses Hormon spielt<br />
nicht nur eine entscheidende Rolle für un-<br />
Schädlinge abwehren<br />
Wie beeinflusst die nächtliche Helligkeit,<br />
was Bienen und Käfer tagsüber so tun? Genau<br />
dieser Frage geht das Forschungsteam<br />
um Knop derzeit im Rahmen des Universitären<br />
Forschungsschwerpunkts «Globaler<br />
Wandel und Biodiversität» nach: «Möglich<br />
ist, dass die nächtliche Beleuchtung verändert,<br />
in welcher Zusammensetzung und<br />
welchem Rhythmus die Pflanzen tagsüber<br />
ihren Duft ausströmen», sagt die Biologin.<br />
Da dieser je nach Helligkeit zum Beispiel<br />
eher Bestäuber anlockt oder Schädlinge<br />
abwehrt, ist der Verlauf allenfalls nicht<br />
mehr optimal auf den Tag abgeglichen.<br />
Es könnte aber auch sein, dass Herbivoren<br />
wie etwa Schnecken bei Kunstlicht<br />
mehr Blüten und Blätter anknabbern, was<br />
die Pflanze für Bestäuber weniger attrak-<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 45
Fokus<br />
Intelligent beleuchten<br />
Die Lichtverschmutzung nimmt auch<br />
in der Schweiz weiter zu. Grund dafür<br />
ist vor allem die fortschreitende Urbanisierung<br />
des Landes – ebenso aber<br />
die Umstellung auf LED, wie die Ökologin<br />
Eva Knop von der UZH sagt. Es<br />
gibt also immer weniger natürlich<br />
dunkle Flächen in der Nacht – gleichzeitig<br />
wird es in den beleuchteten<br />
Gebieten stetig heller.<br />
seren Schlaf, sondern wirkt auch bei der<br />
körpereigenen Abwehr von Krebszellen<br />
mit. Ob zu viel künstliche Beleuchtung<br />
tatsächlich die Wahrscheinlichkeit einer<br />
Krebserkrankung erhöht, ist jedoch noch<br />
unklar.<br />
Natürliche Nachtdunkelheit erleben<br />
Konkrete Gesetze zur Lichtverschmutzung<br />
gibt es in der Schweiz bislang keine.<br />
Leitplanken setzen das Umweltschutzgesetz<br />
und das Natur- und Heimatschutzgesetz<br />
sowie Empfehlungen des Bundesamts<br />
für Umwelt zur Vermeidung von Lichtemissionen.<br />
In den vergangenen Jahren<br />
sind jedoch zahlreiche Projekte und Richtlinien<br />
auf Initiative von einzelnen Bürgerinnen<br />
und Bürgern, Gemeinden, Regionen<br />
und Organisationen wie Dark-Sky<br />
Switzerland entstanden. Eva Knop sagt<br />
dazu: «Das Bewusstsein für die Problematik<br />
hat spürbar zugenommen.»<br />
Im Zentrum solcher Initiativen steht,<br />
die Lichtmenge sowohl zeitlich, räumlich<br />
als auch in Intensität und Farbe präziser<br />
an den tatsächlichen Bedarf anzupassen<br />
und direkte Strahlung in den Himmel zu<br />
vermeiden. So hat sich etwa die Gemeinde<br />
Fläsch GR bei der Erneuerung ihrer Strassenbeleuchtung<br />
bewusst dafür entschieden,<br />
sensible Orte wie etwa ihren Kirchturm,<br />
der eine Kolonie gefährdeter Mausohren<br />
beherbergt, nicht zu beleuchten.<br />
Der Naturpark Gantrisch möchte als erster<br />
Sternenpark der Schweiz die Bevölkerung<br />
für den Einfluss künstlichen Lichts auf<br />
Flora und Fauna sensibilisieren und das<br />
Erlebnis natürlicher Nachtdunkelheit zurückbringen.<br />
Dunkle Zonen definieren<br />
Auch im Kanton Zürich soll das Thema<br />
Lichtverschmutzung verbindlicher angegangen<br />
werden. Die Baudirektion hat den<br />
Auftrag erhalten, in den kommenden zwei<br />
Jahren die gesetzlichen Grundlagen auszuarbeiten<br />
und etwa im Richtplan dunkle<br />
Zonen zu definieren. Die Stadt Zürich gehörte<br />
2004 zu den ersten Städten in Europa,<br />
die mit einem Plan Lumière ihre Beleuchtung<br />
besser koordinieren und bewusster<br />
gestalten wollen. Solche Konzepte<br />
dienten am Anfang vor allem dem Standortmarketing.<br />
Mittlerweile haben ökologische<br />
und energetische Überlegungen<br />
mehr Gewicht erhalten. Zahlreiche weitere<br />
grosse und kleine Städte der Schweiz<br />
haben inzwischen ähnliche Leitbilder<br />
ausgearbeitet.<br />
Dieser Artikel ist zuerst im UZH Magazin<br />
erschienen (UZH Magazin 1/22, Universität<br />
Zürich).<br />
LED ist laut Knop vor allem deshalb<br />
problematisch, weil kurzwelliges Licht<br />
mit einem höheren Blauanteil stärker<br />
in der Atmosphäre streut als etwa<br />
Halogenleuchten oder die für Strassenlaternen<br />
bisher üblichen Natriumdampflampen,<br />
deren Licht ins<br />
Orange geht. Hinzu kommt, dass LED<br />
als energieeffizientere und günstige<br />
Art der Beleuchtung auch Private dazu<br />
verleitet, den eigenen Garten oder<br />
Balkon öfter und länger zu erhellen als<br />
bisher.<br />
Gleichzeitig birgt LED, richtig eingesetzt,<br />
grosses Potenzial zur Vermeidung<br />
von unerwünschten Lichtemissionen.<br />
Es lässt sich gezielter ausrichten<br />
als andere Beleuchtungen, ohne<br />
Verzögerung ein- und ausschalten und<br />
sehr genau in seiner Intensität und<br />
Farbzusammensetzung steuern.<br />
Schon vor einigen Jahren haben etwa<br />
die Stadtwerke St. Gallen an einer<br />
naturnahen Strasse deshalb eine<br />
volldynamisch und intelligent gesteuerte<br />
LED-Beleuchtung eingeführt: Sie<br />
erfasst nicht nur, ob sich eine Person<br />
nähert, sondern auch, ob diese zu<br />
Fuss, auf dem Velo oder mit dem Auto<br />
unterwegs ist.<br />
Je nachdem werden dann zwei oder<br />
mehrere Strassenlampen auf mittleres<br />
oder maximales Helligkeitsniveau<br />
hochgeregelt – sodass der Person ein<br />
Lichtteppich vorausgeht – um danach<br />
wieder auf eine zur Orientierung<br />
ausreichende Grundeinstellung abgesenkt<br />
oder in den Ruhezustand versetzt<br />
zu werden, in dem die Lampen<br />
kein Licht abgeben.<br />
Bild: Adobe Stock<br />
46<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Aurora borealis<br />
Bild: <strong>vsao</strong>, Anna Wang
Perspektiven<br />
Aktuelles aus der Immunologie:<br />
Immuntherapie zur Behandlung von Sarkomen<br />
Neue Therapien<br />
und ihre Grenzen<br />
Die neueren Formen der Immuntherapie gelten als vielversprechende<br />
Waffe im Kampf gegen einzelne Tumorarten. Was die Sarkome angeht,<br />
ist der Erfolg momentan trotz intensiver Forschung noch eher bescheiden.<br />
Selbst wenn derzeit nur eine Minderheit der Sarkompatienten<br />
von der Immuntherapie profitieren kann, sollte das nicht davon abhalten,<br />
in diese Richtung weiterzugehen.<br />
Dr. med. Armelle Dufresne MD PhD, Centre Leon Berard Lyon<br />
Die Entwicklung der Immuntherapie,<br />
darunter Immuncheckpoint-Inhibitoren<br />
(ICI),<br />
die PD1/PD-L1 und CTLA-4<br />
blockieren, und die adoptiven Zelltherapien,<br />
haben völlig neue Möglichkeiten in<br />
der Krebsbehandlung geschaffen, die eine<br />
erstaunliche Aktivität bei zahlreichen soliden<br />
und hämatologischen Malignomen<br />
aufweisen. Sarkome, eine seltene und heterogene<br />
Gruppe von über 150 verschiedenen<br />
Knochen- und Weichteilkrebsarten,<br />
gelten seit langem als sensitiv gegenüber<br />
Immunerkennung. In diesem Zusammenhang<br />
wurden in den letzten fünf Jahren<br />
zahlreiche klinische Studien durchgeführt,<br />
um die Wirksamkeit der Immuntherapie<br />
bei Weichteilsarkomen und Knochensarkomen<br />
zu erforschen. Die ersten<br />
klinischen Studien, in denen ICI als Mono-<br />
oder Kombinationstherapie bei nicht<br />
ausgewählten Sarkomen bewertet wurden,<br />
waren mit Gesamtansprechraten von<br />
10 bis 20 Prozent enttäuschend. Die pivotale<br />
Phase-2-Studie mit Pembrolizumab<br />
bei Knochen- und Weichteilsarkomen<br />
zeigte ein Ansprechen bei 4 von 10 Patienten<br />
mit einem plenomorphen undifferenzierten<br />
Sarkom und bei 2 von 10 Patienten<br />
mit einem entdifferenzierten Liposarkom.<br />
Eine minimale Aktivität wurde bei<br />
Synovialosarkomen, Leiomyosarkomen<br />
und Knochensarkomen beobachtet. Kurz<br />
darauf bestätigte eine Phase-II-Studie, in<br />
der Nivolumab mit einer Kombination<br />
aus Ipilimumab und Nivolumab verglichen<br />
wurde, die niedrigen Ansprechraten<br />
mit Nivolumab allein. Allerdings erreichten<br />
6 von 38 Patienten, die mit der Kombination<br />
aus Ipilimumab und Nivolumab<br />
behandelt wurden, ein objektives Ansprechen,<br />
dies jedoch auf Kosten einer höheren<br />
Toxizität. Diese bescheidene Wirksamkeit<br />
lässt sich dadurch erklären, dass<br />
die meisten Sarkome eine geringe Immuninfiltration<br />
und eine geringe oder durch<br />
Translokationen verursachte Tumormutationslast<br />
aufweisen, was das Vorhandensein<br />
von Neoantigenen, die für die<br />
Aktivierung der Immunantworten nützlich<br />
sind, einschränken kann.<br />
Um dieses Hindernis zu umgehen, fokussiert<br />
sich die aktuelle klinische Forschung<br />
auf drei verschiedene strategische<br />
Ausrichtungen:<br />
Kombination von Therapien<br />
Mehrere klinische Studien evaluieren die<br />
Kombination von ICI mit anderen Krebstherapien.<br />
Es geht darum, die Produktion<br />
von Neoantigenen durch Krebsbehandlungen,<br />
die einen sogenannten «immunogenen»<br />
Zelltod auslösen, zu stimulieren.<br />
Als Beispiele seien hier Chemotherapien<br />
(Anthrazykline, wirksam für Sarkome),<br />
Strahlentherapie, Tyrosinkinaseinhibitoren<br />
erwähnt. Letztere haben häufig eine<br />
antiangiogene Wirkung und sind in der<br />
Lage, die Mikroumgebung des Tumors zu<br />
verändern, was auch die Wirksamkeit der<br />
Immuntherapie steigern kann. Derzeit<br />
laufen mehrere Kombinationsstudien. Einige<br />
davon in der neoadjuvanten Phase<br />
der Sarkombehandlung: Durch die biologische<br />
Analyse von Operationspräparaten,<br />
die diesen Behandlungen unterzogen<br />
wurden, kann man viel über die Mechanismen<br />
der Wirksamkeit und Resistenz<br />
gegenüber der Immuntherapie erfahren.<br />
Adoptive Zelltherapie<br />
Einer der grundlegenden Immunmechanismen,<br />
der die Aktivität der Immuntherapie<br />
bei Sarkomen einschränkt, hängt<br />
mit dem Mangel an Neoantigenen oder<br />
deren geringer Erkennung durch das Immunsystem<br />
zusammen. Adoptive Zelltherapien<br />
versuchen diesen Schritt zu umgehen,<br />
indem nach der Verabreichung einer<br />
lymphodepletierenden Chemotherapie<br />
eine grosse Menge autologer T-Zellen injiziert<br />
wird, die aus dem Primärtumor oder<br />
aus dem peripheren Blut des Patienten gewonnen<br />
wurden und spezifisch auf ein<br />
Tumorantigen abzielen. Zu den adoptiven<br />
Zellprodukten können T-Zell-Rezeptoren,<br />
chimäre Antigenrezeptor-T-Zelltherapien<br />
(CAR), tumorinfiltrierende Lymphozyten<br />
(TIL) und natürliche Killerzellen (NK) ge-<br />
48<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Perspektiven<br />
Bild: Adobe Stock<br />
hören. NY-ESO-1 und MAGE A4 sind zwei<br />
Testis-Antigene, die an der immunologischen<br />
Reifung beteiligt sind und deren Expression<br />
typischerweise auf embryonale<br />
Keimzellen beschränkt ist. Es wurde gezeigt,<br />
dass es eine Überexpression dieser<br />
beiden Antigene bei Synovialosarkomen<br />
und myxoiden Liposarkomen gibt. In zwei<br />
klinischen Studien an Patienten mit<br />
metastasierendem Synovialsarkom, die<br />
(HLA)-A*02-positive Tumoren aufwiesen<br />
und NY-ESO-1 oder MAGE A4 exprimierten,<br />
führte die TCR-T-Zelltherapie zu häufigen<br />
und lang anhaltenden Reaktionen<br />
ohne übermässige Toxizität. Obwohl diese<br />
Strategien sehr vielversprechend sind,<br />
werden sie durch die Häufigkeit der<br />
HLA-Allele in der Allgemeinbevölkerung<br />
eingeschränkt. Lediglich zwei Sarkomsubtypen<br />
exprimieren diese Zielstrukturen<br />
zuverlässig.<br />
Klinische Studien<br />
Verschiedene klinische Studien sowie<br />
mehrere in der Literatur berichtete Fälle<br />
haben die rasche Identifikation einiger<br />
Sarkomsubtypen ermöglicht, die besonders<br />
empfindlich auf eine Immuntherapie<br />
reagieren: alveoläre Weichteilsarkome,<br />
Chordome oder Angiosarkome. Mehr als<br />
150 Patienten mit alveolären Weichteilsarkomen<br />
wurden in klinischen Studien<br />
unter Einbeziehung von PD1/PD-L1-Antikörpern<br />
behandelt, wobei die Ansprechrate<br />
von 7,1 bis über 50 Prozent reichte. Die<br />
Wirksamkeit bei alveolären Weichteilsarkomen<br />
oder Chordomen ist schwer zu<br />
erklären. Ancillary Studies in Verbindung<br />
mit klinischen Studien versuchen Faktoren<br />
zu identifizieren, die ein Ansprechen<br />
vorhersagen. Bei Angiosarkomen bildeten<br />
mehrere retrospektive Serien und die<br />
genetische Profilierung von Patienten,<br />
die Signaturen häufiger UV-Läsionen in<br />
den Hautuntertypen identifizierten, die<br />
Grundlage für eine Expansionskohorte<br />
in der doppelten Anti-CTLA-4- und<br />
Anti-PD1-Blockade. Bei 16 auswertbaren<br />
Patienten lag die Gesamtansprechrate bei<br />
25 Prozent, aber 3 von 5 Patienten mit<br />
primärem kutanem Angiosarkom der<br />
Kopf- und Gesichtshaut erreichten ein<br />
bestätigtes Ansprechen mit einer sechsmonatigen<br />
progressionsfreien Überlebensrate<br />
von 38 Prozent.<br />
Zuverlässige Vorhersagen<br />
Diese klinischen Entwicklungen laufen<br />
natürlich parallel zu biologischen Studien,<br />
die darauf abzielen, Biomarker für<br />
das Ansprechen zu identifizieren. Der<br />
PD1/PDL1-Spiegel in Tumorzellen oder<br />
der Immunmikroumgebung ist bislang<br />
unzuverlässig, um die Wirksamkeit einer<br />
Immuntherapie vorherzusagen. Dasselbe<br />
gilt für die tumorinfiltrierenden Lymphozyten<br />
(TIL). Offen bleibt auch der prädiktive<br />
Effekt der Tumormutationslast. Dieser<br />
soll bei einer Minderheit der Sarkome<br />
hoch sein. Der bislang vielversprechendste<br />
Biomarker ist mit dem Vorhandensein<br />
von tertiären lymphoiden Strukturen,<br />
den sogenannten TLS, in der Tumormikroumgebung<br />
verbunden. Eine Studie, in<br />
welcher Pembrolizumab mit metronomischem<br />
Cyclophosphamid kombiniert<br />
wurde, wies einen Anstieg der objektiven<br />
Ansprechrate um bis zu 30 Prozent auf,<br />
wenn die Patienten aufgrund des Vorhandenseins<br />
von TLS ausgewählt wurden.<br />
Auch wenn letztendlich nur eine Minderheit<br />
der Sarkompatienten von einer<br />
Immuntherapie profitieren kann, ist es<br />
angesichts der Schwere dieser Erkrankung<br />
unerlässlich, dass wir unsere Bemühungen<br />
fortsetzen, um diese Patienten zu<br />
identifizieren und ihnen die wirksamste<br />
auf sie zugeschnittene Behandlung, die in<br />
eine globale Therapiestrategie integriert<br />
ist, anzubieten.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 49
Privat<br />
Hausrat<br />
Privathaftpflicht<br />
Rechtsschutz<br />
Gebäude<br />
Wertsachen / Kunst<br />
Motorfahrzeug<br />
Ausland / Expat<br />
Reise / Assistance<br />
Krankenkasse<br />
Taggeld<br />
Unfall<br />
Leben<br />
Stellenunterbruch<br />
Beruf<br />
Arztpraxis<br />
Gebäude<br />
Berufshaftpflicht<br />
Rechtsschutz<br />
Cyber<br />
Taggeld<br />
Unfall<br />
Nutzen Sie unsere Kooperationspartner<br />
und profitieren Sie von den Vorteilen<br />
und Rabatten:<br />
– Allianz Suisse<br />
– AXA-ARAG<br />
– Concordia<br />
– Helvetia<br />
– Innova<br />
– ÖKK<br />
– Schweizerische Ärzte-Krankenkasse<br />
– Swica<br />
– Versicherung der Schweizer Ärzte<br />
Genossenschaft<br />
– Visana<br />
– ZURICH<br />
Falls Sie bereits eine Versicherung bei<br />
einer der oben genannten Versicherungen<br />
besitzen, dann prüfen Sie einen<br />
Übertritt in unsere Kollektivverträge.<br />
Wir unterstützen Sie gerne dabei.<br />
Exklusive Lösungen für mediservice <strong>vsao</strong>-asmac-Mitglieder<br />
031 350 44 22 – wir sind für Sie da.<br />
info@mediservice-<strong>vsao</strong>.ch, www.mediservice-<strong>vsao</strong>.ch
Perspektiven<br />
Aus der «Praxis»*<br />
Die Gicht und ihr<br />
Management in der<br />
Praxis<br />
Thomas Langenegger 1 , Andreas Krebs 2 , Thomas Rosemann 3 , Thomas Hügle 4<br />
und Johannes von Kempis 5<br />
Hintergrund<br />
Bei der Gicht kommt es als Folge eines anhaltend<br />
erhöhten Serumharnsäurespiegels<br />
zu Ablagerungen von Harnsäurekristallen,<br />
bevorzugt in Gelenken, aber auch<br />
in vielen anderen Geweben wie z. B. Bursae,<br />
Sehnen und Nieren. Epidemiologischen<br />
Studien zufolge stellt die Gicht eine<br />
verbreitete Erkrankung dar, deren Prävalenz<br />
– je nach Land – bei 0,9–2,5 % liegt<br />
[1–3]. Männer sind dabei deutlich häu figer<br />
betroffen als Frauen und die Prävalenz<br />
steigt mit zunehmendem Alter [3]. Daten<br />
aus Grossbritannien und Ita lien machen<br />
deutlich, dass sowohl die Prävalenz als<br />
auch die Inzidenz der Gicht in den vergangenen<br />
Jahren deutlich zugenommen hat<br />
[3]. Eine Hyperurikämie, mit oder ohne<br />
Kristallablagerungen, geht mit einem erhöhten<br />
Risiko für die Entwicklung renaler,<br />
kardiovaskulärer und metabolischer Komplikationen<br />
sowie einer erhöhten kardiovaskulären<br />
und Gesamtmortalität einher<br />
[4, 5]. Anhand einer für die amerikanische<br />
Bevölkerung repräsentativen Stichprobe<br />
konnte gezeigt werden, dass bei Patienten<br />
1<br />
Medizinische Klinik, Zuger Kantonsspital AG,<br />
Baar<br />
2<br />
Rheumatologische Praxis, Kloten und Klinik für<br />
Rheumatologie, Universitätsspital Zürich<br />
3<br />
Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich<br />
4<br />
Service de rhumatologie, Centre hospitalier<br />
universitaire vaudois (CHUV), Lausanne<br />
5<br />
Klinik für Rheumatologie, Kantonsspital<br />
St. Gallen<br />
* Der Artikel erschien ursprünglich in der «Praxis»<br />
(2020; 109 [6] 439–445). mediservice <strong>vsao</strong>-<br />
Mitglieder können die «Praxis» zu äusserst<br />
günstigen Konditionen abonnieren. Details<br />
s. unter www.hogrefe.ch/downloads/<strong>vsao</strong>.<br />
mit einem Serumharnsäurespiegel in der<br />
höchsten Kategorie (≥600 µmol/l) häufig<br />
Komorbiditäten wie eine chronische Niereninsuffizienz<br />
≥ Stadium 2 (bei 86 %), eine<br />
Hypertonie (66 %), eine Adipositas (65 %),<br />
eine Herzinsuffizienz oder ein Diabetes (je<br />
33 %) bestanden und die Inzidenz von<br />
Myokardinfarkten oder Apolexen erhöht<br />
war (23 bzw. 12 %) [6]. Nicht zuletzt ist erwähnenswert,<br />
dass eine Gichterkrankung<br />
mit erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität<br />
einhergeht [7]. Unter diesen<br />
Gesichtspunkten kommt dem adäquaten<br />
Management der Hyperurikämie bei<br />
Gichtpatienten, neben der Behandlung<br />
der akuten Gichtattacke, eine grosse Bedeutung<br />
zu.<br />
Diagnose der akuten Gichtattacke<br />
In den meisten Fällen präsentieren sich<br />
Gichtpatienten mit einer akuten Monarthritis;<br />
in 50 % der Fälle ist das Grosszehengrundgelenk<br />
(Podagra) betroffen (Abbildung<br />
1). Aber auch das Knie sowie das<br />
obere Sprunggelenk stellen klas sische<br />
Gicht-Lokalisationen dar (in 10–15 % der<br />
Fälle). Klinisch zeigt sich neben der Arthritis<br />
häufig eine ausge prägte periartikuläre<br />
Schwellung und Rötung, sodass die<br />
Abgrenzung zu einem Infekt (septische<br />
Arthritis oder Erysipel) in der Praxis oft<br />
schwierig ist (Abbildung 2). Als diagnostischer<br />
Goldstandard bei Gicht wird der<br />
Nachweis der Kristalle in der Gelenksflüssigkeit<br />
durch die Polarisationsmikroskopie<br />
angegeben, wobei die Sensitivität des<br />
Kristallnachweises sehr laborabhängig ist<br />
und zwischen 60 und 80 % liegt [8–10]. Die<br />
Gelenkspunktion dient gleichzeitig auch<br />
Abbildung 1. Akuter Gichtanfall eines Grosszehengrundgelenks.<br />
zum Ausschluss einer septischen Arthritis.<br />
Im Wei teren können bildgebende Verfahren<br />
diagnostisch hilfreich sein. Dabei<br />
ist vor allem der hochauflösende Ultraschall<br />
(typische Doppelkonturen) von<br />
Nutzen (Abbildung 3). In diagnostisch unklaren<br />
Situationen, vor allem bei längerer<br />
Krankheitsdauer, kann die Dual-Energy-Computertomografie<br />
(DECT) Uratablagerungen<br />
abbilden (Abbildung 4). Das<br />
konventionelle Röntgen spielt bei der akuten<br />
Gicht keine Rolle, kann aber beim Vorliegen<br />
einer chronisch tophösen Gicht<br />
spezifische Destruktionen (z. B. Erosionen<br />
in Form von «Overhanging Edges») darstellen.<br />
Von der EULAR (European League<br />
Against Rheumatism) und dem ACR<br />
(American College of Rheumatology) wurden<br />
gemeinsam verschiedene klinische<br />
Parameter definiert, die im Alltag die Diagnose<br />
einer Gicht ohne Mikroskopie ermöglichen<br />
sollen. Allerdings weisen diese<br />
Kriterien eine geringere Sensitivität und<br />
Spezifität auf als der Kristallnachweis [11].<br />
Die EULAR empfiehlt in ihren aktuellen<br />
Richtlinien, dass jeder Gichtpatient zu-<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 51
Perspektiven<br />
Medikamente sind in der Indikation akutem<br />
Gichtschub off-label und bedürfen<br />
einer Kostengutsprache der Krankenkasse.<br />
Die Wahl des oralen Medikaments sollte<br />
auf allfällig vorliegenden Kontraindikationen,<br />
den Erfahrungen des Pa tienten bei<br />
früheren At tacken, der Zeit seit Beginn der<br />
Attacke und der Anzahl und Art der betroffenen<br />
Gelenke basieren [12].<br />
Abbildung 2. Beispiele einer Gicht-Oligoarthritis<br />
der Hand. Klinisch imponiert jeweils eine<br />
starke Weichteilschwellung und -Rötung im<br />
Bereich des Handrückens, die leicht mit einem<br />
Erysipel verwechselt werden kann. Im Ultraschall<br />
zeigte sich bei beiden Patienten jeweils<br />
eine MCP- und PIP-Arthritis. Im unteren Bild ist<br />
eine tophöse Gicht zu sehen; im Aspirat<br />
Nachweis von Tophusmaterial voller Uratkristalle<br />
(Bildausschnitt).<br />
dem systematisch auf das Vorliegen assoziierter<br />
Komorbiditäten und kardiovaskulärer<br />
Risikofaktoren untersucht werden<br />
sollte [12].<br />
Management der akuten Gichtattacke<br />
Eine akute Gichtattacke sollte möglichst<br />
rasch nach Auftreten der ersten Symptome<br />
pharmakologisch behandelt werden<br />
[8]. Aktuelle Richtlinien empfehlen dazu<br />
nicht-stero idale Antirheumatika (NSAR),<br />
perorale Steroide in einer Dosierung von<br />
20–40 mg Prednisonäquivalent für 3–6<br />
Tage oder Colchizin 6 [8, 12]. Die Infiltration<br />
von Kor tikoiden ist bei der Gicht-Monarthritis<br />
besonders schnell hilfreich und<br />
kann auch bei dem Podagra durchgeführt<br />
werden. Sind NSAR, Steroide und Colchizin<br />
6 kontraindiziert, wie z. B. bei Diabetikern<br />
mit fortgeschrittener Niereninsuffizienz,<br />
kann in Zusammenarbeit mit einem<br />
Rheumatologen ausnahmsweise off-label<br />
ein Interleukin-1-Hemmer (Anakinra oder<br />
Canakinumab) subkutan eingesetzt werden<br />
[12]. Canakinumab (Ilaris®) ist in der<br />
Schweiz zur Behandlung von sel tenen periodischen<br />
Fiebersymptomen zugelassen;<br />
Anakinra (Kineret®) jedoch nicht. Beide<br />
6<br />
In der Schweiz nicht zugelassen,<br />
über Apotheken erhältlich.<br />
Management der Hyperurikämie<br />
Nicht-medikamentöse Massnahmen<br />
Verschiedene Arbeiten zeigten, dass Lebensstil-<br />
und Ernährungsfaktoren das Risiko<br />
für das Entstehen einer Hyperurikämie<br />
bzw. Gicht beeinflussen [13]. Deshalb<br />
sollte das Management der Patienten<br />
neben den medikamen tösen auch<br />
nicht-medikamentöse Massnahmen beinhalten.<br />
Internationale Richtlinien empfehlen<br />
in diesem Zusammenhang, dass<br />
Patienten mit Hyperurikämie/Gicht ihren<br />
Konsum von purinreichen Nahrungsmitteln<br />
wie Fleisch oder Meeresfrüchte einschränken<br />
und als Proteinquellen fettreduzierte<br />
Milchprodukte bevorzugen sollten<br />
[12, 14]. Auch sollte möglichst auf Alkohol<br />
(v. a. Bier und Spiri tuosen) und<br />
fruktosehaltige Süssgetränke sowie<br />
Fruchtsäfte verzichtet, dafür aber genügend<br />
Wasser getrunken werden. Regelmässigem<br />
Kaffeekonsum und Kirschsaft<br />
wird ein protektiver Effekt zugeschrieben.<br />
Bei Adipositas ist eine Reduktionsdiät<br />
sinnvoll. Allerdings kann mit nicht-medikamentösen<br />
Massnahmen allein die Harnsäure<br />
meist nicht um mehr als 100 µmol/l<br />
gesenkt werden. In Anbetracht der hohen<br />
Prävalenz kardiovaskulärer Erkrankungen<br />
bei Gichtpatienten sind Lebensstilund<br />
Ernährungsmodifikationen gleichzeitig<br />
auch als Teil der kardiovaskulären<br />
Prävention anzusehen.<br />
Medikamentöse Therapie<br />
der Hyperurikämie<br />
Therapieindikation und Zielwert<br />
Die EULAR empfiehlt, bei jedem Patienten<br />
mit definitiver Gichtdiagnose den Einsatz<br />
einer harnsäuresenkenden Therapie<br />
(ULT, Urate-Lowering Therapy) in Betracht<br />
zu ziehen und mit den Betroffenen<br />
zu diskutieren [12]. Eine ULT ist auf jeden<br />
Fall indiziert bei Patienten mit zwei oder<br />
mehr Gichtanfällen pro Jahr sowie bei<br />
Vorliegen von Tophi, einer Urat-Arthropathie<br />
und/oder Nierensteinen. Zielwert der<br />
Therapie ist ein Serumharnsäurespiegel<br />
von
Perspektiven<br />
reich behandelten Gichtpatienten kam es<br />
in einer Langzeitstudie innerhalb von fünf<br />
Jahren zu einem Rezidiv [15]. Es ist besonders<br />
wichtig, die Patienten darauf hinzuweisen,<br />
dass das Einleiten einer ULT akute<br />
Attacken auslösen kann [8]. Solche Attacken<br />
treten in den ersten drei Monaten der<br />
Therapie am häufigsten auf, sind aber<br />
über einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten<br />
möglich. Daher wird für die ersten<br />
drei bis sechs Monate einer ULT der<br />
Einsatz einer Prophylaxe mit NSAR,<br />
Colchizin 6 (0,5–1 mg täglich) oder niedrig<br />
dosierten Kortikoiden empfohlen [8].<br />
Colchizin kann über die internationale<br />
Apotheke bezogen werden, da es regulär<br />
leider in der Schweiz nicht mehr erhältlich<br />
ist. Eine Dosisanpassung bei Nieren- und<br />
Leberinsuffizienz ist notwendig. Cave: Interaktion<br />
mit Hemmern des Cytochrom<br />
3A4 wie Proteaseinhibitoren, Calciumantagonisten<br />
und Antimykotika Typ Triazole.<br />
Selten, aber potenziell gefährliche Nebenwirkungen<br />
sind Hepato-, Myot- und<br />
Myleotoxozität. Durch eine schrittweise<br />
Erhöhung der ULT-Dosis kann möglicherweise<br />
die Anfallsrate reduziert und bei Allopurinol<br />
auch das Auftreten von allergischen<br />
Nebenwirkungen vermindert werden<br />
[16].<br />
Xanthinoxidase-Hemmer<br />
In aktuellen Therapierichtlinien wird als<br />
Erstlinien-ULT ein Xanthinoxidasehemmer<br />
(Allopurinol, Febuxostat) empfohlen<br />
[8, 12, 14]. Während die ACR Allopurinol<br />
und Febuxostat als gleichwertige Optionen<br />
beurteilt, gibt die EULAR bei Patienten<br />
ohne eingeschränkte Nierenfunk tion<br />
Allopurinol den Vorzug. Die Startdosis<br />
von Allopu rinol liegt bei 100 mg/Tag, sie<br />
sollte alle zwei bis fünf Wochen um<br />
100 mg/Tag erhöht werden, bis der Harnsäurezielwert<br />
erreicht ist [8]. Entgegen<br />
einer weit verbreiteten Meinung liegt<br />
die maximal mögliche Allopurinol-Dosis<br />
nicht bei 300 mg/Tag. Untersuchungen<br />
haben gezeigt, dass weniger als 50 % der<br />
Patienten den Serumharnsäurezielwert<br />
mit einer Allopurinol-Dosis von 300 mg/<br />
Tag erreichen [17]. Falls notwendig, sollte<br />
und kann daher bei Patienten, bei denen<br />
keine Einschränkung der Nierenfunktion<br />
vorliegt, die Allopurinol-Dosis langsam<br />
auf bis zu 900 mg gesteigert werden, dies<br />
stets unter engmaschiger Kontrolle [8].<br />
Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion<br />
sollte die Allopurinol-Dosis<br />
der Kreatinin-Clearance angepasst werden<br />
[12]. Sollte sich die Nierenfunk tion unter<br />
der Allopurinol-Therapie verbessern,<br />
Zusammenfassung<br />
Bei Gicht steht im klinischen Alltag meist die akute Attacke im Vordergrund. Als diagnostischer<br />
Goldstandard gilt dabei der Kristallnachweis in der Gelenksflüssigkeit mittels<br />
Polarisationsmikroskopie. Auch bildgebende Verfahren wie der hochauflösende Ultraschall<br />
sind von Nutzen. Zur Behandlung der akuten Gichtattacke dienen nicht-steroidale<br />
Antirheumatika, Steroide und Colchizin (in der Schweiz nicht zugelassen, über Apotheken<br />
erhältlich). Ebenso wichtig wie Diagnose und Therapie der akuten Attacke ist aber<br />
die langfristige Behandlung der Hyperurikämie, um so weitere Gichtschübe sowie mögliche<br />
renale, kardiale oder metabolische Komplikationen zu verhindern. Daher sollte bei<br />
bestätigter Gichtdiagnose neben nicht-medikamentösen Massnahmen auch eine harnsäuresenkende<br />
Therapie, mit dem Zielwert von
Perspektiven<br />
Urikosurika<br />
In den aktuellen Richtlinien werden Urikosurika<br />
(Pro Urikosurikaeh benecid, Lesinurad<br />
7 ) als Zweitlinientherapie empfohlen,<br />
allein oder in Kombination mit Allopurinol<br />
[8, 12]. Da sie die Harnsäure-Ausscheidung<br />
über die Niere fördern, sollten<br />
sie bei Patienten mit einem Nierenstein in<br />
der Anamnese nicht eingesetzt werden<br />
[8, 14]. Zu Beginn beträgt die empfohlene<br />
Tagesdosis von Probenecid 2 × 250 mg,<br />
nach einer Woche 2 × 500 mg. Lesinurad ist<br />
in Kombination mit Allopurinol indiziert,<br />
falls die Serumharnsäure-Zielwerte mit Allopurinol<br />
allein nicht erreicht werden [24].<br />
Die empfohlene Dosis von Lesinurad beträgt<br />
200 mg 1 × täglich (morgens), nur in<br />
Kombination mit Allopurinol.<br />
7<br />
Lesinurad ist in der Schweiz nicht mehr<br />
verfügbar.<br />
Key messages<br />
– Gichtpatienten sollten auch auf<br />
das Vorliegen renaler, kardialer<br />
und metabolischer Erkrankungen<br />
untersuchtwerden.<br />
– Akute Gichtattacken können primär<br />
mit nicht-steroidalen Antirheumatika,<br />
Steroiden und Colchizin<br />
6 behandelt werden.<br />
– Bei definitiver Gichtdiagnose und<br />
gescheiterten Lifestyle-Modifikationen<br />
sollte eine harnsäuresenkende<br />
Therapie, mit dem Zielwert von<br />
Perspektiven<br />
der Adhärenz [12]. Gichtpatienten sollten<br />
ihren aktuellen und vor allem auch den<br />
angestrebten Harnsäurewert kennen, so<br />
wie praktisch jeder Hypertoniker über seinen<br />
Blutdruck oder jeder Diabetiker über<br />
den Blutzuckerwert Bescheid weiss. Untersuchungen<br />
konnten zeigen, dass durch<br />
eine individualisierte Patienteninformation<br />
und den Einbezug des Pa tienten in<br />
Therapieentscheide eine sehr gute Adhärenz<br />
und Persistenz mit der Therapie über<br />
einen längeren Zeitraum erreicht werden<br />
kann [32].<br />
Fazit<br />
Das Spektrum der Gicht reicht von der einmaligen<br />
Monarthritis bis hin zur chronischen,<br />
schwerwiegenden Erkrankung. Sie<br />
ist mit teilweise massiven Einschränkungen<br />
der Lebensqualität, renalem Funktionsverlust<br />
und erhöhter kardiovaskulärer<br />
Morbidität und Mortalität assoziiert. Sie<br />
lässt sich jedoch – bis auf wenige Ausnahmen<br />
– gut behandeln. Neben der Therapie<br />
der akuten Attacke gehört die langfristige<br />
Senkung des Serumharnsäurespiegels auf<br />
einen Wert von
Perspektiven<br />
Literatur (Fortsetzung)<br />
[23] Fachinformation<br />
Adenuric ® (Febuxostat). www.<br />
swissmedicinfo.ch; letzter<br />
Zugriff: 24.02.2020.<br />
[24] Fachinformation<br />
Zurampic ® (Lesinurad). www.<br />
swissmedicinfo.ch; letzter<br />
Zugriff: 24.02.2020.<br />
[25] Annemans L,<br />
Spaepen E, Gaskin M, et al.:<br />
Gout in the UK and Germany:<br />
prevalence, comorbidities and<br />
management in general<br />
practice 2000–2005. Ann<br />
Rheum Dis 2008; 67: 960–966.<br />
[26] Roddy E, Zhang W,<br />
Doherty M: Concordance of<br />
the management of chronic<br />
gout in a UK primary-care<br />
population with the EULAR<br />
gout recommendations. Ann<br />
Rheum Dis 2007; 66: 1311–1315.<br />
[27] Harrold LR, Mazor<br />
KM, Negron A, Ogarek J, et al.:<br />
Primary care providers’<br />
knowledge, beliefs and<br />
treatment practices for gout:<br />
results of a physician<br />
questionnaire. Rheumatology<br />
(Oxford) 2013; 52: 1623–1629.<br />
[28] Kuo CF, Grainge<br />
MJ, Mallen C, et al.: Eligibility<br />
for and prescription of<br />
urate-lowering treatment in<br />
patients with incident gout in<br />
England. JAMA 2014; 312:<br />
2684–2686.<br />
[29] Cottrell E, Crabtree<br />
V, Edwards JJ, Roddy E:<br />
Improvement in the<br />
management of gout is vital<br />
and overdue: an audit from<br />
a UK primary care medical<br />
practice. BMC Family Practice<br />
2013;14: 170.<br />
[30] Yin R, Li L, Zhang<br />
G, et al.: Rate of adherence to<br />
urate-lowering therapy among<br />
patients with gout: a<br />
systematic review and<br />
meta-analysis. BMJ Open<br />
2018; 8: e017542.<br />
[31] Khanna PP,<br />
Shiozawa A, Walker V, et al.:<br />
Health-related quality of life<br />
and treatment satisfaction in<br />
patients with gout: results<br />
from a cross-sectional study in<br />
a managed care setting.<br />
Patient Prefer Adherence 2015;<br />
9: 971–981.<br />
[32] Abhishek A,<br />
Jenkins W, La-Crette J,<br />
Fernandes G, et al.: Long-term<br />
persistence and adherence on<br />
urate-lowering treatment can<br />
be maintained in primary<br />
care-5-year follow-up of a<br />
proof-of-concept study.<br />
Rheumatology (Oxford) 2017;<br />
56: 529–533.<br />
Im Artikel verwendete Abkürzungen<br />
ACR American College of Rheumatology<br />
DECT Dual-Energy-Computertomografie<br />
EULAR European League Against Rheumatism<br />
NSAR Nicht-steroidales Antirheumatikum<br />
ULT Harnsäuresenkende Therapie<br />
(Urate-Lowering Therapy)<br />
Manuskript eingereicht: 12.11.2019<br />
Manuskript akzeptiert: 20.01.2020<br />
Interessenskonflikt: Der Autor ist Referent und<br />
Advisor der Firma Menarini.<br />
Dr. med. Thomas Langenegger<br />
Leitender Arzt Rheumatologie/Osteoporose<br />
Medizinische Klinik<br />
Zuger Kantonsspital AG<br />
Landhausstrasse 1<br />
6340 Baar<br />
thomas.langenegger@zgks.ch<br />
Antworten zu den Lernfragen:<br />
1. Antworten a) und c) sind korrekt.<br />
2. Antworten b) und c) sind korrekt.<br />
3. Alle Antworten sind korrekt.<br />
Anzeige<br />
Lachen und Träume für unsere Kinder im Spital<br />
Foto: P.-Y. Massot. Anzeige offeriert.<br />
Jede Woche erhalten die Kinder im Spital Besuch<br />
von den Traumdoktoren.<br />
Ihre Spende schenkt Lachen.<br />
PC 10-61645-5<br />
Herzlichen Dank.<br />
56<br />
ZürichseeWerbeAG_190x134_CH-FR-DE-IT.indd 2 6/22 <strong>vsao</strong> 24.04.19 /asmac <strong>Journal</strong> 14:02
Perspektiven<br />
Im Einsatz in der Schweiz<br />
Als Notarzt im<br />
Bundeslager<br />
Severin Baerlocher v/o Dito, Assistenzarzt Allgemeine Innere Medizin, Kantonsspital St. Gallen<br />
Bilder: zvg<br />
«Wie? Du gehst in deinen<br />
Ferien zwei Wochen arbeiten?<br />
Im Schichtdienst? Hast<br />
du einen Vogel?» So ähnlich<br />
klang es häufiger, als ich Arbeitskollegen<br />
erklärte, wie ich meine diesjährigen<br />
Sommerferien verbringen würde. Anlass<br />
für meine Ferienpläne und die irritierten<br />
Gesichter war das einmal pro Generation<br />
wiederkehrende Bundeslager (BuLa) der<br />
Schweizer Pfadfinderbewegung. Bereits<br />
im letzten BuLa, vor 14 Jahren, war für<br />
mich klar, dass ich mich im nächsten als<br />
Arzt engagieren würde. Und siehe da,<br />
<strong>2022</strong> fand ich mich im schönen Wallis<br />
wieder, genauer im Goms, im bislang<br />
grössten Pfadilager, das die Schweiz je<br />
gesehen hatte. Innert vier Wochen wurde<br />
eine Zeltstadt für 35 000 Bewohner aufund<br />
abgebaut, mit allem, was dazugehört:<br />
Post, Zeitung, Radio, Logistikzentrum,<br />
Funkstation, Kneipen und Cafés. Sogar<br />
eine Sauna wurde erstellt und natürlich<br />
die örtliche Notfallklinik.<br />
Der St. Galler Hausarzt Raphael Stolz<br />
organisierte und plante die Notfallstation<br />
und koordinierte zusammen mit Evelyn<br />
Dähler die mehr als 70 Ärztinnen und<br />
Ärzte, welche alle auf freiwilliger Basis<br />
Pfadis und Wölflis verarzteten. Gerüstet<br />
waren wir für fast alles, auch dank der<br />
Hilfe der Schweizer Armee und der Initiative<br />
von Privaten: Es wurde geröntgt,<br />
im Schockraum wurden Anaphylaxien<br />
versorgt und in rund 20 Kojen kleine<br />
und grosse Bobos behandeltt.<br />
Da man in einem Lager, das sich<br />
über fünf Kilometer Länge erstreckte,<br />
nicht davon ausgehen konnte, dass alle<br />
den Weg zur Notfallpraxis selbständig<br />
schaffen würden, gab es einen kompletten<br />
Rettungsdienst. Rapid Responder auf<br />
Quads eilten den Kranken oder Verletzten<br />
als Erste zu Hilfe, und wie in der übrigen<br />
Schweiz wurden je nach Alarmierungstext<br />
Rettungssanitäter oder direkt ein<br />
Notarzt bzw. eine Notärztin aufgeboten.<br />
Notärzte mit Pfadikrawatten, Dito und Audax – allzeit bereit.<br />
Gravierende Zwischenfälle blieben<br />
zum Glück aus. Das Notarztteam rückte<br />
vorwiegend wegen Krampfanfällen<br />
(meist dissoziativ) und anaphylaktischen<br />
Reaktionen aus.<br />
Das Konzept sah vor, dass die<br />
Rettungs- und Notfalldienste ebenfalls<br />
der lokalen Bevölkerung zur Verfügung<br />
stehen und im Ernstfall mit aufgeboten<br />
werden würden. Somit ergab sich ein<br />
buntes Spektrum. Vom jüngsten Lagerteilnehmer,<br />
einem 6-wöchigen Baby, bis<br />
zu den ältesten Pfadfindern in den fortgeschrittenen<br />
80ern mussten wir mit allem<br />
rechnen. Und dank täglich 5000–7000<br />
Besucherinnen und Besuchern sahen<br />
wir Krankheitsbilder, die man sonst im<br />
Zentrumsspital zu Gesicht bekommt.<br />
Zu den stressigen Höhepunkten<br />
gehörten die Zeremonien, zu denen sich<br />
gegen 20000 Pfadfinder und Pfadfinderinnen<br />
vor der Hauptbühne versammelten.<br />
Erfreulicherweise blieb es auch<br />
während dieser Darbietungen ruhig;<br />
Pfadis feiern eben anders als die uns<br />
bekannten Openairgäste. Und das Feierabendbier<br />
für einen Teil des Leitungsteams<br />
gab es erst dann, wenn die jüngeren<br />
Teilnehmenden im Schlafsack lagen.<br />
Bereitschaftsdienst an den Zeremonien.<br />
Hier die Eröffnungsfeierlichkeiten.<br />
Und so blieben uns, nach rund 5000<br />
Konsultationen, zwei Wochen, die sich<br />
meist so gar nicht als Arbeit anfühlten.<br />
Zwei Wochen voller Pfadierinnerungen,<br />
mit neuen Freundschaften aus einem<br />
Superteam und dem Wissen, dass sich<br />
mit der entsprechenden Motivation Berge<br />
versetzen lassen. Bis in 14 Jahren.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 57
mediservice<br />
Briefkasten<br />
Schlüsselverlust – wer<br />
bezahlt die Auswechslung<br />
der Schlösser?<br />
Vor zwei Jahren verlor ich<br />
einen Wohnungsschlüssel.<br />
Beim Auszug aus der<br />
Wohnung verlangt nun der<br />
Vermieter, dass die Schlösser auf<br />
meine Kosten ausgewechselt werden.<br />
Er verweist auf eine Klausel im<br />
Mietvertrag. Darf er das und wie bin<br />
ich versichert?<br />
Grundsätzlich sind Sie aufgrund des<br />
Mietvertrages für jeden Schaden haftpflichtig,<br />
den Sie durch Ihr Verschulden<br />
und durch Nachlässigkeit verursacht<br />
haben. Neben dem Ersatz des verlorenen<br />
Schlüssels kann der Vermieter unter<br />
Umständen auch fordern, dass die<br />
betreffenden Schlösser ausgewechselt<br />
werden.<br />
Ob diese Auswechslung notwendig<br />
ist, muss aufgrund der konkreten Umstände,<br />
unter denen der Wohnungsschlüssel<br />
verloren gegangen ist, geklärt<br />
werden. Falls Sie den Wohnungsschlüssel<br />
in unmittelbarer Umgebung der Wohnung<br />
verloren haben, ist die Gefahr als<br />
erheblich einzuschätzen, dass sich der<br />
Schlüsselfinder mit böswilliger Absicht<br />
früher oder später unbefugten Zutritt<br />
verschafft und Diebstähle begeht. Die<br />
Schlossänderung müsste in diesem Fall<br />
als berechtigtes Anliegen des Vermieters<br />
zur Schadenabwehr bezeichnet werden<br />
und viele Privathaftpflichtversicherungen<br />
bezahlen denn auch die dadurch<br />
entstehenden Kosten, wobei diese je nach<br />
Versicherer betraglich begrenzt sein<br />
können. Von der Leistung kommt zudem<br />
ein vereinbarter Selbstbehalt in Abzug.<br />
Ausserdem kann die Versicherung ihre<br />
Leistungen kürzen, falls ein allzu lasches<br />
Verhalten des Mieters zum Verlust des<br />
Schlüssels geführt hat.<br />
Schlossersatz nicht immer nötig<br />
Hätten Sie den Schlüssel beispielsweise<br />
in Ihren Ferien im Ausland verloren,<br />
so erschiene ein Schlossersatz als unverhältnismässig<br />
und unnötig, falls beim<br />
Schlüssel keine Hinweise auf dessen<br />
Inhaber angebracht waren. In diesem<br />
Fall würde die Privathaftpflichtversicherung<br />
ihrer Rechtsschutzfunktion<br />
nachkommen, indem sie die unberechtigte<br />
Massnahme der Schlossänderung<br />
gegenüber dem Vermieter für Sie ablehnen<br />
und dessen Ansprüche allenfalls auf<br />
den Schlüsselersatz reduzieren würde.<br />
Allerdings können Mietverträge explizit<br />
vorsehen, dass Mieter beim Schlüsselverlust<br />
in jedem Fall für den Ersatz der<br />
Türschlösser aufkommen müssen. Diese<br />
(an sich zulässige) vertragliche Vereinbarung<br />
geht über die normale gesetzliche<br />
Haftpflicht hinaus und bei Ihrer Privathaftpflichtversicherung<br />
besteht demzufolge<br />
keine Deckung: Ihr Versicherer<br />
würde in einem solchen Fall keine<br />
Leistung für den Ersatz der Türschlösser<br />
erbringen.<br />
Bei Haftpflicht zählt der Zeitwert<br />
Für Sie ist zudem wichtig zu wissen,<br />
dass im Haftpflichtrecht nicht der<br />
Neuwert, sondern lediglich der Zeitwert<br />
geschuldet ist. Gemeint ist damit der<br />
Wert der Sache unter Berücksichtigung<br />
des Alters und der Abnutzung zum<br />
Zeitpunkt des Schadens. In diesem Fall<br />
können Sie dem Vermieter also je nach<br />
Alter des Türschlosses die Amortisation<br />
entgegenhalten. Bei einem Türschloss<br />
geht man von einer Lebensdauer von<br />
rund 25 Jahren aus. Ist das Schloss<br />
beispielsweise 13 Jahre alt, wenn es<br />
ausgetauscht werden muss, schulden Sie<br />
dem Vermieter lediglich die Hälfte der<br />
anfallenden Kosten.<br />
(Quelle: Versicherungsratgeber ASA/SVV)<br />
Bild: Adobe Stock<br />
58<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Ich möchte<br />
eine gute<br />
Weiterbildung<br />
und<br />
Zeit dafür.<br />
Geht das?<br />
Das geht!<br />
Gemeinsam machen<br />
wir es möglich!<br />
Wir helfen auf dem Weg zum Facharzttitel.<br />
JETZT AUF VSAO.CH MITGLIED WERDEN!
mediservice<br />
Versicherungsschutz<br />
im Netz – auch für Private<br />
Auch Privatpersonen können gehackt, im Internet betrogen<br />
oder bestohlen werden. Dies sind die grössten Risiken – und so lassen<br />
sie sich absichern.<br />
Marco Feuz, Produktmanager Haushaltversicherung bei Zurich Schweiz<br />
Ein Buch im Netz bestellen, einen<br />
Begriff googeln oder die<br />
Onlineausgabe der Tageszeitung<br />
lesen – das Internet ist für<br />
die meisten Menschen fester Bestandteil<br />
ihres Alltags. 89 Prozent der Schweizer<br />
Bevölkerung ab 14 Jahren nutzten 2020<br />
laut Bundesamt für Statistik regelmässig<br />
das Internet. In den Altersgruppen unter<br />
50 Jahren sind es annähernd 100 Prozent,<br />
doch auch bei den Menschen über<br />
70 gehen noch 53 Prozent regelmässig<br />
online.<br />
Jeder Ausflug ins Internet birgt<br />
Risiken<br />
Was vielen kaum noch bewusst ist: Jedes<br />
Mal, wenn jemand sich im Internet bewegt,<br />
baut er eine Verbindung zu anderen<br />
Computern auf und vernetzt sein Gerät<br />
mit der Aussenwelt, sei es via Laptop, Tablet<br />
oder Smartphone. Doch beim Surfen<br />
im World Wide Web können einem auch<br />
Haie begegnen – Cyberkriminelle haben<br />
das Netz längst als lukrative Geldquelle<br />
entdeckt und greifen neben Firmen auch<br />
Privatpersonen an.<br />
Gefahren durch Viren, Betrug oder<br />
virtuellen Diebstahl<br />
Hat man sich einen Computervirus eingefangen,<br />
braucht es meistens einen Experten.<br />
Dieser entfernt die Schadsoftware,<br />
setzt die Programme neu auf und<br />
kann hoffentlich die persönlichen Daten<br />
aus dem Backup rekonstruieren. Auch das<br />
Onlineshopping ist nicht ohne Risiken.<br />
Zum Beispiel kann es passieren, dass online<br />
bestellte Produkte beschädigt oder<br />
gar nicht geliefert werden. Beim Buchen<br />
einer Ferienunterkunft übers Internet<br />
Bilder: Adobe Stock; zvg<br />
60<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
mediservice<br />
kommt es zuweilen ebenso zu unliebsamen<br />
Überraschungen, wenn sich das Versprochene<br />
vor Ort als Täuschung erweist.<br />
Noch dramatischer kann es werden, wenn<br />
ein Hacker sich Zugang zum E-Banking<br />
verschafft hat und sich einen grösseren<br />
Geldbetrag vom Konto überweist, der<br />
dann in den Weiten des Internets verschwindet.<br />
Fünf Tipps für mehr Sicherheit<br />
1. Halten Sie Ihr Betriebssystem auf dem<br />
aktuellsten Stand – weil Hacker oft über<br />
Schwachstellen in der Software angreifen.<br />
2. Installieren Sie Antivirenprogramme,<br />
die Schadsoftware erkennen und blockieren.<br />
3. Verwenden Sie intelligente Passwörter,<br />
die z.B. Sonderzeichen enthalten, Zahlen<br />
und Buchstaben kombinieren, mindestens<br />
acht Zeichen haben und in denen<br />
der eigene Name nicht vorkommt.<br />
4. Sensibilisieren Sie alle Familienmitglieder<br />
und klären Sie auch Ihre Kinder<br />
z.B. über Phishing auf. Denn Menschen<br />
sind das Einfallstor für fast alle Cyberattacken.<br />
5. Erstellen Sie regelmässig ein Backup<br />
aller wichtigen Daten, z.B. auf einer externen<br />
Festplatte. Banal, aber wichtig:<br />
Das Backup sollte stets vom Netz genommen<br />
werden, damit es dem Virus<br />
nicht ebenfalls zum Opfer fällt.<br />
Zwei neue Cyberversicherungen von Zurich<br />
Versicherungsschutz bei Hackerangriffen und Schadsoftware<br />
Die neue Versicherung «Cyber Safe Surf» bietet eine finanzielle Absicherung gegen<br />
die Folgen von Hackerattacken und Schadsoftware. Zurich übernimmt die Kosten für<br />
die Entfernung der Schadsoftware, das Neuaufsetzen der Programme und die Wiederherstellung<br />
der Daten aus dem Backup. Die Versicherungssumme ist pauschal auf<br />
3000 Franken festgelegt. Die Prämie für die Versicherung «Cyber Safe Surf» beträgt<br />
39 Franken pro Jahr.<br />
Versicherungsschutz bei Onlineshopping und missbräuchlichem Kontozugriff<br />
Die «Cyber Safe Shop & Pay»-Versicherung greift, wenn beispielsweise ein Hacker<br />
via E-Banking das Konto leerräumt, wenn online bestellte Waren beschädigt oder gar<br />
nicht geliefert werden oder wenn es bei der Onlinebuchung einer Ferienunterkunft<br />
zum Betrug kommt. Die Standard-Versicherungssumme beträgt 10000 Franken. Und die<br />
Jahresprämie beträgt 39 Franken. Optional lassen sich auch höhere Summen absichern.<br />
mediservice<br />
<strong>vsao</strong>-Mitglieder<br />
profitieren bei Zurich von Vorzugskonditionen.<br />
So schnell und einfach kommen Sie zu<br />
ausgezeichnetem Service und attraktiven<br />
Preisen:<br />
zurich.ch/de/partner/login<br />
Ihr Zugangscode: TqYy4Ucx<br />
0800 33 88 33<br />
Montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr<br />
Bitte erwähnen Sie Ihre mediservice<br />
<strong>vsao</strong>-Mitgliedschaft.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 61
mediservice<br />
Digitale Transformation<br />
im Gesundheitswesen<br />
Was vor wenigen Jahren noch nach Science-Fiction klang, ist heute Alltag:<br />
Die künstliche Intelligenz (KI) dringt in alle Lebensbereiche vor.<br />
Und verändert damit die Art, wie wir arbeiten und leben, als Individuen und<br />
als Gesellschaft. Was bringt KI für die Medizin?<br />
Dieter J. Tschan, lic. oec. HSG, Nimeda Consulting GmbH; Dr. Jörg Tschan, Oralchirurge, Nimeda Consulting GmbH<br />
Die digitale Transformation hat<br />
auch im medizinischen Bereich<br />
den Alltag erreicht.<br />
Längst reicht es nicht mehr<br />
aus – falls überhaupt – im Wartezimmer<br />
einen Gratis-WLAN-Zugang zur Verfügung<br />
zu stellen. Das ist mittlerweile guter<br />
Standard in fast jeder Praxis.<br />
Im folgenden Artikel werden deshalb<br />
einige (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)<br />
digitale Möglichkeiten für Privatpraxen im<br />
Gesundheitswesen skizziert; mit einem<br />
speziellen Fokus auf Artificial Intelligence<br />
bzw. künstliche Intelligenz (AI oder KI).<br />
Altes Bedürfnis – neue Lösung<br />
Die Kernaussage, dass der Mensch zur Erledigung<br />
der Arbeitsleistung auf technologische<br />
Unterstützung setzt, um die Arbeit<br />
besser, schneller, effizienter und weniger<br />
anstrengend zu erledigen, ist heute so<br />
wahr wie anno dazumal.<br />
Zur Illustration sei hier das Waschen<br />
der Kleider genannt: Obwohl man auch<br />
heute noch die Kleider im Fluss waschen<br />
könnte (sofern es denn noch erlaubt wäre),<br />
macht man das doch viel lieber mit der<br />
Waschmaschine. Das Grundbedürfnis<br />
nach sauberer Kleidung bleibt gleich, aber<br />
die Art und Weise, wie wir dieses Resultat<br />
erreichen, hat sich in den vergangenen<br />
Jahrhunderten fundamental geändert.<br />
Warum also nicht die Segnungen der<br />
modernen Technologie auch zum Wohle<br />
der eigenen Praxis nutzen? Neue, digitale<br />
Möglichkeiten ergeben sich nicht nur im<br />
Kernbereich der medizinischen Versorgung,<br />
sondern insbesondere bei der administrativen<br />
Unterstützung. Kleine Verbesserungen<br />
führen nicht nur zu mehr Effizienz,<br />
sondern auch zu mehr Zufriedenheit<br />
der Mitarbeitenden, da lästige, repetitive<br />
und oftmals auch anstrengende oder gefährliche<br />
Tätigkeiten entfallen.<br />
Einige Beispiele, die wir hier nennen können,<br />
sind u.a.<br />
– cloudbasierte Dienste (Onlinekalender,<br />
Zugriff auf Patientendaten beispielsweise<br />
von zu Hause aus bzw. von jedem<br />
anderen Standort aus),<br />
– automatisch generierte Erinnerungen<br />
(beispielsweise per SMS) für Termine,<br />
– moderne Zeiterfassungssysteme für die<br />
Angestellten, welche ein flexibleres Arbeiten<br />
ermöglichen und ganz allgemein<br />
die Möglichkeit, gewisse Arbeiten auch<br />
im Home-Office bzw. dezentral zu erledigen<br />
und somit die zu Verfügung stehende<br />
Arbeitszeit sowie den zu Verfügung stehenden<br />
Arbeitsplatz optimal zu nutzen.<br />
Bild: zvg<br />
62<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
mediservice<br />
Fokus KI<br />
KI ist wohl die Schlüsseltechnologie des<br />
21. Jahrhunderts; sie wird das öffentliche<br />
und private Leben sehr stark prägen. Als<br />
Analogie hierzu sei auf die Einführung des<br />
elektrischen Stroms Ende des 19. Jahrhunderts<br />
verwiesen; auch KI ist eine Basistechnologie,<br />
die «durchgängig» eingesetzt<br />
werden wird. Überall, wo grosse Datenmengen<br />
rasch analysiert und darauf aufbauend<br />
«gute» Entscheidungen getroffen<br />
werden sollen, wird KI zur Anwendung<br />
gelangen. Denn KI ermöglicht unter anderem<br />
bessere Realtime-Entscheidungen,<br />
bspw. im Gesundheitswesen oder im Verkehr.<br />
Massive Produktivitätssteigerungen<br />
dank KI sind ebenfalls zu erwarten (bspw.<br />
KI-basierte Prozessoptimierung, sogenannte<br />
End-to-end-Optimierung, bei welcher<br />
grosse Datenmengen quasi in Realtime<br />
verarbeitet werden). Oder persönliche,<br />
KI-basierte Assistenten für Beruf und private<br />
Anwendungen. Die Akzeptanz, auch<br />
im Gesundheitswesen, wächst, wie folgende<br />
Beispiele (von positivem Impact von KI<br />
in Praxen) illustrieren sollen.<br />
1. Vorabinformationen für Ärztinnen<br />
und Ärzte<br />
Symptome können schon vorab geprüft<br />
werden; Vordiagnosen bzw. Verdachtsdiagnosen<br />
erleichtern die ärztliche Diagnose<br />
durch Bereitstellen von zusätzlichen<br />
Daten. KI dient hierbei als selbstlernende<br />
Wissensquelle und Entscheidungshilfe,<br />
indem sie relevante Daten<br />
für jede Indikation und jeden Patienten<br />
individuell liefert.<br />
2. Unterstützung bei der Diagnose<br />
(Zweitmeinung)<br />
Die KI erstellt auf Grundlage der ihr zur<br />
Verfügung stehenden Daten Zweitmeinungen<br />
zur Diagnose (bspw. Unterstützung<br />
bei der Interpretation von Röntgenbildern,<br />
Hautkrebs-Screenings oder<br />
Laborbefunden).<br />
3. Einsparung von Wartezeiten<br />
Die Kombination aus fachlicher Expertise<br />
des Arztes und Einordnung der<br />
Symptome durch die Berechnungen der<br />
KI soll eine schnellere, einfachere Diagnose<br />
bei gleichzeitiger Einsparung von<br />
Wartezeiten ermöglichen. Patienten<br />
können dabei von zu Hause aus bereits<br />
eine erste Beurteilung ihrer Symptome<br />
erhalten und Ärzte sind besser auf das<br />
Patientengespräch vorbereitet.<br />
KI kann aber auch administrative Aufgaben<br />
wie die Transkription medizinischer<br />
Dokumente (z.B. Rezepte, Arztberichte,<br />
Zuweisungen an Fachspezialisten<br />
etc.) übernehmen, dadurch haben<br />
Ärzte mehr Zeit für ihre Kernkompetenz,<br />
nämlich das Behandeln der Patienten,<br />
was zu erhöhter Zufriedenheit<br />
auf beiden Seiten führen kann.<br />
4. Professionelle Fernbehandlung<br />
Behandlung von Patienten aus der Ferne,<br />
bspw. via Videosprechstunde, und<br />
damit einhergehend Ausweitung der<br />
medizinischen Versorgung auf abgelegene<br />
Gebiete ausserhalb der städtischen<br />
Zentren.<br />
KI in der Praxis<br />
«Schön und gut; aber was bedeutet das für<br />
mich?», werden Sie sich jetzt vielleicht<br />
fragen. Deshalb hier zwei konkrete Beispiele,<br />
die heute schon angewendet werden<br />
und die zeigen, wie die – KI-unterstützte<br />
– Zukunft aussehen könnte.<br />
1. GoForward 1 (USA)<br />
GoForward bietet Gesundheitsvorsorge<br />
auf einer Flatrate-Basis an. Dabei werden<br />
Tools wie biometrische Fernüberwachung<br />
und applikationsbasierte<br />
Pflege angeboten. GoForward umfasst<br />
Programme, die sich um Herzgesundheit<br />
kümmern, Krebsprävention betreiben,<br />
Gewichtsmanagement und Grundversorgung<br />
anbieten.<br />
2. Aaron.ai 2 (Deutschland)<br />
Aaron.ai setzt in Deutschland bereits<br />
erfolgreich KI-basierte Telefonbeantworter<br />
ein; Aaron.ai nimmt alle Anrufe<br />
strukturiert entgegen, falls Mitarbeitende<br />
in der Praxis gerade nicht verfügbar<br />
oder anderweitig beschäftigt sind.<br />
Fazit<br />
Die Zukunft lässt sich nicht aufhalten,<br />
auch – und insbesondere – nicht im Gesundheitswesen.<br />
Uns allen ist noch die<br />
Geschichte rund um das BAG und den<br />
Faxgeräten in Erinnerung, welche die<br />
Schweiz zum internationalen Gespött gemacht<br />
hat.<br />
Man kann die digitale Transformation<br />
als Gefahr oder als Chance sehen. Entschliesst<br />
man sich zu Letzterem, so ergeben<br />
sich viele Möglichkeiten, proaktiv zu<br />
handeln und modern(er) zu werden. Getreu<br />
dem Motto von Jeremias Gotthelf «Im<br />
Hause [in der Praxis] muss beginnen, was<br />
leuchten soll im Vaterland», darf und soll<br />
man diese Entwicklungen nicht der Konkurrenz<br />
oder dem Staat überlassen, son<br />
dern selber eintauchen in die vielfältigsten<br />
Möglichkeiten der digitalen Transformation.<br />
Die Patienten und Patientinnen<br />
werden es Ihnen danken!<br />
1<br />
https://goforward.com/<br />
2<br />
https://aaron.ai/<br />
Über Nimeda Consulting<br />
Die Nimeda Consulting GmbH ist eine<br />
spezialisierte Beratungsfirma für<br />
Personen im medizinischen Umfeld.<br />
Dank der Interdisziplinarität unseres<br />
Teams (Arzt und Manager) gelingt es,<br />
auch komplexe Problemstellungen<br />
umfassend und detailliert zu analysieren<br />
und nachhaltige Lösungen zu<br />
präsentieren.<br />
Durch unsere einzigartige Kombination<br />
von Management-, Medical-, ITsowie<br />
Legal-Know-how werden wir<br />
Ihre medizinische Praxis nachhaltig<br />
erfolgreicher machen; denn dank<br />
unseren bewährten Beratungsdienstleistungen<br />
können Sie sich stärker auf<br />
Ihre medizinische Kerntätigkeit fokussieren.<br />
Wir bieten u.a. folgende Dienstleistungen<br />
an: Management-, Finanzund<br />
IT-Beratung, Führung und<br />
Coaching, Praxisübergabe und -übernahme,<br />
Neueröffnung, Sanierungen.<br />
Wir beraten Sie gerne auf Deutsch und<br />
Französisch und Englisch. Unser<br />
Slogan: Management Know-how for<br />
Medical Professionals.<br />
www.nimeda.com<br />
Quellen zu KI/AI:<br />
[1] Kanadpriya Basu, Ritwik Sinha,<br />
Aihui Ong, and Treena Basu, Artificial<br />
Intelligence: How is It Changing Medical<br />
Sciences and Its Future?, PMC (nih.gov),<br />
(2020).<br />
[2] Limbach Gruppe, Wenn der<br />
Computer mitdenkt: von Telemedizin zu<br />
künstlicher Intelligenz in der Arztpraxis,<br />
Limbach Gruppe, (<strong>2022</strong>).<br />
[3] Medizinische Fakultät FAU,<br />
Wenn KI in der Arztpraxis hilft, Medizinische<br />
Fakultät (fau.de), (2021).<br />
[4] Arzt & Wirtschaft, künstliche<br />
Intelligenz: Wertvolle Unterstützung für<br />
Ärzte, ARZT & WIRTSCHAFT (arzt-wirtschaft.de),<br />
(2021).<br />
[5] Jürgen Stüber, Patienten<br />
telefonieren mit einer KI – die Arztpraxis<br />
der Zukunft?, (businessinsider.de), (2020).<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 63
mediservice<br />
Kochen für Gaumen und Gesundheit<br />
Rindscarpaccio<br />
für festliche Stunden<br />
Martina Novak, Fachspezialistin SWICA Unternehmenskommunikation<br />
Bilder: zvg; Adobe Stock<br />
64<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
mediservice<br />
Rindscarpaccio<br />
Zutaten<br />
Rindshuft<br />
200 g Rindshuft<br />
2 EL Zitrusöl<br />
Meersalz<br />
Sauerrahm<br />
180 g Sauerrahm<br />
20 g grobkörniger Senf<br />
abgeriebene Schale einer Zitrone<br />
Salz, Pfeffer<br />
Erdnuss-Crumble<br />
100 g gesalzene Erdnüsse<br />
40 g brauner Zucker<br />
30 g Honig<br />
30 g Butter<br />
Rezept für 2 Personen<br />
Und so wirds gemacht<br />
Für die Rindshuft<br />
Als Erstes die Rindshuft in Frischhaltefolie<br />
satt einwickeln, so dass das Stück eine<br />
relativ runde Form erhält. An beiden<br />
Enden mit einem Knopf schliessen.<br />
Anschliessend die Huft für 24 Stunden in<br />
den Tiefkühler legen, bis sie komplett<br />
gefroren ist. Danach aus der Folie auspacken<br />
und hauchdünn aufschneiden, am<br />
besten gehts mit einer Aufschnittmaschine.<br />
Die dünnen Scheiben mit Zitrusöl<br />
marinieren und ganz wenig Meersalz<br />
darüberstreuen.<br />
Für den Sauerrahm<br />
Alle Zutaten gut miteinander verrühren<br />
und mit Salz und Pfeffer abschmecken.<br />
Anschliessend für eine Stunde kalt stellen,<br />
damit der Sauerrahm etwas fest wird.<br />
Mehrfache<br />
Prämien rabatte<br />
Als Mitglied von mediservice <strong>vsao</strong>asmac<br />
profitieren Sie bei SWICA dank<br />
Kollektivvertrag und BENEVITA<br />
Bonusprogramm von attraktiven<br />
Prämienrabatten auf Spital- und<br />
Zusatzversicherungen. Zudem unterstützt<br />
SWICA Ihre Aktivitäten in<br />
den Bereichen Bewegung, Ernährung<br />
und Entspannung mit bis zu<br />
800 Franken pro Jahr.<br />
www.swica.ch/de/mediservice<br />
Für den Erdnuss-Crumble<br />
Die Erdnüsse in einen Plastiksack geben<br />
und mit einer Bratpfanne fein klopfen.<br />
Die Butter in einem Topf flüssig werden<br />
lassen und den Zucker und den Honig<br />
darin auflösen. Anschliessend die Erdnüsse<br />
dazugeben und gut mischen. Es<br />
entsteht eine zähe Masse, die auf einem<br />
mit Backpapier belegten Backblech ausgestrichen<br />
werden muss. Masse bei 160° C<br />
für 10 bis 15 Minuten (bis sie karamellisiert)<br />
backen. Danach das Blech aus dem<br />
Ofen nehmen und bei Zimmertemperatur<br />
auskühlen lassen. Wenn die Masse kalt<br />
und hart ist, im Mixer grob hacken.<br />
Die Gesundheitsorganisation SWICA ist Sponsorin der Schweizer Kochnationalmannschaft,<br />
aus deren Repertoire dieses Rezept stammt.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 6/22 65
Impressum<br />
Kontaktadressen der Sektionen<br />
<strong>Nr</strong>. 6 • 41. Jahrgang • <strong>Dezember</strong> <strong>2022</strong><br />
Herausgeber/Verlag<br />
AG<br />
VSAO Sektion Aargau, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zürich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
Tel. 044 250 43 23, Fax 044 250 43 20<br />
mediservice <strong>vsao</strong>-asmac<br />
Bollwerk 10, Postfach, 3001 Bern<br />
Telefon 031 350 44 88<br />
journal@<strong>vsao</strong>.ch, journal@asmac.ch<br />
www.<strong>vsao</strong>.ch, www.asmac.ch<br />
Im Auftrag des <strong>vsao</strong><br />
Redaktion<br />
Catherine Aeschbacher (Chefredaktorin),<br />
Kerstin Jost, Fabian Kraxner, Bianca Molnar,<br />
Patricia Palten, Léo Pavlopoulos, Lukas<br />
Staub, Anna Wang<br />
Geschäfts ausschuss <strong>vsao</strong><br />
Angelo Barrile (Präsident), Nora Bienz<br />
(Vizepräsidentin), Severin Baerlocher,<br />
Christoph Bosshard (Gast), Marius Grädel,<br />
Patrizia Kündig, Richard Mansky,<br />
Gert Printzen, Svenja Ravioli, Patrizia Rölli,<br />
Martin Sailer, Jana Siroka, Clara Ehrenzeller<br />
(swimsa)<br />
Druck, Herstellung und Versand<br />
Stämpfli AG, Kommunikationsunternehmen,<br />
Wölflistrasse 1, 3001 Bern<br />
Telefon +41 31 300 66 66<br />
info@staempfli.com, www.staempfli.com<br />
Layout<br />
Oliver Graf<br />
Titelillustration<br />
Stephan Schmitz<br />
Inserate<br />
Zürichsee Werbe AG, Fachmedien,<br />
Markus Haas, Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa<br />
Telefon 044 928 56 53<br />
E-Mail <strong>vsao</strong>@fachmedien.ch<br />
Auflagen<br />
Druckauflage: 22 200 Expl.<br />
WEMF/KS-Beglaubigung <strong>2022</strong>: 21 697 Expl.<br />
Erscheinungshäufigkeit: 6 Hefte pro Jahr.<br />
Für <strong>vsao</strong>-Mitglieder im Jahresbeitrag<br />
inbegriffen.<br />
ISSN 1422-2086<br />
Ausgabe <strong>Nr</strong>. 1/2023 erscheint im<br />
Februar 2023. Thema: Frequenz<br />
© <strong>2022</strong> by <strong>vsao</strong>, 3001 Bern<br />
Printed in Switzerland<br />
BL/BS<br />
VSAO Sektion beider Basel, Geschäftsleiterin und Sekretariat:<br />
lic. iur. Claudia von Wartburg, Advokatin, Hauptstrasse 104,<br />
4102 Binningen, Tel. 061 421 05 95, Fax 061 421 25 60,<br />
sekretariat@<strong>vsao</strong>-basel.ch, www.<strong>vsao</strong>-basel.ch<br />
BE VSAO Sektion Bern, Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Tel. 031 381 39 39,<br />
info@<strong>vsao</strong>-bern.ch, www.<strong>vsao</strong>-bern.ch<br />
FR<br />
ASMAC Sektion Freiburg, Sanae Chemlal, Rue du Marché 36, 1630 Bulle,<br />
presidence@asmaf.ch<br />
GE Associations des Médecins d’Institutions de Genève, Postfach 23,<br />
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genf 14, amig@amig.ch, www.amig.ch<br />
GR<br />
JU<br />
NE<br />
VSAO Sektion Graubünden, Kornplatz 2, 7000 Chur, Samuel B. Nadig,<br />
lic. iur. HSG, RA Geschäftsführer/Sektionsjurist, Tel. 081 256 55 55,<br />
info@<strong>vsao</strong>-gr.ch, www.<strong>vsao</strong>-gr.ch<br />
ASMAC Jura, 6, chemin des Fontaines, 2800 Delémont,<br />
marie.maulini@h-ju.ch<br />
ASMAC Sektion Neuenburg, Joël Vuilleumier, Jurist,<br />
Rue du Musée 6, Postfach 2247, 2001 Neuenburg,<br />
Tel. 032 725 10 11, vuilleumier@valegal.ch<br />
SG/AI/AR VSAO Sektion St. Gallen-Appenzell, Bettina Surber, Oberer Graben 44,<br />
9000 St. Gallen, Tel. 071 228 41 11, Fax 071 228 41 12,<br />
surber@anwaelte44.ch<br />
SO<br />
TI<br />
TG<br />
VD<br />
VS<br />
VSAO Sektion Solothurn, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zürich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
Tel. 044 250 43 23, Fax 044 250 43 20<br />
ASMAC Ticino, Via Cantonale 8-Stabile Qi, 6805 Mezzovico-Vira,<br />
segretariato@asmact.ch<br />
VSAO Sektion Thurgau, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zürich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
Tel. 044 250 43 23, Fax 044 250 43 20<br />
ASMAV, case postale 9, 1011 Lausanne-CHUV,<br />
asmav@asmav.ch, www.asmav.ch<br />
ASMAVal, p.a. Maître Valentine Gétaz Kunz,<br />
Ruelle du Temple 4, CP 20, 1096 Cully, contact@asmaval.ch<br />
Zentralschweiz (LU, ZG, SZ, GL, OW, NW, UR)<br />
VSAO Sektion Zentralschweiz, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zürich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
Tel. 044 250 43 23, Fax 044 250 43 20<br />
ZH/SH<br />
VSAO ZH/SH, RA lic. iur. Susanne Hasse,<br />
Geschäftsführerin, Nordstrasse 15, 8006 Zürich, Tel. 044 941 46 78,<br />
susanne.hasse@<strong>vsao</strong>-zh.ch, www.<strong>vsao</strong>-zh.ch<br />
Publikation<strong>2022</strong><br />
FOKUSSIERT<br />
KOMPETENT<br />
TRANSPARENT<br />
Gütesiegel Q-Publikation<br />
des Verbandes Schweizer Medien<br />
66<br />
6/22 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Unser Beratungspartnernetz<br />
für Treuhand, Versicherungen, Vorsorge<br />
Schweizweit in Ihrer Nähe<br />
BERATUNGSSTELLEN für Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzberatung<br />
• Allcons AG 4153 Reinach • Assidu 2800 Delémont, 6903 Lugano • BTAG Versicherungsbroker AG 3084 Wabern<br />
• UFS Insurance Broker AG 8810 Horgen • VM-F Frank insurance brokers GmbH 9300 Wittenbach • Vorsorge<br />
Wirz 4058 Basel<br />
TREUHANDPARTNER für Finanzbuchhaltung, Steueroptimierung, Wirtschaftsberatung<br />
• Axios Fiduciaire Sàrl 1920 Martigny • B+A Treuhand AG 6330 Cham • Brügger Treuhand AG 3097 Liebefeld/Bern<br />
• contrust finance ag 6004 Luzern • Fiduciaire Leitenberg & Associés SA 2301 La Chaux-de-Fonds<br />
• GMTC Treuhand & Consulting AG 9014 St. Gallen • KONTOMED Ärztetreuhand AG 8808 Pfäffikon • LLK Treuhand<br />
AG 4052 Basel • Mehr-Treuhand AG 8034 Zürich • Quadis Treuhand AG 3952 Susten • Sprunger Partner AG<br />
3006 Bern • W&P AG Treuhand Steuern Wirtschaftsprüfung 7001 Chur<br />
Alle Beratungspartner finden Sie auch online oder rufen Sie uns an.<br />
Für unsere Mitglieder ist ein einstündiges Erstgespräch zur gezielten Bedürfnisabklärung kostenlos.<br />
mediservice <strong>vsao</strong>-asmac<br />
Telefon 031 350 44 22<br />
info@mediservice-<strong>vsao</strong>.ch<br />
www.mediservice-<strong>vsao</strong>.ch
medifuture<br />
verpasst?<br />
Gestalten Sie<br />
Ihre Zukunft jetzt.<br />
suva.ch/jobs/<br />
medizin<br />
Wir bieten Ärztinnen und Ärzten attraktive berufliche<br />
Perspektiven in der Versicherungs- und Arbeitsmedizin.<br />
Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir uns bald<br />
gemeinsam für einen sicheren Alltag und eine gesündere<br />
Gesellschaft einsetzen können. Suva macht Sinn.<br />
marina.antic@suva.ch, Talent Acquisition Manager,<br />
freut sich, von Ihnen zu lesen oder zu hören:<br />
marina.antic@suva.ch, 041 419 56 75