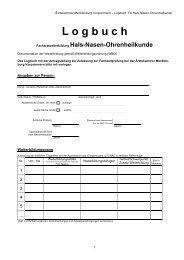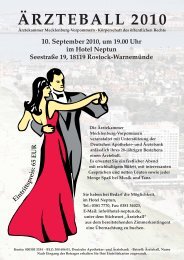Ärzteblatt Mai 2010 - Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
Ärzteblatt Mai 2010 - Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
Ärzteblatt Mai 2010 - Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG<br />
Das Post-Polio-Syndrom<br />
Peter Brauer<br />
Unter den Ärzten ist das Wissen um die Polio-Encephalo-<br />
Myelitis (PM) als Erkrankung und das Post-Polio-Syndrom<br />
(PPS) als ihre späte Folge besonders im Hinblick auf die einschlägige<br />
Patientenbetreuung bedauerlicherweise mehrheitlich<br />
katastrophal.<br />
Jede Polio-Infektion (PI) ist encephalitisch und hinterläßt<br />
neurogene strukturelle Defekte bei paralytischen wie aparalytischen<br />
Verläufen. Läsionen finden sich neurohistopathologisch<br />
und bei entsprechender Größenordnung auch magnetresonanztomographisch.<br />
Betroffen davon sind das Myelon,<br />
Myelencephalon, Metencephalo, Mesencephalon, Diencephalon<br />
und das Telencephalon in seinen motorischen wie<br />
prämotorischen Anteilen. Der Virusbefall des Myelons erfolgt<br />
nicht obligat. Die emotionalen und intellektuellen Funktionen<br />
sind nicht direkt erfaßt, die sensorischen Funktionen<br />
können teilweise beeinträchtigt sein.<br />
Nur etwa ein Prozent der Infizierten erkranken manifest paralytisch,<br />
etwa ein Prozent aparalytisch, etwa sechs Prozent<br />
abortiv und etwa 92 Prozent bleiben asymptomatisch. Alle<br />
Verlaufsformen erreichen bei erhaltenem oder entsprechend<br />
mehr oder weniger weitgehend wieder hergestelltem funktionellen<br />
Niveau nach einer PI einen klinisch stabilen Zustand<br />
als zeitlich begrenzte Phase. Die Subklinik ist allerdings instabil.<br />
Es handelt sich dabei im spinal motorischen Bereich um<br />
einen neurogenen Remodellierungsvorgang. Restierende gesunde<br />
und vorgeschädigte übernehmen die Funktion zerstörter<br />
Neurone durch Reinervation verwaister Muskeln unter<br />
Bildung motorischer Rieseneinheiten. Sie leisten damit das bis<br />
zu Zehnfache gegenüber dem physiologischen Zustand. Nicht<br />
erfaßte Muskulatur atrophiert. Die kompensierenden Muskeln<br />
hypertrophieren. Im cerebralen Bereich sind Kompensationsvorgänge<br />
in Form von neurogener Sprossung und Neubahnung<br />
zu vermuten. PPS-Symptomatik cerebralen Charakters<br />
legt diese Vermutung nahe. Stark betroffen sind zumeist<br />
verschiedene Stammhirnareale mit wichtigen neuroregulativen<br />
Funktionen wie beispielsweise Hirnaktivierung, Atmung,<br />
Temperatur, Herz-Kreislauf, Schlaf, Schmerz, Gleichgewicht.<br />
Die muskuläre Reinervation ist nicht stabil und unterliegt einem<br />
ständigen Auf- und Abbau von begrenzter Kapazität.<br />
Funktion und Struktur befinden sich auf Dauer kurz unterhalb<br />
oder direkt an ihrer Leistungsgrenze. Durchschnittlich<br />
35 Jahre nach der PM treten bei einem hohen Prozentsatz<br />
der Betroffenen unerwartet, häufig schleichend, seltener<br />
schlagartig neue Symptome auf, die als Tertiärfolgen zu dem<br />
PPS, einer eigenständigen Erkrankung zusammengefaßt werden<br />
und streng von den Polio-<br />
Primär- sowie Polio-Sekundär-Folgen<br />
zu trennen sind. Zu diesem<br />
Kreis gehören mindestens 75 Prozent<br />
der Polio-Überlebenden mit<br />
Folgeparalysen und -paresen, von<br />
den aparalytischen Erkrankungsfällen<br />
sind es etwa 40 %. Abortive<br />
und asymptomatische Infektionsverläufe<br />
sind zu etwa 20 Prozent<br />
betroffen. Das bedeutet für<br />
Deutschland zum gegenwärtigen<br />
Zeitpunkt immer noch eine Zahl<br />
von bis zu 100.000 offensichtlich<br />
Betroffenen. Die Dunkelziffer ist<br />
mit mindestens einer Million anzusetzen.<br />
Nach KOS könnte in der<br />
ärztlichen Praxis jeder 40. Patient<br />
der Geburtsjahrgänge bis 1962<br />
ein PPS haben. Das PPS-Risiko ist<br />
von der Größe und Lokalisation<br />
des poliobedingten Vorschadens<br />
Seite 150 ÄRZTEBLATT MECKLENBURG-VORPOMMERN