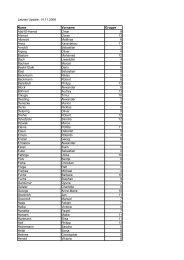s - Physikalisches Institut Universität Bonn
s - Physikalisches Institut Universität Bonn
s - Physikalisches Institut Universität Bonn
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
In den frühen 70-er Jahren war mit dem OMEGA-Spektrometer beim CERN CERN<br />
ein Mehrteilchendetektor entwickelt worden, mit dem ähnlich wie mit Blasenkammern<br />
komplexe Ereignistopologien im vollen Raumwinkel gemessen werden<br />
konnten, nun aber unter wesentlich besseren experimentellen Bedingungen.<br />
Dank der elektronischen Auslese der Messdaten konnte auf interessante<br />
Ereignisse getriggert und die Rekonstruktion der Ereignisse statt über die Vermessung<br />
von Filmen über die rechnergesteuerte Auswertung von Driftkammerdaten<br />
vorgenommen werden. Detektorkomponenten zu Triggerzwecken, für<br />
Teilchenidentifikation und elektromagnetische Kalorimetrie wurden von den<br />
an OMEGA-Experimenten beteiligten externen <strong>Institut</strong>en gebaut.<br />
<strong>Bonn</strong> war ein Jahrzehnt lang in internationalen Kollaborationen an Experimenten<br />
mit dem OMEGA-Spektrometer beteiligt (K. Heinloth, M. Jung, E.<br />
Paul mit Diplomanden und Doktoranden 6 ). Mit den beim CERN verfügbaren<br />
Energien war es nun möglich, die in <strong>Bonn</strong> und bei DESY untersuchte Physik<br />
zur Photoproduktion zu höheren Energien hin fortzusetzen. Für die Photoproduktionsexperimente<br />
am OMEGA-Spektrometer wurde in <strong>Bonn</strong> u.a. einer<br />
der weltweit ersten Übergangsstrahlungsdetektoren zur Trennung von Pionen,<br />
Kaonen und Protonen entwickelt, gebaut und erfolgreich eingesetzt. Ein<br />
herausragendes Ergebnis, das im Experiment WA69 der OMEGA-PHOTON-<br />
Kollaboration unter <strong>Bonn</strong>er Federführung erarbeitet wurde, war der Nachweis,<br />
dass es für die Beschreibung der Photoproduktion von Hadronen in harten Prozessen<br />
nicht genügt, das Photon als Quelle von Vektormesonen zu betrachten,<br />
sondern dass, mit zunehmender Härte der Streuung, das Photon auch durch<br />
eine direkte (elektromagnetische) Kopplung an die Quarks im Proton mehr<br />
und mehr zum γp-Wikungsquerschnitt beiträgt [17]. Abbildung 8 zeigt den<br />
Wirkungsquerschnitt der inklusiven Ein-Teilchen-Photoproduktion als Funktion<br />
des Transversalimpulses (Maß für die Härte der Streuung) im Vergleich<br />
mit einer Kombination von im gleichen Experiment gemessenen Pion- und<br />
Kaon-induzierten Wirkungsschnitten, mit denen nach Maßgabe des Vektor-<br />
Dominanz-Modells das Photon als Quelle von Vektormesonen approximiert<br />
wird. Bei kleinen Transversalimpulsen ist das Verhältnis der Wirkungsquerschnitte<br />
nahezu eins. Der bei Transversalimpulsen oberhalb von ca. 1 GeV<br />
zunehmende Überschuss weist die zusätzliche, harte Komponente aus, in Übereinstimmung<br />
mit Rechnungen, die im Rahmen der Quantenchromodynamik<br />
QCD durchgeführt wurden. Die Auffassung des Photons als Superposition verschiedener<br />
Komponenten ist von grundlegender Bedeutung für das Verständnis<br />
der Streuprozesse mit quasi-reelen Photonen, wie sie in den Experimenten H1<br />
und ZEUS am Elektron-Proton-Speicherring HERA bei DESY in Hamburg<br />
seit 1993 untersucht werden (siehe unten).<br />
Bei DESY wurde 1976 der e + e − -Speicherring PETRA fertiggestellt. Für die DESY<br />
6 Die Absolventen B. Diekmann, P. Mättig und H. Marsiske wurden Hochschulleh-<br />
rer bzw. leitende Forscher.<br />
11