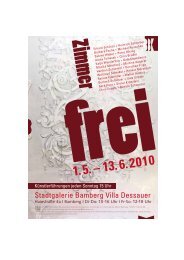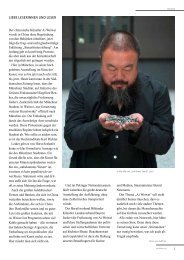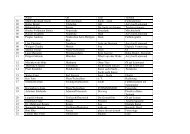Im Bilde 02/2006 - BBK-Bayern
Im Bilde 02/2006 - BBK-Bayern
Im Bilde 02/2006 - BBK-Bayern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>BBK</strong> Niederbayern<br />
12<br />
Eröffnung der Jubiläumsausstellung im Kulturmodell Bräugasse<br />
20 JAHRE <strong>BBK</strong> NIEDERBAYERN E.V.<br />
(Einführung: Dr. Maximilian Seefelder, Bezirksheimatpfleger)<br />
Jubiläumsfeiern – und sei es eben das zwanzigjährige<br />
Bestehen einer etablierten Kulturinstitution<br />
wie des Berufsverbands <strong>Bilde</strong>nder<br />
Künstler Niederbayern e.V. – folgen in der<br />
Regel einem Muster: Der Blick schweift<br />
zurück, die Reden rühmen die Erfolgsgeschichte<br />
und die Jahre harter Arbeit. Lob den<br />
Verantwortlichen und aller Dank dazu.<br />
Nicht zu vergessen bei Anlässen wie dem<br />
heutigen: Wert und Nutzen der bildenden<br />
Kunst sind hervorzuheben – im Allgemeinen<br />
wie im Besonderen. Es darf philosophiert<br />
werden. Wo sonst, wenn nicht hier? Es gilt,<br />
möglichst blumige Worte für bunte <strong>Bilde</strong>r<br />
finden.<br />
Gerne wird dabei die Formel vom ‚Traumberuf<br />
Künstler’ bemüht, den wir um seine<br />
geistig kreative Freiheit beneiden, der uns die<br />
Aura des mystisch Schöpferischen atmen<br />
lässt – ein ‚creator mundi’, fähig seine eigene<br />
kleine Welt zu erschaffen.<br />
Die Realität indes sieht anders aus. Der<br />
Welt des Künstlers sind oft sehr enge, schier<br />
unüberwindbare Grenzen gesetzt. Freilich,<br />
das ist nicht der Stoff, aus dem man Festreden<br />
macht. Tatsache bleibt aber: Neun von<br />
zehn Kunststudierenden schaffen es nicht,<br />
nach dem Kunststudium von ihrer Kunst zu<br />
leben. Und dann - aus der Traum von der ungehinderten<br />
Verwirklichung der eigenen kreativen<br />
Fähigkeiten, von den Freiheiten, die mit<br />
einem gewöhnlichen Beruf nicht zu erreichen<br />
sind?!<br />
Diese Freiheit hat ihren Preis – und wirklich<br />
bewusst ist dies oft weder Kunstliebhabern<br />
noch angehenden Künstlerinnen und<br />
Künstlern. Schnell wird dann mehr Anerkennung<br />
für die unverzichtbare Arbeit Kunst-<br />
und Kulturschaffender gefordert – vor allem<br />
mehr Förderung und finanzielle Unterstützung.<br />
Nur, Realität ist auch: Die Zahl entsprechender<br />
Fördertöpfe ist überschaubar, die<br />
eingestellten Mittel sind endlich. Und bei der<br />
Diskussion über die wirklichen Notwendigkeiten,<br />
über das Unentbehrliche und Unverzichtbare<br />
zieht zumeist die Kunst – die edle,<br />
schöne Muse – den Kürzeren.<br />
Dennoch, es bleibt dabei: Kunst ist ein Gewinn.<br />
Sie bereichert das Leben – nicht nur im<br />
Wortsinn das des einzelnen Sammlers und<br />
des Kunstliebhabers, sondern auch das öffentliche.<br />
Mehr noch: Ein Demokratisierungsprozess<br />
hat stattgefunden. Kunst ist<br />
nicht mehr wie ehedem den Musentempeln<br />
und elitären Minderheiten vorbehalten, sondern<br />
sie ist beinahe allgegenwärtig in Bahnhofshallen,<br />
Parkgaragen oder Kneipen erlebbar.<br />
Sie lädt ein, regt an oder provoziert zur<br />
Beschäftigung mit ihr. Diese Auseinandersetzung,<br />
diesen Luxus kann und sollte sich jeder<br />
leisten. Er ist nicht von materiellen Mitteln<br />
abhängig.<br />
im <strong>Bilde</strong> 2/06<br />
Die Künstler sind es, die konventionelle<br />
Sichtweisen überwinden und neue Perspektiven<br />
eröffnen – Ihnen, mir, allen. Und, das ist<br />
das Faszinierende daran, sie schaffen es ohne<br />
Worte.<br />
Doch ehe ich ins Schwärmen gerate – Tatsache<br />
bleibt auch: Kunst ist und war auch immer<br />
schon ein Geschäft. Die romantisch verklärte<br />
Vorstellung vom Maler, der mit Picknickkorb<br />
und Staffelei ins Grüne zieht, an<br />
den Wochenenden in den Salons der Gesellschaft<br />
zuhause ist und seine Arbeiten zwischen<br />
Kanapees und Champagner quasi im<br />
Vorbeigehen zu gutem Geld macht, fand in<br />
der Realität kaum ihre Entsprechung. Selbst<br />
die Gunst großzügiger Mäzene musste oft auf<br />
erniedrigende Weise gewonnen und erhalten<br />
werden und nicht selten lebte unbeachtet und<br />
verarmt, wer heute als großer Meister gerühmt<br />
wird.<br />
In Zeiten knapper öffentlicher Mittel und<br />
der verschärften Situation auf allen Märkten<br />
wird den Kunstschaffenden ein großes Maß<br />
an Realitätsbezug, Unternehmergeist und Engagement<br />
abverlangt. Es ist notwendig, Allianzen<br />
zu schmieden und Kooperationen einzugehen,<br />
um gemeinsame Interessen vertreten<br />
und so neben ideellem auch materiellen<br />
Gewinn aus der aktiven Arbeit mit und an der<br />
Kunst ziehen zu können.<br />
Doch auch diese Erkenntnis ist nicht wirklich<br />
neu. Mit dem Ziel, sich gemeinsam für<br />
die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
freier künstlerischer Arbeit<br />
einzusetzen, wurde schon vor 150 Jahren die<br />
„Allgemeine Deutsche Kunstgenossenschaft“<br />
als erster nationaler Zusammenschluss regionaler<br />
Kunstvereine gegründet. Sie vertrat<br />
fortan die Interessen bildender Künstler gegenüber<br />
Politik und Öffentlichkeit. Sie war<br />
maßgeblich an der Erstellung der gesetzlichen<br />
Grundlagen für das erste deutsche Urheberrecht<br />
von 1876 beteiligt. Darüber hinaus<br />
brachte sich die Allgemeine Deutsche Kunstgenossenschaft<br />
auch normativ in die nationale<br />
Kunstszene ein. Sie kontrollierte damit<br />
nicht nur den Kunstmarkt, sondern ebenso<br />
den Zugriff auf staatliche Förderungen.<br />
Interne Auseinandersetzungen blieben nicht<br />
aus, zumal insbesondere zeitgenössisch<br />
„moderne“ Künstler kaum Unterstützung von<br />
den bestehenden Organisationen erwarten<br />
konnten. <strong>Bilde</strong>r – z. B. die des norwegischen<br />
Malers Edvard Munch, heute einer der Vertreter<br />
der klassischen Moderne – wurden als<br />
„abstoßend, hässlich und gemein“ bezeichnet<br />
und von Ausstellungen ausgeschlossen. So<br />
musste es letztendlich zum Bruch kommen<br />
zwischen der progressiven, liberalen Künstlerschaft<br />
und dem bis dahin dominierenden<br />
traditionell akademischen Kunstbetrieb, den<br />
auch die Allgemeine Deutsche Kunstgenos-<br />
senschaft vertrat. Abspaltungen – treffend<br />
als „Sezession“ bezeichnet – fanden an der<br />
Wende zum 20. Jahrhundert in allen deutschsprachigen<br />
Zentren moderner bildender<br />
Kunst statt: München 1893, Wien 1897,<br />
Berlin 1898.<br />
Warum erzähle ich das? Weil daran auch<br />
das generelle Dilemma moderner Kunst offensichtlich<br />
wird: Innovativ, progressiv, visionär<br />
und ihrer Zeit voraus soll und will sie<br />
sein – mit dem Ergebnis, dass sie es dementsprechend<br />
schwer hat, verstanden, toleriert<br />
oder gar anerkannt zu werden.<br />
Die Kunstgeschichte zeigt zahllose Beispiele<br />
dieser immer wieder kehrenden Problematik.<br />
Breitenwirksame, offiziell propagierte<br />
Kunstdefinitionen halten sich oft hartnäckig<br />
und lassen kaum Raum für Neues.<br />
Dennoch überholen sich solch zeitgenössische<br />
Kunstauffassungen regelmäßig selbst.<br />
Ehedem verschmähte Künstler wie Munch,<br />
Klimt und Co sind heute populär und nahezu<br />
inflationär auf Kaffeetassen und Einkaufstüten<br />
zu finden. Popularität allein – posthum<br />
ebenso wenig wie zu Lebzeiten – kann es<br />
aber nicht sein, was ein Künstler, eine Künstlerin<br />
zum Leben braucht. Mit schillernden<br />
Vernissagen und hoch gelobten Ausstellungen<br />
ist es nicht getan, wenn dem nicht Aufträge<br />
und Verkäufe folgen.<br />
So gilt es grundlegende Akzeptanz zu<br />
schaffen, Berührungsängste abzubauen,<br />
Kunst für jedermann – sowohl inhaltlich als<br />
auch finanziell – zugänglich zu machen. Dazu<br />
bedarf es der gezielten Öffentlichkeitsarbeit<br />
und des Marketings als vorrangige Aufgabe<br />
und Ziel sowohl der öffentlichen Kulturarbeit,<br />
der Kulturförderung, als auch von<br />
Künstlervertretungen wie dem <strong>BBK</strong> und der<br />
Kunstschaffenden selbst.<br />
Sicher war es kein Zufall, dass die Gründungsinitiative<br />
des <strong>BBK</strong> Regionalverbandes<br />
ausgerechnet vom östlichen – um nicht zu sagen<br />
„hintersten“ – Niederbayern ausging. Pionierarbeit<br />
im eigentlichen Sinne war hier gefragt.<br />
Es galt künstlerisches Terrain urbar zu<br />
machen, mit dem Wesentlichen auszustatten<br />
und auf unbürokratischem Weg einheitliche<br />
Rahmenbedingungen zu schaffen, die die<br />
Selbständigkeit bildender Künstler in der Region<br />
fernab der großen Kunst- und Kulturzentren<br />
erst möglich machten.<br />
Die Einrichtung des „Kulturmodell Bräugasse“<br />
als Präsentationsplattform, Arbeitsplatz<br />
und Begegnungsstätte von Künstlern<br />
und Laien war dabei ein großer Schritt. Der<br />
Vorsitzende des <strong>BBK</strong> Landesverbandes <strong>Bayern</strong>,<br />
Klaus von Gaffron, konnte bereits anlässlich<br />
des 10jährigen Bestehens des <strong>BBK</strong><br />
Niederbayern e.V. 1996 konstatieren:<br />
„10 Jahre <strong>BBK</strong> Niederbayern heißt: Aus einer<br />
künstlerischen Diaspora ist ein lebendiges<br />
Forum geworden, eine Schnittstelle an der<br />
Künstler aus den verschiedenen Bundesländern,<br />
aber auch aus den Nachbarländern Ausstellungsmöglichkeiten<br />
fanden und anregend<br />
auf die regionale Kunstszene wirkten.“